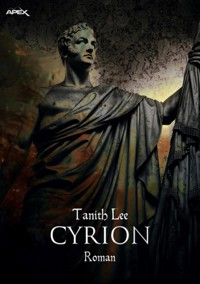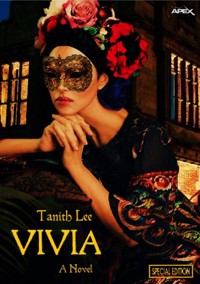5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Dem jungen Sklaven Dekteon gelingt die Flucht. Er verbringt die Nacht an einem geheimnisvollen Ort, einem merkwürdigen Ring aus Steinen, den ihm ein alter Sklave gezeigt hat. Als er am Morgen erwacht, findet er sich in einer anderen, ihm fremden Welt und in einem anderen Körper wieder – und verstrickt in ein Spiel, das unversehrt zu überstehen er kaum eine Chance hat, denn er steckt im Körper eines Königs, dessen rituelle Hinrichtung unmittelbar bevorsteht...
ÖSTLICH VON MITTERNACHT, der fünfte Band der großen TANITH-LEE-Werkausgabe im Apex-Verlag, beschreibt eine Welt, die durchdrungen ist von Traditionen, die zu brechen einem Sakrileg gleichkommt, und von Zauberei, die eine ohnehin schon fremde, von Frauen dominierte Welt noch um ein Vielfaches fremder erscheinen lässt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
TANITH LEE
Östlich von Mitternacht
Tanith Lee-Werkausgabe, Band 5
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
ERSTER TEIL
1. Der Sklave
2. Vollmond
3. Zaister
4. Zauberei bei Tag und bei Nacht
ZWEITER TEIL
5. Die Frauen
6. Izvire
7. Sonnenhaus
8. Zauberei bei Nacht und bei Tag
DRITTER TEIL
9. Die Jagd
10. Obdach
11. Im Dunkeln
12. Zauberei im Dunkeln
VIERTER TEIL
13. Der Tempel
14. Todesmond
15. Dekteon
16. Zauberei östlich von Mitternacht
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
Dem jungen Sklaven Dekteon gelingt die Flucht. Er verbringt die Nacht an einem geheimnisvollen Ort, einem merkwürdigen Ring aus Steinen, den ihm ein alter Sklave gezeigt hat. Als er am Morgen erwacht, findet er sich in einer anderen, ihm fremden Welt und in einem anderen Körper wieder – und verstrickt in ein Spiel, das unversehrt zu überstehen er kaum eine Chance hat, denn er steckt im Körper eines Königs, dessen rituelle Hinrichtung unmittelbar bevorsteht...
ÖSTLICH VON MITTERNACHT, der fünfte Band der großen TANITH-LEE-Werkausgabe im Apex-Verlag, beschreibt eine Welt, die durchdrungen ist von Traditionen, die zu brechen einem Sakrileg gleichkommt, und von Zauberei, die eine ohnehin schon fremde, von Frauen dominierte Welt noch um ein Vielfaches fremder erscheinen lässt...
ERSTER TEIL
1. Der Sklave
Dekteon öffnete die Augen.
Er schaute hoch und sah durch das rote Haar, das ihm ins Gesicht hing, einen leuchtend roten Herbstwald und dahinter das kalte Rot der aufgehenden Sonne. Er lag auf der Seite - so hatte er auch geschlafen -, und jetzt schmerzte sein Körper. Sein erster Gedanke galt den Hunden. Er lauschte. Nichts war zu hören. Das beunruhigte ihn. Das letzte, woran er sich erinnerte, war, dass er unter der klammen Finsternis der Steinplatte gelegen hatte und die Hunde über ihm bellten - und jetzt befand er sich nicht mehr unter der Erde, sondern hier in einem Wald, den betreten zu haben er sich nicht erinnerte, und die Sonne ging auf.
Schwerfällig erhob sich Dekteon, rieb wieder Gefühl in seine Arme, die Beine und den ganzen Körper. Es war ein frostklarer Tag ohne jeden Laut, nicht ein Vogel zwitscherte. Umso erschreckender war das Geräusch, das plötzlich durch die Bäume zu vernehmen war. Ein Wagen kam herbei, gezogen von einem Rotschimmel. Etwas war seltsam an diesem Wagen, seine Form vielleicht. Dekteon war sich nicht sicher. Ein Mann mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze beugte sich über die Zügel. Dekteon glaubte, der Mann habe ihn nicht gesehen, aber der Wagen hielt vor ihm an. Auch an dem Pferd war etwas Merkwürdiges. Es war gedrungen, viel breiter um die Brust und mit dickerem Kopf als die Pferde, die Dekteon bisher gekannt hatte. Seine Beine...
»Komm!,« rief der Mann unvermittelt. Er konnte nur Dekteon meinen. Weiß schimmerte das Gesicht unter der Kapuze, es wandte sich ihm zu. Konnte sein Herr ihn geschickt haben, damit er nach ihm suche? Nein, wenn schon die Hunde ihn in den Hügeln nicht erwischt hatten, dann hatte dieser Mann ihn ganz sicher nicht verfolgen können, auch nicht mit seinem seltsamen Wagen und dem merkwürdigen Pferd. Er sah wie ein Fremder aus einem fernen Land aus, und seine Stimme klang irgendwie gespreizt. Und doch- und das war das Eigenartigste - auf gewisse Weise wirkte er auch vertraut.
»Komm!«, rief der Fremde erneut. »Beeil dich!«
Mit gezwungener Forschheit entgegnete Dekteon: »Ich kenne Euch nicht. Was wollt Ihr von mir?«
»Man wartet auf dich. Mein Gebieter wünscht, dass du dich beeilst.«
»Wer ist dein Gebieter?«, fragte Dekteon schon nicht mehr mit der gleichen Ehrerbietung wie zuvor. »Ist er Lord Fren von Am-See?«
»Nein. Beeil dich! Man wartet auf dich!«
Das Pferd schüttelte den Kopf. Die Glasperlen am Zaumzeug glitzerten. Seine Hufe waren nicht beschlagen, ja, es hatte gar keine Hufe, sondern eher Tatzen wie ein Bär.
Ein Schauer rann über Dekteons Rücken. Dies war bestimmt keines von Lord Frens Pferden.
»Komm!«, forderte der Fremde ihn erneut auf. »Wo willst du denn sonst hin?«
Das wusste Dekteon auch nicht. Er schluckte. Die Kälte biss an den Striemen, die Lord Frens letztes Auspeitschen hinterlassen hatten, und wenn er sich bewegte, rissen die Blutkrusten wie morscher Stoff auf. Ohne Unterschlupf und Essen würde er hier nicht lange durchhalten.
»Na schön, ich komme mit. Aber wenn du etwas Ungutes mit mir im Schilde führst, bringe ich dich um. Ich bin ein entflohener Sklave - aber das weißt du ja, nicht wahr? Ich habe demnach nichts zu verlieren.«
Selbst in seinen eigenen Ohren klangen diese Worte bedrohlich. Er kletterte auf den Wagen hinter den Fremden.
Ein dickes Fell lag auf dem Boden des Wagens und darauf ein großes Stück kalter Braten und ein praller Trinkbeutel. Es sah aus, als warte es nur auf ihn. Misstrauisch beäugte Dekteon die Sachen, aber er war ausgehungert, sein Magen leer seit zwei Tagen. Schließlich aß er das Fleisch und trank aus dem Beutel. Nichts war ungewöhnlich an ihm oder dem schalen Bier, das er enthielt.
Dekteon legte sich auf das Fell und schloss die Hand um das gefeilte Metall, das ihm als Messer gedient hatte. Er beschloss, nicht zu schlafen. Ein wenig benommen fragte er sich, wohin der Mann im Kapuzenkittel ihn bringen mochte.
Mit Dekteon würde es ein böses Ende nehmen, das hatte er immer gewusst. Der alte Sklave im Uferhaus, das zum Besitz derer von Am-See gehörte, hatte ihn immer und immer wieder ermahnt und gewarnt. Doch Dekteon war jung und stark, und er hatte rotes Haar, ein Rot so dunkel wie gebackener Ton. Es war schlimm, ein Sklave mit solchem Haar zu sein, selbst wenn man als Sklave geboren war.
Und sein Haar war es, woran seine Herren sich am leichtesten erinnerten, viel leichter als an seinen Namen. In drei Häusern hatte er gedient, und in jedem hatten sie ihn nur Roter oder Rotschopf genannt:
»Roter, hol das Brennholz, und gefälligst etwas schneller, du fauler Teufel!«
»Rotschopf, du hast das Zaumzeug nicht ordentlich eingefettet!«
»Schafft diesen roten Hund herbei! Wird Zeit, dass er seine Peitschenhiebe bekommt!«
Dekteon war das Kind einer Sklavin. Für Sklaven gab es so etwas wie Heirat und Ehe nicht, und er wusste nicht, wer sein Vater war. Die ersten zehn Jahre seines Lebens hatte er auf einem der großen Güter im Süden zugebracht. Das Herrenhaus war riesig gewesen mit einer großen Halle und einem offenen Kamin in der Mitte, und an den Wänden schimmerte Seide. Von der Tür aus hatte Dekteon das alles gesehen, aber nie war er eingetreten.
Die Unterkunft der Sklaven war armselig und ihre Habe gering. Der Herr hatte einen großen Garten gehabt, dessen schwarzgrüne Bäume zu allen möglichen Formen geschnitten waren, und ein rundes Becken mit Goldfischen.
Mit acht Jahren hatte Dekteon einen dieser Fische mit der Hand gefangen. Dafür war er zum ersten Mal in seinem jungen Leben ausgepeitscht worden. Dann hatte man ihn zum Hundejungen gemacht, und er war für die Hunde seines Herrn verantwortlich gewesen. Doch als er zehn war, hatte sein Herr sich mit einem anderen hohen Herrn verfeindet, und es kam zur blutigen Fehde. Bei einem Überfall wurde das Herrenhaus ausgeplündert und die Sklaven verschleppt. Das war das letzte Mal, dass er seine Mutter gesehen hatte.
Er diente seinem neuen Herrn, bis er siebzehn war. Mit dreizehn hatte man ihm das Brandzeichen aufgedrückt. Dazu wurde einem ein Fetzen zwischen die Zähne geschoben, damit man sich das Schreien verbiss, wenn das Eisen einen berührte, aber auch, um die Schreie zu dämpfen. Dekteon war an der Schmiede mit anderen Jungen in einer Schlange gestanden. Jedem hatte man einen Lumpen in den Mund gestopft. Das weißglühende Eisen zischte. Jeder Junge brüllte, und der Lappen fiel aus dem Mund. Dekteon hatte sich fest vorgenommen, nicht zu schreien, aber er tat es trotzdem. Dabei war ihm, als brülle ein anderer auf, der sich einfach seine Stimme geliehen hatte. Das Brandmal hatte die Form von zwei kleinen Flügeln mit einem Stab dazwischen, ein typisches Seeland-Brandzeichen für Sklaven, das bedeutete: Dieser Vogel kann nicht fliegen. Als er siebzehn war, verspielte sein Herr ihn bei einem Wagenrennen. Er kam zu Lord Fren ins Uferhaus derer von Am-See.
Dekteon war als Sklave geboren und aufgewachsen. Er wusste, was von ihm erwartet wurde und was nicht, aber irgendwie hatte er nie das gelernt, was ein Sklave lernen sollte. Er hatte stattdessen Pferde und Hunde versorgt, Bäume gefällt, Wölfe gejagt und war weite Strecken gelaufen. Er war stark und kräftig und, weil er viel im Freien aufhielt, auch sehr widerstandsfähig. Die anderen Sklaven tuschelten untereinander, schlichen umher, kauerten sich in dunkle Winkel und zitterten oder beugten sich schmeichlerisch, wenn ihre Gebieter vorbeikamen. Dekteon ließ seinen Herrn erst ein paarmal nach ihm rufen, ehe er zu ihm lief. Wenn er sich scheinbar achtungsvoll verbeugte, schnitt er ungesehen Grimassen. Stumm und unerkannt regte sich Grimm in ihm und wuchs und machte sich auf ebenso dumme wie verwegene Weise Luft.
Dekteon stahl aus der Küche und aus dem Obstgarten seines Herrn, wilderte in seinen Wäldern und fischte in seinen Bächen. Er ritt auch Lord Frens Rapphengst im Hof bei den Stallungen, bis Lord Fren ihn eines Tages dabei ertappte. Dafür wurde Dekteon geprügelt. Ein Sklave gewöhnt sich an Prügel und Peitschenhiebe, aber so schmerzhaft war er noch nie zuvor bestraft worden. Am nächsten Vormittag, nachdem Lord Fren schlechtester Laune von einer Auseinandersetzung mit seiner Hauptfrau gekommen war, gab er seinem Pferd die Sporen einmal zu viel, und es warf ihn ab. Dafür gab er Dekteon die Schuld, er war überzeugt, dass dieser dem Tier etwas angetan, es verhext habe. Ein alter Sklave achtete nicht auf seine eigene Sicherheit und warnte Dekteon, dass er mit einer weiteren Züchtigung zu rechnen habe. Dem Rothaarigen war klar, dass noch einmal Prügel - und so kurz hintereinander – zu viel sein würde. Selbst sein widerstandsfähiger Körper würde sich nicht so schnell erholen, wenn er noch einmal, auf die offenen Striemen, gepeitscht würde. Er geriet in Panik und versteckte sich im Heustadel. Das war sehr dumm von ihm und unüberlegt gehandelt. Schon bald entdeckte ihn der hochnäsige und eingebildete Aufseher. Und dann tat Dekteon das Allerdümmste und Unüberlegteste, das er in seinem Fall nur tun konnte: Er setzte sich gegen die Männer des Aufsehers zur Wehr, schlug dem Aufseher selbst ein paar Zähne aus, und irgendwie kippte dabei eine Lampe um, und der ganze Heustadel fing Flammen. Schließlich bekam Dekteon von hinten einen Schlag auf den Schädel, und eine Weile danach wurde er ausgepeitscht.
Später, als er von Schmerzen geschüttelt und von Fieber glühend in dem Schuppen lag, wo das Brennholz aufgestapelt war, schlich sich der alte Sklave wieder zu ihm. Nie hatte Dekteon erfahren, wie der Alte hieß, noch was seine Pflichten in Lord Frens Haushalt waren. Der Alte aß nicht mit den anderen Sklaven und bekam auch nicht solche Arbeiten wie sie zugeteilt. Manchmal sah Dekteon ihn tagelang nicht, doch er war immer bereit zu helfen, wenn Hilfe benötigt wurde, oder zumindest erteilte er seine gut gemeinten Ratschläge, auch wenn sie nicht gefragt waren. Jetzt half er, so gut es in seiner Macht stand. Er hatte einen Becher mit Wasser mitgebracht, aber der Bursche, der die Tür bewachte, hatte ihn gestoßen, dass das meiste Wasser übergeschwappt war. Während Dekteon gierig den Rest schluckte, berichtete der alte Sklave ihm von Frens Plänen. Der ungehorsame rote Hund sollte an die Kupferminen verkauft werden.
Das war gleichbedeutend mit einem Todesurteil, würde jedoch seinem Herrn gutes Geld einbringen, denn ein kräftiger Sklave war für die Minen viel wert. Vielleicht hielt er sogar zwei Jahre durch, ehe die unbeschreiblichen Zustände zu seinem Tod führten.
Dekteon lag im schmutzigen Stroh und stierte mit weiten Augen ins Leere. Er spürte weder Schmerz noch Fieber, nur allesbeherrschende Verzweiflung, die schlimmer war als beides.
Der alte Sklave beugte sich über ihn, steckte ihm ein Stück Brot in die Jacke und durchschnitt mit einem zum Messer gefeilten Metall den dicken Strick, mit dem man ihn gefesselt hatte. Dekteon staunte, und die Tat des Alten verlieh ihm neuen Lebenswillen. Dankbar blickte er seinen Retter an, der leise sagte: »Sie halten dich für zu schwach, als dass du jetzt entkommen könntest, und das bist du wohl auch, doch du musst es versuchen. Nur ein Mann hält Wache an der Tür, und es wird bald dunkel, dann ist auch Abendessenzeit. Lauf zum Kuppelberg und überquere ihn.«
»Aber... « Dekteon schluckte. »Wo soll ich denn hin?«
Der Alte wirkte seltsam, ja fast weise. Seine Augen glommen.
»Folge dem Hochland. Drei, vier Berge, ein Nachtmarsch, dann kommst du zu einem Kreis aus verwitterten Steinen – dies ist ein alter Ort. In seiner Nähe findest du einen Fluss, durchwate ihn. Auf der anderen Seite befindet sich Wildnis, dort leben viele Gesetzlose. Als ich noch jung war, flohen ein paar Sklaven von hier dorthin, und Frens Vater hat sie nie gefunden.«
In seinem Fieber regte der Gedanke an Flucht Dekteon an. Schließlich steckte der Alte das gefeilte Eisen durch Dekteons Gürtel und verließ ihn.
Selbst bis hierher drang der Geruch des Bratens aus der großen Halle und der Rauch frisch angezündeter Lampen. Jemand brachte Dekteons Wächter zu essen, und während dieser sich darüber hermachte, schlich der Rothaarige aus der Tür hinter ihm und schlug ihm ein Holzscheit über den Schädel. Dann setzte er den bewusstlosen Wächter mit dem Rücken an die Schuppenwand, als schliefe er. Dekteon hatte das behelfsmäßige Messer nicht benutzen wollen, denn es lag ihm nicht, einen anderen zu töten. Niemand war im Hof, und er wusste von einem Loch in der Mauer, durch das er kriechen konnte. Wenn er Glück hatte, würde sein Wächter erst in zwei Stunden erwachen oder entdeckt werden.
Das Fieber verlieh Dekteon zunächst einen klaren Kopf.
Er rannte unter dem sternenglitzernden Himmel, und die Hoffnung schmeckte süß in seinem Mund.
Die ganze Nacht lief oder stolperte er auf überwucherten Pfaden über die Berge. Irgendwann hatte er das Stück Brot verloren, und als die Sonne aufging, war ihm, als weise sie ihn darauf hin, wie krank und erschöpft er war.
Vor seinen Augen verschwamm alles, ihm war heiß und kalt zugleich, aber verbissen schleppte er sich weiter. Auf den Steinkreis stieß er erst gegen Mittag, und da hörte er auch das ferne Kläffen von Hunden. Man jagte ihn also, und bestimmt sollte er in Stücke gerissen werden.
Da erreichte er die Steine: Sie waren hässlich und schief und sahen aus, als würde der nächste Windstoß sie umwerfen, dabei standen sie vermutlich schon Jahrhunderte so. Halb wahnsinnig vor Furcht hatte Dekteon am Hang zurückgeblickt und etwa zwanzig Hunde, unscheinbar wie Ameisen, herbeilaufen sehen und mit ihnen Reiter, die ihn verfolgten. Ganz deutlich waren ihre Schreie und das Bellen in der klaren Herbstluft zu hören, und wie unheildrohend es klang!
Er rannte in den Steinkreis. Nirgendwo vermochte er einen Fluss zu sehen, weder nah noch fern. Ober irgendetwas stolperte er, und er fiel. Da sah er, dass es eine gewaltige Granitplatte war, grün von Moos, die in der Mitte des Kreises nur wenig aus der Erde ragte.
Ein törichter Gedanke überkam Dekteon: Wenn er die Platte hob, musste es eine Vertiefung darunter geben, in der er sich verstecken konnte. Lächerlich! Wie wollte er das wissen? Außerdem fehlte ihm die Kraft, den Stein zu heben.
Das Kläffen der Hunde kam näher. Dekteon drückte die Hände gegen die Platte und versuchte verzweifelt, sie zu verrücken. Und irgendwie, unglaublicherweise, brachte er die nötige Kraft auf, und der Stein verlagerte sich.
Jetzt vermochte er das schmale, finstere Loch darunter zu sehen, gerade breit genug für einen Mann. Schaudernd vor Angst und Erschöpfung sprang der Rothaarige in diese Finsternis - die nur der Anfang eines bodenlosen Abgrunds sein mochte, es jedoch glücklicherweise nicht war. Fast sofort fanden seine Füße festen Halt. Die Grube war etwa sechs Fuß tief. Er streckte die Hände hoch, um die Steinplatte zu schließen. Und zu seinem Erstaunen ließ sie sich ohne größere Schwierigkeiten bewegen und verbarg ihn.
In der Finsternis herrschte tiefe Stille. Nur schwach war das Kläffen der Hunde zu hören, als käme es aus weiter Ferne.
Dekteon fühlte sich schwindelig. Er kauerte sich gegen die Seite der schwarzen Grube und schloss die Augen.
Und das Erwachen bescherte ihm einen roten Wald im Sonnenaufgang, einen Wagen und ein Pferd mit den Beinen eines Bären.
Dekteon zuckte zusammen. War er doch eingeschlafen? Narr! Er durfte es nicht, und dennoch war es passiert.
Der Wald hatte sich gelichtet. Die Sonne war inzwischen weit gewandert, stand bereits jenseits des Mittags und war von stumpfem Gelb, Nebel stieg auf.
Der Mann im Kapuzenumhang hielt immer noch, vornübergebeugt, die Zügel. Das merkwürdige Pferd trabte auf seinen gepolsterten Ballen leise dahin. Dekteons wunder Rücken brannte. Er unterdrückte einen Schmerzenslaut und wandte sich an den Kutscher.
»Du hast mir noch nicht gesagt, wohin du mich bringst.«
»Zu meinem Herrn«, erwiderte der Vermummte sofort.
»Wer ist das?«
»Mein Herr heißt Zaister.«
Dekteon bemühte sich, seine Gedanken zu sammeln.
»Was will er von mir? Woher wusste er, wo er mich finden würde?«
»Du wurdest erwartet.«
Konnte es sein, fragte sich Dekteon, dass er den Fluss doch irgendwo entdeckt und überquert hatte, während er im Fieberwahn umhergeirrt war, und er sich jetzt im Gebiet der Gesetzlosen befand und zu irgendeinem Häuptling oder so etwas gebracht wurde? Falls dem so war, erschien es ihm klüger, zumindest im Augenblick, zu schweigen. Ganz sicher war er sich nicht, dass ihm der Vermummte vertraut vorkam. Es war das Beste, wenn er sich erst einmal umschaute, ehe er weitere Fragen stellte.
Und einschlafen würde er gewiss nicht mehr.
Der Nebel wurde dichter. Der Rotschimmel verschmolz schier damit, und die Bäume hatte er ganz verschluckt.
Nur das dumpfe Mahlen der Räder und das leise Klingeln der Glasperlen am Zaumzeug waren zu hören.
So ging es weiter, immer tiefer hinein in den Nebel; ohne dass ein Wort gewechselt worden oder irgendetwas von der Landschaft zu sehen gewesen wäre. Aus irgendeinem, ihm selbst unerklärlichen Grund beunruhigte Dekteon der Nebel. Vielleicht, weil er ihm wie ein natürliches Zeichen seiner eigenen Verwirrung erschien. Doch plötzlich, nach etwa zwei Stunden, fing der Nebel an sich aufzulösen und in Schleiern vom Wagen aufzusteigen. Sie holperten über einen Hang und auf der anderen Hügelseite wieder hinunter. Sie befanden sich auf einem gepflasterten Weg. Wie hatte der Vermummte ihn gefunden? Und wie war er imstande gewesen, ihm in dem dicken Nebel zu folgen?
Vorne und zu beiden Seiten öffnete sich, ganz deutlich zu sehen, ein Tal, eingerahmt von Bäumen in leuchtenden Herbstfarben. Ein Städtchen erhob sich aus dem Tal, doch als sie näher kamen, sah Dekteon, dass es verlassen und zerfallen war. Die Dächer waren eingestürzt, doch die Mauern standen noch. Zwischen den Häusern weideten Schafe im braunen Gras. Sie hatten verfilztes schwarzes Lockenfell und große Augen. Sie funkelten den vorüberratternden Wagen an, ohne jedoch wegzurennen. Am nordwestlichen Tal-Ende krönten Bauwerke den Gipfel eines bläulichen Berges. Doch nicht sehr viel war von der Burg übriggeblieben, die gewiss einmal sehr beeindruckend gewesen war: vier Türme, eine Mauer und der arg mitgenommene Hauptbau. Der Wagen folgte dem Pfad geradewegs durch das Tal, den Berg empor und durch den torlosen Mauereingang. Eine von verwitterten Standbildern eingesäumte Straße führte zum Portal des Wohnteils. Löwen, denen die Köpfe abgebrochen waren, und geflügelte Hunde, aus deren Rachen Flechten wuchsen, das waren die Statuen.
Der Wagen hielt beim Portal an. Ein schlanker Baum wuchs aus einem alten Brunnen im Hof.
Der Vermummte sprang aus dem Kastenwagen.
»Komm«, forderte er Dekteon. auf, wie schon zuvor.
»Beeile dich!«
So, wie es aussah, würde die Sonne in gut zwei Stunden untergehen. Tief, wie sie stand, schien sie geradewegs in die Kapuze. Das Gesicht des Mannes war wahrhaftig ungewöhnlich weiß, nicht ungesund, nur einfach farblos. Auch die Augen wirkten eigenartig hell, fast leuchtend im Schatten der Kapuze.
Zögernd stieg Dekteon aus dem Wagen, er wusste ja nicht, was ihm bevorstand. »Komm!«, wiederholte Weißgesicht. »Folge mir. Du wirst erwartet.«
Er trat durch die Öffnung, wo sich einst eine Tür befunden hatte. Dekteon schaute sich um. Jetzt bot sich die letzte Möglichkeit für einen Fluchtversuch. Keine Gesetzlosen waren zu sehen, keine weiteren Fremden mit leuchtenden Augen.
Etwas ließ ihn hochblicken.
Ein Vogel schwebte am Himmel über ihm, schwarz mit weiten Schwingen, reglos. Er schien ihn zu beobachten. Lächerlich, dieser Gedanke, und doch ließ er sich nicht vertreiben. Dekteon zuckte entmutigt mit den Schultern und folgte Weißgesicht in die große Halle.
Wenn das die Festung von Gesetzlosen war, war sie zumindest ungewöhnlich - nämlich ohne Gesetzlose, ohne überhaupt jemand, außer Weißgesicht natürlich und seinem bisher noch unsichtbaren Herrn, Zaister.
Dekteon hatte ein wenig Mut gefasst. Schließlich würde es zweifellos angenehmer sein, Zaister als Sklave zu dienen als Fren. Aber Zaister hatte ihn nicht gekauft, stellte keine Besitzansprüche. Tatsächlich behandelte man ihn, auf seltsamste Weise, als Gast.
Die Große Halle der uralten Burg war zerfallen. Am Nordende wuchs die Rundung eines Turmes in sie hinein. Zu diesem Turm gab es eine Holztür, und sie war verschlossen, obgleich kein Schloss zu sehen war. Eine Treppe führte hinunter in eine arg mitgenommene Küche. Die Herde und offenen Feuerstellen waren dem Zerfallen nahe und wirkten eigenartig unfertig. Der Kamin über der mittleren Feuerstelle musste mit Trümmern, Schutt und Ruß verstopft sein, keine Flammen leckten freundlich nach einem brutzelnden Braten. Doch ein Kohlebecken stand in der Nähe, und es dauerte nicht lange, bis Weißgesicht ein Feuer entzündet hatte und wohlige Wärme davon aufstieg. Auch an diesem Kohlebecken war etwas merkwürdig, aber was?
Weißgesicht brachte kalten Braten und einen Laib Brot aus Kästen zum Vorschein und auch noch etwas von dem sauren Bier und stellte alles auf den Tisch. Dekteon, dem nichts Vernünftigeres einfiel, fing zu essen an.
»Blut auf deiner Kleidung«, stellte Weißgesicht fest.
»Ich wurde ausgepeitscht«, murmelte Dekteon überrascht, dass der andere davon überhaupt sprach. Im nächsten Augenblick staunte er noch mehr. Man hatte ihm Jacke und Hemd vom Rücken gerissen. Erschrocken sprang er auf. Weißgesicht winkte ihm beruhigend zu. Aus einem Kasten, an dem er zuvor noch nicht gewesen war, holte er einen kleinen Tiegel mit grünlichem Inhalt. »Zum Heilen«, erklärte er ruhig.
Unsicher gestattete Dekteon, dass der andere die Salbe auf seine Striemen strich. Wie ein Wunder schwand der Schmerz sofort.
»Ich dachte«, sagte Dekteon, »ich müsse mich beeilen.«
»Jetzt ist Zeit, vor dem Sonnenuntergang. Genügend Zeit ist jetzt.«
»Was geschieht bei Sonnenuntergang? Lerne ich dann - deinen Herrn kennen?« Dekteon war froh, dass er sich hatte zurückhalten können und nicht Unseren Meister gesagt hatte.
Weißgesicht antwortete nicht darauf. Stattdessen sagte er: »Ich bringe dir etwas Frisches zum Anziehen.«
»Gut.«
Weißgesicht verließ die Küche.
Trotz seiner inneren Unsicherheit genoss Dekteon die Wärme, das Essen und das Ende seiner Schmerzen. Er schluckte den letzten Bissen Braten hinunter und rieb den Teller mit dem letzten Stückchen Brot sauber. Er legte den Kopf zurück, als er den Becher ansetzte, damit ihm auch nicht ein Tropfen entginge. Als Sklave lernte man, gründlich zu sein und alles Angenehme voll auszukosten.
Seltsam, dieses Feuerbecken. Was war es bloß? Wie bei dem Wagen stimmte etwas daran nicht ganz. Und dieses Pferd - aber vielleicht war es gar kein richtiges Pferd, sondern ein Haustier, das in dieser Gegend üblich war. Als Sklave wusste er nicht viel von Erdkunde und den Pflanzen und Tieren ihm fremder Gebiete. Wie sollte er wissen, ob es hier nicht ganze Herden dieser bärenprankigen Zugtiere gab?
Seine Nackenhärchen stellten sich plötzlich auf. Da wusste er sofort, dass er heimlich beobachtet wurde. Vorsichtig stand er auf und tat, als wolle er sich die Hände am Kohlebecken wärmen. Er wirbelte herum, doch er sah niemanden. Der Eingang zur Küche war leer, auch die Treppe dahinter. Er stieg ein paar Stufen hoch und starrte auf die Holztür in der runden Wand des Turmes.
Sie war geschlossen. Außerdem hätte er die Schritte gehört, wäre jemand- die Treppe heruntergekommen. Da erinnerte sich Dekteon an den Vogel, der über ihm am Himmel geschwebt hatte.
2. Vollmond
Dekteon kehrte in die Küche zurück und setzte sich wieder. Eine Minute später kehrte Weißgesicht so gleichmütig zurück, wie er gegangen war.
Er brachte Kleidung mit, wie er versprochen hatte. Dekteon fragte sich, ob er sich einen Spaß mit ihm erlaubte. Zum einen waren die Sachen aus feinem Stoff, zum anderen vollkommen rot: rotes Hemd, rotes Wams, rote Hose. Dazu stellte er Stiefel aus rotem Rindsleder vor Dekteon und reichte ihm einen Gürtel aus dem gleichen Leder mit brünierten Bronze-Zierknöpfen. Das Wams war mit Goldfäden kunstvoll bestickt: ein ungewöhnliches Muster aus Kreisen und Tieren mit Geweihen wie die von Hirschen. Natürlich mochte ein mächtiger Lord seine Sklaven kostbar kleiden, aber dieser Zaister konnte kein mächtiger Lord sein, nicht, wenn er hier in dieser zerfallenen Burg hauste. Außerdem war Dekteon nicht Zaisters Sklave.
»Dein Herr erlaubt sich einen Spaß mit mir«, sagte der Rothaarige. Er machte keine Anstalten, in die Sachen zu schlüpfen. Weißgesicht trug eine grobgewebte graue Hose und einen einfachen Umhang mit Kapuze.
»Beeil dich!«, drängte Weißgesicht. »In einer halben Stunde geht die Sonne unter.«
»Was hat das mit mir zu tun?«, fragte Dekteon, obgleich er spürte, wie ihm ein Schaudern über den Rücken rann. Das Gefühl, beobachtet zu werden, hatte nicht nachgelassen.
Weißgesicht sagte: »Deine Kleidung ist schmutzig und zerlumpt, diese Sachen dagegen sind warm und angenehm. Es wird dir Freude machen, sie zu tragen.«