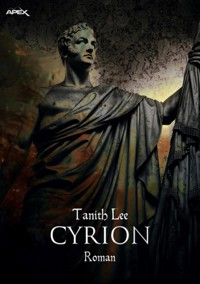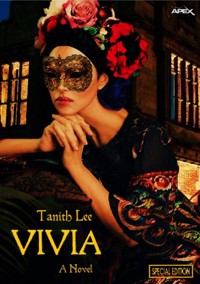10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Sammelband HORROR-SOMMER 2018 beinhaltet auf über 1000 Seiten sieben erstklassige Horror-Romane und -Erzählungen internationaler Spitzen-Autorinnen und Autoren – von Tanith Lee, T. E. D. Klein, Dennis Wheatley, Peter Saxon, Paul W. Fairman, John Farris und Christian Dörge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1501
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TANITH LEE/T.E.D. KLEIN/
DENNIS WHEATLEY/PETER SAXON/
CHRISTIAN DÖRGE u.a.
HORROR-SOMMER 2018
Romane und Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Dennis Wheatley: DER SCHWARZE PFAD (To The Deavil – A Daughter)
Peter Saxon: DIE SCHWÄRZESTE NACHT (The Darkest Night)
Tanith Lee: NUNC DIMITTIS (Nunc Dimittis)
T.E.D. Klein: PETEY (Petey)
Paul W. Fairman: FRANKENSTEINS FLUCH (The Frankenstein Wheel)
John Farris: DER UNGEBETENE GAST (The Uninvited)
Christian Dörge: UNRUHE
Das Buch
Der Sammelband HORROR-SOMMER 2018 beinhaltet auf über 1000 Seiten sieben erstklassige Horror-Romane und -Erzählungen internationaler Spitzen-Autorinnen und Autoren – von Tanith Lee, T. E. D. Klein, Dennis Wheatley, Peter Saxon, Paul W. Fairman, John Farris und Christian Dörge.
Dennis Wheatley: DER SCHWARZE PFAD
(To The Deavil – A Daughter)
Unseren guten Freunden
DIANE UND PIERRE HAMMEREL gewidmet.
Mit großer Dankbarkeit für ihre grenzenlose Gastfreundschaft,
welche sie Joan und mir während unseres Besuches
in Nizza entgegenbrachten; zu unseren lebhaftesten Erinnerungen daran
gehört unsere ebenso anstrengende wie faszinierende Expedition
(bei Tageslicht) in die Höhle der Fledermäuse.
1.
In Molly Fauntain wuchs allmählich die Überzeugung, dass das Geheimnis, von dem die einsame Bewohnerin der Villa nebenan umgeben war, mehr Spannung barg als der Roman, an dem sie gerade arbeitete.
Mollys Bücher, die sie in ihrem Häuschen an der Comiche d'Or hoch über dem blauen Mittelmeer schrieb, spielten im Agenten-Milieu. Sie selbst war zwar keine Spionin gewesen, wie ihr Sohn John vermutete, hatte aber während des Krieges als Sekretärin des Secret Service das Milieu genau studieren können. Ihr Mann war in Afrika gefallen, und sie hatte nur zu schreiben begonnen, weil sie von der Witwenpension allein nicht hätte leben können.
Vor vier Tagen war ihre neue Nachbarin eingetroffen. Molly hatte gerade auf ihrer kleinen Terrasse den Tee getrunken, als ein Taxi vorfuhr und das junge Mädchen ausstieg. Zu dieser Zeit konnte sie nicht mit dem Train Bleu, sondern nur vom Flughafen Nizza gekommen sein. Ein Mann mittleren Alters, der trotz seiner stämmigen und aggressiven Erscheinung etwas Verstohlenes an sich hatte, begleitete sie. Seine Kleidung kam Molly merkwürdig vor. Das heißt, sie war nicht an sich merkwürdig, aber sie passte zu einem Geschäftsmann der Londoner City und nicht zu einem Urlauber an der Riviera. Der Mann half dem Fahrer, das Gepäck ins Haus zu tragen. Nach etwa zehn Minuten kehrte er zu dem wartenden Taxi zurück, fuhr davon und hatte sich seitdem nicht wieder blicken lassen.
Seltsam war, dass auch sonst kein Mensch die Villa nebenan besucht hatte und dass das Mädchen, soviel Molly wusste, niemals ausging, wenigstens tagsüber nicht.
In der letzten Nacht hatte sich das Geheimnis noch vertieft. Molly war kurz nach ein Uhr wach geworden, als ein loser Stein einen steilen Gartenweg hinunterkollerte. Sie stand auf und trat ans Fenster. Das Mondlicht fiel silbern auf die Kakteen zwischen den Pinien, und ihre Nachbarin stieg gerade die Stufen hinab, die von der Terrasse zur Straße führten.
Molly hatte sich ein Buch genommen und mit gespitzten Ohren auf die Rückkehr des Mädchens gewartet. Es dauerte anderthalb Stunden, bis sie das Gartentor klicken hörte. Sie stand wieder auf und sah die Unbekannte ins Haus zurückkehren.
Warum ging das junge Mädchen nachts spazieren, wenn es am Tag nie einen Fuß vor die Tür setzte?
Zum zwanzigsten Mal an diesem Vormittag wandelten Mollys graugrüne Augen von der Schreibmaschine zum offenen Fenster.
Die neue Nachbarin war die unschuldige Ursache, dass sie mit ihrer Arbeit nicht weiterkam, und, was wichtiger war, sie würde nicht eher wieder Ruhe finden, bis sie nicht wenigstens versucht hatte, dem Mädchen zu helfen, falls es in Schwierigkeiten steckte.
Da gab es nur eins zu tun. An der Riviera war es nicht üblich, zeitweiligen Nachbarn Besuche abzustatten. Aber Molly hatte von ihrer Köchin erfahren, dass die Unbekannte Engländerin war. Das mochte als Vorwand ausreichen.
Kurz entschlossen schob Molly ihren Stuhl zurück und stand auf. Vor ihrer Nase lag ein echtes Geheimnis, und sie würde es aufklären.
2.
Auf dem Weg in ihr Schlafzimmer zog Molly Fountain sich den leinenen Arbeitskittel über den Kopf. Niemand, der sie in diesem Augenblick gesehen hätte, würde sie auf fünfundvierzig geschätzt haben. Ihre Figur war ausgezeichnet, und nur ihr graues Haar verriet ihr Alter.
Sie nahm eine weiße, handgestickte Bluse und einen grauen Mantel mit passendem Rock aus dem Schrank, zog sich schnell an und ging zur Nachbarvilla hinüber. Als sie die steilen Stufen erklommen hatte, bog sie zur Terrasse ein. Das Mädchen hatte ihre Schritte gehört und erhob sich von einem Liegestuhl, machte aber keine Anstalten, Molly entgegenzugehen und zu begrüßen. Ihr Gesichtsausdruck war wachsam, und Molly meinte, in den dunklen Augen eine Spur von Furcht zu entdecken.
Fröhlich begann sie: »Ich bin Molly Fountain, Ihre Nachbarin. Da wir beide Engländerinnen sind, dachte ich...«
Die Augen des Mädchens weiteten sich. »Doch nicht die Molly Fountain?«, rief sie lebhaft aus.
Molly lächelte. Ihr Name war durchaus nicht allgemein bekannt, aber diese Frage war ihr in den letzten zwei Jahren doch schon öfter gestellt worden.
»Falls Sie an die Autorin von Secret-Service-Storys denken, dann werde ich es wohl sein.«
»Ich finde Ihre Bücher unheimlich spannend«, versicherte das Mädchen.
Molly nutzte den ihr so unerwartet zugefallenen Vorteil schnell aus. »Wenn Sie einige meiner Bücher gelesen haben, werden Sie mich hoffentlich nicht ganz als eine völlig Fremde betrachten. Bitte, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen meinen ersten Besuch am Vormittag mache, aber die gesellschaftlichen Formen werden hier weniger beachtet als zu Hause, und ich dachte, es wäre Ihnen vielleicht lieber so, als wenn ich am Nachmittag meine Karte abgegeben hätte.«
Zum ersten Mal sah Molly das Mädchen von Angesicht zu Angesicht, und während sie sprach, betrachtete sie sie genau. Sie war überdurchschnittlich groß und sehr dünn. Die Gehemmtheit, die sich in ihren Bewegungen ausdrückte, gab ihr das Aussehen eines zu lang geratenen Schulmädchens. Molly schätzte sie auf neunzehn. Über der breiten Stirn war das dicke, wellige dunkelbraune Haar in der Mitte gescheitelt. Der Mund war voll und großzügig geschnitten. Eine Stupsnase raubte ihr jeden Anspruch auf klassische Schönheit, und ihr Teint wirkte ein bisschen kränklich. Am schönsten an ihr waren ihre Zähne, die, wenn sie lächelte, blendendweiß aufblitzten, und ihre großen, außergewöhnlich leuchtenden braunen Augen.
Mollys Erwähnung der gesellschaftlichen Formen erinnerte das Mädchen an die Pflichten der Gastfreundschaft. Nah einem Augenblick des Zögerns forderte sie Molly auf: »Möchten Sie nicht eintreten?«
»Danke, gern«, antwortete Molly prompt. »Aber, wissen Sie, Sie haben mir Ihren Namen noch gar nicht genannt.«
»Oh!« Wieder gab es eine kurze Pause. »Ich heiße Christina Mordant.«
Ȇbereinen steilen Gartenweg erreichten sie den Rasenplatz vor dem Haus.
»Sind Sie zum ersten Mal an der Riviera?«, fragte Molly.
»Ja«, sagte Christina und führte ihren Gast durch eine Terrassentür ins Wohnzimmer. »Aber in Frankreich lebe ich schon seit einiger Zeit. Bis kurz vor Weihnachten war ich in einem Pensionat in Paris.«
»Ich bin gern bereit, Ihnen etwas von dieser wunderschönen Küste zu zeigen«, bot Molly an.
Jetzt war Christinas Zögern deutlicher zu merken. »Danke«, stotterte sie, »zu nett von... aber... ich mache mir nicht viel daraus, auszugehen.« Voller Verlegenheit setzte sie hastig hinzu: »Nehmen Sie doch Platz. Ich werde Ihnen etwas zu trinken holen. Leider kann ich Ihnen keinen Cocktail anbieten, aber Maria könnte schnell Kaffee kochen. Wir haben auch einen köstlichen Orangensaft.«
Molly hatte gar keinen Durst, doch sie nahm die Gelegenheit wahr, ihren Besuch zu verlängern.
»Organgensaft wäre fein, wenn es Ihnen nicht zu viel Mühe macht.«
Sobald Christina das Zimmer verlassen hatte, sah sich Molly unter den Scheußlichkeiten aus billigem Holz und Chrom der möbliert vermieteten Villa um. Sie hoffte, irgendeinen Hinweis auf Christinas Persönlichkeit zu finden, und tatsächlich entdeckte sie auf einem Tischchen ein Manikür-Etui, das die Initialen E. B. trug.
Christina kam mit einem Tablett zurück. »Und Sie leben das ganze Jahr über hier, Mrs. Fountain?«, fragte sie und goss zwei Gläser voll.
»Fast das ganze Jahr über. Den Juni verbringe ich meistens in London, und dann gönne ich mir im Herbst noch vierzehn Tage Paris, aber ich kann es mir nicht leisten, mehr als sechs Wochen in einem Hotel zu wohnen.«
Christina hob ihre dunklen Augenbrauen. »Ich hätte gedacht, Sie seien schrecklich reich. Ihre Bücher müssen Ihnen doch Tausende einbringen.«
»Das ist ein weitverbreiteter Irrglauben«, lächelte Molly.
»Sicher, ich habe ein paar Bestseller geschrieben. Aber das meiste Geld schluckt die Steuer.«
Weitere zehn Minuten gingen im Gespräch über Bücher und Autoren hin. Offenbar interessierte Christina sich sehr für Literatur. Als sie erwähnte, sie habe eine Vorliebe für historische Romane, bemerkte Molly:
»Da überrascht es mich aber, dass Sie so gar keine Ausflüge machen. Diese Küste ist voller geschichtlicher Sehenswürdigkeiten, die bis auf die Zeiten der Phönizier zurückgehen. Als ich in
Ihrem Alter war, hätte ich alles darum gegeben, diese Stätten besuchen zu dürfen.«
Christina sah sie verlegen an, wendete dann die Augen ab und murmelte: »Mir macht es eben Spaß, im Garten zu faulenzen.«
»Wie lange werden Sie hierbleiben?«
»Noch drei Wochen. Die Villa ist für einen Monat gemietet.«
»Fühlen Sie sich nicht sehr einsam? Haben Sie gar keine Bekannten, die Sie besuchen könnten oder die einmal zu Ihnen kommen?«
»Nein. Ich kenne hier unten niemanden. Aber... aber ich bin gern allein.«
»Es ist ein großes Glück, wenn man mit der eigenen Gesellschaft zufrieden ist und nicht ständig nach neuen Zerstreuungen jagen muss«, meinte Molly. »Aber trotzdem finde ich, Sie müssten ab und zu ein wenig Abwechslung haben. Gehen Sie wirklich nie aus?«
Christina schüttelte den Kopf.
»Heute Nacht hielt mich ein spannendes Buch lange wach, und als ich dann aufstand, um mir Schlaftabletten zu holen, glaubte ich, Sie gerade durch den Garten nach Hause kommen zu sehen.«
Christinas Gesicht blieb verschlossen. »Ja, ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht. Nachmittags schlafe ich meistens. Aber wenn es dunkel wird, überkommt mich eine seltsame Unruhe. Ich weiß auch nicht warum.«
»So geht es manchen Menschen. Die Astrologen behaupten, unser ganzes Leben werde durch die Stunde unserer Geburt bestimmt, und wer am Abend geboren ist, werde immer abends munter.«
»Tatsächlich? Das scheint auf mich zu passen. Ich wurde abends um halb zehn geboren.« Nah einer Sekunde fügte Christina freiwillig die Information hinzu: »Ich habe am sechsten März Geburtstag. Nächsten Monat werde ich einundzwanzig.«
»Dann werden Sie an Ihrem Geburtstag noch hier sein. Das ist ja eine nette Gelegenheit, mit Verwandten oder Freunden mal richtig zu feiern.«
»Ich nehme an, ich werde ganz allein sein.«
Molly dachte darüber nach, wie seltsam es doch war, dass dieses junge Mädchen keinen Menschen in der Welt hatte, der den Wunsch hegte, ihren 21. Geburtstag zu einem unvergesslichen Tag für sie zu machen.
Aber damit war sie der Lösung des Geheimnisses noch keinen Schritt nähergekommen.
Wie würde sich Colonel Crackenthorp, der Held ihrer Romane, in einer solchen Situation verhalten? Natürlich würde er es mit einer Schocktaktik versuchen. Also wollte Molly das auch tun. Sie sah dem Mädchen gerade in die Augen und fragte plötzlich:
»Christina Mordant ist nicht Ihr richtiger Name, nicht wahr?«
Das Mädchen zuckte zusammen und keuchte: »Woher... woher wissen Sie das?«
Gleich darauf erholte sie sich wieder von ihrem Schreck. Ihr Gesicht war weiß geworden, aber sie stand langsam auf. Ihre großen braunen Augen verengten sich und funkelten zornig. Sie zitterte am ganzen Körper.
»Was geht das Sie an?« fauchte sie. »Sie haben kein Recht, in meinen Privatangelegenheiten herumzuspionieren! Was nehmen Sie sich eigentlich heraus? Auf der Stelle gehen Sie!«
Colonel Crackenthorps Schocktaktik hatte in Mollys Büchern immer einen ganz anderen Erfolg. Das Mädchen wäre zusammengebrochen, hätte an seiner breiten Schulter geweint und alles gestanden. Aber sie war auch kein gutaussehender Bursche wie »Crack« sondern nur eine Romanschreiberin mittleren Alters.
Sie erhob sich. »Bitte, entschuldigen Sie. Ich habe in der Tat kein Recht, Sie so auszufragen. Das war unhöflich von mir. Ich kann Ihnen versichern, das ist sonst gar nicht meine Art. Aber ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ich hoffte, Sie würden mir anvertrauen, wenn Sie in Schwierigkeiten stecken. Sie sind noch so sehr jung und scheinen niemanden zu haben, an den Sie sich wenden können. Immer wenn ich Sie auf Ihrer Terrasse sah, machten Sie einen so unglücklichen Eindruck. Jetzt kann ich Sie nur noch bitten, mir meine Einmischung zu verzeihen.«
Mit dem Rest ihrer Würde neigte Molly kurz den Kopf und schritt durch die Terrassentür hinaus. Sie hatte den Rasen zur Hälfte überquert, als sie hinter sich einen verzweifelten Aufschrei hörte.
»Oh, Mrs. Fountain! Kommen Sie zurück! Ich habe das nicht so gemeint. Sie sind so freundlich. Ich bin überzeugt, dass ich Ihnen vertrauen kann. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich hier bin, denn das weiß ich selbst nicht. Aber ich werde wahnsinnig vor Angst. Bitte, hören Sie mich an!«
Molly kehrte um, und im nächsten Augenblick weinte das Mädchen in ihren Armen. Ohne Überheblichkeit, jedoch mit einiger Überraschung stellte sie fest, dass die Technik des guten alten Crack nun doch funktioniert hatte.
3.
Gut zehn Minuten vergingen, bis Christina wieder fähig war, zusammenhängend zu sprechen. Molly erfuhr nur, dass ihr Vater der Mann war, der vor vier Tagen mit dem Taxi gekommen und gleich darauf weggefahren war.
Jetzt saßen sie im Wohnzimmer auf dem billigen Plüschsofa. Molly hatte dem Mädchen einen Arm um die Schultern gelegt und wischte ihr mit einem kleinen Taschentuch die Tränen ab.
»Mein Liebes«, sagte Molly, »hat Ihr Vater Ihnen wirklich gar keinen Grund genannt, warum er Sie allein hier zurückgelassen hat?«
»Nur... nur dass ich... Feinde hätte, die mich verfolgten.«
»Was für Feinde?«
Christina fischte ihr eigenes Taschentuch hervor und putzte sich energisch die Stupsnase. Mit festerer Stimme antwortete sie: »Ich habe keine Ahnung. Ich zerbreche mir ständig den Kopf darüber.« Sie trank einen Schluck Orangensaft und fuhr fort: »Er sagte, ich wäre in großer Gefahr, aber es könnte mir nichts passieren, wenn ich seinen Anweisungen aufs Wort folgte. Als ich ihn drängte, mir mehr zu verraten, meinte er, es wäre besser für mich, wenn ich nichts davon wüsste.«
»Armes Kind! Und Sie haben gar keinen Anhaltspunkt, worin die Gefahr besteht?«
»Nein. Ich habe nie jemandem etwas zuleide getan, ehrlich nicht.«
Molly dachte nach. »Sind Sie zufällig eine Erbin? Ist Ihr Vater sehr wohlhabend? Dann könnte es nämlich um eine Entführung gehen.«
»Ich glaube schon, dass er mit seiner Maschinenfabrik viel Geld verdient, aber auch nicht mehr als eine große Zahl anderer britischer Industrieller. Ich wüsste nicht, warum Kidnapper gerade auf ihn kommen sollten.«
»Maschinenfabrik?«, nahm Molly den Faden auf. »Vielleicht ist Ihr Vater eine Schlüsselfigur in der Aufrüstung! Möglich, dass die Russen Sie entführen wollen, um von ihm Informationen über geheime neue Entwicklungen zu erpressen.«
Mit einem schnellen Kopfschütteln dämpfte Christina Mollys Eifer. »Das kann nicht sein, Mrs. Fountain. Mein Vater stellt nur langweilige Landmaschinen her.«
Von neuem überdachte Molly das Problem. »Sind Sie, ehe Sie England verließen, wegen einer kleinen Operation in einem Privatkrankenhaus gewesen?«
»Ja.« Die braunen Augen wurden rund vor Überraschung. »Woher wissen Sie das?«
»Es war nichts als eine Vermutung. Aber es könnte eine Erklärung sein. Ihr Vater mag Sie hergebracht haben, um Sie vor der Polizei zu verstecken.«
»Das verstehe ich nicht. Es ist doch kein Verbrechen, sich operieren zu lassen.«
»So ungefähr habe ich es mir vorgestellt«, fuhr Molly unbeirrt fort. »Auch heutzutage kommt es noch vor, dass ein Mädchen neunzehn oder zwanzig wird, ohne genug vom Leben zu wissen, um auf sich aufpassen zu können. Als Sie feststellten, dass sie ein Kind bekamen, hat Ihr Vater Sie in ein Privatkrankenhaus gebracht, um es entfernen zu lassen. Er mag sich gedacht haben, dass es für Sie in Ihrem Kummer besser wäre, gar nicht erst zu erfahren, dass so etwas illegal ist. Aber das ist es, und alle Beteiligten können dafür ins Gefängnis kommen. Kein Wunder, dass Ihr Vater Sie für einige Zeit versteckt halten möchte, bis die Gefahr einer Entdeckung vorüber ist.«
Christina hatte schweigend zugehört, aber nun begann sie zu kichern, und dann lachte sie mit strahlend weißen Zähnen laut heraus. Mollys mitfühlender Gesichtsausdruck veranlasste sie, sich schnell wieder zu beherrschen.
»Entschuldigen Sie, Mrs. Fountain. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie mir helfen wollen, aber auch Sie würden die komische Seite Ihrer letzten Theorie erkennen, wenn Sie wüssten, wie ich erzogen worden bin. Ich bin schon vor Jahren von anderen Mädchen aufgeklärt worden,, doch ich habe bis zum Dezember vorigen Jahres fast mein ganzes Leben in Schulen verbracht - auch die Ferien. Und in sämtlichen Schulen wurde ich vor allem, was Hosen trägt, so sorgfältig behütet wie in einem Kloster. Bis heute habe ich noch nie einen Freund gehabt, ganz zu schweigen von einem Verhältnis.«
Molly kam sich ziemlich dumm vor. Sie versteckte ihre Verlegenheit unter einem Lächeln. »Um welche Operation handelte es sich denn?«
»Mir wurden die Mandeln herausgenommen. Der Arzt meinte, es wäre nicht nötig, aber Vater bestand darauf. Er sorgte dafür, dass ich hinterher noch drei Wochen in dem Krankenhaus blieb, dann brachte er mich geradenwegs hierher.«
»Das sieht so aus, als versuchte er schon seit Ende Januar, Sie zu verstecken.«
»Kann sein. Anfangs war ich ganz gerührt, dass er sich so um mich kümmerte. Er scheint sich um mich früher nie viel Gedanken gemacht zu haben. Sicher haben Sie recht damit, dass er mich verstecken will, aber ich verstehe das Ganze nicht.«
Mollys Herz öffnete sich immer mehr diesem mutterlosen, verlassenen Mädchen. »Wir werden der Sache schon irgendwie auf den Grund kommen, mein Liebes. Allerdings muss ich dazu mehr über Sie erfahren. Wollen Sie nicht damit anfangen, mir Ihren richtigen Namen zu nennen?«
»Es tut mir leid. Ich werde Ihnen gern alles erzählen, was Sie wissen möchten, aber meinen Namen kann ich Ihnen nicht sagen. Vater ließ mich schwören, ihn niemandem zu verraten. Macht es Ihnen etwas aus, mich weiterhin Christina zu nennen?«
»Natürlich nicht, Liebes. Dann berichten Sie mir zuerst über Ihren Vater. Welche Gründe hatte er, Sie ständig in Internate zu schicken? Die Vergangenheit mag uns einen Anhaltspunkt für sein jetziges Verhalten geben.«
Christina nahm eine Zigarettenschachtel, bot Molly an und nahm sich selbst auch eine Zigarette.
»Ich weiß es nicht genau«, begann sie, »aber ich nehme an, Vater hat mir nie besondere Zuneigung gezeigt, weil ich ein unerwünschtes Kind war. Damals gehörte er der arbeitenden Klasse an. Er war ein Chauffeur, der das Hausmädchen geheiratet hatte. Aber er war von Jugend an sehr ehrgeizig, und ich muss für ihn eine zusätzliche Last gewesen sein, die ihn am Vorankommen hinderte.«
Sie lächelte verlegen.
»Ich bin in Essex geboren, in der Chauffeurs-Wohnung über der Garage, die zum Haus einer reichen alten Dame gehörte. Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen den Namen des Hauses und des Dorfes nicht nenne. Wir wohnen jetzt nämlich selbst in diesem Haus, und ich würde damit praktisch mein Versprechen brechen. Als ich ein paar Wochen alt war, gab mein Vater seine Stellung auf und kaufte sich in einem kleinen Geschäft in der nahe gelegenen Stadt ein.«
Wie gebannt hörte Molly zu.
»Wir lebten in einer kleinen Wohnung. Wir waren keine glückliche Familie. Für Mutter muss es schrecklich gewesen sein. Vater war nicht direkt unfreundlich zu ihr, das heißt, er war es erst zum Schluss, aber er interessierte sich für nichts anderes als für seine Arbeit. Von seinen beiden Partnern starb der eine nach ein oder zwei Jahren, und den anderen kaufte er aus. Aber damit war er nicht zufrieden. Er gründete eine kleine Fabrik, in der er Motoren herstellte, die er größtenteils selbst erfunden hatte, und sie verkauften sich wie warme Semmeln. Als ich fünf war, zogen wir in ein größeres Haus. Vater hatte noch weniger Zeit als früher, und für Mutter hatte er keinen Pfennig mehr übrig, weil er alles ins Geschäft steckte.« Die Erinnerung ließ ihre Augen matt glänzen.
»Da Mutter gar kein Vergnügen und keine Bekannten hatte, suchte sie Anschluss in einer Freikirche. Aus irgendeinem Grund war Vater außerordentlich verärgert darüber. Sie stritten sich oft. Da er selbst Agnostiker ist und die christliche Lehre ablehnt, musste ihn das natürlich in Wut bringen.
Schließlich verbot er ihr, in die Kirche zu gehen. Aber sie tat es doch, und an meinem sechsten Geburtstag nahm sie mich mit. Es wurde für uns beide ein unangenehmes Erlebnis. Ich musste mich übergeben, noch ehe ich die Kirche betreten hatte, und Mutter brachte mich wieder nach Hause. Dieses peinliche Geschehen wiederholte sich noch zweimal. Warum Kirchen und Kapellen eine solche Wirkung auf mich haben, weiß ich nicht. Kein Arzt konnte eine Erklärung finden. Deshalb wurde ich immer vom Gottesdienst befreit. Noch heute kann ich keinen Blick in eine Kirche werfen, ohne Brechreiz zu bekommen.«
Sie lächelte verwirrt.
»In meiner Kinderzeit war Schluss mit den Kirchgängen, weil ich mich Vater gegenüber verplapperte. Er reagierte wie ein Wahnsinniger, warf seinen Teller nach Mutter, sprang auf und jagte sie um den Tisch. Ich rannte schreiend nach oben in mein Zimmer. Eine Zeitlang, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, hörte ich, wie er sie schlug und verfluchte. Sie musste eine Woche im Bett liegen, und danach war sie nie mehr dieselbe Frau wie früher. Immer klagte sie über Schmerzen, und die Hausarbeit fiel ihr ständig schwerer. Ihre Bekannten aus der Gemeinde machten sich Sorgen um sie und besuchten sie, und auch der Pastor kam ein- oder zweimal in der Woche, wenn Vater nicht da war, und las mit ihr in der Bibel.
Einer dieser Besuche war eine Ursache, dass sie im Alter von achtundzwanzig Jahren sterben musste. Vater kam eines Nachmittags unerwartet nach Hause und fand den Pastor vor. Ich war im Kindergarten und habe erst später davon gehört. Vater packte den Geistlichen bei den Schultern und warf ihn aus dem Haus.
Seltsamerweise hatte dieser Angriff auf einen Mann Gottes keine schlimmen Folgen für Vater. Einige Leute zogen sich von ihm zurück, und er musste seinen Plan aufgeben, für den Stadtrat zu kandidieren. Aber seine beruflichen Erfolge wurden nicht geschmälert. Der Pastor hat ihn nicht wegen Körperverletzung angezeigt.«
Sie machte eine Pause und sagte dann leise: »Als Vater am nächsten Morgen aufwachte, lag Mutter tot neben ihm im Bett. Allgemein wurde angenommen, der verzögerte Schock habe sie getötet. Eine Nachbarin allerdings, die ein leeres Röhrchen mit Schlaftabletten fand, behauptete, sie hätte sich selbst umgebracht, um dem Zusammenleben mit Vater zu entrinnen. Falls Vater die Wahrheit kennt, dann ist er der einzige.«
Christina zündete sich eine neue Zigarette an und fuhr fort: »Für einige Zeit sah unsere Nachbarin nach mir. Im Herbst brachte mein Vater dann eine Frau namens Annie ins Haus. Sie war dick und blond und faul, aber gutmütig. Sie versicherte mir, sie hätte sich immer eine kleine Tochter wie mich gewünscht, und mein Leben mit ihr war eine Folge von fröhlichen Spielen und kleinen Überraschungen. Zweifellos war sie gewöhnlich und ziemlich dumm, aber die neun Monate, die sie bei uns war, bedeuten für mich die glücklichste Zeit meines Lebens, und als sie fortging, war ich wochenlang untröstlich.
Vater brach mit ihr, weil er so schnell vorankam. Er kaufte ein neues Haus in der besten Wohngegend, und in diese Umgebung passte Annie nicht mehr. Sie machte keine Szene. Sie hatte mehr Würde als manche gebildetere Frau, die ich kennengelernt habe.
Für mich hatte das neue Haus dadurch allen Glanz verloren. Bald hasste ich es geradezu. Vater ersetzte Annie durch ein Mädchen, das seine Sekretärin gewesen war. Sie machten sich nicht die Mühe, vor mir zu verbergen, dass sie miteinander schliefen. Sie hieß Delia Weddel und stammte aus einer guten Familie, aber wenn ich je eine Hure gesehen habe, dann sie.
Erst ein gesundheitlicher Zusammenbruch rettete mich vor ihr. Der Arzt empfahl Seeluft für meine Gesundheit, und da ich bald acht wurde, sollte ich nach Weihnachten in ein Internat an der See kommen. Delia war nur zu froh, mich loszuwerden.
Als ich Weihnachten das erste Mal nach Hause kam, stellte ich zu meiner Freude fest, dass es mit Delia ein ebensolches Ende genommen hatte wie mit Annie. Vater hatte ein Paar mittleren Alters namens Jutson ins Haus genommen, sie als Köchin und Haushälterin und ihn für die schweren Arbeiten und den Garten. Sie sind heute noch bei uns. Später fand ich heraus, dass Vater sich Wohnungen für seine wechselnden Mätressen in London hielt. Ich erfuhr über sie so gut wie nichts.
Die Jutsons sind ehrbare, schwer arbeitende Leute, aber sie ist eine recht mürrische Person. Ich glaube, Vater hat sie immer sehr gut dafür bezahlt, dass sie über seine Angelegenheiten schweigen, denn immer, wenn ich einen der Jutsons fragte, warum Vater so selten zu Hause wäre, erhielt ich die Antwort: »Wer nicht fragt, bekommt auch keine Lügen zu hören.«
Nach dem Internat schickte mich Vater auf eine Haushaltsschule in Somerset. Dort blieb ich weitere zweieinhalb Jahre.
Ich war ganz zufrieden, aber kurz vor meinem achtzehnten Geburtstag schrieb der Schulleiter meinem Vater, da ich nun alle Kurse mitgemacht und alle Examina abgelegt hätte, könnte er mich nicht länger behalten. Vater steckte mich in ein Pensionat in Paris, und dort blieb ich bis zum Dezember vergangenen Jahres.«
Wieder steckte Christina sich eine Zigarette an und setzte hinzu: »Ich vergaß zu erwähnen, dass die alte Mrs. Durnsford starb und Vater The Grange kaufte...«
Betroffen hielt sie inne. »Verdammt, jetzt habe ich eine Sache ausgeplaudert, die ich Ihnen nicht sagen wollte.«
Molly lächelte. »Machen Sie sich keine Sorgen, mein Liebes. Ich werde keinen Versuch machen, aufgrund dieser Information Ihren Namen herauszufinden, und als Bruch Ihres Versprechens kann man diesen kleinen Ausrutscher nicht bezeichnen.«
»Nein, das wohl nicht«, stimmte Christina zu. »Für mich brachte es keine wesentliche Änderung, dass Vater in seine alte Heimat zurückkehrte. Die Jutsons wohnen jetzt in der Wohnung über der Garage, wo ich geboren bin. Anderes Personal hat Vater nicht im Haus, und er verkehrt mit niemandem - außer dem alten Kanonikus Copely-Syles.«
Etwas ungeschickt endete Christina: »Und das ist alles.«
»Ach, Sie armes Kind! Doch erzählen Sie mir von diesem Kanonikus.«
»Ich kenne ihn schon seit meiner frühesten Kindheit. Er wohnt nur eine Meile von uns entfernt auf dem Weg ins Dorf, in der Priorei. Auch als wir in... in der Stadt lebten, besuchte er uns von Zeit zu Zeit.«
»Es kommt mir recht merkwürdig vor, dass Ihr Vater mit seinem Vorurteil gegen die Kirche einen Kanonikus zum einzigen Freund hat.«
»Kanonikus Copely-Syles übt kein kirchliches Amt aus, und ich vermute, er hat Vater zu seinem beruflichen Start verholfen. Sie kannten sich schon zu der Zeit, als Vater noch Chauffeur bei Mrs. Durnsford war. Es kann zum Teil meinetwegen gewesen sein, dass der Kanonikus immer dann zu uns kam, wenn ich für ein paar Tage zu Hause war. Er ist nämlich mein Pate.«
»Wissen Sie etwas darüber, was Ihr Vater für Pläne mit Ihnen hat, wenn der Monat, für den die Villa gemietet ist, vorbei ist?«
»Ja und nein. Das gehört mit zu den Dingen, die mich beunruhigen. Er sagte, wenn alles gut gehe, würde er kommen und mich abholen. Käme er nicht, solle ich nach England zurückkehren und mich an das Hauptbüro der National Provincial Bank in London wenden. Er habe für mich so gut vorgesorgt, dass ich, ohne arbeiten zu müssen, mein ganzes Leben lang ein ausreichendes Einkommen haben werde.«
»Großer Gott!«, rief Molly aus. »Daraus kann man doch nur schließen, dass Sie beide von dieser Gefahr bedroht werden und dass es sich um etwas Schlimmeres handelt als Erpressung oder das Risiko einer Gefängnisstrafe.«
Christina nickte. »Ja, und mir schaudert bei dem Gedanken, dass er jetzt vielleicht schon tot ist und dass auch ich, wenn man mich findet, noch vor Ende dieses Monats sterben muss.«
Molly versuchte, sie zu beruhigen. »Mein liebes Kind, so etwas dürfen Sie nicht denken. Leider muss ich gestehen, dass ich trotz allem, was Sie mir erzählt haben, noch immer nicht weiß, welche Gefahr Ihnen droht.«
Eine Viertelstunde lang stellten sie alle möglichen Vermutungen an. Als Molly sich erhob und Abschied nehmen wollte, meinte Christina: »Sie sind so freundlich zu mir gewesen, Mrs. Fountain. Für mich bedeutet es schon eine große Erleichterung, dass ich mich einmal aussprechen durfte.«
Molly gab ihr, auf Zehenspitzen stehend, einen Kuss. »Das freut mich sehr, und, nicht wahr, Sie kommen zu mir herüber, wann immer Sie möchten? Wenn wir uns in der Zwischenzeit nicht sehen, erwarte ich Sie morgen zum Lunch. Aber wenn Sie auch nur den geringsten Anlass haben, sich zu fürchten, zögern Sie nicht, mich sofort aufzusuchen.«
Zusammen traten sie hinaus in den Sonnenschein und kletterten den steilen Gartenweg hinab. Auf halbem Weg raschelte es im Unterholz, und ein freudiges Bellen erscholl.
»Das ist Fido, mein Cockerspaniel«, erklärte Molly. »Der böse Hund muss mich gesehen haben und durch die Hecke geschlüpft sein.«
Geschickt vermied der Hund die stachligen Kakteen und sprang auf seine Herrin zu. Als er in Christinas Nähe kam, blieb er plötzlich stocksteif stehen. Seine Nackenhaare sträubten sich, Speichel tropfte von seinen Lefzen, und er ließ ein furchtsames Winseln hören.
»Was kann denn nur mit ihm los sein?«, rief Molly erstaunt. »So etwas habe ich bei ihm noch nie erlebt!«
»Ich kann nichts dafür«, sagte Christina mit kläglichem Gesicht. »Aber alle Tiere schrecken vom ersten Augenblick an vor mir zurück.«
4.
Es war der erste März, und an diesem Morgen war John Fountain, Mollys Sohn, eingetroffen. Er war dreiundzwanzig Jahre alt und in einer Firma für Innenarchitektur tätig. Gerade hatten er und seine Mutter ihren Lunch beendet, und er lehnte sich mit einem zufriedenen Seufzer zurück.
»Welch ein Vergnügen, wieder einmal französische Küche zu genießen! Aber jetzt erzähl mir mal ein bisschen mehr über das Mädchen von nebenan.«
»Viel mehr ist da wohl nicht zu erzählen, Johnny. Sie fürchtet sich immer noch, tagsüber das Grundstück zu verlassen, doch unlogischerweise macht es ihr nachts nichts aus. Sonntags esse ich der Abwechslung wegen immer in einem Restaurant, und da fragte ich sie, ob sie Lust habe, mit mir ins Reserve nach St. Raphael zu gehen. Sie sagte nein, und dann tauchte sie etwa um halb sieben auf und meinte, ob sie es sich noch anders überlegen dürfe. Natürlich sagte ich ja, und ich bin überzeugt, es hat ihr Freude gemacht.«
»Nimmst du ihr die Geschichte tatsächlich ab?«
»Ja. Sie hat ein so aufrichtiges Gesicht, und ich kann mir auch nicht vorstellen, aus welchem Grund sie mich täuschen sollte. Jeder Verdacht, sie wolle sich Geld von mir leihen oder so etwas, wird hinfällig durch die Tatsache, dass ich mich ihr genähert habe und nicht umgekehrt. Und schließlich beweist die Art, wie ihr der Name ihres Hauses und der der früheren Besitzerin entschlüpfte, dass sie keine geübte Lügnerin ist.«
»Mit einem alten Telefonbuch von Essex wäre es eine Kleinigkeit, das Dorf, aus dem sie stammt, festzustellen. Die Initialen auf dem Maniküre-Etui machen es so gut wie sicher, dass ihr wirklicher Name mit einem B beginnt.«
»Es wäre aber nicht recht, wenn wir das täten.«
»Es könnte notwendig werden, wenn die Leute, die hinter ihr her sind, plötzlich auf der Bildfläche erscheinen.«
»Das wollen wir nicht hoffen! Johnny, könntest du ihr, solange du hier bist, nicht ein bisschen von deiner Zeit widmen? In Begleitung eines Mannes wird sie wahrscheinlich weniger Angst haben, tagsüber auszugehen, und ein bisschen Abwechslung würde ihr sehr guttun.«
Johnny grinste. »Zweifellos, aber was ist mit mir? Schließlich bin ich hier auf Urlaub. Glaubst du, dass sie meine Kragenweite ist?«
»Ehrlich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Sie ist praktisch ein neugeborenes Lamm, und wahrscheinlich wird sie dich nur langweilen. Doch sie hat noch so gut wie gar nichts von ihrem Leben gehabt und ist so schrecklich einsam, dass es eine gute Tat wäre, wenn du ihr ab und zu eine oder zwei Stunden schenken würdest.«
»Das riecht doch eine Meile nach Verkuppelungsabsichten!«, lachte John.
»Idiot! Ich versichere dir, an eine ernsthafte Beziehung zwischen dir und diesem jungen Mädchen habe ich überhaupt nicht gedacht. Es ist einfach so, dass sie die Gesellschaft von jungen Menschen nötig hat und...«
»Na gut. Bevor ich mich schlagen lasse...«
Er verstummte, denn auf dem Kiesweg vor der Fenstertür knirschten Schritte. Im nächsten Augenblick fiel ein langer Schatten über das Parkett, und Christina stand auf der Schwelle.
»Ich hoffe, ich störe nicht, Mrs. Fountain«, begann das Mädchen atemlos. »Ich wusste, dass Ihr Sohn heute angekommen ist, und ich habe gewartet, bis ich der Meinung war, jetzt müssten Sie mit dem Lunch fertig sein. Ich muss Sie dringend sprechen.«
»Sie stören gar nicht, Liebes. Treten Sie nur näher«, antwortete Molly. Sie stellte die beiden jungen Leute einander vor. Sie nickten höflich und lächelten. Keiner von beiden streckte die Hand aus. John dachte: »Mein Gott, was für eine Nase! Die Augen sind allerdings bemerkenswert.« Christina hingegen schoss es durch den Kopf. »Er sieht ganz nett aus. Nur schade, dass er einen so vorstehenden Adamsapfel hat.«
»Setzen Sie sich doch.« Molly bot Zigaretten an, und Christina nahm sich eine. John erkundigte sich: »Wie wäre es mit einem Likör?«
»Danke, nein«, gab Christina schnell zurück. »Ich trinke keinen Alkohol.«
»Es wird Ihnen sicher lieber sein, wenn John uns allein lässt«, bemerkte Molly nach einer Pause. »Er hat sich auch so mit Essen vollgestopft, dass er kaum noch die Augen offenhalten kann.«
John seufzte. »So wird man von der eigenen Mutter verjagt!«
Christina warf schnell ein: »Sie haben doch vorgeschlagen, Ihrem Sohn von mir zu erzählen, weil uns die Hilfe eines Mannes von großem Wert sein könnte, und ich habe zugestimmt. Wenn es ihm nichts ausmacht, zu bleiben, kann er von mir gleich hören, welche neue Entwicklung eingetreten ist.«
»Seien Sie überzeugt, dass ich Ihnen gern helfen werde«, versicherte John, und Molly fragte: »Hat der Feind Sie bereits aufgespürt?«
»Nein, aber ein Freund - oder wenigstens ein alter Bekannter. Ich war dermaßen überrascht, als ich ihn durch das Gartentor kommen sah, dass ich einen Augenblick lang glaubte, ich hätte einen Sonnenstich. Es war Kanonikus Copely-Syles.«
»Da er ein guter Freund Ihres Vaters ist, kann es ja sein, dass Ihr Vater ihm anvertraut hat, wo Sie sich versteckt halten.«
»Nein, das ist ja gerade das Seltsame daran. Er hat mich durch reinen Zufall entdeckt. Für ein paar Tage hält er sich in Cannes auf, und heute Vormittag fuhr er nach St. Raphael. Da sah er mich auf meiner Terrasse sitzen. Er bat seinen Freund, der den Wagen fuhr, anzuhalten, und kam zu mir.«
»Daran scheint nichts Beunruhigendes zu sein«, bemerkte John.
»Doch!«, widersprach Christina. »Seine ersten Worte waren nämlich: Mein liebes Kind, was tust du hier in Südfrankreich? Warum bist du nicht in England bei deinem Vater? Ich antwortete: Warum sollte ich das? Er machte ein ganz betroffenes Gesicht. Ja, hat dich denn niemand benachrichtigt, dass er bei einem Autounfall schwer verletzt worden ist? Ich erfuhr es gestern durch einen Brief von einem gemeinsamen Freund. Ich würde dich nie aufregen, wenn es nicht einen triftigen Grund dafür gäbe, aber wie die Dinge stehen, muss ich dir sagen, dass um sein Leben zu fürchten ist!«
Molly, deren Gedanken sich im Rahmen von Thriller-Handlungen bewegten, kombinierte: »Dieser Autounfall könnte von seinen Feinden arrangiert worden sein. So etwas ist schon häufiger geschehen.«
»Ja, möglich ist es. Jedenfalls sagte der Kanonikus, er kehre morgen nach England zurück, und er bot mir an, mich mitzunehmen.«
»Dann wollen Sie uns also verlassen?«
»Nein.« Christina schüttelte den Kopf. »Vater hat mir eingeschärft, ich müsse bleiben, ganz gleich, welche Botschaften man mir überbringe. Auch dann, wenn sie angeblich von ihm stammten.
Ich solle warten, bis er mich persönlich abhole, oder, falls er nicht käme, bis zum zwanzigsten März.«
»Damit wollte er natürlich verhindern, dass Sie Ihren Feinden in die Falle gehen, aber er kann dabei doch unmöglich an den Kanonikus gedacht haben. Haben Sie nicht bei unserm ersten Gespräch erwähnt, er sei Ihr Pate?«
»Ja, nur bedeutet das nicht viel. Er hat mir immer zu meinem Geburtstag ein kleines Geschenk geschickt, und ich habe ihm einen Dankeschön-Brief geschrieben. Näher sind wir uns nie gekommen. Ich habe ihn vielleicht dreißig- oder vierzigmal in meinem Leben gesehen, aber niemals längere Zeit, und immer in Gegenwart meines Vaters, so dass ich mit ihm stets nur höfliche Redensarten gewechselt habe.«
»Trotzdem verbindet ihn eine lebenslängliche Freundschaft mit Ihrem Vater. Daher fürchte ich, mein Liebes, an seinen schlechten Nachrichten kann kaum gezweifelt werden.«
»Der Meinung bin ich eigentlich auch«, seufzte Christina. »Aber ich muss unabsichtlich bei Ihnen einen falschen Eindruck über seine Verbindung mit Vater hervorgerufen haben. Es muss sich zwischen ihnen eher um gemeinsame Interessen als um wirkliche Freundschaft handeln. Vater sagte mir einmal, sollte mich der Kanonikus jemals in die Priorei einladen, dann sollte ich mit einer Ausrede absagen. Damals dachte ich, er fürchte, ich könne religiös werden wie Mutter. Doch auch abgesehen davon bin ich überzeugt, Vater mag ihn im Grunde nicht, und mir geht es ebenso.«
»Ist Ihnen, abgesehen von dieser persönlichen Antipathie, etwas Nachteiliges über ihn bekannt?«
»Nein, absolut nichts. Er wird im Dorf sehr geachtet.«
»Dann ist es also unwahrscheinlich, dass er mit fragwürdigen Vorgängen in Verbindung steht oder sich dazu hergeben würde, Sie auf eine so brutale Art zu täuschen?«
»Das ist wirklich kaum anzunehmen. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich sollte mich lieber an Vaters Anweisungen halten und bleiben, wo ich bin.«
»Was hat der Kanonikus gesagt, als Sie sein Angebot, Sie morgen mit nach England zu nehmen, ablehnten?«, erkundigte sich John.
»Er hat sich viel Mühe gegeben, mich zu überreden, und als es ihm nicht gelang, stellte er mich als gefühllose Tochter hin.«
»Womit haben Sie Ihre Weigerung begründet?«
»Ich sagte, der Freund, der ihm von Vaters Unfall geschrieben habe, müsse die Gefahr übertreiben, denn Wenn meine Rückkehr nach England wirklich nötig sei, hätte Vaters Büro mich bestimmt benachrichtigt. Vorsichtshalber teilte ich dem Kanonikus noch mit, dass ich zurzeit unter dem angenommenen Namen Christina Mordant lebe, und bat ihn, meine Identität niemandem hier unten zu enthüllen. Natürlich machte er ein sehr erstauntes Gesicht, aber er versprach es mir, ohne weiter zu fragen.«
»Kluges Mädchen«, lächelte John. »Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, die Wahrheit über Ihren Vater herauszufinden. Rufen Sie doch einfach zu Hause oder in seiner Fabrik an.«
»Nein, das darf ich nicht. Er hat mir verboten, ihn anzurufen, ganz gleich, was geschehen möge. Außerdem könnte der Anruf zurückverfolgt und damit mein Versteck entdeckt werden.«
Sie diskutierten noch einige Zeit, ergebnislos. Dann machte Molly den Vorschlag: »Johnny und ich wollten heute Abend zum Dinner nach Cannes fahren, und wir würden uns freuen, wenn Sie mitkämen. Wir dachten an das Carlton, aber falls Sie kein Abendkleid mithaben, ist uns ein ruhigeres Restaurant ebenso recht.«
»Das ist riesig nett von Ihnen.« Christina zögerte eine Sekunde. »Aber ich finde, es schickt sich nicht für mich, jetzt, da Vater vielleicht im Sterben liegt.«
»Wie Sie wollen, Liebes. Nur fände ich es besser, Sie gingen mit uns aus, statt zu Hause zu sitzen und über unerfreuliche Möglichkeiten nachzugrübeln. Ich will Sie nicht drängen, aber sollten Sie Ihre Meinung ändern, dann kommen Sie um halb acht herüber.«
Wie am Abend zuvor änderte Christina tatsächlich ihre Meinung und erschien um zwanzig nach sieben für einen Besuch im Carlton angezogen. Als sie aus dem dämmerigen Garten in das hell erleuchtete Zimmer trat, fiel es Molly ebenso wie John schwer, ihr Erstaunen zu verbergen. Sie trug ein langes Kleid aus austernfarbenem Satin. Es war rückenfrei und hatte ein trägerloses Dekolleté, das ihren Hals und ihre Schultern von der besten Seite zeigte. Im Augenblick hatte sie jedoch ein kurzes Cape aus dunklem Skunk darübergeworfen.
Mutter und Sohn hatten sie bisher noch nie anders gesehen als in sehr alltäglichen und ziemlich kindlichen Kleidern. Deshalb wirkte diese Aufmachung umwerfend. Sie sah mehrere Jahre älter und sehr mondän aus, und das wurde unterstrichen durch einen ganz neuen Gesichtsausdruck und ein viel sichereres Auftreten.
Molly dachte: »Möchte wissen, wo sie gelernt hat, sich so anzuziehen? Das muss ja ein tolles Pensionat gewesen sein! Das Parfüm ist sicher von Dior. Dafür ist sie noch zu jung. Ein Jammer, dass sie nicht etwas weniger Exotisches gewählt hat. Ihr Vater mag sie vernachlässigt haben, aber mit Geld muss er sehr großzügig sein.«
Johns Gedanken hätte man ungefähr so in Worte fassen können: »Donnerwetter! Und heute Mittag habe ich sie noch mit der Skelett-Lizzy verglichen, dem größten Mädchen in der sechsten Klasse. Na ja, sie muss auch fast ebenso groß sein wie ich. Aber wenn der Verstand unter diesem braunen Haar ihrem jetzigen Aussehen entspricht, dann kann sie längst nicht so langweilig sein, wie ich befürchtet hatte. Jedenfalls kann keiner, der uns zusammensieht, mich beschuldigen, ich hätte sie aus der Wiege geraubt.«
Er war gerade dabei, Cocktails zu mixen, stellte ein drittes Glas zurecht und fragte: »Kann ich Sie in Versuchung führen?«
»Warum nicht?« erwiderte sie leichthin. »Wenn bei unseren gesellschaftlichen Abenden in Paris Getränke angeboten wurden, durften wir Mädchen nur Sherry nehmen, aber irgendwann muss man ja wohl mit schärferen Sachen anfangen. Sagen Sie es mir rechtzeitig, falls ich einen Schwips bekomme.«
Er lachte. »Da verlassen Sie sich lieber nicht auf mich, sondern auf den zügelnden Einfluss meiner Mama.«
Kurz nach acht waren sie in Cannes. Die Winter-Saison befand sich auf ihrem Höhepunkt, und so war das große Restaurant im Carlton ziemlich überfüllt. Alle Gäste waren in Abendkleidung, und in dem Raum schwirrte es von sämtlichen Sprachen, die diesseits des Eisernen Vorhangs gesprochen werden.
Doch schon während des Dinners wurde Molly klar, dass ihre kleine Party ein Misserfolg wurde. Johnny und Christina hatten keine gemeinsamen Interessen, keine gemeinsamen Bekannten und waren unter völlig verschiedenen Bedingungen aufgewachsen. Dazu kam, dass Johnny sich mittags offenbar überfressen hatte, und die zwei Gläser Champagner, die Christina trank, vermochten nicht, ihr die Zunge zu lösen. Es war schade um den teuren Abend.
Als der Kaffee serviert wurde, kam Molly auf den Gedanken, dass die beiden jungen Leute vielleicht ihre Hemmungen verlieren würden, wenn sie nicht dabei war. An einem Tisch in der Nähe entdeckte sie ein älteres amerikanisches Ehepaar, das sie seit Jahren kannte und das nicht weit von ihrer Villa wohnte. Sie hatte Johnny schon zu Hause einen größeren Betrag in Francs zugesteckt, so dass er bezahlen konnte. Molly schluckte ihre Enttäuschung tapfer hinunter und erklärte:
»Ihr beide wollt doch sicher tanzen, und mir ist heute Abend gar nicht danach, lange aufzubleiben. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen überarbeitet, und das rächt sich nun mit Kopfschmerzen. Bitte entschuldigt, wenn ich euch im Stich lasse. Dort drüben sitzen meine Freunde, die Pilkingtons, die sicher gleich aufbrechen werden. Sie werden mich gern mitnehmen, dann kann ich euch den Wagen dalassen.«
Es tat ihr wohl, dass John protestierte, aber umstimmen ließ sie sich nicht mehr.
Am nächsten Morgen wachte John erst kurz vor elf auf, frühstückte im Bett, trödelte eine Stunde mit Baden und Anziehen herum und kam erst um halb eins nach unten.
»Wie hat sich der gestrige Abend noch entwickelt?« erkundigte Molly sich. »Ich hoffe, mein kleiner Schützling hat dich nicht zu sehr gelangweilt.«
»Gelangweilt?« Er hob in scherzhaftem Erstaunen die Augenbrauen. »Glaub mir, Mumsie, du kannst von Glück sagen, dass du mich heil zurückbekommen hast!«
Molly strich sich lächelnd über das graue Haar. »Du übertreibst mal wieder.«
»Was? Dies Mädchen ist eine menschliche Bombe! Also wirklich, dein neugeborenes Lamm, diese kleine Schwester des Heiligen Soundso, die gerade aus dem Kloster kommt, stellt eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar!«
»Komm, komm, Johnny! Mix dir einen Vermouth-Cassis und mir auch einen, und dann zügele deine Phantasie und erzähl mir, was geschehen ist.«
John begann zu mixen und sprach über die Schulter weg: »Also, wir tanzten zusammen. Die offensichtliche Tatsache, dass sie wenig Erfahrung darin haben kann, mit einem Mann zu tanzen, ist der einzige Beweis für deine Theorie, sie sei gerade erst aus dem Ei gekrochen. Aber ansonsten - Junge, Junge! Sie hat ein gutes Gefühl für den Rhythmus, so dass ich glaube, mit einiger Übung wird sie eine gute Tänzerin werden. Das meine ich jedoch nicht. Sie klammerte sich an mich, als sei ich ihr Lieblingsteddy. Ich hatte schon Angst, sie würde mich mitten auf dem Tanzboden vernaschen. Und ihr Parfüm! Das ist eigens dazu geschaffen, den Geschlechtstrieb zu wecken.«
»Johnny, werde nicht geschmacklos.«
»Spiel nicht die Zimperliche, Mumsie. Jedenfalls, nachdem wir eine Weile getanzt hatten, sagte sie, jetzt würde sie gern einen Brandy versuchen. In der nächsten Stunde kippte sie drei Doppelte, ohne mit der Wimper zu zucken, und dann verlangte sie, ich solle sie ins Casino führen.«
»Das hättest du leicht ablehnen können, weil sie noch keine einundzwanzig ist.«
»Nun ja, ich hatte keine große Lust, aber andererseits war mir alles recht, wenn ich nur nicht weiter mit ihr tanzen musste. Um Viertelvor eins waren wir im Casino. Und was glaubst du, was dann geschah?«
»Woher soll ich das wissen, du Dummkopf!«
»Die anderthalb Stunden, während ich vorsichtig mal hier und mal da kleine Summen setzte, spielte Klein-Christina Bakkarat mit einem Pokergesicht, als sei sie mit den Karten in der Hand geboren worden, und am Ende hatte sie eine halbe Million gewonnen.«
»Johnny, das gibt's doch gar nicht!«
»Doch, Mumsie, doch! Stell dir das vor, fünfhundert Pfund, und das steuerfrei.«
»Es muss Anfängerglück gewesen sein.«
»Sicher, aber der alte Kanonikus stand die ganze Zeit hinter ihrem Stuhl und riet ihr, was sie wann tun sollte.«
»Was! Ihr Pate, Kanonikus Copely-Syles?« Molly fuhr überrascht hoch. »Ihn hast du bisher noch gar nicht erwähnt.«
»Tut mir leid, ich habe die Geschichte ein bisschen gerafft, um die Pointe von ihrem großen Gewinn anbringen zu können. Der Kanonikus war schon da, als wir den Spielsaal betraten, und kam zu uns herüber.«
»Was hältst du von ihm?«
»Er ist ein netter alter Knabe. Eine ziemlich pittoreske Erscheinung. Ganz in schwarzen Satin gekleidet, rosiges Gesicht, lange silberne Locken und sehr freundlich.«
»Ich bin froh, dass er Christina nicht den Abend verdorben hat. Er hätte ihr auch Vorwürfe machen können, weil sie im Casino erschien, nachdem er ihr am Morgen mitgeteilt hatte, ihr Vater sei in Lebensgefahr.«
»Ich glaube, anfangs war er ein bisschen schockiert. Zufällig sah ich sein Gesicht, bevor Christina ihn entdeckte, und er starrte uns irgendwie besorgt oder verärgert an. Doch sobald wir ins Gespräch gekommen waren, ließ er sich nichts mehr davon anmerken, und er erwähnte ihren Vater erst, als wir uns verabschiedeten.«
»Sagte er irgendetwas Neues?«
»Nein, er stellte uns nur einem Freund vor, der an einem anderen Tisch spielte. Dabei bemerkte er, falls sie ihre Meinung ändern sollte und kurzfristig einen Flug buchen müsse, könne dieser Herr ihr behilflich sein. Auch er war ein sehr distinguierter alter Knabe, nur zur Abwechslung groß und dünn. Mit einem roten Band quer über der Hemdbrust hätte er in einem Theaterstück als französischer Gesandter auftreten können. Für diese Rolle brauchte er nicht einmal seinen Namen zu wechseln. Es war der Marquis de Grasse.«
Molly ließ beinahe ihr Glas fallen. Der Mund blieb ihr offenstehen. Dann rief sie voller Bestürzung: »Oh, Johnny! Was mag nur hinter dieser ganzen Sache stecken? De Grasse ist einer der berüchtigtsten Männer in ganz Frankreich.«
5.
Nach einer Weile fragte John: »Ich vermute, du bist mit dem Marquis aneinandergeraten, als du Molly Polloffski, die schöne Spionin, spieltest?«
»Johnny, ich habe dir schon hundertmal gesagt, ich habe während des Krieges ganz normale Büroarbeit verrichtet. De Grasse bin ich nie begegnet. Aber ich habe eine Menge über ihn gehört.«
»Ein Bursche dieses Namens war mit mir zusammen in Cambridge. Ich kannte ihn nicht näher, und am Ende meines ersten Jahres ging er nach Frankreich zurück.«
Molly nickte. »Das muss sein Sohn Comte Jules de Grasse gewesen sein. Der Vater war nie zu fassen. Im Krieg wechselte er von einem Lager zum anderen, und als die Franzosen die Kollaborateure vor Gericht stellten, kam er nur wegen der Tatsache, dass er seinen Sohn 1940 nach England zur Schule geschickt hatte, um eine lange Gefängnisstrafe herum. Er warf mit Bestechungsgeldern nur so um sich, und letzten Endes ging er als freier Mann davon.«
»Woher stammt sein vieles Geld?«
»Nach außen hin ist er ein respektabler Reeder, doch er benutzt seine Schiffe für Schmuggelgeschäfte. Vor dem Krieg war er spezialisiert auf Drogen und Mädchenhandel, und neuerdings soll er Waffen in den Nahen Osten liefern.«
»Woher weißt du das, Mumsie?«
Molly errötete leicht. »Ach, manchmal schauen alte Kollegen bei mir herein, und dann reden wir über dies und jenes.«
John lachte. »Immer im Dienst, was? Ich habe schon lange den Verdacht, dass du deinen alten Kollegen Tips gibst, falls du hier unten über etwas stolperst, was in ihr Ressort fällt.«
»Johnny, du hast nur Flausen im Kopf! Die Dienststelle, für die ich gearbeitet habe, ist gleich nach Kriegsende aufgelöst worden.«
»Das mag sein, aber es gibt noch andere, zum Beispiel die deines Freundes Conky Bill. Der steckt seine große Nase doch in alle möglichen Angelegenheiten.«
»Und wenn du nicht aufhörst, deine Nase in anderer Leute Angelegenheiten zu stecken, wird sie dir eines Tages abgeschnitten werden.«
»Touché!«, grinste John. »Kehren wir zurück zu dem bösen Marquis. Was weißt du sonst noch über ihn?«
»Sein Hauptquartier war immer St. Tropez.«
»Dort wohnt er im Augenblick auch. Er und seine Frau haben ständig eine Suite im Capricorn, du weißt doch, das ist das große, moderne Hotel hoch über der Bucht. Als er hörte, Christina sei noch nie in St. Tropez gewesen, meinte er, seine Frau und er seien entzückt, junge Leute zu Gast zu haben. Er werde ihr heute einen Wagen schicken, damit sie mit ihnen den Lunch nehmen könne.«
Mollys Glas klirrte, als sie es heftig auf den Tisch stellte. »Um Gottes willen, sie hat doch abgelehnt?«
»Nein, sie hat zugesagt. Anscheinend lehnt sie nur tagsüber Einladungen ab. Natürlich kann sie heute Morgen ihre Meinung geändert haben.«
»Ich fürchte, sie ist schon fort, denn ich habe sie nicht auf ihrer Terrasse gesehen. Oh, Johnny, lauf schnell hinüber und sieh nach.«
Nach sieben oder acht Minuten kam John schnaufend zurück. Er breitete die Hände aus. »Keine Spur von ihr, Mumsie. Soviel ich aus der alten Katalonierin, die sie bedient, herausbekommen konnte, wurde sie um zwölf von einem Herrn abgeholt, der Jules de Grasse gewesen sein muss. Sie wird tatsächlich ihre Meinung geändert haben, denn sie war nicht zum Ausgehen angezogen, und sie hatten so etwas wie einen Streit miteinander, bis sie zum Umziehen nach oben ging.«
Molly stand auf und nahm sich eine Zigarette. »Hoffentlich passiert ihr nichts! Diese neue Entwicklung gefällt mir gar nicht. Wenn wir sie nur aus den Klauen dieser Menschen befreien könnten!«
John zuckte die Schultern. »Wir können uns kaum mit Waffen aus deinem Privatmuseum ausrüsten und bei den de Grasses als Rollkommando aufkreuzen. Sie ist bei hellem Tageslicht aus eigenem freiem Willen mitgegangen. Uns bleibt nichts weiter übrig, als zu warten, ob sie heil zurückkommt, oder, wenn das nicht der Fall ist, die Polizei zu rufen.«
Stunden später läutete das Telefon. John ging an den Apparat. Es war Christina. Atemlos teilte sie ihm mit: »Ich war zum Lunch bei den de Grasses, und ich bin immer noch bei ihnen. Wir sind gerade eben ins Hotel zurückgekommen, und ich rufe aus der Zelle in der Garderobe an. Aber in einer Minute werden wir in ihre private Suite gehen. Sie haben mir das Versprechen abgenommen, zum Dinner mit ihnen auf ihre Yacht zu gehen. Ich will aber nicht. Können Sie... können Sie nicht unter irgendeinem Vorwand herkommen und... und mich hier herausholen? Ach bitte, bitte!«
»Okay«, antwortete John sofort. »In einer Dreiviertelstunde sind wir da. Bleiben Sie, wo Sie sind, lassen Sie sich auf keinen Fall dazu überreden, das Hotel zu verlassen. Und halten Sie die Ohren steif.«
John fühlte sich längst nicht so sicher, wie er gesprochen hatte. Auch Molly verriet ihre Besorgnis mit den Worten: »Wenn die de Grasses sie erst einmal auf ihrer Yacht haben, werden wir sie vielleicht nie mehr Wiedersehen:«
John nickte düster. »Sieht so aus, als sei der Marquis immer noch im Mädchenhandel tätig. Wenn wir nicht schnell handeln, landet das arme Ding womöglich in Port Said oder in Buenos Aires.«
»Das ist möglich, wenn sie nichts anderes im Sinn haben. Aber ich bin sicher, dass der Kanonikus dahintersteckt. Er will sie vielleicht zwingen, etwas Bestimmtes für seine eigenen dunklen Zwecke zu tun.«
»Ich will verdammt sein, wenn ich das zulasse!«, entfuhr es John.
Seine Mutter sah ihn verwundert an. »Also magst du sie doch?«
Er zuckte grinsend die Schultern.
»Hol' du den Wagen«, befahl Molly. »Ich muss eben noch einmal nach oben.«
Fünf Minuten später trat sie mit einer großen Krokodilledertasche auf die Straße. »Du hast doch nicht das ganze Arsenal mitgenommen?«, fragte John argwöhnisch.
Molly stieg ein. »Meine kleine Automatik«, gab sie zögernd zu.
John lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. »Bevor ich auch nur einen Meter fahre, musst du mir versprechen, dass du nicht herumballern wirst. Sonst landen nämlich wir im Gefängnis, und nicht die de Grasses.«
»Nun gut, ich verspreche es«, seufzte Molly. »Aber das ist doch ein bisschen hart. Wieder entgeht mir die Chance herauszufinden, was für ein Gefühl das ist, wenn man jemanden mit einer Pistole in Schach hält.«
»Versuch' das bei einer Gelegenheit, wo ich nicht dabei bin«, riet er.
Unterwegs legten sie sich ihren Plan zurecht. Im Hotel angekommen, fragten sie nicht erst beim Empfang nach dem Marquis, sondern gingen geradenwegs zum Lift und nannten dem Boy die Suite der de Grasses. Im obersten Stockwerk stiegen sie aus. Der Boy bezeichnete ihnen eine Tür am Ende des Ganges. John läutete.
Einen Augenblick später öffnete Comte Jules die Tür. Er war ein kleiner, aber athletisch gebauter junger Mann Mitte Zwanzig mit schlanken Hüften, breiten Schultern und einem runden Gesicht. Seine Augen waren sehr dunkel und seine Lippen etwas aufgeworfen. Die leicht nach oben gebogenen Mundwinkel verliehen ihm ein fröhliches, gutmütiges Aussehen.
Ein paar Sekunden lang betrachtete er seine Besucher verständnislos. Dann rief er: »Nein, so etwas! Wenn das nicht John Fountain ist!«
»Zufällig habe ich gestern deinen Vater im Casino getroffen«, erklärte John, »und da erfuhr ich, dass du hier bist. Meine Mutter und ich haben heute Nachmittag Freunde in St. Tropez besucht.
Plötzlich kam mir der Einfall, ich könnte dir guten Tag sagen, bevor wir zum Dinner in unsere kleine Villa zurückfahren.«
»Wie nett! Ich bin entzückt.« Comte Jules Stimme verriet nichts als ehrliches Vergnügen.
»Du wirst meine Mutter noch nicht kennengelernt haben«, sagte John.
»Enchanté, Madame.« Comte Jules ergriff Mollys Hand, als sei diese aus zerbrechlichem Porzellan, und führte sie in die Nähe seiner Lippen, ohne sie jedoch zu küssen. »Verzeihen Sie, dass ich Sie im Flur stehenließ. Bitte, treten Sie ein. Wir freuen uns so, Sie zu sehen.«
Als Jules die Tür zum Salon öffnete, bemerkte John, dass Christina mit ängstlicher Erwartung in ihre Richtung starrte. Molly überspielte diese Dummheit sofort, indem sie rief: »Nein, so etwas, da ist ja Christina!«
»Sie kennen sich?«, fragte Jules.
»Ja, natürlich, wir sind doch Nachbarn«, gab Molly unbefangen zurück.
Eine Frau, die auf den ersten Blick ziemlich jung aussah, erhob sich von einem Sofa. Jules wandte sich ihr zu.
»Belle mère, darf ich dir Mrs. Fountain und ihren Sohn John, der mit mir in Cambridge war, vorstellen? - Meine Stiefmutter, die Marquise de Grasse.«
Die Gesellschaft trank gerade Cocktails, und Jules mischte schnell neue für Molly und John. Christina erklärte: »Madame la Marquise und Comte Jules sind reizend zu mir gewesen. Sie bestanden darauf, dass ich auch den Nachmittag mit ihnen verbringe. Comte Jules hat mich zum alten Fort und rund um den Hafen gefahren, und nun haben sie mich noch zum Dinner auf ihrer Yacht eingeladen.«
»Ich wünschte, ich wäre noch so jung wie Sie«, erwiderte Molly lächelnd. »Wenn ich bis in die frühen Morgenstunden auf gewesen wäre, würden mir jetzt die Augen zufallen.«
Christina fing den Ball geschickt auf. »Das ist ja das Problem! Ich bin nicht daran gewöhnt, abends auszugehen, und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber mir wäre es wirklich lieber, ich könnte nach Hause gehen.«
»Nein, nein«, protestierte Jules. »Ein oder zwei Tabletten werden Ihre Kopfschmerzen verjagen, und da wir erst um neun speisen werden, können Sie sich gern noch eine Stunde hinlegen, bevor wir aufbrechen. Belle mère wird es Ihnen in unserm Gästezimmer gemütlich machen.«
»Nein, danke, das möchte ich lieber nicht.«
Comte Jules zuckte die Schultern. »Unsere Freunde wollen sicher nicht gleich wieder gehen. Warten wir ab, wie Sie sich ein wenig später fühlen.« Zu John gewandt, setzte er hinzu: »Heute Abend wird in Le Lavendou ein Feuerwerk veranstaltet, und wir wollen mit der Yacht um das Kap fahren, damit wir es uns ansehen können. Ich würde dich und deine Mutter zu gern auch einladen. Nur ist leider der Speiseraum auf unserem Schiff ziemlich klein, und unsere Gesellschaft ist schon vollzählig.«
Darauf ließ er das Thema fallen und begann, mit John über gemeinsame Bekannte in Cambridge zu sprechen.
Draußen wurde es schnell dunkel. Während der nächsten Viertelstunde bemerkte Molly an Christina eine deutliche Änderung. Sie wurde lebhafter, plauderte und lachte, und als Comte Jules die Lampen einschaltete und die Vorhänge zuzog, bemerkte sie, sie könne es kaum noch erwarten, noch einmal ihr Glück am Spieltisch zu versuchen. )
Molly, die in diesem Stimmungsumschwung Gefahr witterte, sagte zu ihr: »John hatte die Absicht, morgen Abend wieder mit Ihnen nach Cannes zu fahren. Aber dann müssen Sie sich heute Nacht ausschlafen. Comte Jules wird Ihnen sicher verzeihen und Sie ein anderes Mal auf die Yacht einladen. Am besten brechen wir jetzt gleich auf.«
»Oh, nein, jetzt noch nicht!«, rief Jules. »Sie sind kaum zwanzig Minuten hier, und Christina sieht schon wieder besser aus. Ich bin überzeugt, sie wird ihr Versprechen halten und doch noch mit uns kommen.«
»Wie spät wird es werden?«, wollte Christina wissen.
»Es braucht nicht spät zu werden. Wir setzen uns zum Dinner, sobald die Yacht den Hafen verlässt. Das Feuerwerk fängt um zehn an, und es dauert nur eine halbe Stunde. Eigentlich hätten wir dann noch ein Weilchen tanzen wollen, aber wenn Sie es wünschen, können wir danach nach Hause fahren, so dass Sie kurz nach Mitternacht im Bett wären.«
»Ja, wenn das so ist...« Christina zögerte. Mit einer für sie ungewöhnlichen Forschheit verlangte sie: »Geben Sie mir noch einen Cocktail. Ich werde meinen Entschluss fassen, bis ich ihn ausgetrunken habe.«
»Selbstverständlich!« Jules sprang auf. Es überraschte John, dass seine Mutter rief: »Mir auch einen, bitte.« Zu seinem Entsetzen öffnete sie ihre große Krokodilledertasche. Aber sie nahm nur eine Puderdose heraus.
Als Jules die Gläser gefüllt hatte, machte Molly John auf eine ganz moderne Anordnung von Bücherregalen am anderen Ende des Raums aufmerksam. Auch die Marquise zeigte Interesse für innenarchitektonische Fragen, und ein paar Minuten lang diskutierten sie über das Thema.
Dann warf John zufällig einen Blick auf Christina. Ihr Gesicht war leichenblass geworden. Auf seine Frage hin gestand sie, dass ihr gar nicht gut wäre.
»Armes Kleines«, sagte die Marquise. »Möchten Sie gern ins Badezimmer? Kommen Sie, ich bringe Sie hin.«
»Nein«, murmelte Christina, »mir ist nicht übel. Ich fühle mich nur benommen.« Sie wies auf ihr Glas. »Dieser letzte Cocktail muss zu viel für mich gewesen sein.«
»Ein Schluck zu viel, wenn man übermüdet ist, hat oft diese Wirkung«, ließ John sich hören. »Aber damit ist die Frage entschieden. Sie muss mit uns nach Hause fahren. Je eher, desto besser.«
»Nein!« Jules' Stimme hatte einen scharfen Ton angenommen. »Sie wird hierbleiben, bis sie sich wieder erholt hat. Belle mère, könntest du die Güte haben, sie mit in dein Zimmer zu nehmen und dich um sie zu kümmern?«
»Ich fürchte, das ist keine gute Idee«, erhob John Einspruch. »In ein paar Stunden wird es ihr noch schlechter gehen. Und dann fällt dir die wenig beneidenswerte Aufgabe zu, sie in diesem Zustand nach Hause zu bringen.«
Johns Worte wurden dadurch bekräftigt, dass Christinas Kopf trotz aller Bemühungen, ihn aufrechtzuhalten, nach vorn kippte. Dennoch gab Jules kalt zurück:
»Für mich ist es eine Ehrensache, einen Gast, der sich nicht wohl fühlt, nach Hause zu fahren.«
»Das glaube ich dir ja. Aber hast du auch bedacht, dass jemand bei ihr bleiben muss und du deine Stiefmutter auf diese Weise um die Party bringst?«
»Die Zofe meiner Stiefmutter kann für Christina sorgen.«
»Nein«, mischte sich Molly ein. »Christina kommt mit uns. Wie peinlich muss es für sie sein, wenn sie sich, nachdem sie zu viel getrunken hat, in einem fremden Bett und unter Menschen, die sie kaum kennt, wiederfindet! Ich werde sie in ihre eigene Villa bringen.«
»Madame!«, brauste Jules auf. »Ich lasse mich nicht auf diese Weise kommandieren. In ihrem Zustand kann sie nirgendwohin gebracht werden. Sie bleibt über Nacht hier, und ich werde einen Arzt für sie' rufen.«
»Tut mir leid«, warf John ein. »Meine Mutter kennt sie schon geraume Zeit und ist mehr oder minder für sie verantwortlich. Daher wird das getan, was meine Mutter anordnet.«