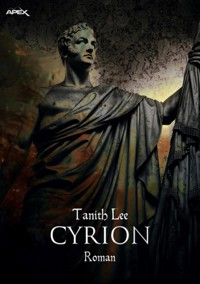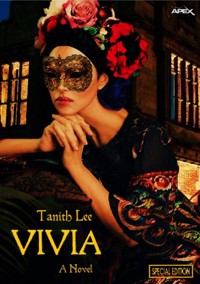6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Er ist Parl Dro, der Exorzist. Mit seinen Liedern und Zaubersprüchen tötet er all jene Kreaturen der Nacht, die aus den Gräbern zurückkehren, um die Menschen heimzusuchen. In den dunklen, halbvergessenen Ländern am Ende der Welt jagt er Geister und Dämonen. Bis er schließlich zwei Schwestern begegnet, die gegen seinen Zauber immun sind...
Der Roman Das Lied des Exorzisten – erstmals im Jahr 1980 veröffentlicht – aus der Feder der englischen Bestseller-Autorin Tanith Lee (* 19. September 1947 in London; † 24. Mai 2015 in East Sussex) gilt als Meisterwerk der Unheimlichen Fantasy.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
TANITH LEE
Das Lied des Exorzisten
Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
DAS LIED DES EXORZISTEN
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
Er ist Parl Dro, der Exorzist. Mit seinen Liedern und Zaubersprüchen tötet er all jene Kreaturen der Nacht, die aus den Gräbern zurückkehren, um die Menschen heimzusuchen. In den dunklen, halbvergessenen Ländern am Ende der Welt jagt er Geister und Dämonen. Bis er schließlich zwei Schwestern begegnet, die gegen seinen Zauber immun sind...
Der Roman Das Lied des Exorzisten – erstmals im Jahr 1980 veröffentlicht – aus der Feder der englischen Bestseller-Autorin Tanith Lee (* 19. September 1947 in London; † 24. Mai 2015 in East Sussex) gilt als Meisterwerk der Unheimlichen Fantasy.
DAS LIED DES EXORZISTEN
Erstes Kapitel
»Cilny – wir sind in Gefahr!«
Die Schatten antworteten nicht.
Der einzige Weg, der vom Berg herabführte, war eine steile, gewundene, stahlblaue Straße. Etwa zehn Meilen unterhalb der Passhöhe schien sich diese Straße nur widerwillig dem Tiefland einzugliedern und bog gleich wieder zu einem Hochtal ab, wo Bäume und die Häuser eines Dorfes sich nebeneinander erhoben. Eine halbe Meile vor dem Dorf führte die Straße an einem seltsam windschiefen Haus vorbei.
Auch bei diesem Haus wuchsen Bäume. Auf der Suche nach dem Wasserlauf, der auch den steinernen Brunnen innerhalb der eisernen Umfriedung speiste, hatten sich ihre Wurzeln unter das Fundament geschoben und das Haus allmählich an einer Seite angehoben. An den Mauern zeigten sich bizarre Risse, in denen sich dunkelgrüne Kletterpflanzen festgesetzt hatten. Das Haus selbst besaß an der nördlichen Seite einen starken, wehrhaften Auswuchs: einen dreistöckigen, steinernen Turm.
Der Turm schien ursprünglich für Verteidigungszwecke gebaut worden zu sein. Seine drei schmalen Fenster blickten nordwärts über die rauchigen Baumwipfel hinweg auf die Berge.
Die Sonne war untergegangen. Um diese Stunde schienen die Berge genau die gleiche zwielichtige Farbe wie der Himmel hinter ihnen anzunehmen, als bestünden sie aus einem schwärzlichen, trüben Glas. Andere, weiter entfernte Hügel traten dagegen bescheiden, in den Hintergrund zurück. Sie verschwammen zu schemenhaften, schwarzbraunen Pinselstrichen am Horizont.
Vom höchsten Fenster des Turmes aus konnte man die Bergstraße deutlich erkennen, selbst in der Dämmerung. Und noch klarer zeichnete sie sich ab, nachdem die Sterne am Firmament als gleißende, diamantene Lichtpunkte aufgeflammt waren und ein fahler Viertelmond im Osten aufstieg.
Eine Gestalt kam vom Pass her die Straße herab. Sie war in einen schwarzen Kapuzenmantel gehüllt, doch die gesamte Erscheinung und die Art des Ganges ließen darauf schließen, dass sie männlichen Geschlechts war. Sie ließen aber ebenso darauf schließen, dass die Gestalt hinkte. Bei jedem Schritt – denn gerade Schritte waren es immerhin noch – zeigte sich eine merkliche Verzögerung an der linken Seite.
Als der hinkende Mann in dem schwarzen Mantel drunten auf der Straße nur noch etwa siebzig Schritte von dem Haus entfernt war, wich das Mädchen am Turmfenster rasch in den Raum zurück. Es wandte sich den Schatten zu und wiederholte die geflüsterte Bemerkung mit kaum unterdrückter Verzweiflung.
»Cilny – wir sind in Gefahr! In schrecklicher Gefahr! Kannst du mich hören? Bist du da? Oh, Cilny, antworte mir.«
Diesmal kam eine Erwiderung. Die Schatten, die in einer tiefen Ecke des Turmes gekauert hatten, schienen sich zu teilen. Eine Gestalt löste sich von ihnen, so fahl wie der Viertelmond.
»Ich bin hier«, sagte eine Stimme, ein Wispern nur, leiser noch als das Wispern eines Blattes an einem der Bäume draußen. »Was ist?«
»Liebste Cilny, meine einzige und beste Schwester«, sagte das Mädchen, das aus dem Fenster geblickt hatte. »Ein Mann geht die Straße entlang. Er hinkt auf dem linken Bein, und er ist schwarz gekleidet. Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube ihn zu kennen.«
Der fahle Mondschatten lachte leise, es war nur der Hauch eines Lachens.
»Wann hast du je einen solchen Mann getroffen, Ciddey?«
»Ich habe ihn nicht getroffen, niemals. Und ich hoffe und bete, dass ich ihn auch niemals treffen werde. Aber ich. habe von einem solchen Mann gehört. Alte Berichte.«
»Wie geheimnisvoll! Willst du mir nicht davon erzählen?«
»Wenn es der ist, den ich meine, dann heißt er Parl Dro. Aber er hat noch einen anderen Namen. Gewissermaßen seine Berufsbezeichnung: Geistertöter.«
Der fahle Mondschein, ebenfalls ein Mädchen mit langen Haaren und schlanker Gestalt, wie das andere auch, aber im Gegensatz zu dem anderen von seltsamer Transparenz, wich ein wenig zurück, und die durchsichtigen Hände hoben sich zu dem durchsichtigen Mund.
»Eine solche Person wollen wir hier nicht haben«, ertönte die hauchende Stimme.
»Nein, das wollen wir nicht. Versteck dich also, Cilny. Versteck dich!«
Während Parl Dro die Straße hinabschritt, betrachtete er das Haus mit zwei rabenschwarzen Augen. Er musterte es aufmerksam, da es die Nähe des Dorfes verkündete, das er noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen trachtete. Nicht, dass es für ihn ungewohnt gewesen wäre, auf der nackten Erde zu schlafen. Daran war er ebenso gewöhnt wie an den ständigen stechenden Schmerz seines lahmen Beines. Er kannte diesen Schmerz schon seit Jahren, und mit der Zeit hatte er gelernt, ihn mit Verachtung zu strafen, sich nicht mit ihm aufzuhalten, auch wenn er ihm ständig schmerzhaft bewusst war. Ebenso wenig wollte er sich mit dem Verdruss aufhalten, der nur um weniges hinter ihm lag, denn möglicherweise würde noch mehr Verdruss – nicht mehr weit vor ihm – seiner harren.
Gelegentlich war es geschehen, dass Parl Dro, wenn er humpelnd in ländlichen, abgelegenen Orten auftauchte, irrtümlich für Gevatter Tod gehalten wurde. Hellseher und Kartenleger sagten seine Ankunft oft in der Gestalt des unheilverkündenden Königs des Schwertes voraus. Aber schließlich war der Ruf, der ihm vorauseilte, nicht einmal so unpassend.
Schon seit einer halben Stunde war es ihm, wenn auch nur im Unterbewusstsein, aufgefallen, dass er vom Haus aus beobachtet wurde, aber es hatte ihn nicht gekümmert. Es war nichts Besonderes, dass ein Fremder angestarrt wurde. Als er dann, den Kurven der Straße folgend, vor dem schmiedeeisernen Tor angelangt war, drängte ihn irgendetwas, stehenzubleiben. Vielleicht war es sein ungewöhnlicher siebter Sinn gewesen, der ihn zu dem gemacht hatte, was er war. Vielleicht aber war es auch nur der wesentlich gewöhnlichere und weniger geheimnisvolle sechste Sinn, diese innere Antenne, die auf die lautlose menschliche Aura, auf Unheil oder Mysterien ansprach. Er war sich nicht sicher. Das Haus selbst, schief und überwachsen in der Hülle der Nacht, wirkte in seiner bizarren Form so düstere Geheimnisse beschwörend, dass er geneigt war, seine plötzliche Erkenntnis als bloße Einbildung abzutun. Aber Dro war kein Mann, der irgendeinen Vorgang zu leicht zur Seite schob, selbst wenn es seine eigene Einbildung war.
Er öffnete das Eisentor und betrat den gepflasterten Hof.
Ein toter Feigenbaum reckte seine Zweige über den Brunnen. Eifersüchtig auf die Nähe der Quelle, hatten ihm die anderen Bäume das Leben ausgesaugt. Es hatte tatsächlich den Anschein, als wäre es in böser Absicht geschehen. Die Haustür, tief in einen steinernen Vorbau eingelassen, bestand aus Holz. Sie war alt und sehr verwittert. Er trat an die Tür und klopfte mehrmals.
Während er wartete, wurde das Licht der Sterne am dunklen Nachthimmel immer intensiver, und der gespenstische Mond nahm, wie es Geister auch zu tun pflegen, eine festere Form an und schien erst jetzt Wirklichkeit zu werden.
Ein Käfer krabbelte über den Efeu, der sich an der Mauer emporrankte.
Niemand antwortete auf das Klopfen, obwohl gewiss jemand da war. Das ganze Haus schien zu lauschen und den Atem anzuhalten. Es blickte auf ihn herab. Möglicherweise scheuten sich die Bewohner des Hauses, nach Sonnenuntergang einem unbekannten Reisenden die Tür zu öffnen.
Es gehörte nicht zu Dros Methoden, Unschuldige unnötigerweise zu quälen, obwohl er natürlich auch dazu durchaus fähig war, wenn es die Umstände erforderten. Er trat von der Tür zurück.
Der Hof war nun mit dunklen Schatten verhangen. Doch der Sternenglanz stahl sich durch die Zweige der Bäume und spiegelte sich im Wasser des Brunnens.
...da war etwas bei dem Brunnen. Irgendetwas.
Parl Dro ging quer über den Hof auf den Brunnen zu. Er spähte über den Rand und erblickte seine eigene gesichtslose Silhouette, die sich vor die strahlende Schwärze des Himmels schob. Eine rostige Kette führte hinunter bis zum Wasser. Er ließ sich von einem Impuls leiten und begann die Kette mit der Winde aufzuziehen. Die Kette war am anderen Ende durch einen Eimer beschwert, und die Winde zerstörte die nächtliche Ruhe mit heiserem Quietschen. Sein siebter Sinn war jetzt aufs äußerste geschärft. Der Eimer schwang über den Rand des Brunnens, und im gleichen Augenblick öffnete sich knarrend die Haustür.
Es hatte keinerlei Vorwarnung gegeben, keine Bewegung war im Haus von draußen erkennbar gewesen. Eben noch hatte das Dunkel der Nacht unberührt dagelegen, um in der nächsten Sekunde von der sich öffnenden Tür zerstört zu werden. Eine Lampe ergoss ihr fahles Licht auf die Pflastersteine des Hofes.
Dro erhielt den Eindruck von nichts anderem als Blässe, als er das Mädchen dort auf der Schwelle stehen sah, einer Blässe, die ihm sofort den gewohnten Schauer über den Rücken jagte. Aber es war nicht nur allein die Blässe des Gesichts. Es war das ausgebleichte Kleid, das flachsblonde Haar, das in fünf Zöpfen geflochten war, von denen drei über den Rücken hingen und die beiden anderen das Gesicht einrahmten. Das – und die weiße Haut. Weiße Hände! Die Rechte hielt die Laterne aus grünlichem Glas, in der ein kümmerliches Flämmchen flackerte, in der Linken aber blitzte weiß ein blankes Messer...
Dro hatte in der Bewegung innegehalten. Seine Hand lag noch am Griff der Winde. So verharrte er und betrachtete das Mädchen. Er erwartete die schon gewohnte Befragung und Irreführung: Wer bist du? Wie kannst du es wagen? Mein Mann wird gleich hier sein und dir Beine machen. Doch nichts davon kam. Das Mädchen schrie ihn ganz einfach nur mit gellender Stimme an: »Verschwinde! Mach, dass du fortkommst!«
Er ließ ihre Worte eine Weile in der Luft hängen. Dann erwiderte er mit gemessener und klarer Stimme: »Kann ich mir denn nicht vorher noch einen Schluck Wasser aus dem Brunnen nehmen? Ich habe geklopft. Ich dachte, es wäre niemand zu Hause.«
Er besaß eine wunderschöne Stimme und eine blendende Ausdrucksweise, mit denen er die Menschen in seinen Bann zu schlagen verstand, besonders Frauen. Doch bei dieser verfehlten sie ihre Wirkung.
»Verschwinde, habe ich gesagt. Sofort!«
Wieder verharrte er eine Weile, dann ließ er plötzlich den Griff der Winde los. Die Kette spulte sich mit einem Kreischen ab, und der Eimer klatschte ins Wasser. Er hatte es absichtlich getan, um sie zu erschrecken. Und sie erschrak. Sein siebter Sinn war angespannt wie ein Nerv, sträubte sich. Er ging um den Brunnen herum und auf die Tür zu. Er wollte sicher sein, und das bedeutete, dass er alle anderen Erklärungen für ihre Unfreundlichkeit ausschließen musste. Während er sich auf sie zu bewegte, streifte er die Kapuze von seinem Kopf. Sein Gang war anmutig und verriet kaum etwas von seinem Gebrechen. Er befreite seine Hände aus der Umhüllung des Mantels und zeigte sie frei und offen und damit auch, dass er unbewaffnet war.
Parl Dro war ein bemerkenswert aussehender Mann. Vielleicht sah er nicht mehr so jung aus wie vor zehn Jahren, aber seine außergewöhnliche Schönheit hatte sich wie ein samtener, sanfter Hauch über seine schroffen Gesichtszüge gebreitet und ihnen einen eigentümlichen Reiz und Zauber verliehen. Lippen und
Nase, Backenknochen und Kiefern formten ein Profil, wie es die Bildnisse legendärer Kaiser auf alten Münzen zeigten. Seine Augen besaßen die gleiche unglaublich undurchdringliche Schwärze wie sein langes, glattes schwarzes Haar. Charakterlich – sowohl physisch als auch psychisch – lag er etwa zwischen dem erdgebundenen Sternkreiszeichen des Stiers und dem Feuerzeichen der Schlange.
Während er auf das fahle Licht der kleinen Lampe zuschritt, musste die junge Frau dies alles sehen. Auch konnte ihr dieser kalte und zynische Zug um den Mund nicht entgehen, dieser fast verächtliche Zug, der deutlich machte, dass er jede sexuelle Unmäßigkeit ablehnte und daher in dieser Hinsicht keinerlei Bedrohung darstellte. Ebenso wenig konnte ihr die fast unsichtbare und doch exakt gezeichnete Linie zwischen den beiden Augen entgehen – ein Zeichen von Kalkulation, Intelligenz und absoluter Kontrolle über jedes normale Maß hinaus. Nur ein Dummkopf würde diesen Mann für einen Räuber oder Frauenschänder halten. Und die junge Frau schien keineswegs dumm zu sein. Doch sie hatte Angst, und sie verharrte in ihrer drohenden Haltung.
So plötzlich wie sie die Tür geöffnet hatte, so plötzlich stieß sie mit dem Messer zu.
Parl Dro trat zurück, es war der schleppende Schritt eines Hinkenden, aber er war zeitlich genau berechnet, und die Klinge zerschnitt die Luft nur wenige Zentimeter von ihm entfernt. Er war überdurchschnittlich hoch gewachsen, und sie war nicht besonders groß. Sie hatte mit dem Messer so nah wie nur möglich nach seinem Herzen gezielt.
»Willst du jetzt endlich verschwinden?!«, schrie sie mit unverkennbarer Panik in der Stimme. »Du bist hier nicht willkommen!«
»Das merke ich.« Er stand außerhalb ihrer Reichweite und blickte sie unverwandt an.
»Was willst du eigentlich?«, zischte sie schließlich.
»Das sagte ich bereits. Einen Schluck Wasser.«
»Du willst kein Wasser.«
»Wie seltsam. Ich dachte, ich wollte. Vielen Dank, dass du meinen Irrtum korrigierst.«
Sie blinzelte. Ihre langen Wimpern waren fast grau, und ihre Augen hatten eine Farbe wie heiße, trockene Asche – nahezu grün, jedoch nicht ganz.
»Mach keine Wortspielereien mit mir. Geh! Oder ich rufe die Hunde.«
»Du meinst die Hunde, die ich bellen und knurren höre, seit ich durchs Tor trat?«
Daraufhin schleuderte sie das Messer gegen ihn. Es war ein kraftvoller Wurf. Er beobachtete die Bahn des Messers, ließ es auf sich zukommen und wich dann geschickt zur Seite, so dass es nur seinen Ärmel ritzte und dann klappernd neben dem Brunnen auf den Boden fiel. Noch vor wenigen Tagen hatte er es mit weit Schlimmerem zu tun gehabt.
»Zu dumm«, sagte er. »Du solltest mehr üben.«
Er wandte sich um und ließ sie verdutzt stehen. Am Tor blickte er nochmals zurück. Sie hatte sich noch nicht gerührt. Im Moment glaubte sie, ihn losgeworden zu sein. Sie würde einen Schock bekommen, aber jetzt war es noch zu früh dafür.
Ohne das Messer aufzuheben, wich sie ins Haus zurück und schlug die Tür zu. In der Stille hörte er, wie der Riegel vorgeschoben wurde.
Er zog die Kapuze über den Kopf.
Sein Gesicht war grimmig und verschlossen, als er sich wieder hinaus auf die Straße begab und seinen Weg zum Dorf fortsetzte.
Das Dorf war wie viele hundert andere auch. Es gab eine breite Hauptstraße, von der mehrere kleine abzweigten. Die Hauptstraße besaß auch einen Wasserlauf, einen Kanal, natürlich oder künstlich angelegt, der Abwässer mit sich fortschwemmte und in dem seltsame, phosphoreszierende Fische schwammen. Trittsteine waren in bestimmten Abständen über den Wasserlauf gelegt, und in anderen Abständen zweigten Seitenarme, so schmal wie Nadeln, zu den einzelnen Häusern ab. Die meisten Gebäude an der Hauptstraße beherbergten Geschäfte, deren offene Fronten jetzt zur Nachtzeit mit Gittern verschlossen waren. Die Wohnhäuser besaßen zur Straße hin nur blinde Mauern. Bis auf wenige schmale Schlitze, aus denen goldgelbes Licht hervorsickerte, befanden sich sämtliche Fenster in den rückwärtigen Mauern.
Die drei Gasthäuser hingegen machten mit Licht und Lärm das wett, was dem Dorf, das dumpf und finster inmitten von Getreidefeldern, Obst- und Weingärten kauerte, andererseits mangelte.
An dem ersten Gasthaus ging Dro vorbei. Für seinen Geschmack war es zu laut und zu überfüllt. Das zweite Gasthaus war nur zwei Häuser weiter und schien dem Dorf auch als Bordell zu dienen. Mit Frauen hatte er schon genug Ärger gehabt. Als er vorbeiging, rief ihm ein lockiges Mädchen mit listigen Augen vom offenen Eingang her die seit alters her gebräuchliche Einladung zu. Als er jedoch nicht darauf reagierte, schrie sie ihm unflätige Bemerkungen nach, die seine Männlichkeit betrafen oder eher seinen Mangel daran, was ihn zu einem leichten Lächeln animierte. Das letzte Gasthaus stand an einer Ecke, die von der Hauptstraße und einer Nebenstraße gebildet wurde. Auch hier gab es viel zu viel Lärm und Getriebe, aber immerhin in einem geringeren Maß als in den anderen. Die Schrift auf dem Schild war so gut wie unleserlich, und die Tür war geschlossen, als wollte sie sagen: Nicht jeder ist hier willkommen.
Als Dro die Tür aufstieß, wandten sich ihm alle Gesichter der Anwesenden zu. Ihre Reaktion auf seinen Anblick drückte Unsicherheit und Verstörtheit aus.
Pari Dros Ruf, oder vielmehr seine Schande, pflegte ihm vorauszueilen. Einige der Anwesenden konnten vermutlich seine Identität erahnen. Auch das Mädchen in dem schiefen Haus schien ihn erkannt zu haben. Aber wenn die trinkenden und essenden Leute in diesem Gasthaus tatsächlich erraten hatten, wer sich hier zu ihnen gesellte, so hatten sie wohl weder die Lust noch einen Grund, sich mit ihm anzulegen. Selbst die Sänger, die sich am anderen Ende des Raumes um den Herd mit seinen plumpen Drehspießen scharten, ließen sich nicht aus dem Takt bringen.
Dro ließ die Tür hinter sich zufallen. Er blieb einige Sekunden lang stehen und erlaubte den dreisteren Gaffern, sich an ihm sattzusehen. Dann ging er langsam und kaum hinkend auf einen der langen Tische zu. Als er sich setzte, entrang sich ihm unwillkürlich ein leichter Seufzer bei dem scharfen, stechenden Schmerz, der sein verkrüppeltes Bein durchzuckte.
Die anderen Gäste an dem Tisch bewegten sich unruhig, wie Gras, das von einer Brise berührt wurde. Sie hoben die Augen von den Bechern, aus denen sie tranken, von den Knochen, an denen sie nagten, von den Karten, Würfeln und Rätselblocks, mit denen sie spielten, und warfen sich gegenseitig bedeutungsvolle Blicke zu. Ein älterer Junge in einer Lederschürze kam herbei. Ein Fleischmesser steckte in seinem Gürtel, und in den Händen hielt er einen Krug und einen Becher.
»Was soll’s denn sein?«
»Was gerade da ist.«
»Das ist da«, sagte der Junge. Er stellte den Becher, auf den Tisch und füllte ihn aus dem Krug mit einem stark riechenden Most. »Und das«, fügte er hinzu und deutete auf die Spieße, die Töpfe mit Ragout und auf die heißen Brotlaibe und gebackenen Zwiebeln, die über dem Herd auf einem Regal lagen.
»Vergeude nicht deine Zeit«, sagte einer der Spieler am Tisch. »Er isst nichts.« Er hob eine Karte auf und zeigte sie den anderen. Es war der König des Schwertes. Finster brütend blickte der Monarch mit Kapuze und hoher Krone zwischen den vier schwarzen Punkten hervor. Es war die Karte des Todes. Sie bedeutete Unheil.
»Er meint«, erklärte der Junge, »du würdest wie der Tod aussehen...«
»Ich fühle mich auch so«, sagte Dro. Er warf die Kapuze ab, nahm den Becher auf und leerte ihn. »Ein Drittel eines Laibs«, bestellte er dann, »und ein paar Scheiben von dem Schaf, das ihr da über dem Feuer verbrennen lasst.«
»Wir verbrennen immer die Schafe«, erwiderte der Junge schlagfertig, »um sicherzugehen, dass sie auch tot sind, bevor man sie isst.«
»Ich bin sehr erleichtert zu sehen, dass ihr die gleichen Vorsichtsmaßnahmen offensichtlich auch bei dem Brot trefft.«
Irgendjemand lachte. Ein anderer stellte pantomimisch dar, wie jemand versucht, in ein lebendiges Brot zu beißen. Der Junge füllte nochmals Dros Becher, dann bahnte er sich durch die Sänger einen Weg zum Herd, wobei er in gefährlicher Weise sein Messer schwang. Als der grölende Chor abbrach, vernahm Dro einige Takte perfekter Musik, hell und rein, wie glänzende Fische, die aus einem schlammigen Pfuhl emporstiegen. Die Quelle der Musik schien ein Saiteninstrument zu sein, dem hohe, jubilierende Töne entlockt wurden, doch plötzlich ertönte eine Flöte, deren Töne sich noch höher aufschwangen. Dro neigte den Kopf und wartete auf die nächsten Takte, aber da setzte der grölende Gesang wieder ein, und die Musik ging in ihm unter.
Der Junge war zurück und stellte einen Teller vor ihn hin.
»Stich mit der Gabel rein. Wenn es noch mäh macht, muss ich’s noch mal für eine Weile auf den Spieß stecken.«
Dro stach mit der Gabel in das Schaffleisch, und entlang des ganzen Tisches fingen die Männer an zu blöken.
»Man sollte doch besser den Schäfer holen«, sagte Dro, »bevor sich der Wolf an seine Herde heranmacht.« Er begann langsam zu essen. Eine Weile herrschte Schweigen.
Schließlich sagte jemand: »Du meinst wohl einen lahmen Wolf, was?«
Sein Nachbar stieß ihm den Ellbogen in die Seite. »Sei ruhig, Idiot. Ich erkenne ihn jetzt.«
»Ja«, sagte ein anderer. »Ich auch. Ich dachte, er wäre nur eine Legende.«
Dro ließ sich nicht beim Essen stören. Einer der Männer sagte nun zu ihm: »Wir haben erraten, wer du bist.« Dro lehnte sich zurück und lächelte verhalten.
»Soll ich der letzte sein, der es erfährt?«
Sie rutschten unruhig auf ihren Sitzen hin und her. Den Satz, den jetzt einer von ihnen sagte, hatte Dro in ähnlicher Form schon oft zu hören bekommen.
»Mit so jemandem wie dir will ich nicht an einem Tisch sitzen.«
Aber niemand von ihnen stand auf. Tatsächlich näherten sich noch andere dem Tisch, neugierig, wie von einem finsteren Verbrechen angezogen. Dro aß und trank weiter, langsam und irgendwie isoliert von dem ganzen Tumult, den er verursacht hatte. Er war daran ebenso gewöhnt wie an den nackten Boden oder den Schmerz, der mit ihm wanderte. Gewöhnt daran und hin und wieder auch fähig, zurückzuschlagen.
Die Bemerkungen kamen freundlich, vorsichtig, tändelnd wie plätschernde Wellen.
»Was hältst du selbst von dem, was du tust?«
»Wie kannst du nachts nur schlafen?«
»Er schläft prima. Es gibt genügend, die Grund haben, ihm dankbar zu sein.«
»Und genügend, die ihm keineswegs dankbar sind.«
»Viele, die ihn verfluchen, was, Geisterjäger? Wie viele Flüche begleiten dich auf deiner Wanderschaft? Ist es das, was dich so jung erhält?«
»Du bist durch einen Fluch lahm geworden, nicht wahr?«
»Nein, nicht auf diese Weise. Eines seiner Opfer hat ihm seine Krallen ins Fleisch geschlagen. Seither altert er nicht mehr.«
Im ganzen Raum wurde es plötzlich still, und auch die Sänger und die Musik verstummten. Pro blickte nicht auf. Er wartete auf das Stichwort, das unweigerlich fallen musste. Er beendete seine Mahlzeit und nahm den letzten Schluck aus seinem Becher, da fiel das Stichwort.
»Nun, deine Reise an diesen Ort war vergeblich, Parl Dro. Wir haben hier keine lebenden Toten.«
»Oh, ihr habt unrecht«, sagte er, und sie horchten auf beim Klang seiner makellosen Stimme, die so lange geschwiegen hatte. »Eine halbe Meile vor dem Dorf an der Straße... das schiefe Haus dort mit dem Turm...«
Er hätte die Stille mit dem Messer des Jungen zerschneiden können, als er das gesagt hatte. Es war gewiss nicht so, dass sie es gewusst und ihm absichtlich verschwiegen hatten. Vermutlich hatten sie es nur geahnt, und die Bestätigung ihres Verdachtes ließ sie nun zu Eis erstarren. Es war natürlich nicht notwendig, ihnen zu erzählen, dass er eigentlich zu einem anderen Ort unterwegs war, dass er diese Aufgabe praktisch nur am Rande wahrnehmen würde.
Der Mann, der vorher zuerst geblökt hatte, sagte sehr leise:
»Er meint das Soban-Haus.«
Ein anderer fügte hinzu: »Das ist Ciddeys Haus. Dort gibt es nichts Außergewöhnliches – außer Armut und vielleicht einen kleinen Hauch von Irrsinn.«
Der Junge in der Lederschürze lehnte sich über Dros Schulter, um dessen Becher erneut aufzufüllen. Dro legte seine Hand über den Becher. Der Junge schüttete stattdessen Worte über ihn aus.
»Bis vor fünf Jahren waren die Sobans die Herren hier. Der alte Soban und seine zwei Töchter. Aber sie haben ihr Geld verloren, und die Dorfgemeinde kaufte ihr Land.«
»Sie verloren ihr Geld, weil der Vater es vertrunken hat. Er trank bereits, als Ciddey noch nicht mal alt genug war, um zu beißen.«
»Dann hat er alles Mögliche verkauft«, sagte der erste Mann. »Aufgearbeiteten Plunder – lächerliches Zeug, bizarre Gebilde.«
»Aber eine sehr hübsche Sache war dabei. Zwei alte Sensen, die miteinander verschweißt waren. Der Schmied hat ihm dabei geholfen.«
»Jemand erzählte mir«, sagte ein anderer Mann, »er hätte Ciddeys Babyzähne als Amulett verkauft.«
»Verrückt!«
»Ciddey ist auch verrückt. Wirklich schade, denn sie ist ein hübsches Mädchen. Der alten Zeiten wegen lassen wir sie in Ruhe. Sie lebt ganz allein in dem alten Haus.«
»Nicht ganz allein«, wandte Dro ein.
»Der Vater hat sich zu Tode getrunken«, sagte der erste Mann. »Meinst du den?«
»Ich glaube nicht.«
»Da gab es mal eine Geschichte«, sagte der erste Mann. »Die Mädchen spielten mit Kräutern herum, mit giftigen. Sie waren die Trunkenheit ihres Vaters leid... und so haben sie ihm einen Trank bereitet.«
»Das ist eine Lüge!«, rief jemand.
Dro bemerkte, dass sich die Gruppe der Sänger beim Herd auflöste. Der Spielmann, der vorher seinem Instrument so exquisite Töne entlockt hatte, wurde in einzelnen Fragmenten sichtbar. Zuerst erschien ein fadenscheiniger roter Ärmel, dann ein schmutziger grüner Ärmel, dann der Kopf mit dunklem, goldenem Haar und einer langen Nase, die sich zwischen den hohen Schultern wie ein Krähenschnabel ausnahm.
Die Sänger näherten sich Dros Tisch. Sie waren erregt und nervös. In ihrem ereignislosen Dorfleben war plötzlich etwas geschehen. Der Musiker, der nun allein dastand, neigte seinen Kopf über ein seltsames Instrument. Es gelüstete ihn offensichtlich nicht, sich der neugierigen Menge anzuschließen, und damit zeigte er, dass er nicht aus diesem Dorf stammte.
»Es gab noch eine zweite Tochter«, sagte schließlich jemand direkt hinter Dros linkem Ohr.
»Ciddeys Schwester? An der war doch nichts Besonderes dran.«
»Na, ich weiß nicht. Hat sich Cilny Soban nicht selbst im Fluss nördlich der Berge ertränkt? Das ist nicht gerade das, was ich als normal bezeichnen würde.«
»Das stimmt, Parl Dro«, sagte der ältere Junge. »Zwei Hirten fanden sie am Morgen, als sie ihre Kühe auf die Weide trieben.«
»Cilny lag auf dem Grund des Flusses«, sagte der erste Mann kummervoll. »Aber das Wasser war so klar, dass man sie gut erkennen konnte. Einer der Hirten ist ein wenig einfältig. Er dachte, sie wäre ein Wassergeist, wie sie da mit ihrem Nachthemd und einem Blumenkranz auf dem Kopf auf dem Grund lag und die Fische durch ihr Haar schwammen.«
»Was hältst du davon, Pari Geisterjäger?«
Dro nahm die Hand von seinem Becher fort Und ließ ihn sich wieder auffüllen. Die Menge befand sich nun in einem Stadium, in dem sie willig Informationen preisgab. Wie Geschenke warfen sie ihm Bruchstücke von Gerüchten und eigenen Erinnerungen zu, begierig auf seine Reaktion wartend. Doch der König des Schwertes verharrte reglos und in Gedanken versunken auf seinem Sitz.
Mit großem Nachdruck erwähnten sie nun die besondere Betonung der Namen der beiden Mädchen: Sidd-day und Sill-nee. Sie erzählten, wie sehr sich die Schwestern geliebt hätten, kaum eine Stunde hätte die eine ohne die andere verbracht. Hin und wieder mochte wohl eine von ihnen ihre Augen auf einen Mann aus dem Dorf geworfen haben, doch dann hätte die andere geschrien und gezetert, dass eine solche Liebschaft, ganz zu schweigen von einer Heirat, unter ihrer Würde wäre. Als Cilny dann in jenem Frühling Selbstmord beging, war niemand überrascht gewesen, und als. Ciddey darauf bestand, dass der Körper ihrer Schwester verbrannt und die Asche in einer steinernen Urne ihr übergeben wurde, hatte sich selbst der Priester achselzuckend gefügt. Die Sobans waren schon immer ein heidnischer Stamm gewesen, unmoralisch und unstetig. Seit dem Tod von Cilny hatte man Ciddey nur noch selten zu Gesicht bekommen. Hin und wieder konnte man sie nachts an den Hängen unterhalb des Berges herumwandern oder am Fenster des Turms stehen sehen. Mit der typischen Überheblichkeit der Sobans erwartete sie von den Dorfbewohnern, dass sie ihr Essen und andere zum Leben notwendige Dinge kostenlos vor das Tor stellten, gewissermaßen als Zins für ihr Land. Mit einer Mischung aus Selbstverachtung, Scham und Stolz willfahrten die Dorfbewohner ihrem Begehren. Niemand hatte bisher darüber nachgedacht, ob Cilny womöglich als Geist zurückgekommen war. Doch jetzt, nachdem sie einmal darüber nachgedacht hatten, hielten sie es durchaus für wahrscheinlich.
Dro leerte seinen dritten Becher.
Der Wasser-Tod erklärte möglicherweise das eigentümliche Gefühl, das ihn am Brunnen überkommen war. Das Wasser war das Verbindungsglied zu der übernatürlichen Kraft. Die Urne mit der Asche war ebenfalls bezeichnend. Jetzt war es an der Zeit, die Menge mit einer Reaktion zu belohnen und dann ihr Feuer zu dämpfen. Während er so dasaß und sich das blumenumkränzte Mädchen in dem glasklaren Strom vorstellte, gewahrte er, dass der Musiker seinen Platz am Herd verließ und sich langsam näherte. Mit unglaublicher Geschicklichkeit, die große Übung verriet, schlängelte er sich durch die Menge, ohne dass viel Notiz von ihm genommen wurde. Interessiert, aber keineswegs erstaunt, beobachtete ihn Dro verstohlen.
»Was meinst du, Pari Dro?«, fragte der Junge in der Schürze.
»Ich meine, dass es einen Geist in dem schiefen Haus gibt«, antwortete Dro und sprach damit eine Vermutung aus, die er bereits in seinem ersten Satz angedeutet hatte, doch diesmal registrierte die Menge sie mit einer gewissen Befriedigung. Der Musiker mit seinem Instrument auf dem Rücken pfiff leise durch die Zähne.
»Und was wirst du nun tun?«
»Oh, ich denke, ich werde zu Bett gehen. Das heißt, wenn ihr hier ein Zimmer für mich habt.«
Ein enttäuschtes Murmeln erhob sich. Man hatte zweifellos von ihm erwartet, dass er sich sofort auf den Weg machen würde.
»Aber willst du denn Ciddey Soban keinen Besuch abstatten?«
»Anscheinend nicht.« Er erhob sich, wobei er dem stechenden Schmerz in seinem verkrüppelten Bein keine Beachtung schenkte. Der Musiker, der sich soeben zwischen zwei stämmige Arbeiter geschoben hatte, erstarrte in der Bewegung, als hätte er im Boden Wurzeln geschlagen. Er war nur um wenige Zentimeter kleiner als Dro, aber schlank und biegsam wie ein Schilfrohr.
Dro wandte sich an den Jungen mit der Schürze.
»Das Zimmer?«
»Ich werde es dir zeigen. Und was ist nun mit Cilny, der lebenden Toten?«
»Was soll mit ihr sein?«
Das Murmeln der Menge klang nun bedrohlich. Dro spürte, wie sich die Haltung ihm gegenüber abkühlte und verhärtete. Man wollte ihn nicht gehen lassen, bevor er seine Arbeit getan hatte. Doch selbst in dem Gedränge um ihn nahm Dro den federleichten Griff wahr, der sich behände unter seinen Mantel schob und seine Geldbörse aus der inneren Tasche hervorzog. Dro blickte nicht in die Richtung des Musikers. Er verachtete keineswegs die Geschicklichkeit eines Taschendiebs, noch missgönnte er ihm den Lohn.
Der Junge geleitete Dro zur Treppe.
»Geradeaus, und dann die Tür links«, erklärte er. »Willst du denn gar nichts wegen Cilny unternehmen? Man hält dich für eine Legende.«
Die Menge wandte sich schmollend von Dro ab – wie eine Frau, die sich missachtet fühlt. Der Spielmann lehnte mit unschuldiger Miene an einem Tisch und stimmte sein Instrument, wobei ihm die goldenen Haare über die Augen fielen.
Der Junge grinste spöttisch, als er Dro die Treppe hinaufhumpeln sah.
»Was bist du doch für eine Enttäuschung!«