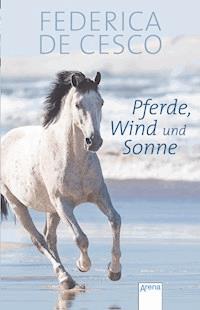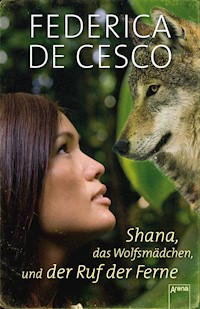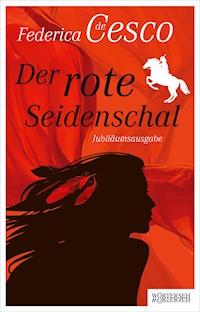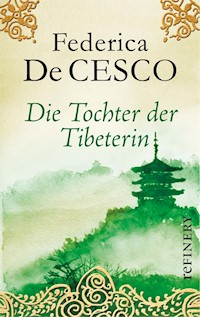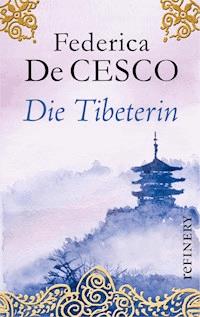Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Münster, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Stadt ist zerstört, es ist Winter, die Menschen kämpfen um ihre Existenz. Die junge Anna hält ihre Familie mit einer Stelle als Dolmetscherin bei der britischen Besatzungsmacht über Wasser. Als sie eines Tages mit Fieber bei der Arbeit erscheint, bietet ihr der englische Captain Jeremy an, sie nach Hause zu bringen – es ist der Beginn einer leidenschaftlichen Liaison, die im Nachkriegsdeutschland verpönt ist, denn mit dem Feind lässt man sich nicht ein. Doch als Anna schwanger wird, ist Captain Jeremy verschwunden, und die Engländer verweigern ihr jede Auskunft. Vierzig Jahre später findet Annas Tochter Charlotte Tagebuchaufzeichnungen und alte Tonbandaufnahmen – und sie macht sich daran, das Geheimnis der großen verbotenen Liebe von Anna und Jeremy zu lüften. Warum verschwand er eines Tages spurlos aus Annas Leben, obwohl sie seine große Liebe war? Was ist das Geheimnis des charismatischen und so undurchschaubaren Mannes, der ihr Vater ist? Und was ist der Grund für Annas Selbstmordversuch Jahrzehnte später? Je mehr Charlotte in die Geschichte ihrer Familie eintaucht, desto lebendiger wird für sie – und die Leser – auch die deutsche Nachkriegszeit, als die europäischen Völker einander als Feinde galten und in vielen Familien das Gespenst des Nationalsozialismus noch lebendig war.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FEDERICA
DE CESCO
DER ENGLISCHE
LIEBHABER
Roman
1. eBook-Ausgabe 2018
© 2018 Europa Verlag GmbH & Co. KG, München
Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © Collaboration JS/arcangel
Redaktion: Ilka Heinemann
Layout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-247-3
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Müncheninfo@europa-verlag.com+49 89 18 94 733-0mr@europa-verlag.com
Wie immer für Kazuyuki
Und für Ilka
INHALT
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
48. KAPITEL
49. KAPITEL
EPILOG
PROLOG
Ich lege mich gerne früh zu Bett, dann ist der Tag schneller vorbei. Tina liegt neben meinen Füßen, auf ihrer Decke, die nach altem Hund riecht. Ich liebe es, ihr kleines warmes Leben neben mir zu spüren. Wache ich mitten in der Nacht auf, brauche ich nur meinen Atem mit ihrem Atem in Einklang zu bringen, es beruhigt mich mehr als Tabletten. Und so war es auch gestern Abend, an dem mir die Müdigkeit sofort die Augen schloss. Ich schlief und träumte vom untergegangenen Münster. Es ist schon lange nicht mehr vorgekommen. Und es war kein schöner Traum.
Ich war wieder jung und mit dem Fahrrad unterwegs. Der Zweite Weltkrieg stand vor dem Ende, und unsere Stadt war vernichtet. Es gab nichts mehr zu zerstören. An manchen Stellen ließ sich kaum noch feststellen, wo die Straßen verliefen. Ich musste vorsichtig sein, denn in den Trümmern lauerten Gefahren. Blindgänger, die nicht explodiert waren. Hier und da gab es auch kleinere Sekundärexplosionen von Gas und Benzin. Und im Traum durchlebte ich den Luftangriff vom 28. Oktober 1944 erneut. Das Datum werde ich, wie so viele Münsteraner, nie vergessen. Der Luftangriff hatte nur eine halbe Stunde gedauert und doch so viel zerstört. Die Bomben hatten in verschiedenen Kirchen eingeschlagen und das Rathaus in Brand gesetzt. Hinter den Mauern schwelten die Feuer noch stundenlang, wie die Glut in einem Ofen. Außer blauem Qualm, der nach Verbranntem roch, war vom Prinzipalmarkt aus davon nichts zu sehen. Aber das Feuer fraß sich von innen durch das Mauerwerk, und am frühen Abend stürzte der gotische Rathausgiebel ein und schlug mit voller Wucht auf das Steinpflaster. Ich wurde Augenzeugin, als es geschah. Und davon träumte ich jetzt.
Ich schob mein Fahrrad durch den Schutt, den Blick auf die Trümmer früherer Zerstörungen und auf Pfützen aus den zerplatzten Wasserleitungen gerichtet, als ich in kurzer Entfernung ein Getöse hörte. Ich drehte mich in die gleiche Richtung und sah, wie sich an dem Rathaus die ersten Steinbrocken lösten. Was ich dann vernahm, war eher ein Knarren als ein Dröhnen. Es war, als ob die ganze Fassade seufzte. Der prachtvoll geschwungene Giebel bewegte sich, wie ein verletztes Lebewesen sich bewegen mag, bevor es zusammenbricht. Im Traum geschah es wie im Zeitlupentempo. Und alles war still. In Wirklichkeit hatte es einen gewaltigen Lärm gegeben, und ich hatte mich gerade noch rechtzeitig auf der anderen Straßenseite in Sicherheit bringen können. Das Getöse machte mich gehörlos, Mund und Nasenlöcher füllten sich mit Staub. Ich keuchte und schnappte nach Luft. Mein Haar, meine Kleider waren grau überpudert. Etwas weiter standen ein paar alte Männer wie graue Statuen, fassungslos und gelähmt. Neben mir weinte eine Frau. Ihr Schluchzen ging mir durch Mark und Bein. Unsere Blicke trafen sich in stummer Qual. Sprechen konnten wir nicht.
Die Erinnerung hatte mich geweckt. Und noch halb im Schlummer stellte ich mir eine Frage. Warum mussten alte, ehrwürdige Gebäude für unsere Verbrechen büßen? Gebäude sind unschuldig und hilflos. Sie tragen eine Geschichte in sich, die Geschichte der Stadt und die Geschichte ihrer Erbauer. Von den Handwerkern auch, die jeden Stein mit meisterhafter Hingabe gemeißelt hatten, ein Werk für ihr ganzes Leben und weit darüber hinaus. Und jetzt, in wenigen Sekunden, war dieses Werk zunichtegemacht. Und mir war, als ob ich das Leid der alten Steine in meinem eigenen Fleisch spürte. Und ich erinnerte mich auch, dass ich den Eltern nicht erzählt hatte, wie das Rathaus fiel. Ich hatte es einfach nicht übers Herz gebracht. Sie haben es später natürlich erfahren, aber nicht von mir.
1. KAPITEL
Der Anruf kam mitten während der Party, als Charlotte mit ein paar Leuten von der Filmcrew bei sich zu Hause das Ende der Dreharbeiten zu »Blut auf dem Teller« feierte, einem Dokumentarfilm über einen Schlachthof. Charlotte provozierte gerne, aber die Dreharbeiten waren strapaziös gewesen, und letzten Endes waren alle froh, dass sie es hinter sich hatten. Jetzt musste der Film noch geschnitten und vertont werden, dann war er endgültig fertig. Blieb nur noch zu hoffen, dass er etwas Geld einbrachte.
Jedenfalls waren jetzt alle wieder in Berlin, tranken Bier und tanzten, während »The Time of my Life« in voller Lautstärke durch die offenen Fenster schallte. Charlotte hatte das Telefon nicht gehört. Stefan kam leicht schwankend zu ihr, den Apparat in der einen, den Hörer in der anderen Hand.
»Für dich.«
Charlotte drückte den Hörer an ihr Ohr und verstand mühsam die Worte. Eine Schwester Soundso rief aus dem Pflegeheim in Münster an und entschuldigte sich für die späte Störung.
»Ihrer Mutter geht es nicht gut, sie möchte Sie sehen.«
Charlotte unterdrückte die Frage: Ist es dringend? Krebs wächst langsam und beständig, ein unaufhaltsames Abbröckeln des Lebens, bis sich alles beschleunigt und unversehens das Ende kommt. Charlotte war längst darauf gefasst.
»Wir wissen nicht, wie lange sie noch ansprechbar ist«, sagte die Schwester.
Charlotte seufzte.
»Danke, dass Sie mich benachrichtigt haben. Ich komme, so schnell ich kann.«
Sie legte den Hörer auf. Stefan blickte sie fragend an.
»Ich muss nach Münster«, sagte Charlotte.
»Deine Mutter?«
Charlotte nickte.
»Sie wollte nie, dass ich sie im Heim besuche. Auch nicht, seit sie die Diagnose hat. Wenn sie mich jetzt zu sich bestellt, sieht es wirklich mies für sie aus.«
Sie blickte auf die Uhr und seufzte. Halb eins.
»Ich glaube, ich gehe ins Bett, sonst merken die Schwestern, dass ich bekifft bin.«
Charlotte stieg am nächsten Morgen um sieben in den Zug, döste vor sich hin und dachte an die Mutter. Wann hatten sie sich zum letzten Mal gesehen? Das musste vor etwa zwei Jahren gewesen sein. Sie sahen einander nur selten. Ihre Beziehung zeichnete sich nicht durch besondere Herzlichkeit und Nähe aus. Gelegentlich telefonierten sie miteinander, dann erzählte Charlotte ein bisschen von ihrer Arbeit als Filmerin und ihrem Leben in Berlin. Das interessierte die alte Frau.
Die Mutter hörte zu, sprach jedoch wenig. Was außer vom Fortgang ihrer Erkrankung hatte sie selbst schon zu erzählen? Auch als sie noch gesund gewesen war und noch zu Hause gewohnt hatte, war nichts Besonderes in ihrem Leben geschehen, aber sie hatte es ja nicht anders gewollt. Anna Teresia Henke war am liebsten in ihren Möbeln, bei ihren Sachen gewesen. Sie hatte sich an einen festen Stundenplan gehalten: viermal täglich raus, mit Tina. Der Park hatte ja gleich um die Ecke gelegen. Und dazwischen hatte es genug im Haushalt zu tun gegeben oder im Fernsehen zu betrachten. Der Tumor hatte sich mit ersten Symptomen bemerkbar gemacht, sie hatte Bauchschmerzen, schlechte Verdauung und keinen Appetit gehabt. Aber sie hatte es zunächst auf die leichte Schulter genommen, war noch nicht zum Arzt gegangen. Immer nur müde? Keine Lust auf nichts? Ein Mangel an Vitaminen, an Eisen oder an was sonst noch was. Sie würde schon wieder auf die Beine kommen!
Anna war nie nachlässig gekleidet, nie nachlässig frisiert gewesen. Ihre Haut war blass und zerknittert, und die altmodische Brille hatte getönte Gläser, sodass Charlotte sich nicht an ihre Augenfarbe erinnern konnte. Braun? Grün? Annas Besonderheit war, dass sie immer Lippenstift trug, sogar wenn sie im Bett lag. Und stets das gleiche leuchtende Korallenrot. Früher war sie unterhaltsam und witzig gewesen, in letzter Zeit kaum noch. Und ihr schroffer Humor war nicht immer leicht verdaulich. Schön an ihr war ihr helles, jugendliches Lachen, das zwar selten kam, aber sehr herzlich war. Von Natur aus war sie aufgeschlossen für alles Neue und niemals voreingenommen. Aber mit den Jahren hatte sie sich immer mehr von der Welt zurückgezogen. »Reisen? Ich lasse meinen Hund nicht allein. Yoga? In meinem Alter krieche ich nicht mehr auf dem Boden herum! Kaffeeklatsch mit Freundinnen? Immer das gleiche Blabla!« Charlotte hatte dabei den Eindruck, dass sie sich verstellte, dass bei ihr Sprechen und Handeln, Fühlen und Wahrnehmen verschiedene Wege gingen. Man kam nicht an sie heran.
Anna hatte immer einen Hund gehabt, immer schwarzgrau, und immer ein Terrier. Ihr letzter hieß Tina. Vor drei Monaten hatte sie ihn einschläfern lassen müssen. Seitdem ging es mit ihr rapide bergab. Was hielt sie noch am Leben? Sie hatte ja längst die Diagnose.
Anna war nie verheiratet gewesen. Charlotte wurde 1947, knapp nach Kriegsende, geboren und war – wie man damals naserümpfend sagte – ein uneheliches Kind. Dazu kam, dass ihr Vater ein englischer Offizier war, ein Angehöriger der Besatzungsmacht. Das hatte sich natürlich herumgesprochen. Für Charlotte kein guter Start ins Leben. Sie hatte intensiv darunter gelitten. Seit frühester Kindheit musste sie vieles einstecken, und es hatte sie nachhaltig geprägt. Und der Vater selbst? Attraktiver Typ, sympathisch, aber undurchschaubar, keineswegs die Sorte Mann, den Charlotte sich in Bezug auf ihre Mutter vorgestellt hatte. Jeremy Fraser hatte zweifellos Klasse, gesellschaftlich jedenfalls, aber Charlotte wusste nicht, ob sie ihn ablehnen oder akzeptieren sollte. Er hatte gut deutsch gesprochen. Und er musste etwas in ihr berührt haben. Denn als er nicht mehr lebte, hatte sie eine Zeit lang einen stets wiederkehrenden Traum: Ihr Vater hatte einen kleinen Koffer in der Hand und stieg in einen Zug. Der Hintergrund war beleuchtet, der Zug rauchig und schwarz. Charlotte wollte zu ihm, bewegte hektisch die Beine, kam aber nie vom Fleck. Und die Lokomotive pfiff, Charlotte hatte das schrille Pfeifen noch in den Ohren. Und dann fuhr der Zug ab und entfernte sich. Ein mustergültiges Traumerlebnis, sagte Charlotte zu sich, ein Fressen für C.G. Jung. Aber dahinter war nichts Gutes, da war ein seelischer Knacks.
Charlotte hatte nie den Mund gehalten. Solange sie denken konnte, hatte sie ihrer Mutter Fragen gestellt. Viel war dabei nie herausgekommen. Anna hatte kaum die Möglichkeit eines Austausches zugelassen, geschweige denn eines aufklärenden Gespräches. Der englische Vater war einfach weg, in die Vergangenheit abgerutscht. In Annas Wohnung hatte es nicht einmal ein Foto gegeben. Aber Charlotte hatte stets das Gefühl gehabt, als blicke die Mutter ständig nach einem Bild, das nicht auf der Kommode stand oder an der Wand hing, sondern sich nur in ihrer Erinnerung zeigte. Im Laufe der Jahre hatte sie den Eindruck gewonnen, dass Anna sich weigerte, die Vergangenheit mit ihrer Tochter zu teilen. Nach dem Motto: Die Vergangenheit gehört mir, und du hast gefälligst draußen zu bleiben. Aber du kannst sagen, was du willst, ich gehöre dazu, dachte Charlotte. Zu deiner Vergangenheit, zu deiner Geschichte. Aber sie wurde nie mit einbezogen.
Der Zug – der wahrhaftige Zug, nicht der Traumzug – traf mit erträglicher Verspätung in Münster ein. Es regnete in Strömen. Ein trister Sonntag im April 1988. Von der Omi kannte Charlotte ein Sprichwort: »In Münster regnet es, oder es läuten die Glocken. Wenn beides zusammentrifft, ist Sonntag.«
Charlotte hätte an das Sprichwort denken sollen. Sie hatte keinen Schirm dabei, und alle Geschäfte waren zu. Sie zog ihre Kapuze über den Kopf und wartete übel gelaunt auf den Bus.
Münster war eine erzkatholische Stadt, das Pflegeheim wurde von Diakonissen geleitet. Sie trugen zwar immer noch ihre traditionellen weißen Hauben, aber ihre Kleider waren insgesamt etwas kürzer als in früheren Zeiten und dunkelblau statt schwarz. Eine Schwester Gertruda, pathologisch blass und berufsmäßig hilfreich, führte Charlotte in die dritte Etage. Im Aufzug seufzte sie abgrundtief.
»Ihre Mutter ist dem Herrgott schon nahe.«
Sie ließ den Satz bedeutungsvoll in der Schwebe. Sie gingen durch einen abscheulich langen Gang, die Schwester klopfte diskret an eine Tür, steckte den Kopf durch den Spalt und hauchte: »Frau Henke, Ihre Tochter ist da.«
So nahe beim Herrgott war Anna nun auch wieder nicht. Sie saß in einen Morgenmantel gewickelt in einem Ohrensessel. Man hatte sie mit Kissen hochgestützt. Ihre Füße steckten in karierten Männerpantoffeln. Sie hatte eine Infusion am Arm und schien vor sich hin zu dösen.
Charlotte räusperte sich.
»Tag, Mutti. Darf ich hereinkommen?«
Die alte Frau schreckte aus ihrem Dämmerzustand.
»Ja, ja, komm nur!«, rief sie ziemlich laut, worauf sie einen Hustenanfall bekam. Ein Wasserglas stand neben ihr auf dem Nachttisch. Charlotte nahm das Glas und hielt es an Annas Lippen.
»Ruhig, Mutti … schön langsam trinken!«
Anna schluckte das Wasser. Charlotte hörte das Knarren in ihrer Brust. Ihr verwischter Lippenstift hinterließ einen roten Halbmond auf dem Rand. Charlotte betrachtete sie. Wie sah sie jetzt aus? Eigentlich nicht viel anders als früher, aber sie hatte deutlich abgenommen. Sie konnte ja kaum noch etwas zu sich nehmen. Die Wangenknochen ihres leicht slawischen Gesichts zeichneten sich stark ab, und sie trug ihr weißes Haar jetzt kurz, was ihr gut stand.
Sie hatte das Glas ausgetrunken und nickte ihrer Tochter zu.
»Danke, dass du gekommen bist. Ich hatte es eigentlich nicht erwartet.«
»So. Und warum nicht?«
»Weil man ja nie genau weiß, wo du gerade bist. Du treibst dich ja dauernd in der Weltgeschichte herum. Zum Glück haben sie dich schließlich doch noch in Berlin erwischt. Wer war der Typ, mit dem Schwester Gertruda gesprochen hat?«
»Stefan. Und nenne ihn gefälligst nicht den Typ. Wir leben zusammen.«
»Ist er nett?«
Charlotte bewahrte ihre Geduld.
»Wäre er nicht nett, hätte ich ihn längst vor die Tür gesetzt.«
»Da bin ich ja beruhigt. Und wo warst du die Tage davor?«
»Gar nicht weit. In der Nähe von Bremen. Wir haben in einem Schlachthof gefilmt.«
»Und wer hatte diese Schnapsidee?«
»Ich, wer denn sonst? Mir ging es darum, die Zuschauer mit der Brutalität des Tötens am Laufband zu konfrontieren.«
»Und wie war es?«
»Ein Missverständnis von Anfang an! Ich wollte einen Schock auslösen. Der Produzent, dieses Arschloch, fand das Thema herrlich morbide. Immerhin hat er das Geld springen lassen. Wir starteten also mit den Dreharbeiten. Aber die Schlachter wünschten uns auf den Blocksberg. Wir wurden auf Schritt und Tritt bewacht, durften nicht drehen, wo wir wollten. Es sei denn, heimlich. Und da sind wir ziemlich gewieft. Am Ende zeigen wir alles: die Tötung mit Stromschlägen oder mit Bolzenschüssen, die Qualen des Tieres, wenn der erste Schuss danebengeht. Und danach die ausgeweideten Leiber am Fleischhaken, der Dampf, das frische Blut auf unseren Schutzanzügen. Ich rieche auch jetzt noch die Gedärme voller Scheiße! Ich wasche mir die Haare, ich dusche, ich werde den Gestank nicht los!«
Anna schien sofort zu verstehen, was sie meinte.
»Ja, ja, der Geruch ist schon ziemlich aufdringlich.«
»Ich esse nie wieder Fleisch.«
»Keine Leberwurst mehr? Keine Zunge in Sülze?« Annas Stimme hörte sich ironisch an. Charlotte war konsterniert.
»Wie kannst du so zynisch sein! Wo du doch immer einen Hund hattest.«
Anna verzog keine Miene.
»Das ist etwas anderes. Ein Hund ist ein Haustier, kein Nutztier. Was ich eigentlich sagen will: Das ist bei Menschen nicht viel anders. Mit dem Unterschied, dass die Menschen auf Tischen liegen.«
Charlotte hielt überrumpelt inne.
»Wie kommst du darauf?«
»Weil ich im Institut für Rechtsmedizin Obduktionen protokolliert habe.«
»Das kann man doch überhaupt nicht vergleichen!«
»Und wieso nicht? Wir sind auch Säugetiere. Natürlich muss man sich an den Anblick gewöhnen. An den Geruch auch.«
»Du bist wirklich nicht zartbesaitet.«
»Konnte ich mir nicht leisten. Ich habe Medizin studiert, im zweiten Semester. Da kam der Krieg. Wir brauchten Geld, und Linchen war ja in Amsterdam und spielte die Verlegersgattin, von der war nichts zu erwarten.« Linchen war Annas ältere Schwester. Und während Anna ihr Leben lang zupackend gewesen war, hatte Linchen es stets verstanden, ihre angeblich so fragile Gesundheit zur Schau zu tragen und andere für sich arbeiten zu lassen. Ihr Erscheinungsbild war dabei stets gepflegt und geradezu madonnenhaft, was auf gewisse Männer anziehend wirkte.
Nach ein paar glücklichen Jahren in Lausanne lebte sie heute wieder in Amsterdam, immer noch elegant, immer noch perfekt zurechtgemacht, auch wenn sie nur über die Straße zum Bäcker ging. Und bestens versorgt von ihrem Sohn, der nach Hendriks frühem Unfalltod den höchst defizitären Verlag mit amerikanischer Spannungsliteratur wieder hochgepäppelt hatte.
»Hast du Nachricht von Johan?«, fragte Charlotte.
»Oh ja! Seine Frau will sich scheiden lassen! Donatella lebt bei ihren Eltern in Milano, die Kinder hat sie mitgenommen. Und Johan sitzt bei seiner Mutter und lamentiert.«
Anna verzog die Lippen zu einem Lächeln. Schadenfreude, dachte Charlotte und bemerkte: »Johan war schon als Kind ein Jammerlappen.«
»Doch nur, weil er eifersüchtig war. Ich hatte einen Beruf und brachte dir Spielsachen mit, die Johan nicht haben konnte. Linchen hatte ja kein eigenes Geld, weil ihr Mann ihr monatelang oft nichts schickte. Ich musste dich ein bisschen verwöhnen! Wo ich doch schon den ganzen Tag außer Haus war. Hinzu kam, dass die Nachbarn über dich tuschelten.«
»Na ja«, sagte Charlotte kalt. »Ich war ja vom Heiligen Geist gezeugt!«
»Ich weiß, was man über mich sagte.« Annas Stimme hörte sich plötzlich scharf an. »Nein, keine Notzucht im Straßengraben! Wie oft habe ich dir einschärfen müssen, dich gegen das Gerede zu wehren! Dein Vater war englischer Offizier und hatte sich in mich verliebt. Als ich ihn traf, war ich unterernährt, hatte fahle Haut und Fieberblasen. Aber ich hatte natürliche Locken! Keine Dauerwelle, um Gottes willen nicht! Und grüne Augen. Jetzt sind sie grau.«
»Deine Haare? Die sind doch weiß!«
»Nicht die Haare: die Augen. Daran merke ich, dass ich bald hopsgehe. Und sieh dir doch nur meinen Hals an!«
Annas Hals war tatsächlich so dünn wie ein Kinderhals, die Schlüsselbeine traten stark hervor. Deshalb schien ihr Kopf viel zu schwer. Er wackelte sogar ein wenig. Charlotte wollte etwas Beruhigendes sagen, aber ihr fiel nichts ein. Inzwischen verschluckte sich Anna an der eigenen Spucke. Ein Hustenanfall schüttelte sie. Charlotte suchte hastig ein Taschentuch, und Anna spuckte zähen Schleim. Charlotte hielt ihr das Glas Wasser unter die Nase. Anna trank gierig und lehnte sich schwer atmend zurück.
»Ist mein Lippenstift verschmiert?«
»Warte, ich ziehe ihn dir nach«, sagte Charlotte.
Anna tastete nach ihrem Taschenspiegel, der in Reichweite auf dem Nachttisch lag. Sie betrachtete sich prüfend und nickte zufrieden.
»Danke, jetzt bin ich wieder vorzeigbar.«
Charlotte lächelte verkrampft.
»Hübsch siehst du aus.«
»Quatsch«, erwiderte Anna. »Ich weiß, wie ich aussehe. Dem Krebs ist es wurscht, ob ich ›Rouge Baiser‹ trage. Aber mir nicht.«
Sie tastete ungeschickt nach ihrer Infusion.
»Sitzt die noch? Scheint so. Und jetzt hör gut zu. Ich habe alles vorbereitet. Du fährst mit dem Bus Nummer elf zu meiner Wohnung. Der Mietvertrag läuft bis Ende September, ich konnte nicht früher kündigen. Du schellst bei der Nachbarin. Ilse Meichler, du kennst sie ja. Ilse wird dir die Haustür öffnen und den Wohnungsschlüssel geben. Den Schlüssel kannst du behalten. Du wirst ihn noch brauchen.«
»Soll ich dir etwas aus der Wohnung holen?«
»Nein, ich habe hier alles, was ich brauche. Also, du gehst in mein Schlafzimmer. Auf dem rechten Nachttisch steht ein Schmuckkästchen mit einem Ring und einer Uhr. Die sind von deinem Vater, er hatte sie mir beide geschenkt. Und da ist auch die Hutnadel mit dem blauen Vögelchen. Die hat deine Omi immer getragen. Entsinnst du dich noch?«
Charlotte schüttelte den Kopf.
»Keine Ahnung mehr!«
»Der Schmuck ist für dich. Und nimm auch sonst noch mit, was du haben willst. Mir ist das jetzt egal. Der ganze Kram in der Vitrine, meinetwegen. Oben in der Schublade. Da liegen auch meine Tagebücher. Die sind für dich, daraus kannst du einige Schlüsse ziehen. Und falls du keine Lust hast, sie zu lesen, schmeiße sie in den Müll.«
»Du hast Tagebuch geschrieben?«, wunderte sich Charlotte. »Davon weiß ich nichts!«
»Damit habe ich erst angefangen, nachdem ich beim Arzt war. Ein netter Arzt übrigens, der mir sofort den Befund lieferte. Ohne Schnickschnack und sachlich wie ein Wetterbericht. Die Speiseröhre. Ein Flugschein in die ewige Seligkeit. Ich bedankte mich für seine Ehrlichkeit, und er sagte: ›Ich traue Ihnen zu, dass Sie das einstecken können.‹ Er schlug eine Therapie vor, erklärte mir prozentual Erfolg und Risiko, und am Ende ließ ich mich überzeugen. ›Na gut, versuchen wir es mal.‹ Die Therapie zerrte an meinen Kräften, wie du ja weißt. Bald wurden meine Glieder bleischwer. Ich konnte kaum noch meinen Hintern aus dem Sessel ziehen. Zwei- oder dreimal am Tag ging ich mit Tina ums Haus, mehr war für uns beide nicht drin. Sie war ja auch nicht mehr die Jüngste. Alte Frau, alter Hund. Zu jenem Zeitpunkt begann ich zu schreiben. Und eigentlich waren es keine richtigen Tagebücher. Ich habe sie nur so genannt. Ich wollte unsere Geschichte aufschreiben, meine und Jeremys – damit du endlich verstehst, was damals geschehen ist. Bald werde ich ja darüber nichts mehr erzählen können. So, und jetzt verschwinde, hole den Schmuck und halte ihn in Ehre. Lieber mit warmen als mit kalten Händen geben, solange es noch geht. Ich sollte ja sowieso nicht mehr da sein. Dass ich hier noch liege, ist deine Schuld.«
»Mutti, fang nicht wieder davon an!«
»Nein. Und es würde auch zu nichts führen, darüber zu reden. Außerdem bin ich müde. Geh jetzt endlich, ich will zu Bett.«
Charlotte streichelte ihre Hand mit den dicken blauen Adern. Stäche man hinein, dachte sie, würde gleich Blut hinausspritzen.
»Ich danke dir, Mutti.«
»Nichts zu danken.«
Von einem Atemzug zum anderen schien sich Annas Gesicht in einem Nebel aufzulösen. Ein feuchter Schimmer überzog ihre Haut, und die Wangenknochen wurden spitz. Es war keine Einbildung, Charlotte bemerkte ihre beschlagenen Brillengläser. Doch auf einmal bewegten sich Annas Lippen.
»Eine Zeit lang war es so schwer zu ertragen … so schwer, wenn du nur wüsstest! Endlich habe ich es hinter mir. Ach, ich bin ja so froh, dass ich bald über den Berg bin.«
Ihre Stimme versagte. Es war, als ob sie vor Charlottes Augen in einen Zustand versank, in dem alles weit weg war und unfassbar. Charlotte war beunruhigt. Konnte sie die Mutter guten Gewissens alleine lassen?
Während sie noch überlegte, ging die Tür auf: Schwester Gertruda. Sie blickte zuerst besorgt auf die alte Frau, dann tadelnd auf die Besucherin.
»Oje, Frau Henke, Sie sind ja ganz erschöpft!«
Anna vernahm ihre Stimme und war plötzlich wieder ganz wach.
»Ich sehe meine Tochter nicht oft. Wir hatten uns dies und das zu erzählen.«
Das jedoch machte auf die Schwester keinen Eindruck.
»Kommen Sie, Frau Henke, Sie sollten sich hinlegen.« Sie nahm Anna behutsam die Brille ab, griff ihr unter die Arme und hob sie routiniert aus dem Sessel. Sie ließ Charlotte unmissverständlich spüren, dass ihre Gegenwart nicht mehr erwünscht war. Also gut.
Charlotte schlüpfte in ihren Parka.
»Tschüss, Mutti!«
»Mach’s gut, Mädelein«, murmelte die alte Frau. Charlotte verspürte eine Gänsehaut. Viele Jahrzehnte lang hatte sie diesen Namen nicht mehr gehört. Es war ihr Kosename von früher. Sie zog den Reißverschluss hoch und merkte auf einmal, dass ihre Hände zitterten. Inzwischen saß Anna auf dem Bett, hob abwesend lächelnd das Gesicht zu ihr empor. Ihre Augen glitten über die junge Frau hinweg, als ob sie diese nicht mehr wahrnahmen, und waren – tatsächlich – grau verschleiert, wie Vogelaugen.
2. KAPITEL
Da es nicht mehr regnete, ging sie zu Fuß. Es machte Charlotte nichts aus, dass der Weg ziemlich weit war. Sie brauchte frische Luft.
Das Haus stand in einem guten Viertel, mit Blick auf einen kleinen Park. Es stammte aus den Fünfzigerjahren, war aber kürzlich renoviert und rosa gestrichen worden, was Charlotte als geschmacklos empfand. Immerhin hatte man sich nach etlichen Bausünden endlich Mühe gegeben, das Stadtbild etwas zu verschönern.
Charlotte betrachtete die Namensschilder. Hier! L. und I. Meichler. Sie drückte auf den Knopf.
Eine Frauenstimme tönte durch die Lautsprechanlage.
»Ja?«
Charlotte nannte ihren Namen, die Haustür sprang surrend auf. Das Treppenhaus war gut gepflegt, neben dem Fenster standen Grünpflanzen. Im dritten Stockwerk erwartete sie Ilse Meichler und begrüßte sie mit festem Händedruck.
»Schön, dass du dich wieder mal blicken lässt. Du hast immer viel zu tun, sagt Anna. Lass dich anschauen! Gut siehst du aus!«
»Danke, Frau Meichler«, sagte Charlotte, wie es sich’s gehörte.
Ilse trug zu braunen Hosen und braunem Pullover eine altmodische Perlenbrosche. Sie sah bieder aus, aber nicht kleinkariert. Sie wühlte beim Sprechen in einem bestickten Handtäschchen. »Wo habe ich den Schlüssel? Ah, hier ist er!«
Sie führte Charlotte zu der Tür gegenüber, steckte den Schlüssel ins Schloss und öffnete. Alles war dunkel. Die Rollladen waren zu, und es roch nach eingeschlossener Luft.
»Es ist meine Schuld«, murmelte sie. »Ich hätte gestern lüften sollen.«
Sie zog die Rollladen hoch, riss die Balkontür auf. Feuchte Luft drang in die Wohnung.
»So! Jetzt kann man endlich atmen. Schade, dass Anna nicht mehr hier ist. Ich vermisse sie sehr. Sie erzählte immer von dir. Sie war so stolz auf dich …«
»Sie hat mich jahrelang unterstützt.« Charlotte sagte lieber die Wahrheit. »Das Filmgeschäft ist hart. Auf einmal das große Geld und dann monatelang – nichts. Man muss sich das Geld selbst einteilen. Und bis man das gelernt hat …«
»Na ja«, Ilse relativierte. »Sie hatte ja auch eine gute Rente …«
Sie hat sich jeden Bissen vom Mund abgespart, dachte Charlotte. Nicht mal in den Urlaub ist sie gefahren. Aber sie behielt ihre Gedanken für sich.
Ilse sprach weiter. »Sie ließ sich immer mehr gehen. Ihre Krankheit und dann die Sache mit dem Hund. Ein Glück, dass sie einen Platz in dem Pflegeheim bekommen hat.«
»Ich wollte ihr ja dabei helfen«, sagte Charlotte. »Ich hätte ihr das eine oder andere abnehmen können. Nichts zu machen! Sie hat sich immer dagegen gesträubt. Vielleicht hätte ich mehr darauf beharren sollen. Aber sie wollte alles selbst in die Hand nehmen.«
»So war sie eben. Na ja, es ist ja alles gut gegangen. Sie hat im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen. Ist sie noch immer klar bei Verstand?«
»Vollkommen.«
Ilse seufzte.
»Ich weiß nicht, ob wir sie beneiden sollten. Bei alldem, was sie mitmachen muss …«
»Ich weiß es auch nicht.«
Sie tauschten einen langen Blick, bevor Ilse sagte:
»So, und jetzt sieh dich um und nimm mit, was du willst. Wann soll die Wohnung geräumt werden?«
»Im September. Aber das ist nichts für mich! Wenn es so weit ist, soll sich Johan darum kümmern.«
»Warum ausgerechnet Johan?«
Charlotte schluckte.
»Weil … weil er kein so enges Verhältnis zu ihr hatte. Mir schlägt das alles auf den Magen.«
»Ich verstehe. Wie geht es ihm?«
»Schlecht. Seine Frau hat ihn verlassen.«
»Die hübsche Italienerin? Wie schade! Aber das kommt ja heute oft vor. Sieh mal, Ludwig und ich sind seit vierzig Jahren verheiratet und machen uns gegenseitig das Leben nicht schwer. So, und jetzt lasse ich dich. Wenn du fertig bist, vergiss nicht, die Balkontür zu schließen.«
Sie ging, und jetzt wurde alles still. Charlotte holte tief Atem und ging über den Flur. Die Tür zum Schlafzimmer war nur angelehnt. Charlotte machte Licht. Die kleine Schachtel, genau unter der Nachttischlampe, schien auf sie zu warten. Charlotte hob behutsam den Deckel und sah als Erstes den Ring. Eine Chevalière, wie sie sofort feststellte, also ein Ring von der Sorte, die früher als Siegelring oder als Statussymbol getragen wurde. Dieser war aus massivem Gold und trug ein heraldisches Emblem, drei Disteln unter zwei Degen, die sich kreuzten. Es war eindeutig ein Ring für Männer. Solange sie denken konnte, hatte ihre Mutter den Schmuck getragen. Charlotte mochte keinen Schmuck, aber der Ring war schön. Sie schob ihn über den linken Ringfinger, und war freudig überrascht, dass er passte und ihr sogar gut stand. Als Nächstes besah sie sich die Uhr, die von Blancpain war, ein ganz flaches Modell mit römischem Zifferblatt. Die Uhr mit ihrem schmalen Armband war auch aus Gold, hatte aber nichts Protziges an sich, sie war einfach nur schlicht und schön. Und da war auch noch die Hutnadel ihrer Großmutter Ida, ungefähr in der Länge ihres kleinen Fingers. Das Vögelchen war aus altem Silber, mit Flügeln aus blauer Glasur. Hübsch, dachte Charlotte. Aber wer trägt heutzutage noch einen Hut?
Der Schmuck bildete einen sonderbaren Gegensatz zu dem anspruchslosen Zimmer. Das Bett in der Ecke, an der Wand der zweitürige Kleiderschrank. Ein Stuhl, ein Bügelbrett – fertig. Keine Spur von Gemütlichkeit, ganz zu schweigen von dem hässlichen Wäschekorb und dem Drahtbügel am Schrank, an dem noch ein alter Morgenrock baumelte. In allen Dingen lag eine ansteckende Traurigkeit. Nur der Schmuck glänzte und schien zu sagen: »Nimm mich mit!« Charlotte steckte das Schächtelchen in ihre Tasche.
Wieder im Wohnzimmer, nahm sie amüsiert zur Kenntnis, dass ihre Mutter eine fragwürdige Vorliebe für Schleiflack hatte. Früher war ihr das nie aufgefallen. Aber sie lebte in ihrer eigenen Fantasiewelt und hatte sich ja nie für solche Sachen interessiert. Fast alle Möbel stammten aus den frühen Sechzigerjahren, außer zwei dick gepolsterten Sesseln und einem Sofa mit abgenutzter Sofadecke. Charlotte konnte sich die Mutter gut auf diesem Sofa vorstellen, die Beine hochgelegt und vor dem Fernseher.
Sie sah sich um. Die Vitrine, von der Anna gesprochen hatte, stand auf einer Kommode mit Spitzendeckchen, offenbar selbst gehäkelt. Ein Geschenk der Nachbarin? Sah ganz danach aus. Ferner erblickte Charlotte in der Vitrine einige schöne Römergläser, dunkelblau mit goldenem Dekor, wie Tante Linchen sie auch noch hatte. Es war, als ob alte Erinnerungen in das schimmernde böhmische Glas eingedrungen wären. Und was noch? Außer einigen kitschigen und womöglich wertvollen Figuren aus Meißner Porzellan sah sie Schalen aus Milchglas und verschiedene Vasen. Schöne Sachen für Menschen von früher, aber nichts für Charlotte.
Der Spiegel der Vitrine strahlte das matte Licht zurück, das aus der Deckenbeleuchtung auf einen verdorrten Rosenstrauß fiel. Er lag, noch in Zellophan eingewickelt, neben einer großen Kristallvase. Die langstieligen dunkelroten Rosen waren seit Methusalems Zeiten vertrocknet und schwärzlich verfärbt. Bei dem Anblick wurde es Charlotte fast übel. »Himmel, immer noch dieser Strauß!« Freilich fehlten etliche Blumen, und Charlotte erinnerte sich, dass sie selbst einen Teil davon entsorgt hatte. In den Müll und fertig! Aber die Rosen waren ja einmal frisch gewesen. Unvermittelt überkam Charlotte ein seltsames Gefühl; es war, als ob ein Luftzug, sanft und eindringlich wie ein Flügelschlag, ihre Wange streifte. Wenn sie die Mutter besuchte, hatte sie eigentlich nie einen Blick in die Vitrine geworfen. Wozu auch? Jedenfalls erinnerte sie sich nicht, dass ihr die Blumen irgendwann mal aufgefallen wären. Vielleicht ganz einfach deswegen, weil man einen vertrockneten Rosenstrauß nicht in einer Vitrine vermutet. Aber jetzt, ganz alleine in diesem Wohnzimmer, hatte sie etwas aufgespürt, etwas, das sie wohl wahrnehmen, aber nicht deuten konnte. Etwas eigentümlich Lebendiges, ein unsichtbares Schaukeln in der Luft, wie Wellenringe im Wasser. Einbildung? Charlotte war unsicher. In diesen kleinbürgerlichen vier Wänden erzählte ihr die Luft eine Geschichte, die noch in der Schwebe hing. Hier war ihr Lebenselement, ihre Umgebung. Sie erzählte von Ereignissen, die Charlotte nur teilweise kannte, aber bisweilen als Fragmente im Traum erlebte. Und sich dann beim Aufwachen wünschte, sie endlich mal in ihrer ganzen Tragweite verstehen zu können.
Charlotte empfand sich selbst als nüchternen Menschen. Sie schüttelte sich wie unter einem Regenguss, kehrte in eine Wirklichkeit zurück, die nachvollziehbar und konkret war. »Nimm mit, was du willst«, hatte die Mutter gesagt, und Ilse Meichler hatte die Worte wiederholt. Ja, aber was sollte sie denn mitnehmen? Der große persische Teppich mit den kräftigen Pflanzenfarben hätte ihr schon gefallen, aber wie sollte sie mit einer Teppichrolle auf den Schultern in den Zug steigen?
Was Charlotte am meisten interessierte, waren die Tagebücher. Oben in der Schublade, hatte Anna gesagt. Charlotte sah sich um. Die Vitrine stand auf einer Kommode mit etlichen Schubladen. Charlotte zog einige auf, sah nur Krimskrams, bis sie vier Schuhschachteln entdeckte, voller Notizhefte, Briefe, Telegramme, Tonbänder und Zahlscheine aus den Fünfzigerjahren. Aus einem angerissenen braunen Umschlag quollen alte Fotografien. Das erste vergilbte Bild, das sie in die Finger bekam, zeigte zwei mollige Damen mit verkniffenen Gesichtern unter Hüten groß wie Fahrradreifen. In ihrer Mitte stand ein blonder Junge in Schuluniform. Charlotte drehte das Bild um und las: Tante Berta und Tante Amanda mit Manfred im Schlossgarten. Und ein Datum: 1921.
Tante Berta war kurz nach Kriegsende gestorben, aber Tante Amanda hatte Charlotte noch gekannt. Sie war ab und zu aus Osnabrück, wo sie wohnte, zu Besuch gekommen. Eine nette alte Dame mit einem Gesicht wie aus Pudding, die täglich ein Stück Kuchen aß.
Der Junge in Schuluniform war Onkel Manfred, der später in Russland gefallen war. Die Mutter sprach nie von ihm und Tante Linchen nur selten, und dann nur so, als ob sie eine heiße Kartoffel in den Mund nahm. Charlotte fragte sich manchmal, was dieser Jüngling – das sagte man doch früher – wohl angestellt haben mochte, bevor er in Russland explodierte? Er sah nahezu beängstigend brav aus.
Während sie auf den Umschlag mit den Bildern starrte, überlegte Charlotte, was sie von dem ganzen Zeug mitnehmen sollte. Nur die Tagebücher? Aber die Tonbänder machten sie neugierig, die Briefe und die Fotos auch. Sie zog den Reißverschluss ihres Rucksacks weit auf und stopfte alle vier Schachteln hinein. Dann, einer plötzlichen Eingebung folgend, öffnete sie die Vitrine, zog behutsam eine einzige Rose aus dem Strauß, eine, die noch ihre ursprüngliche Form bewahrt hatte. Sie schnitt die Blüte ab, wickelte sie sorgfältig in ein Taschentuch, damit sie unbeschadet die Reise überstand. Dann schloss sie die Balkontür und zog die Rollläden herunter. Ein letzter Rundgang durch die Wohnung: Alles war, wie sie es vorgefunden hatte. An der Tür blieb sie einen Atemzug lang stehen. Die ganze Wohnung schien nur aus Augen zu bestehen, und alle diese Augen beobachteten sie. Wieder überlief sie eine Gänsehaut.
»Tschüss!«, sagte sie leise, bevor sie sorgfältig die Tür hinter sich abschloss. Dann schellte sie bei der Nachbarin. Sofort waren Ilses Schritte zu hören. Sie öffnete und tupfte sich mit einer Serviette den Mund ab.
»Entschuldige, aber Ludwig und ich essen früh zu Abend. Hast du etwas gefunden?«
»Den Schmuck«, sagte Charlotte. »Und alte Briefe und Fotos. Sonst nichts.«
»Schade«, sagte Ilse. »Es sind einige wertvolle Sachen dabei. Willst du nicht hereinkommen? Ich mache dir gerne eine Stulle.«
Eine Stulle. So nannte man hierzulande ein Butterbrot. Mit Leberwurst? Charlotte kam es hoch. Sie bedankte sich und lehnte ab.
»Mein Zug geht in zwanzig Minuten. Sonst muss ich eine Stunde warten, bis der nächste fährt.«
»Na, dann beeil dich mal! Und mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um Anna.«
Ilse drückte ihr kräftig die Hand, winkte kurz mit ihrer Serviette und schloss die Tür.
Charlotte erwischte gerade noch den Bus, stieg im letzten Augenblick atemlos in den Zug und kam um Mitternacht in Berlin an. Ein Taxi brachte sie auf schnellstem Weg nach Hause. Stefan hatte auf sie gewartet.
»Du siehst ja todmüde aus. Möchtest du etwas essen?«
Charlotte ließ sich auf einen Stuhl fallen.
»Danke, etwas Warmes könnte ich wohl vertragen.«
Stefan hantierte schon in der Küche.
»Nun, wie geht es ihr?«
»Nicht besonders.«
Stefan brauchte keine weiteren Erklärungen. Er brachte Brot und Butter auf den Tisch und wartete vor dem Herd, bis die Kartoffelsuppe aufgewärmt war. Dann setzte er sich ihr gegenüber, und Charlotte zeigte ihm den Schmuck.
»Sie wollte, dass ich noch mehr Sachen mitnehme, aber was soll ich mit dem Zeug?«
»Der Ring ist sehr schön«, meinte Stefan.
»Nicht wahr? Er ist von meinem Daddy, aber wie für mich gemacht!«
»Dann pass auf, dass du ihn nicht in einer Damentoilette liegen lässt.«
»Und was soll ich mit der Hutnadel?«
»Aufbewahren. Als Erinnerung.«
»Von mir aus. Es kann ja sein, dass sie für Omi eine Bedeutung hatte.«
Charlotte schlürfte lustlos die Suppe. Inzwischen versuchte Stefan die Armbanduhr aufzuziehen.
»Sie geht nicht mehr.«
»Ich werde sie zum Uhrmacher bringen.«
Stefan blätterte in Annas Tagebüchern.
»Was für eine Schrift!«
»Sie war Linkshänderin.«
»Ich kann das kaum lesen. Was schreibt sie denn so?«
»Keine Ahnung. Ich war so kaputt, dass ich fast auf der ganzen Fahrt nur geschlafen habe.«
»Noch etwas Suppe?«
»Ich kann nichts essen. Mein ganzer Magen ist verkrampft.« Charlotte schob ihren Teller zurück. »Ich muss ständig an sie denken. Sie wird ja nur noch künstlich ernährt.«
»Redet sie über ihren Zustand?«
»Absolut sachlich. Sie sagt, es ist ja bald vorbei. Ich habe sogar den Eindruck, dass sie sich freut. Kannst du das verstehen?«
»Irgendwie schon.«
»Mich hat es umgehauen. Weil ich nichts für sie tun konnte, überhaupt nichts. Und weil es sie im Grunde nicht interessierte. Weil sie sterben will und alles andere ihr schnuppe ist. Und das finde ich wirklich belastend.«
3. KAPITEL
Anna Teresia Henke starb am 16. August 1988. Ilse rief an, um es Charlotte zu sagen.
Die Nachricht kam für sie nicht überraschend. Als sie das letzte Mal angerufen hatte, war die Stimme ihrer Mutter nur noch ein Flüstern gewesen, sie hatte sinnlose Worte gestammelt und Charlotte kaum wiedererkannt.
Charlotte hatte wehmütig gedacht, dass die Mutter nun niemanden mehr brauchte, weder die Lebenden noch das Leben als solches. Der Tod war ihr näher gewesen, sie hatte ihn herbeigesehnt, wie einen tröstenden Freund. Und jetzt war ihr Wunsch in Erfüllung gegangen.
Sie rief Johan an. Und war erleichtert, als er sagte, dass er kommen würde.
Die Bestattung fand drei Tage später auf dem Friedhof von Hiltrup statt. Charlotte wollte mit dem Wagen fahren, aber sie wusste auch, wie langwierig die Kontrollen an den deutsch-deutschen Grenzen sein konnten. Also beschloss sie, schon am Vortag loszufahren und in einer kleinen Pension in Münster zu übernachten.
Der Morgen der Beerdigung war nass und kühl, mit einem fernen Hauch von blauem Himmel. Der ganze Sommer war verregnet gewesen. Auch jetzt sprühte leichter Nieselregen auf die Bäume, und es war für die Jahreszeit unangenehm kühl. Anna war in der kleinen Friedhofskapelle aufgebahrt, aber der Sarg war schon geschlossen. Es war ein Sarg aus einfachem Tannenholz, ein Sarg für arme Leute. Der Beamte von der Gemeindeverwaltung verlangte nur eine Unterschrift, bevor er Charlotte die Sterbeurkunde aushändigte.
Charlotte setzte sich eine Weile vor den Sarg und verlor sich in ihren Gedanken. Die Mutter hatte kein Testament hinterlassen, aber als Frau mit Prinzipien hatte sie im Vorfeld alles organisiert. Sie hatte ihre Beerdigung im Voraus bezahlt und für zehn Jahre die Friedhofsgebühren beglichen. Was danach kam, war ihr egal.
Am Grab waren außer dem Beamten und dem Pastor nur das Ehepaar Meichler und die Diakonissen anwesend, die Anna gepflegt hatten. Johan war noch nicht eingetroffen. Charlotte fragte sich, ob er es sich letzten Endes doch anders überlegt hatte. Es gab eine knapp gehaltene Leichenpredigt, dann wurde der Sarg in das offene Grab hinuntergelassen. Der Pastor sprach die üblichen Gebete, die Diakonissen bewegten die Lippen und murmelten »Amen« im Chor. Charlotte stand etwas abseits und fror. Sie hatte einen zu dünnen Mantel an. Darunter trug sie Schwarz, nicht weil sie zu einer Beerdigung ging, sondern weil es – sozusagen – ihr Markenzeichen war: schwarzer Pulli, schwarze Shorts und schwarze Strumpfhose. Dazu passende Stiefel. An ihrer Schulter baumelte ein überdimensionaler Beutel aus schwarzem Knautschleder.
Zum Schluss wurde dem Pastor eine Schaufel gereicht, und er streute eine Handvoll Erde auf den Sarg. Jeder Anwesende tat es ihm nach. Charlotte fand das Geräusch der prasselnden Erde auf dem Sarg abscheulich.
Dann wurde das Grab zugeschaufelt. Charlotte tauschte ein paar nichtssagende Worte mit dem Pastor und dankte den Diakonissen, wie es sich gehörte, mit einer Spende für das Pflegeheim. Ilse Meichler umarmte sie mitfühlend, und ihr unscheinbar freundlicher Mann schüttelte ihr die Hand. Beide sprachen eine Weile über ihre langjährige Freundschaft mit Anna, bevor sie sich ziemlich eilig verabschiedeten. Sie wollten den Bus nicht verpassen. Charlotte blieb alleine, sah zu, wie das Grab zugeschaufelt wurde. Sie fror innerlich und kam sich verloren vor. Offenbar hatte Johan sie im Stich gelassen. Das sieht ihm ähnlich, dachte Charlotte.
»Leb wohl, Mutti«, sagte sie leise. »Sei mir nicht böse, aber ich friere. Ich setze mich etwas ins Warme.«
Sie stapfte über den deprimierenden Leichenacker, als sie Johan aus einem Taxi vor dem Eingangstor steigen sah. Er kam mit hastigen Schritten auf sie zu.
»Tut mir leid! Der Zug hatte Verspätung!«
Charlotte betrachtete ihn verwundert. Solange sie sich erinnern konnte, war Johan ein linkischer Typ gewesen, einer, der frühzeitig Bauch angesetzt hatte und bedächtig sprach. Jetzt stand ein gut gebauter Mann vor ihr, mit breiten Schultern. Er trug einen Trenchcoat, darunter schwarze Hose und schwarzen Pullover. Dazu einen Seidenschal in dezentem Grau und eine Schirmmütze.
»Du siehst richtig gut aus!«, bemerkte Charlotte. »Wie hast du das gemacht?«
»Krafttraining dreimal in der Woche und schwimmen. Aber ich trinke zu viel. Donatella hat mir immer nur ein Glas Rotwein zum Essen erlaubt. Jetzt strenge ich mich nicht mehr an, ich habe keine Lust mehr. Wozu, für wen?«
»Ach, komm«, sagte Charlotte. »Die Welt ist voller schöner Frauen.«
Johans Gesicht sackte nach unten. Es sah aus, als hätte er plötzlich wieder sein Doppelkinn.
»Aber es gibt nur eine Donatella.«
»Johan, sei kein Masochist. Sie wird schon wieder zurückkommen.«
Johan seufzte und meinte dann, als ob er es erst jetzt zur Kenntnis nähme: »Du hast dich aber auch verändert.«
Charlottes Haar war schwarz gefärbt, die Augen mit Kajal umrandet und der Lippenstift pflaumenrot.
»Das kommt dir nur so vor, weil wir uns ziemlich lange nicht mehr gesehen haben, nur deswegen.«
Johan nickte und sparte sich weitere Kommentare. Bei einer jungen Frau hätte ihn diese Aufmachung nicht sonderlich gestört. Aber Charlottes kantiges Gesicht mit den hohen Wangenknochen zeigte bereits die harten Linien einer Vierzigjährigen.
Sie kehrte mit Johan zum Grab zurück. Einige Männer waren dabei, mit ihren Spaten die Erde zu zerstampfen. Johan nahm seine Mütze ab, und Charlotte bemerkte, dass er nicht den Fehler machte, sein schütteres Haar auf die falsche Seite zu kämmen. Einer der Friedhofswärter reichte Johan einen Spaten mit etwas Erde, die er auf das Grab verstreute. Danach schwiegen beide eine Weile, bevor Charlotte hörbar Atem holte.
»Endstation«, sagte sie.
Sie sahen sich an. Es war ein seltener Augenblick des Einvernehmens.
»Und wie geht es weiter?«, fragte er. »Muss noch irgendwas unterschrieben werden?«
»Ich habe schon alles erledigt. Willst du die Sterbeurkunde?«
»Ja, das wäre gut. Die ist für Linchen.«
»Ich schicke dir eine Fotokopie.«
Charlotte fügte sinnend hinzu: »Ich werde keine Chrysanthemen auf ihr Grab stellen. Die hat sie nie gemocht.«
»Welche Blumen mochte sie denn?«
Charlotte spürte einen leichten Schmerz in der Brust, ein Hauch von Schmerz nur, der sofort verging.
»Sie mochte Rosen.«
»Ich werde Rosen in Auftrag geben.«
»Rote Rosen«, sagte Charlotte. »Nimm ein Dutzend! Und langstielige. Die werden ihr gefallen.«
»Muss es denn gleich ein Dutzend sein?«
»Komm, sei kein Geizkragen!«
»Ich hoffe nur, dass sie nicht geklaut werden«, murmelte Johan.
»Wollen wir zusammen Mittag essen?«, schlug Charlotte vor. »Ich bin mit dem Auto hier und will vor der Rückfahrt noch etwas zu mir nehmen. Auf der Transitautobahn bekomme ich ja nichts zu essen.«
»Ausgezeichnet! Ich habe auch noch nichts im Magen!«
»Kennst du ein Lokal in der Nähe? Aber lieber keinen Italiener, sei so gut.« Johan sprach mit resigniertem, traurigem Gesicht. »Nicht, dass ich keine Spaghetti mehr mag, aber die italienische Küche ist Lebensfreude. Und die habe ich verloren.« Er sah sie unglücklich an. »Vielleicht verstehst du mich nicht.«
»Doch«, erwiderte Charlotte. »Ich verstehe dich gut. Wir kennen uns ja schon so lange, wir sind ja gar nicht so verschieden«, setzte sie freundlich hinzu, obwohl sie es nie so empfunden hatte.
4. KAPITEL
Sie verließen den Friedhof und fanden ein paar Straßen weiter einen gutbürgerlichen deutschen Gasthof, wo Charlottes Erscheinung für missbilligende Seitenblicke sorgte. Doch sobald sie hochmütig zurückstarrte, wandten sich alle Augen von ihr ab, als habe sie sich von einer Sekunde zur anderen in Luft aufgelöst.
»Du fällst auf«, raunte Johan ihr zu.
Charlotte zog geringschätzig die Schultern hoch.
»Münster!«
Johan bestellte zwei Erbsensuppen. Danach einen Gemüseteller für Charlotte und Rinderbraten mit Bratkartoffeln und Rotkohl für sich selbst. Charlotte trank Cola, Johann wollte ein Bier. Nach der Bestellung warf Charlotte ein Päckchen Zigaretten auf den Tisch, und Johan zog den Aschenbecher in Reichweite. Sie zündeten sich ihre Zigaretten an, und Johan fragte: »Wie lange lebst du schon in Berlin?«
»Seit 21 Jahren. Ich habe sofort gewusst, dass es mir dort gefallen würde.«
»Was hast du all die Jahre in Berlin gemacht?«
»Ich habe dort die Filmakademie besucht. Es war eine wilde Zeit. Neben dem Studium habe ich die verrücktesten Sachen gemacht.«
Johan, auf beide Ellbogen gestützt, sah sie fragend an. Charlotte grinste.
»Performances, Happenings. Das war damals trendy. Einmal zum Beispiel zog ich mich splitternackt aus, beschmierte mich mit roter und blauer Farbe und lag einfach da, am Straßenrand. Ich hatte ein kleines Schild neben mir, auf dem geschrieben stand: ›Tod durch Niederschlag‹. Leute, die solche Protestaktionen verstanden, warfen Münzen auf die Untertasse oder sogar ein paar Scheine. Andere glaubten, da läge eine Leiche, hielten sich fern oder riefen die Polizei. Ich erklärte den Bullen, das sei eine Demonstration gegen die atomare Nachrüstung.«
»Haben sie dich mitgenommen?«
»Die haben nur einen Blick auf meinen Ausweis geworfen und haben mich liegen lassen. Womöglich waren sie sogar einverstanden. Berlin war ja voller Performer. Wir zeigten durch unsere Aktionen, dass nicht nur der Atompilz unsere Vernichtung sein konnte, sondern auch unsere Passivität. Wir wollten dagegen ankämpfen. Für uns konnte keine Aktion peinlich oder obszön genug sein, um die Leute aufzurütteln. Später habe ich einen Kurzfilm gedreht über das, was wir machten. Der Film bekam eine Auszeichnung. Ich entdeckte, dass die Filmsprache eine andere ist, aber ebenso wirksam. Ich stelle Fragen, existenzielle Fragen. Aber meine Filme bieten keine Lösungen an. Warum soll ausgerechnet ich eine Lösung anbieten? Ich habe ja nicht einmal eine Lösung für mich selbst.«
»Was filmst du denn?«
»Ich zeige das Leben als ultimative Realität. Meine Arbeit beruht auf der dialektischen Spannung zwischen Kunst und Kritik. In dieser Beziehung hat man es leicht in Berlin. Die Berliner sind offener, unkomplizierter. Aber am Ende zählt, wie überall auf der Welt, ob man einen Namen in der Filmszene hat oder nicht. Mich kennt man inzwischen.«
Der Kellner brachte das Essen. Zunächst die Erbsensuppe, dann den Hauptgang. Die Portionen waren reichlich. Charlotte aß gierig und ohne Tischmanieren, Johan langsam und bedächtig, wobei er von den mühsamen Jahren erzählte, in denen er versucht hatte, den maroden Verlag über Wasser zu halten.
»Mein Vater starb mit fünfzig. Er wurde von einer Straßenbahn überfahren. Du kennst ja die Geschichte. Und was er in all diesen Jahren publiziert hatte, war elitäres Zeug, das kein Mensch mehr lesen wollte. Ich ließ amerikanische Spannungsromane kommen und gab sie meiner Mutter zu lesen.«
Charlotte hielt ihre Gabel auf halben Weg in der Luft.
»Linchen?«
»Ja, sie kann gut Englisch. Wie übrigens deine Mutter ja auch. Sie waren ja auf dem gleichen Gymnasium. Und wenn Linchen ein Roman gefiel, war ich ziemlich sicher, dass er anderen Frauen auch gefallen würde. Ich kaufte die Rechte ein und ließ das Buch in holländische Sprache übersetzen. Und es wurde fast immer ein Erfolg! Die alten Freunde meines Vaters waren entsetzt, weil ich sein verlegerisches Erbe mit Trivialliteratur verleugnete. Mir war das schnuppe. Es ging mir nur darum, dass wir wieder schwarze Zahlen schrieben.«
Charlotte lachte stoßweise.
»Linchen als Verlagslektorin, ich kann es nicht glauben!«
Der Kellner räumte die Teller ab. Sie bestellten Kaffee. Charlotte schob sich eine Zigarette in den Mund, und Johan gab ihr Feuer.
»Und Donatella?«
Johan brauchte ziemlich lange, bis er antwortete. Es behagte ihm nicht, dass sich jemand an sein Innerstes heranmachte. Charlotte fand das auch richtig und wartete geduldig, bis er sprach.
»Am Anfang waren wir sehr glücklich. Sie hatte sich gut an Amsterdam gewöhnt. Aber allmählich merkten wir, wie verschieden wir waren. Jeden Tag ein bisschen mehr. Donatella bekam wieder Heimweh nach Italien. Ich versuchte sie festzuhalten, und sie wollte weg. Ob die Kinder es merkten? Sie waren ja noch klein. Aber wir waren längst kein richtiges Paar mehr, und vielleicht hatte jemand zu Donatella gesagt: Entscheide dich jetzt, sonst ist es zu spät. Eine Scheidung? Nicht sofort, der Kinder wegen. Aber wir trennten uns. Heute arbeitet Donatella wieder bei Mondadori. Und ich hoffe immer noch, dass wir wieder zueinanderfinden. Ich will einfach daran glauben.«
»Vielleicht hilft das«, sagte Charlotte nüchtern. Johans Offenheit hatte ihr Herz berührt. Aber sie wollte nicht sentimental werden.
Ein kurzes Schweigen folgte, bevor Johan fragte: »Und du, lebst du allein?«
Die Worte kamen zögernd, es wäre besser gewesen, nicht zu fragen. Aber Charlotte blieb ganz friedlich.
»Nein, es gibt jemanden.«
»Und dieser Jemand, was macht er?«
»Er ist Tontechniker. Wir arbeiten und leben zusammen. Wir verstehen uns gut. Ich meine damit, dass Stefan mich versteht, und das will etwas heißen. Mich versteht ja sonst keiner.«
Sie zog ihren Lippenstift aus der Tasche und malte sich den Mund an.
Johan wechselte das Thema.
»Und was ist mit Annas Wohnung?«
»Die muss bis Ende September geräumt werden. Die Küche ist in einem schrecklichen Zustand und sollte renoviert werden. Könntest du dich vielleicht darum kümmern?«
»Warum?«
»Weil ich mich nicht in der Lage dazu fühle. In der Wohnung sind nur noch mumifizierte Erinnerungen. Gespenster in allen Ecken. Und ich bin noch nicht immun genug gegen die Vergangenheit … gegen die Vergangenheit meiner Mutter, will ich sagen.«
Johan überlegte kurz, bevor er nickte.
»Also gut. Ich werde mir ein verlängertes Wochenende nehmen. Immerhin lenkt es mich ab. Zu Hause ohne Donatella drehe ich durch.«
»Schlaftabletten? Whisky? Marihuana?«
»Nichts von alldem. Nur belgisches Bier. Aber eine Flasche nach der anderen.«
»Bier macht fett.«
»Von mir aus. Sag, willst du etwas aus der Wohnung behalten?«
»Mutter hat mir Daddys Ring gegeben.« Sie hielt Johan den Finger hin, damit er ihn sehen konnte. »Und auch seine Armbanduhr. Aber die ist beim Uhrmacher. Und ich habe ihre Tagebücher und vier Schuhschachteln voller alter Briefe, Tonbänder und Fotos. Das ist alles. Ich habe zu Hause keinen Platz.«
»Besaß sie noch wertvolle Sachen?«
»Einige. Die gehören jetzt dir.«
»Hat sie noch Geld auf der Bank?«
»Ich habe ihre Kontonummer und die Vollmacht. Ich werde dir eine Entschädigung zahlen. Den Rest teilen wir uns. Und dann löse ich das Konto auf.«
Charlotte sprach mit der Zigarette im Mundwinkel. Eigentlich mochte sie Johan, weil er gelassen blieb, genau wie sie selbst unaufgeregt war. Die Mutter war tot. Wenn sie etwas dazu sagen konnte, wäre das nur Wiederholung, Abgedroschenes. Der Tod war ein endgültiger Schlusspunkt, und Trauer war kein Alltagsgefühl, Trauer brachte Herzklopfen, Erschrecken und nützte doch nichts. Wohin Trauer führen konnte, hatte Charlotte schon früher erlebt. Besser war, einfach nach Plan zu funktionieren.
Johan betrachtete sie nachdenklich.
»Hattet ihr eigentlich Krach miteinander?«
»Krach? Das kann man so nicht nennen. Aber zeitweise konnten wir uns nicht riechen.«
»Was war denn zwischen euch?«
»Die richtige Frage wäre: Warum hat sie mich auf die Welt gebracht? Dabei hatte sie im Institut für Rechtsmedizin gearbeitet und kannte die richtigen Leute. Sie hätte die Sache schnell in Ordnung bringen können.«
»Du meinst, eine Abtreibung?«
»Was denn sonst?«
»Aber dann wärst du ja nicht am Leben!«
»Ursache und Wirkung.« Charlotte sprach ohne sichtbares Gefühl. »Mein englischer Erzeuger sagte später, er hätte nicht gewusst, dass ich unterwegs war. Und es sei auch nicht seine Schuld gewesen, dass er abkommandiert wurde. Und inzwischen weinte sich das deutsche Fräulein die Augen aus dem Kopf.«
»Hast du ihm nicht geglaubt?«
»Nur eine faule Ausrede, habe ich am Anfang gedacht.«
»Und später?«
»Später sind mir einige Zweifel gekommen.«
»Hast du viel darunter gelitten, dass er nicht da war?«
Sie lachte kurz und bitter auf.
»Hast du überhaupt eine Ahnung, was das hieß, ein Besatzungskind zu sein? Mein Vater war weg, hatte meine Mutter mit dickem Bauch sitzen lassen. Als ich in die Schule kam – und es war eine reine Mädchenschule –, musste meine Mutter es ja notgedrungen der Schulleitung beibringen. Und sofort begann das Spießrutenlaufen. Die süßsauren Mienen der Lehrinnen, die Beleidigungen der Mitschülerinnen, die ja fast alle aus Familien kamen, wo man sich zehn Jahre zuvor noch mit erhobenem Arm begrüßt hatte. Heil Hitler, ich hätte gerne Heringssalat! Die Demütigungen, das Abgrenzen. Man zog mich an den Haaren, machte meine Sachen kaputt. Ich wehrte mich natürlich. Ich war das meistgefürchtete Mädchen in der Klasse, weil man wusste, dass ich losschlug, wenn man mir zu nahe kam. Manche Schülerinnen redeten überhaupt nicht mit mir. Wenn ich sie ansprach, drehten sie den Kopf zur anderen Seite. Hau bloß ab, deine Mutter ist eine Britenschlampe, und du bist ein Kind der Schande, pfui Teufel! Ich dachte immer wieder, warum hat meine Mutter mir das angetan?«
Charlotte hatte sich in Rage geredet. »Nicht so laut«, murmelte Johan mit einem bedeutsamen Seitenblick. Zwei Damen, offenbar ganz Ohr, saßen wie Bildsäulen am Nebentisch. Charlotte starrte sie arrogant an. Sofort wandten sich die Damen ihrem Essen zu, führten im synchronen Rhythmus ihre Gabeln vom Mund zum Teller.
»Blöde Kühe«, sagte Charlotte so laut, dass sie es hören konnten. Johan wäre am liebsten im Erdboden versunken. Doch Charlotte hatte bereits die Stimme gesenkt.
»Zu Hause ging es ja noch. Die Familie war, sagen wir mal … großzügig. Ihr wusstet ja alle, wer mein Vater war. Notgedrungen. Aber ihr hieltet den Mund. Außerdem wart ihr ja auf das Geld meiner Mutter angewiesen. Man beißt nicht die Hand, die das Futter austeilt, das weiß sogar jeder Köter. Aber ich spürte, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Du wurdest anders behandelt.«
»Im Grunde konnte ich ja mit dir wenig anfangen«, sagte Johan »Ich bin 1940 geboren, du warst ja sieben Jahre jünger als ich. Ich las schon Bücher, als du noch mit Bauklötzen spieltest. Ich wunderte mich nur, dass du keinen Vater hattest.«
»Deine Mutter hat mich täglich spüren lassen, dass ich weniger wert war als du. Und sie ging sehr subtil vor, weißt du. Zwei Löffel Kartoffelbrei weniger für mich, ein Butterbrot mit Aufschnitt, aber ohne Tomatenscheiben – du hattest drei! Solche Dinge eben. Sie strickte dir Handschuhe, aber nicht für mich! Niemals! Auch nicht, wenn Eisblumen an den Scheiben klebten. Sie stopfte deine Socken, meine nicht. Das übernahm die Omi. Und du glaubst, dass ein Kind es nicht merkt? Ich führte gründlich Buch in meinem Kopf, das kann ich dir versichern! Ungerechtigkeit ertrage ich nicht. Du gehörtest eben zur Familie. Ich nicht. Oder zumindest nicht ganz. Kinder spüren solche Sachen. Die Omi, ja, die Omi war lieb. Aber sie war schon krank, und Großvater behandelte mich wie Luft.«
»Das macht mich aber sehr betroffen«, sagte Johan steif. »Ich habe von alldem nichts gemerkt.«
»Ich gebe dir ja auch keine Schuld. Es war eben so.«
»Und dein Vater? Wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen?«
Charlotte stützte die Ellbogen auf den Tisch und qualmte ihm ins Gesicht.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: