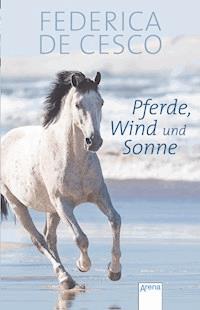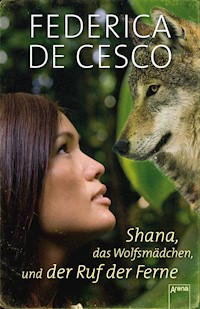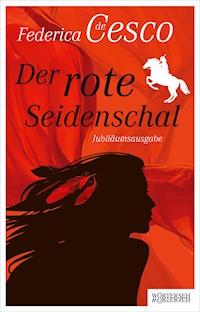Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Würde und Gewalt – eine deutsche Geschichte "Mir kommt es hoch. Es ist schlimm, die unverdaute Vergangenheit nicht erbrechen zu können. Heute werde ich den Gedanken nicht los, dass wir alle durch die Hölle müssen, um uns selbst zu erkennen." Alexander von Gersdorff, der Protagonist im bildgewaltigen neuen Roman der Schweizer Bestsellerautorin Federica de Cesco, findet erst in Japan einen Weg, sich seiner Schuld und den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges zu stellen. Meisterhaft und berührend schildert das Buch die Kraft der Musik und den nie endenden Wunsch des Menschen nach Freiheit. 1914. Der Student Alexander von Gersdorff meldet sich bei Kriegsausbruch freiwillig – aufbegehrend, voller Wut ergreift er die Flucht aus seinem aristokratischen Elternhaus. Die Hartherzigkeit und verlogenen Konventionen seiner Familie hatten Alexanders erste große Liebe brutal zerstört. Das Schicksal will es, dass er mit seinem Regiment ins chinesische Tsingtau geschickt wird, wo die jungen Soldaten ohnmächtig den Irrsinn des Krieges, das Töten und die Gewalt erleben müssen. Alexander bringt das sinnlose Sterben seiner besten Freunde bald an den Rand des Wahnsinns. Erst die Begegnung mit Toyohisa Matsue, dem Nachkommen eines herrschaftlichen Samurai-Clans, in dem japanischen Lager Bandō, das bekannt war wegen der dort gepflegten humanen und liberalen Gefangenenbehandlung, und die Aufführung von Beethovens Neunter Sinfonie hinter Stacheldraht geben seinem Leben eine neue Wendung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe 2015
© 2015 Europa Verlag GmbH & Co. KG, Berlin · München · Wien
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Brockhaus/Commission
ePub-ISBN: 978-3-95890-011-0
eBook-Herstellung und Auslieferung:Brockhaus Commission, Kornwestheim
www.brocom.de
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Wie immer für Kazuyuki
»Die Menschen lassen ihr Lebtag nichtvon ihrer Liebe und nicht von ihrem Hass.«EIJI YOSHIKAWA, »MUSASHI«
1. KAPITEL
DER HIRSCHKÄFER
Seitdem ich krank bin, kommen alte Erinnerungen zu mir. Bilder bewegen sich an meinen Augen vorbei, und ich bewege mich mit ihnen, von einem Punkt zum anderen. Manche dieser Bilder sind ziemlich grell, lichtgetränkt. Ich weiß nicht, ob es Bilder sind, die es gibt oder jemals gegeben hat. Ich habe so verrückte Träume. Seit einigen Tagen liege ich da ohne Schmerzmittel, ohne Schlaftabletten, ohne die Furcht, an meinem eigenen Atem zu ersticken. Es riecht nach sauberen Reisstrohmatten und nach Kampfer. Gerüche, die ich mag. Zunächst habe ich die Traumbilder ohne Interesse betrachtet, nur um die Zeit totzuschlagen. Womöglich fantasierte ich ja. Aber die Bilder wandern an meinen Augen vorbei und ziehen mich mit sich, ein unwiderstehlicher Sog. Sie flimmern nicht und verschwinden auch nicht. Ich sehe sie hinter meinen Pupillen bei Licht und bei Dunkelheit. Ich denke an ganz gleich was, ihre Umrisse sind immer klar. Sie sind wie ein Fenster zu einer anderen Dimension. Es geht nicht, denke ich, dass hinter diesem Fenster etwas ist, das ich nicht sehen kann. Das macht mich reizbar. Ich fühle mich zunehmend unbehaglich, verstricke mich in Phasen krampfhafter Unruhe. Bis ich auf einmal ganz still liege. Etwas ist da. Ich würge Schleim herunter, spüre in mir eine Hebung und Senkung. Unvermittelt explodiert die Luft um mich herum. Alle Geräusche dieser Welt verschwinden. Aus dem Nirgendwo schwebt – wie eine Leuchtspur – ein Bild dicht vor meinen Augen empor und öffnet sich. Ich bin sofort innen drin.
Ich bin neun Jahre alt. Ich hänge mit den Knien kopfüber an einem Ast des höchsten Baumes im Garten und schaukele in zehn Metern Höhe. Meine Mutter steht unten und ruft, ich soll sofort herunterkommen. Inge, die junge Kinderfrau, steht neben ihr, knetet die Hände und jammert: »Ach lieber Jesus, heilige Maria! Wenn ihm nur nichts passiert …« Meine Schwester Amanda tobt und schreit wie am Spieß. Sie will auch auf den Baum, und Inge hält sie fest. Ich sehe das alles von oben, ich bin glücklich, völlig in meiner Welt, fühle mich leicht wie eine Seifenblase und zugleich voller Kraft, der Himmel schwankt mit mir hin und her. Ich gebe immer mehr Schwung, der Himmel schaukelt stärker, bis der Ast den Druck nicht mehr aushält und entzweikracht. Meine Mutter schreit, ich fliege an Zweigen, an grünen Blättern vorbei. Ich lande mit dumpfem Aufprall. In den wenigen Sekunden, da alle wie gelähmt sind, höre ich Blätter rascheln. Ich spucke einen Brocken Erde aus, und dicht vor meinem Gesicht kriecht ein Hirschkäfer hervor. Ein paar Atemzüge lang starren wir uns an – der Käfer und ich. Er bewegt die Fühler, hebt den Kopf, und ich sehe unter den Hörnern so etwas wie ein Gesicht. Sein Anblick weckt eine Assoziation in mir, die ich nicht begreife, nicht begreifen kann, weil sie noch unendlich weit von mir entfernt ist. Schon läuft Mutter auf mich zu, zerrt mich hoch, betastet mich.
»Um Gottes willen, Alexander, hast du dir wehgetan? Hast du dir ein Bein gebrochen? O Himmel, mehr Glück als Verstand!«
Ich beachte sie kaum. Mein Kopf ist gedankenverloren zur Seite geneigt. Ich suche den Hirschkäfer. Irgendwo muss er sein. Doch ich sehe ihn nicht mehr. Er hat sich unter den Blättern verkrochen.
Das war der Anfang. Ich trug diesen Anfang in mir, unzugänglich, unerkannt: eine Erinnerung an die Zukunft, wenn so etwas möglich ist. Ich befand mich in einer Vorwelt, in der alles geschehen konnte, nur nichts Gutes. Die kommende Zeit bewegte sich auf mich zu, mit ihren kreisenden Sternen. Aber woher sollte ich das wissen?
Und jetzt liege ich auf meinem Futon, der hierzulande üblichen Bettmatratze, und bin wütend auf mich selbst. Erster Fehler: dich zu erinnern. Lass das gefälligst, Alexander! Willst du unbedingt wissen, wie verflucht noch mal alt du bist? Ja, und wie alt bist du, sag es doch? Bald hundertjährig? Das glaubst du wohl selbst nicht! Dass Schlimmste dabei ist, dass andere annehmen, du hättest etwas dabei gelernt. Man sagt, im Alter käme die Weisheit. Was heißt das schon? Dass du noch nicht völlig gaga bist? Zweifellos, sonst hättest du nichts Rationales mehr im Kopf, nur Irrationales. Dann wärest du den ganzen Ballast los, diese Schlacken eines hundertjährigen Lebens. Aber solange du dich erinnerst, kann nichts weggewischt oder ausrangiert werden, runter in den Keller der Vergangenheit. Kein Hausputz im Kopf, Alexander. Für wie lange Zeit noch?
Denn irgendwann wird es aufhören. Irgendwann wird es eine Zäsur geben, eine klare Trennung zwischen damals und heute. Bis dahin bin ich wie ein Lachs, der auf dem Weg zu seinem Quellgebiet den Fluss aufsteigt. Ich spüre, dass ich mich vorwärtsbewege, heimlich und fast verstohlen, in einer Art verzweifelter Dringlichkeit gegen den Strom ankämpfe. Und wozu, bitte schön? Ich finde keine Antwort, und das deprimiert mich. Deprimiert! Ich habe mir noch nie überlegt, was für ein hochtrabendes Wort das ist! Zudem hat ein alter Mann nicht deprimiert zu sein. Auch nicht, wenn er sich mit krummem Rücken durch die Straßen schleppt. Ein alter Mann soll seine alberne Erscheinung in Kauf nehmen, ruhig werden und akzeptieren, dass der Tod kein Skandal ist, sondern Biologie.
Das geht mir sehr gegen den Strich. Und nach der Kremation, nach dem Herunterkühlen, wer wird mit elegantem Stäbchengriff meinen zweiten Wirbelknochen aus der Asche fischen um ihn – wie es sich gehört – in die Urne zu legen? Da ist keiner mehr, der das für mich tun könnte. Kazuko Sato vielleicht? Ja, Kazuko würde mir diesen Wunsch nicht abschlagen. Wir sind Nachbarn seit über fünfzehn Jahren, nur ein schmaler Gartenweg trennt ihr Haus von dem meinen. Trotzdem verschiebe ich das peinliche Gespräch von einem Tag auf den anderen.
Denn obwohl der Umlauf meiner Lebensuhr fast vollendet ist (nehmen wir mal an, der Zeiger stünde auf eine Minute vor zwölf), bilde ich mir ein, ich wäre noch fähig, diesen Zeiger zurückzudrehen. Und ich schlafe ein mit dem Gedanken, morgen bin ich wieder jung und mache dieses und jenes. Und wenn mich um sechs die vertrauten Schreie der Raben wecken, höre ich zugleich das Knarren in meiner Brust. Ich spucke zähen, grünen Schleim und komme ohne Hilfe kaum auf die Beine. Es geht nur, wenn ich krieche und mich an irgendeinem Möbel hochziehe. Wie verwirrend, frustrierend und aufreibend das ist! Mein gegenwärtiger – und offenbar endgültiger – Zustand gibt mir nur ein minimales Maß an Freiheit. Ich kann nachdenken oder schlafen. Das sind meine Möglichkeiten, nicht mehr und nicht weniger.
Immerhin kann ich Yae noch sehen. Das ist schon was. Nein, das ist – wenn ich’s recht bedenke – das Wesentliche.
In einem geschnitzten Rahmen hängt die Fotografie an der Wand gegenüber, damit ich sie immer im Auge behalten kann. Yae trägt einen Kimono mit einem Muster aus Libellen und Sommergräsern. Trete ich näher an das Bild heran, sehe ich ihr seidenweiches sinnliches Lächeln, das – wenn es die Umstände verlangten – wie ein Messerschnitt aufglänzen konnte.
Yae war klein von Gestalt, doch in ihrer Haltung lag etwas, das sie größer erscheinen ließ. Ihr Körper war athletisch und geschmeidig wie der einer Tänzerin. Ihr Haar war lang und dick und tiefschwarz, so schwarz, dass es purpurn schimmerte. Die hohe Stirn, die länglichen Wangen gaben ihrem Antlitz die Form einer Mandel. Es war kein sanftes Gesicht; ihre schmale Nase war edel geformt, sie hatte ein eckiges, fast maskulines Kinn und hoch angesetzte, kräftig ausgeprägte Wangenknochen. Ihre Zähne waren stark und weiß, die unteren Schneidezähne standen leicht vor. Ihre Augen sahen einen nicht gerade an, sondern immer ein wenig von der Seite. Ihr Blick war scharf und abschätzend und hochmütig. Es waren Augen wie aus einer alten Legende, wie Penthesileas Augen, vielleicht.
Yae. Man kann ihren Namen nicht übersetzen. Japanische Wörter drücken gleichzeitig die Bilder aus, die der Klang solcher Wörter erweckt. Yaes Name bedeutet »Achtfache Kirschblüte«, aber damit ist die volle Bedeutung noch nicht erfasst. Er bedeutet: der herrliche Anblick, wenn die meisten Bäume noch kahl sind und die Kirschblüten wie ein rosafarbenes Gewölk Berghänge und Flusstäler bedecken. Nun, man kann einfach in einer anderen Sprache nicht sagen, was der Name bedeutet. Jedenfalls hieß sie Yae. Ich habe immer gedacht, nichts kann uns trennen. Jetzt ist sie tot, und ein Teil von mir hat sich losgerissen. Ein Teil von mir wurde im Feuer vernichtet. Seitdem habe ich das Gefühl, es fehle etwas in meinem Körper. Irgendetwas ist nicht mehr da, wo es hingehört. Deswegen bin ich zornig.
Was übrigens damals den Baum betraf (es war eine Buche) – mein Vater ließ ihn fällen. Eine seiner Ruck-zuck-Methoden. Aber zuerst verpasste er mir eine Ohrfeige, dass mir Hören und Sehen verging. »Eines Tages«, herrschte er mich an, »wirst du dir deinen dummen Schädel brechen!«
Ganz unrecht hatte er nicht: Ich war zweifellos intelligent, aber mir schien es an Verstand zu fehlen. Tatsache war, dass ich keinen Sinn für Gefahr hatte. Aber ich kam fast immer ohne größeren Schaden davon. Schrammen, blaue Flecke, eine Gehirnerschütterung – schlimmer traf es mich nie.
»Du hast einen guten Schutzengel«, pflegte Inge zu sagen. Engel, das waren für mich diese nackten, rosigen Wesen, die Speckfalten und goldene Flügel hatten und die sich in unserer Barockkirche unter der Decke tummelten. »Putten« nannte man diese gepuderten kleinen Ferkel. Die waren nichts für mich; die waren für Franziska – Frenzel genannt –, die Heiligenbilder sammelte und schon mit sieben Jahren den Rosenkranz auswendig konnte. Ave-Maria, eine halbe Stunde lang und in allen Variationen.
In unserem Haus war schlechtes Blut. Ein Überbleibsel von Inzucht, ein Gift, das in unserem protzigen Stammbaum vor sich hin moderte. Das Gift regte sich umso ärgerlicher, je mehr wir es vor uns selbst und den anderen verheimlichten. Wir kratzten uns im Verborgenen da, wo es juckte. Wir hatten alle mehr oder weniger einen Dachschaden, wenn nicht Schlimmeres. Sogar mein Vater, der ganz gesund aussah, war schon mit zweiundvierzig moribund, körperlich zerrüttet, eine Jammergestalt. Und ich selbst schleppe achtzig Jahre später noch immer meine Neurosen mit mir herum und gehe nicht hops, obwohl ich mich gründlich satthabe.
»Ich habe so viele hässliche Sachen gesehen«, sagte mir unsere alte Kinderfrau Inge, als ich 1962 zum ersten Mal wieder nach Deutschland kam und sie im Altersheim besuchte. »Eigentlich warst du ordentlich und gut. Und das, was du angerichtet hast, hat dir Gott längst vergeben. Nicht wie deine Schwester Amanda. Nur der Himmel kennt ihre Sünden! Die gnädige Frau Baronin hat jahrelang versucht, sie vor der Verdammnis zu bewahren. Ich ging mit ihr nach Berlin. Amanda trat in einem Kabarett auf. ›Schall und Rauch‹ hieß diese Lasterhöhle! Und Amanda, ach du lieber Jesus! Nackt war sie, splitternackt! In ihrem Alter …«
Inge bekreuzigte sich hektisch, als ob ihr der Leibhaftige als Nackedei in seiner tollsten Stunde erschienen sei.
Nur Amanda, die am wenigsten Geschädigte von uns allen, gab ihrer Rebellion eine artistische Form, was ich bewundernswert fand und Inge pornografisch. Von der gnädigen Frau Baronin, meiner Mutter, ganz zu schweigen. Ende Juli hatte ich also einen Schlaganfall. Ich kam von meinem täglichen Spaziergang zurück, schleppte das gefüllte Einkaufsnetz, als mir schwarz vor Augen wurde. Und als ich zu mir kam, beugte sich eine Krankenschwester über mich und fragte, wie ich mich fühlte. Sie war hübsch, mit einem Grübchen am Kinn. Ich hätte ihr gerne zugelächelt, aber die Hälfte meines Mundes war empfindungslos, und ich konnte kaum die Zunge bewegen.
Ich schlief eine Weile. Als ich die Augen öffnete, saß Dr. Kobayashi an meinem Bett. Er nahm meine rechte Hand, und ich antwortete mit leisem Druck. Die Linke lag da, schwer und kalt wie ein fremder Gegenstand. Dr. Kobayashi erzählte mir, dass Nachbarn gesehen hätten, wie ich vor meinem Gartentor zusammenbrach. Sie hätten mich unverzüglich zu seiner Praxis am Ende der Straße geschleppt, und er hätte dafür gesorgt, dass ich ins Krankenhaus kam. Zwei Wochen lag ich da. Um mich zu drehen, musste ich den linken Arm mit der Rechten heben. Nach einigen Tagen bewegten sich die Finger wieder, Griff um Griff. Berührte ich meinen Arm, war das Gefühl darin dumpf, aber es war vorhanden. Ich konnte auch wieder sprechen. Dr. Kobayashi meinte, dass ich Fortschritte machte. Und tatsächlich, nach den ersten Bewegungen, nach den ersten Worten dauerte es nicht lange, bis ich meinen Arm wieder zu bewegen vermochte, jeden Tag ein wenig mehr. Ich konnte mich aufsetzen, und Keiko, die niedliche Krankenschwester, stützte mich, während ich meine ersten Schritte machte. Sie hatte ein madonnenhaftes Lächeln, Keiko. Die innere Beuge ihres Armes war weich und zart, und für eine Japanerin hatte sie üppige Brüste. Ich spürte sie durch ihren dünnen Kittel. Die Lüsternheit schwebte in den nebelhaften Dämmerbezirk meiner Seele, fernab der Impotenz des realen Lebens. Ich tätschelte Keikos Arm als Ersatz. Sie tat so, als merkte sie es nicht, während sie mich durch die Gänge zog. Sie brachte mich auch zum Lokus und wartete taktvoll vor der Tür, bis ich fertig war. Als ich nach Hause konnte, hätte ich sie gerne mitgenommen. Wie meine Pantoffeln oder den Bademantel. Eine Frau, die mir die nassen Unterhosen wechselt, ihre Nippel wie einen Schnuller in den Mund schiebt. So weit war es also mit mir gekommen. Keiko selbst musste froh sein, dass sie mich los war. Es gab Patienten, die charmanter waren. Ich bin krumm und so dünn, dass mein Schatten Löcher hat. Der linke Winkel des Mundes und das linke Augenlid sind herabgezogen, diese Seite meines Gesichts sieht immer verdrossen aus. Was meiner Gemütsverfassung bestens entspricht. Immerhin meint Dr. Kobayashi, ich hätte keinen dauerhaften Schaden erlitten, und verordnet mir Ruhe. In der brütenden Augusthitze kann ich mich ohnehin kaum bewegen. Kazuko kauft für mich ein, bringt mir warmes Essen aus der eigenen Küche. Hierzulande helfen die Nachbarn einander. Kazukos lethargischer Mann sitzt in irgendeinem Verwaltungsrat und geht nächstes Jahr in Rente. Kazuko freut sich nur mäßig darüber. »Was mache ich mit dem Alten, wenn er den ganzen Tag zu Hause herumlungert? Ihr einziger Sohn ist mit seiner Familie nach Osaka gezogen. Kazuko wird zweiundachtzig, sieht aus, als könnte sie ein Hauch davonwehen, und sprüht wie ein junges Ding vor energischer Tatkraft. Ich kann nur neidisch sein. Und es bedrückt mich, dass ich nur meine Kremation im Kopf habe und mich anderen gegenüber so wenig erkenntlich zeige. Doch ich fühle mich je länger, je schwächer dazu. Außerdem schlucke ich Medikamente, die meine Wahrnehmung trüben. Ich sehe Bewegungen zwischen Fenstertür und Blumentöpfen. Verschwommene Formen regen sich da. Eigentlich ahne ich sie mehr, als dass ich sie sehe, aber sie erinnern mich eindeutig an meine Eltern. Nachdem ich mich vor einigen Tagen so vieldimensional an früher erinnert hatte, macht mich ihre hartnäckige Präsenz reizbar. Denke ich an die Verstorbenen, gehen meine Gedanken eigene Wege, überschreiten unbefangen jenen Punkt, an dem alle fernen Dinge zu einer Vibration werden, dem wahren Leben ähnlich. Was ich ganz gut kann, ist, genuschelte Selbstgespräche führen, bis ich schläfrig werde und mich treiben lasse. Mein Rationalismus wehrt sich nicht im Geringsten dagegen. Und irgendwann geht in meinem Kopf etwas vor: Mein Hirn vollführt eine Art Drehung, blaue Flüssigkeit rieselt mir über die Augen, und zwischen den Tropfen glaube ich die Gestalten deutlicher zu sehen. Und jetzt nehmen wir mal an, dass sie wirklich da sind. Warum auch nicht? Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden, als eure Schulweisheit sich träumt, das sage nicht ich, das sagt Shakespeare. Wie dem auch sei, die Prozedur strengt mich gewaltig an und zerrt an meinen Kräften, aber ich merke intuitiv, wann der richtige Augenblick gekommen ist, wann ich die Erscheinungen festhalten muss, ehe die Wahrnehmung nachlässt. Und gelegentlich klappt es richtig gut. Mit Vater und Mutter, die aus einer Zwischenwelt auf mich herabblicken, habe ich, wie man anno dazumal sagte, »ein Hühnchen zu rupfen«, und zwar ein ganz fettes. Davor graut mir, ehrlich gesagt. Aber ob es mir gefällt oder nicht, zwischen uns besteht ein Blutsband. Und es kann ja sein, dass wir unsere gemeinsame Paranoia loswerden und uns – na ja – irgendwie ergänzen. Aber zuvor muss ich mit den alten Herrschaften eine Anzahl unerfreulicher Gespräche führen, anders kommen wir ja nicht vom Fleck. Ich verzichte also darauf, die aufdringlichen Gäste zu vertreiben, und wir unterhalten uns.
2. KAPITEL
EHRENWERTER HERR VATER
Mutter soll sich – bitte schön – gedulden. Ich kann mir schon erlauben, ein wenig unhöflich zu sein. Im Jenseits ticken die Uhren nicht mehr. Kein Pendelschlag skandiert den Tagesablauf: Frühstück, Mittagessen, Fünfuhrtee, Diner. Wir Kinder hatten auf die Minute pünktlich zu sein, beide Hände auf der Stuhllehne, bis man uns zum Sitzen aufforderte. Sonst wurde uns die Mahlzeit verdorben. Und da für die Frau Mutter die Zeit kein Problem mehr ist, nehme ich mir zunächst den alten Herrn vor. Als Hors d’œuvre sozusagen. Und da steht er auch schon, in langen Unterhosen, und sieht lächerlich aus. Ich bestehe auf dem »Du«, eine Unverfrorenheit in Anbetracht früherer Sitten, als man in vornehmen Kreisen nicht nur bei Tisch, sondern auch im Ehebett »Sie« sagte. »Habe ich Sie erfreut, meine Teure?« Etwas in dieser Art.
»Du bist mit zweiundvierzig gestorben. In Wirklichkeit begann dein Totsein viel früher. Nicht lange nach der Pubertät, nehme ich an.«
Der alte Herr versteht nichts von Psychologie.
»Was soll das heißen? Drücke dich gefälligst klar aus.«
»Das soll heißen, dass du keine eigene Meinung hattest. Du warst ziemlich auf Draht, wenn es um Geschäfte ging, das war schon alles. Die ganze Welt war für dich nur schwarz oder weiß.
Mutter war lilienweiß, wir Kinder waren schwanenweiß, und du warst Lohengrin.«
Er versteht auch nichts von Symbolen.
»Was redest du dir da zusammen? Ich hatte Krebs!«
»Und Metastasen im ganzen Körper. Keine Hoffnung auf Genesung. Und trotzdem musstest du dich im Sterben quälen. Hast dich töricht an dieses schmerzvolle Leben geklammert.«
»Das war eine Verpflichtung. Unser Name, man musste sich darum kümmern. Das waren wir unserem Geschlecht schuldig. Dein Großvater ist würdevoll gestorben. Er hatte noch Ehre im Bauch.«
Ich erinnere mich gut an Großvater, der den alten Gästeflügel unseres Schlosses bewohnte und an einem Augustnachmittag, bei brütender Hitze, plötzlich in den Hortensien lag. Man holte den Arzt, aber da war nicht mehr viel zu machen.
»Hatte er nicht Hämorriden?«
Eugen Heinrich, Baron von Gersdorff, ist peinlich berührt. Für ihn bestand ein Individuum nur bis zur Gürtelschnalle.
»Alexander, du bist ungehobelt. Großvater Willibald stellte für uns die Fortdauer dar, die Ordnung, die Ehre. Sein Name soll erhalten bleiben. Er war ein Grandseigneur.«
»Zumindest war er konsequent.«
Großvater Willibald war mütterlicherseits ein Wittelsbacher. Ein Repräsentant des alten Standes und gleichzeitig ein Original. Er war ein berüchtigter Misanthrop. In Japan wäre er Mönch geworden und hätte auf der Suche nach Erleuchtung morgendlich die klösterlichen Fußböden poliert. Er war dafür bekannt, dass er äußerst widerwillig an mondänen Anlässen teilnahm – und dafür berüchtigt, dass seine Zugehörigkeit zum Ritterorden des heiligen Johannes des Täufers zu Jerusalem von Rhodos und von Malta sein einziger Gesprächsstoff war. Womit er seine Zuhörer, die das alles längst auswendig kannten, je nach Neigung zum Lachen oder zum Gähnen brachte. Dabei hatte er nicht einmal etwas dafür getan. Die Diplome waren seinem Vorfahren Maximilian, sattsam als Schurke bekannt, Ende des siebzehnten Jahrhunderts überreicht worden. Dieser war durch den Salzhandel mit dem Malteser Ritterorden reich geworden und hatte Schloss Eichenhof mit dem nicht sehr sauberen Geld der Johanniter erbaut. Großvater Willibald sah großzügig darüber hinweg. Für ihn waren die Tempelritter die Verkörperung von Adel, Mut und Ehre. In seiner weltfremden Art hatte er wiederholt verkündet, dass er das Schloss bis über seinen Tod hinaus bewohnen würde. Wie er sich das vorstellte, war unklar, denn wir hatten nicht, wie manche Leute gleichen Standes, Grabsteine unter den Wohnzimmerfenstern. Memento mori, immer vor der Nase. Was Großvater betraf, erfuhren wir des Rätsels Lösung erst an seinem Sterbebett. So makaber sie auch sein mochte, hatte die Inszenierung zweifellos Stil. Aber davon später.
Während mir das alles durch den Kopf geht, meint mein ehrenwerter Herr Vater, ein bisschen Moral würde mir guttun.
»Du solltest deinen Großvater seiner Konsequenz zuliebe achten.«
»Ich achte ihn ja auch. Großvater war ein Exzentriker. Ich achte DICH nicht sehr hoch!«
»Ich konnte nicht stolz auf dich sein«, meckert mein unfreundliches Phantom. »Du hattest Glück und bist gesund auf die Welt gekommen. Du trugst eine Verantwortung.«
Hoppla. Die Bemerkung hätte er sich ersparen sollen. Der Bumerang saust sofort auf ihn zu.
»Täusche ich mich, wenn ich den Eindruck habe, dass hier von Rudolph die Rede ist?«
Sein Schatten bewegt sich unruhig. Sogar im Jenseits belastet ihn das schlechte Gewissen.
»Rudolph? Wir hatten ihn den Nonnen anvertraut, das hast du ja noch miterlebt. Es war eine vernünftige Lösung.«
»Ich will jetzt nicht darüber diskutieren«, sage ich, »ob die Lösung vernünftig oder unvernünftig war. Mir kommt eher das Wort Heuchelei in den Sinn.«
»Es war eine bittere Prüfung für uns alle. Deine Mutter hat sich zu Tode geschämt.«
»Geschämt, wieso eigentlich?«
»Du warst zu jung, um das zu verstehen. Jedenfalls habe ich dafür gesorgt, dass die Sache in Ordnung kam. Es war nicht leicht für uns, glaube mir. Und es wäre entgegenkommend von dir, wenn du uns allmählich deine Vorwürfe ersparen würdest.«
»Du machst es dir leicht«, sage ich. »Und ich will sogleich etwas hinzufügen, das du noch weniger gern hören wirst: Wäre Darina meine Frau geworden, hätte sich unser müder Stammbaum erholen können.«
Kaum ist’s gesagt, brodeln im Jenseits Gewitterwolken. Jupiter höchstpersönlich kündigt sich an. Mit Donner, Blitz und Hagelsturm.
»Hast du noch die Unverfrorenheit, ihren Namen zu nennen? Diese elende kleine Dirne!«
Ich merke, dass ich mit den Zähnen knirsche wie ein Kater, der einen Vogel sichtet, was dem Messerwetzen sehr nahekommt. Aber ich habe gelernt, mich zu beherrschen. Ich lasse den Hagel prasseln und ziehe nicht den Kopf ein.
»Du und ich werden immer unsere Meinungsverschiedenheiten haben. Darina war keine Dirne.«
»Der Vater war ein bulgarischer Zigeuner! Er war für die Landarbeiten gekommen, fuhr den Mist mit Pferd und Wagen auf die Felder. Jozif – so war doch sein Name – stank nach Jauche und schnäuzte sich zwischen den Fingern, ja, selbst in meiner Gegenwart. Pfui Teufel! Einmal habe ich ihm mein eigenes Taschentuch gereicht.
Ich hatte die Güte, ihn als Gärtner anzustellen, habe ihn und seine Frau vor der Misere bewahrt. Aber Undank ist der Welt Lohn! Paula, die alte Vettel, pflückte nachts das Obst von den Bäumen, stahl unsere Eier. Einmal hat sie sogar eines unserer Ferkel geschlachtet. Von der Muttersau angeblich zertrampelt. Die dreimal verfluchten Schurken wurden immer anmaßender. Und am Ende haben sie sogar versucht, mich zu erpressen!«
Ich bewahre meine Geduld und entgegne: »Die Eltern mögen Aasgeier gewesen sein. Aber falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, Gauner kommen in den besten Familien vor.«
»War das eine Anspielung?«
»Das war eine. Darina hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun!«
»Himmel, Alexander! Sei kein Idiot. Glaubst du allen Ernstes, die Eltern hätten diese Sache ausgeheckt, ohne dass die Tochter davon wusste? Und was im Nachhinein mit dieser Schnepfe geschah, bestätigte doch ihr schlechtes Gewissen.«
Den Dingen in meinem Kopf kann ich auf rationale Art nicht ganz beikommen. Aber ich beherrsche mich.
»Unter uns gesagt, Vater, ich würde dich gerne umbringen. Zu deinem Glück ist die Sache schon erledigt. Im Gegensatz zu dir habe ich mir ein verdammt langes Leben zugelegt. Und alles bekommen, was ich wollte. Jedenfalls fast alles.«
»Allmächtiger! Da gibt es nichts, womit du prahlen könntest! Es sagen mir die Sterne, dass du ein Verbrecher bist! An deinen Händen klebt Blut!«
»Ich war im Krieg.«
»Oh, Hölle und Pferdemist! Erspare mir dein Heldenepos an der chinesischen Front. Ich rede von dem, was du Onkel Günther und mir angetan hast! Du hättest an einem Strick baumeln sollen!«
»Ich habe einen starken Lebensfaden, Vater. Wo er auf andere Lebensfäden trifft, nutzt er sie ab.«
Dass ich ein harter Brocken war, stand außer Zweifel. Sonst hätte ich es nicht überstanden. »Wir waren festgenagelt in Schützengräben«, setzte ich fort, »der Haufen der Gefallenen wurde immer höher, und die meisten Verletzten krepierten unter den Händen der Herren Militärärzte. Und lass dir bloß nicht sagen, menschliche Haare können sich nicht sträuben: Das gibt es!«
»Ja, was hast du denn erwartet?«, sagt Vater. »Dass man dir die Stiefel putzt und Blumen überreicht? Und überhaupt, was soll das Gejammer? Das alles hast du dir selbst zu verdanken!«
Meinem Vater machte die Welt wenig Kopfzerbrechen.
»O nein!«, sage ich.
»O nein, was?«
»Das alles habe ich DIR zu verdanken! Willst du es nicht endlich zugeben?«
Viele Jahre später sagte Toyohisa zu mir, als ich ihm den Schlamassel schilderte: »Die Jugend wartet begierig auf Marschbefehle. Aber das Alter kann nur rückwärtsblicken auf traurige Erinnerungen und hoffnungslose Träume.«
Das traf auf mich zu wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Schlimmer noch: Ich hatte mich in Marsch gesetzt, ohne dass ich gerufen wurde. Ich hatte ja noch nicht das legale Alter erreicht. Seither weiß ich, dass ich als Narr losmarschiert war, und meinen Doppelweg – den inneren und den äußeren – am Nullpunkt der Weltkenntnisse begonnen hatte. Aber der Weg entsteht nur dadurch, dass die Menschen ihn durchschreiten. Leider können ihn die meisten nicht zu Ende gehen. Der Metzger der Weltgeschichte dreht sie durch den Fleischwolf. Was bleibt, sind Soldatenfriedhöfe und Kreuze wie abgenagte bleiche Knochen, in Reih und Glied aufgestellt, so weit das Auge reicht.
»Du hast mich nie verstanden, du Grünschnabel!«, fängt das Phantom nun wieder an. »Hunderttausende trugen ihre Haut zu Markte. Und so viele sind gefallen! Ich hatte Angst um dich. Mein Leben mochte mir gleichgültig sein, deines aber war mir teuer.«
Er redet wie in einem Theaterstück. Ich hätte beinahe gelacht. Denn der Herr Baron war nie einberufen worden. Sein Kampf fand nur in seinem Bauchfell statt. Die Krebsforschung steckte noch in den Kinderschuhen. »Eine heimtückische Krankheit«, nannte man es damals. Es stimmt ja, Vater hat viel gelitten. Und jetzt tut es mir fast leid, dass ich ihn so gehasst habe. Die Zeit vergeht, die Wut ist weg. Was bleibt, sind der Schmerz und danach – im Alter – der Rückzug in sich selbst.
»Pass auf«, sage ich. »Wir brauchen uns doch gegenseitig nichts vorzumachen. Heute verstehe ich dich, irgendwie.«
»Aber warum erst jetzt?«
»Weil du mich verrückt gemacht hast. Ursache und Wirkung, ja?«
»Günther sagte, DU hast dich selbst verrückt gemacht. O mein Gott! Du hast ihn auf dem Gewissen, weißt du das?«
»Onkel Günther war ein Arschloch.«
Ach, der Raum und Zeit übersteigende Groll und die sonderbare, mühelose Welt, in der man sich alles sagen kann! Das Gefühl ist eigentlich recht angenehm.
»Alexander! Nicht diese Ausdrücke! Wenn du mal mit ihm sprechen würdest … Das geht doch. Ich meine, du sprichst ja auch mit mir …«
»Bist du noch bei Trost? Willst du, dass ich kotze?«
»Was soll deine Mutter sagen, wenn sie dich so reden hört?«
»Was soll sie sagen? Nichts. Der lüsterne Bock war ja bei ihr ein gern gesehener Gast.«
»Worauf zum Teufel willst du hinaus?«
»Ich? … Ich rufe dir nur in Erinnerung, dass der Kerl Talente hatte, die du nicht hast. Weißt du noch? Er kam am Sonntag nach dem Kirchgang und ließ sich verwöhnen. Eine leckere Mahlzeit, Dessert und Kaffee. Und nach dem Portwein durfte er Anna unter die Röcke grapschen.«
Bei der Anspielung auf erfolgten Ehebruch kommt meinem Phantom die Galle hoch.
»Pfui, Alexander, mir reicht’s! Günther war ein Lackaffe, das gebe ich zu. Aber was du da begehst, ist Rufmord. Jedenfalls habe ich nie Derartiges bemerkt.«
»Das glaube ich dir sofort. Du warst ja pausenlos mit dir selbst beschäftigt.«
»Hör mal, ich hatte eine Beule im Bauch, die schief heraushing und immer dicker wurde …«
»Das war die Strafe der Götter.«
»Warum der Götter? Es gibt nur einen einzigen …«
Ich bin ihm nicht mehr böse, aber ich habe ihn satt.
»Los,Vater, geh jetzt!«
Er lässt es sich nicht zweimal sagen, löst sich auf, wie Rauch, und entschwindet beleidigt durch die Fenstertür. Das wär’s dann gewesen. Aber das Gespräch hat mich müde gemacht. Ich drehe mich auf die Seite und schlafe ein.
3. KAPITEL
ZWEIFELLOS DIE SCHÖNSTE FRAU DER WELT
Als wir in japanischer Gefangenschaft waren, hatten viele von uns nachts Träume vom Fliegen. Ich fragte, wie hoch sie flogen, ob andere zuschauten und ob das Fliegen mühelos oder anstrengend war. Im Lager sprachen wir offen darüber. Einige sagten, dass sie mit den Armen ruderten, um Höhe zu gewinnen. Andere traten die Luft, als ob sie Fahrrad fuhren. Ich selbst glitt mühelos über die Menge hinweg und sah das Land von oben. Und in dieser Nacht – etliche Jahrzehnte später – führt mich mein Traum nach Oberbayern, an der Grenze zu Österreich. Ich kreise über meine Geburtsstadt Burghausen so mühelos, wie ein Vogel kreist. Meine Arme schweben in der Luft, als habe ich vergessen, dass ich sie ausgebreitet habe. Die alte Burg zieht unter mir vorbei. Die niederbayerischen Herzöge haben sie – mit viel Geld und zur eigenen Glorie – auf einer felsigen Hochfläche errichtet. Diese Hochfläche, einer Steilküste ähnlich, präsentiert sich nicht weniger schroff als die Befestigungswälle. Ich sehe die Ringmauer weit, weit unter mir, sie ist bemerkenswert lang. Die längste der Welt, habe ich mir sagen lassen.
Im Sinkflug wende ich mich jetzt nach rechts. Schloss Eichenhof – unser Schloss – stand einst auf einem Hügel außerhalb von Burghausen, an einer Schleife der Salzach. Auf einer Seite fallen die Wiesen bis an die Ufer des Stroms, und gegenüber bilden die Wälder eine dichte schwarze Wand. Ich gleite tiefer und sehe, dass da kein Schloss mehr steht. Aber ich will den Wald nicht so bald verlassen und ziehe eine Weile Kreise über dem Ort. Ein Erkundungsflug. Ich fühle dabei eine Art Vakuum in mir, eine Übelkeit. Das Schloss besteht in einem Anderswo, das ganz nahe ist. Einem Anderswo, das vibriert. Und auf einmal glaube ich zu sehen, wie Schloss Eichenhof sich – leicht schwankend – aufrichtet und vergrößert. Die Wände streben seitwärts hinauf, scheinen an Form und Substanz zu gewinnen. Ich schwebe näher heran, und das Schloss steht vor mir, wie ich es gekannt habe. Meine Eltern hatten das Gut nie richtig instand gesetzt. Das schwere Ziegeldach senkt sich an den Giebeln, der alte Turm steht schief, die Außenwände zeigen Risse und Flecken. Ich sehe auch den Weg, der in vielen Kurven durch den Wald führt. Erst nach der letzten Biegung kommt das Haus in Sicht. Zwischen den kreisförmigen Rasenflächen, in deren Mitte ein kleiner Springbrunnen plätschert, war der Hof gepflastert worden. Vater besaß als einer der Ersten in Deutschland einen Daimler Phoenix dreiundzwanzig, auf den er sehr stolz war. Fuhr er mit seinem Automobil in einer Benzinwolke bis zur großen Freitreppe, hielten sich alle die Nase zu und fanden es ungeheuer fortschrittlich. Die Steintreppe, schön in den Proportionen, führt zu einer offenen Veranda und von dort zur Eingangstür. Auf der Veranda standen im Sommer Korbstühle und Tische. Man konnte im Schatten sitzen und die Terrassen und Rosengärten überblicken. Weiter unten zieht sich das Gelände, mit Eichen bewachsen, bis zur Salzach hinunter. Nach wie vor ist die Böschung steil. Man hatte uns Kindern verboten, dort zu spielen. Denke ich zurück, scheint alles irgendwie ins Unwirkliche entrückt. Achtung, jetzt komme ich in Bodennähe, schwebe die Treppe empor. Die mit Haken und Riegel versehene kastanienbraune Tür ist geschlossen. Ich bewege mich einfach hindurch. Jetzt bin ich drinnen, betrachte die hohen Räume mit ihren Stuckaturen und an den Wänden die Reihen der Vorfahren in Harnisch oder Krinoline. Wie die alten spanischen Könige sehen alle degeneriert aus, zu fett, zu dünn, zu bleich. Ich komme an wuchtigen Schränken vorbei, an Sofas mit Brokatbezug, an Ohrensesseln. Durch die schweren Vorhänge schimmert ein Streifen Licht. Vor einem Fenster steht der Sessel meiner Mutter, davor ihr kleiner Schemel mit einer Petit-Point-Stickerei auf dem Fußpolster. In der Erinnerung sehe ich sie dort sitzen, Kreuzworträtsel lösend oder mit einem Buch in der Hand, auf dem Gesicht die modische Melancholie. Wir – die Kinder – bewohnten das Stockwerk über der »Beletage«. Dort befand sich auch unser Klassenzimmer. Man achtete sehr darauf, dass wir uns ruhig verhielten. Mutter litt an Dysmenorrhö und war sehr lärmempfindlich. Was es mit dieser Krankheit auf sich hatte, wussten wir nicht, allein der Name war schon schlimm genug. Flüsterte uns Inge bedeutsam zu: »Die gnädige Frau fühlt sich unwohl«, gingen wir wie auf Eiern.
Und jetzt wandere ich umher, sehe alle Dinge mit Geisteraugen, verschwommen, wie ein Kurzsichtiger sie wahrnehmen würde. Denn das Haus ist ja nur die Erinnerung eines Hauses. Es gehört zu den Toten, die einst die Räume bewohnten, zu den früheren Generationen, die es ihren Bedürfnissen und ihrem Geschmack entsprechend eingerichtet hatten. Meine Blicke gleiten über die Lampen, die Ziervasen, die Wandteppiche, die Statuen, die Uhr auf dem Kamin, den großen Flügel, den Kronleuchter mit seinen Kristallen. Alles scheint voller Augen, tausend tote Augen, die mich beobachten. Und ich sehe einen Jungen durch verlassene Räume wandern, sehe sein Antlitz in Spiegeln schimmern, ein bleiches Vorüberstreichen. Der Junge ist eine andere Person in einem anderen Leben. Und doch ist er ein Stück von mir. Ahnt dieser Junge, dass er nur ein Scheinbild ist, dass ihn der Mann, der er geworden ist, erträumt?
Im Oktober 1944 wurde Schloss Eichenhof von einer Brandbombe zerstört. Es war ein sehr trockener Herbst, auch die umliegenden Bäume brannten wie Fackeln. Was übrig blieb, waren verkohlte Ruinen. Und heute steht dort ein Kongresshotel.
Als ich erwache, leuchtet die Morgensonne aprikosenfarbig. Ich weiß sofort, wo ich bin und dass ich geträumt habe. Ein leichter Schwindel erfasst mich. Ich taste nach meinem Glas Wasser. Nach einigen Versuchen und Flüchen gelingt es mir, das Glas an den Mund zu heben. Dann schäle ich mich aus dem Bett, schleppe mich ins Badezimmer. Ich ziehe mein Yukata aus – das übliche japanische Hausgewand –, hocke mich auf den niedrigen Plastiksitz vor dem Wasserhahn, der aus der Wand herausragt. Dann fülle ich Wasser in eine Plastikschüssel und gieße es mir über den Kopf. Nächster Schritt: einseifen und Haare waschen. Anschließend reibe ich mir mit einem Waschlappen den Schaum vom Körper. Zum Schluss gieße ich mir eine zweite Wasserladung über den Kopf. Die Badewanne ist zu groß, zu tief. Ich kann die Beine nicht hoch genug heben, um hineinzusteigen. Immerhin bin ich jetzt sauber. Ich trockne mich ab, streife den Yukata über und ziehe die Gürtelschärpe fest zu. Dann gehe ich in die Küche und mache mir mein Frühstück zurecht. Ein langer, heißer Tag steht mir bevor. Was soll ich mit diesem Tag anfangen?
Zunächst – wie jeden Morgen – begrüße ich Yae. Humpelnd trete ich näher an das Bild heran. Diese Frau ist so einzigartig. Mein Gott! Ich bin fast glücklich darüber, dass sie sich nie verändern wird und das Alter ihr nie etwas anhaben kann.
Ich versuche mein Gleichgewicht zu halten und verbeuge mich leicht.
»Guten Morgen, Liebste. Ich wünsche, dass dir heute ein guter Tag beschieden sein wird. Ich wünsche, dass dir heute alles Schöne zuteilwird. Ich wünsche, dass du mich in alle Ewigkeit liebst und auf mich wartest. Ich wünsche, dass du mir hilfst, deiner würdig zu sein.«
Danach wanke ich wieder auf den Futon zu und lege mich ächzend nieder. Diese Schwäche! Ich muss mich ablenken, pausenlos an etwas anderes denken. Aber Erinnerungen haben die fatale Neigung, sich selbstständig zu machen. Ob ich will oder nicht, ich denke immer wieder an den Augenblick, als ich Yae zum ersten Mal sah.
Damals – nach Toyohisas Tod – wohnte ich eine Zeit lang bei seinem Sohn Tomohisa. Eigentlich war ich die meiste Zeit allein. Tomohisa fuhr täglich zur Hafenstadt Yokohama. Ihm gehörten dort einige Küstenfrachter und ein Fährschiff, das zweimal am Tag die Inseln anlief.
Es war kurz nach Neujahr. Der Winter hatte spät eingesetzt, und der erste Schnee war leicht und trocken. Es war an einem Morgen nach solchem Schneefall, als die Luft voll von der kühlen Sonne war und die Erde weiß und glitzernd dalag. Ich saß mit einer Zeitung an der Fenstertür. Die japanischen Schriftzeichen hatte ich schon als junger Soldat gut gelesen. Ich entsinne mich, wie im Garten der Bambushain mit seinen gefiederten Wipfeln so schneebeladen war, dass er aussah, als sei er mit weit aufgespannten Regenschirmen übersät. Dann und wann vernahm ich ein dumpfes Rauschen, und eine weiche Schneewolke brach durch die Äste. Gerade hatte ich die Zeitung auf dem Tisch ausgebreitet, als ich im Garten das typische Schlurfen japanischer Sandalen hörte. Eine Frauenstimme bat um Einlass. Eine schöne Stimme, klangvoll und deutlich. Statt das Eingangstor zu benutzen, war die Besucherin durch den Garten gekommen, was bedeutete, dass sie eine Vertraute des Hauses war.
»Bitte, treten Sie ein«, rief ich freundlich.
Ein Schatten fiel auf den Neuschnee, ich hörte das Geräusch von Sandalen, die von den Füßen gestreift werden. Eine Frau schob mit leichter Hand die Schiebetür auf und stand vor mir, leuchtend wie ein Gemälde, in einem blau-roten Festkimono. Tiefblau wie das stürmische Meer, dunkelrot wie die winterliche Abendsonne. Der goldene Damast ihres Obi zeigte, prachtvoll hineingewebt, ein Muster von Fichtennadeln und Bambus. Ein silberner Pfeil steckte in ihrem hochgesteckten Haar. Sie blickte mich etwas seitwärts an, überrascht, aber keineswegs aus der Fassung gebracht. Nichts konnte Yae aus der Fassung bringen. Auch nicht die ungehobelte Art, mit der ich sie anstarrte, wo doch die elementarste Höflichkeit verlangt hätte, dass ich mich vorstellte und sie begrüßte.
Gewiss gab es recht hübsche Japanerinnen, aber eine solche Frau hatte ich noch nie gesehen. Sie war zweifellos die schönste Frau der Welt.
Errötend wie ein Schuljunge kam ich endlich auf die Beine, sprach die erforderlichen Begrüßungsworte, die sie mit freundlicher Verbeugung erwiderte. Wie ein Gemälde sah sie aus, ein Gemälde, das lebte und atmete.
Sie erklärte mir, dass sie eine von Tomohisas Nichten war, aber bis dahin in Kyoto gelebt hatte. Seit dem Sommer wohnte sie wieder in Tokio. Nach ihrer Rückkehr war es das erste Mal, dass sie ihren Onkel besuchte. In der Hand trug sie ein gefaltetes Tuch, wundervoll bestickt und kunstvoll verknotet. Darin war ein Geschenk, das sie ihrem Onkel überreichen wollte. Weil es Neujahr war, hatte sie gehofft, ihn zu Hause anzutreffen. Und jetzt war da nur dieser »Gaijin«, ein in der Reife seiner Jahre und kaum noch attraktiver Ausländer, der sie mit der Zeitung in der Hand unhöflich anglotzte.
Später erzählte mir Tomohisa, dass Yae verheiratet gewesen war. Nach kurzer Zeit war die Ehe in die Brüche gegangen. »Ihr Mann war ein Schwächling«, sagte er verächtlich. »Yae hat nicht lange gefackelt. Kinder sind nicht vorhanden. Das hat ihr die Entscheidung leicht gemacht.«
Und damit war die Sache aus der Welt geschafft.
Yae unterrichtete Kalligrafie. Sie war eine Meisterin. Ich würde sagen, es lag in ihren Genen. Seit Jahrhunderten waren die Frauen des Aizu-Clans für ihre Schönschrift bekannt. »Shodo«, die Kunst des Schreibens, nennen es die Japaner. Und wenn Yae die Zeichen für Wind, Feuer, Vogel, Blume oder Unendlichkeit ausführte, sah ich ihr Werk zugleich aus ihren Pinsel- und Atembewegungen entstehen, und es war ihre eigene Lebenskraft, die sich auf dem Papier widerspiegelte.
Sie hatte einen Herzfehler. Keiner wusste es, am wenigsten sie selbst. Sie brach zusammen, als sie unseren Altarschrein für das Ura-Bon-Fest reinigte, spuckte Blut und war tot. An und für sich hätte sie keinen passenderen Zeitpunkt wählen können: Ura-Bon ist das Willkommensfest für die zurückgekehrten Geister der Ahnen.
Außer den Erinnerungen, was ist heute von ihr geblieben? Ein paar Briefe, die ich nicht lesen will, Tuschbilder in himmlischer Vollendung, die ich nicht anschauen will. Staub im Sonnenschein und Schneeflocken im Winter. Das Leben wandert mit der Welt und den Sternbildern. Es zieht uns fort.
Die nächsten Stunden verbringe ich in Unruhe. Mir ist entsetzlich heiß. Ob ich wohl Fieber habe? Oder ist es die Einsamkeit? Aber die Einsamkeit ist meine natürliche Welt. Die Nähe des Todes vielleicht? Der Sensenmann ist ein großer Spaßvogel. Er schlägt zu wie der Blitz, wenn du ihn nicht erwartest, und tanzt Polka irgendwo in der Ferne, sobald du ihn herbeisehnst.
Was hatte Toyohisa einst gesagt?
»Wie das Universum hat auch der Mensch seinen Lebenslauf. Der Lebenslauf des Menschen deckt sich mit dem des Universums. Sterben bedeutet, das Gewand des Universums anzulegen. Eine Kleidung anzuziehen für den Körper und für die Seele. Es ist das Kleid des Todes. Es steht uns gut, mein Freund.«
Im Moment platzen mir noch die Nähte auf. Ich müsste mein eigener Hofschneider werden. Und dann – am jenseitigen Ufer – nur noch schnell einige Falten zurechtzupfen. Letztlich will ich doch gut aussehen. Ich werde gewiss Leute treffen, die ich kenne.
Ich habe nichts als meine Erinnerungen, um mir die Zeit zu vertreiben. Erst am späten Nachmittag kommt Kazuko Sato und erlöst mich. Bevor sie die Schiebetür öffnet, bleibt sie draußen stehen und ruft: »Guten Abend!« Ihre Stimme ist noch jugendlich, kräftig. Sie trägt einen hellen Kittel, und ihre Gestalt taucht wie ein Licht in dem dämmrigen Vorraum auf. Dort lässt sie ihre Sandalen von den Füßen gleiten, bevor sie hereintritt. Ihr Anblick macht mich froh. Sie hat eine spontane Herzlichkeit an sich, etwas Beschwingtes. Sie gleitet leichtfüßig über die alten Matten. Sie trägt weiße Tabi-Socken, bei denen der große Zeh wie der Daumen bei einem Fausthandschuh separat ist, sodass der Fuß die traditionelle Sandale gut halten kann.
»Alexander-San, wie fühlen Sie sich heute?«
»Scheußlich, wie denn sonst?«
Aber ich will höflich sein und entschärfe die Sache. Wir sind schließlich in Japan.
»Es tut mir leid.«
»Oh!«
Kazuko macht ein betroffenes Gesicht, wie es von ihr erwartet wird. Ich spule genussvoll mein tägliches Lamento ab: »Ich leide sehr, liebe Schwester«, und sie lacht sich ins Fäustchen. Sie kniet nieder, wobei sie mit müheloser Leichtigkeit ein Tablett in den Händen hält. Eigentlich bin ich nicht hungrig, aber beim Anblick der Speisen in ihrem Keramik-, Porzellan- und Lackgeschirr läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Kazuko ist eine gute Köchin.
»Alexander-San«, sagt sie mit Schalk in den Augen, »wann werden Sie endlich Geduld lernen?«
»Nicht mehr in diesem Leben.«
Es ist immer das gleiche Spiel zwischen uns: Ich jammere ihr die Ohren voll, und sie neckt mich.
»Bitte, setzen Sie sich hoch, Sie können ja sonst die Suppe nicht trinken. Warten Sie, ich helfe Ihnen.«
»Ich bin ein Wrack.«
»Ach!«, klagt sie verschmitzt. »Wir Frauen tragen ein schweres Los! Zuerst die Kinder, dann die alten Männer. Es hört einfach nie auf.«
»Was machen eigentlich Ihre Enkelkinder, Kazuko-San?«
Seitdem ihre Familie vor einigen Jahren nach Osaka gezogen war, hatte ich die Kinder nicht mehr gesehen. Damals gingen beide noch zur Schule. Der dreizehnjährige Yukio hatte Akne und fühlte sich miserabel. Er befand sich in einer Zeit der Zweifel, aber auf irgendeine Art war ich ihm zugetan. Es war, als trüge er eine Inschrift auf sich, die der Entzifferung harrte. Sie lautete: Du bist, wie ich war. Und doch war er nicht so wie ich. Wir sind Zufallskinder der Weltgeschichte: Die heutige Zeit ist keineswegs eine bessere Zeit. Sie ist eine andere Zeit. Es gibt keine Gebrauchsanweisung. Wer mit ihr nicht zurechtkommt, muss zusehen, wie sie vorbeigleitet.
Yukio gehört der heutigen Zeit.
Er sähe jetzt gut aus, meint Kazuko. Nächstes Jahr würde er mit dem Studium beginnen. Er hätte vielseitige Interessen. Was er denn studieren wolle? Ach, er hätte sich noch nicht entschieden.
»Heutzutage haben die Jungen die Wahl«, meint Kazuko. »Sie stehen vor dem Leben wie vor einem Festessen. Was schmeckt mir wohl am besten? Sie wissen es nicht.«
»Wir – wir hatten keine Wahl«, sage ich. »Man setzte uns Kartoffeln vor. Reis in Ihrem Fall, Kazuko-San.«
Sie versteht sofort, was ich meine.
»So desu«, so ist es, erwidert sie ernst.
Nun, die gute alte Zeit kann uns gestohlen bleiben. Gott sei Dank ist sie vorbei.
»Und Miwa?«, frage ich.
Yukios ältere Schwester war kräftig, eher untersetzt, wie halbwüchsige Japanerinnen es oft sind. Sie sehen charmant, aber tolpatschig aus. Ihr Haar war weich und kastanienbraun. Sie hatte Brauen, die über der Nasenwurzel fast zusammenwuchsen, und einen merkwürdig schweren, glatten Blick. Es war ein Blick, der nicht ihrem Alter entsprach, weil er so zeitlos schien. Sie trug noch ihre Schuluniform und spielte bei mir Klavier.
Nahezu in jedem japanischen Haus findet man ein Klavier. Auf dem schwarzen Lack liegt meistens ein Spitzendeckchen. Darauf stehen eingerahmte Bilder von Großeltern, Schwiegereltern und Kindern. Oft steht da auch eine Blumenvase. Einmal sah ich eine Urne auf dem Klavier. Das hat mir besonders gefallen. Man ist tot, aber man gehört dazu.
Und mir kommt in den Sinn: Miwa spielte Klavier, und ich fühlte so etwas wie Schwindel im Kopf, eine Rückwärtsdrehung des Gehirns. Ich hatte so etwas schon früher erlebt. Als ich das Mädchen betrachtete, bemerkte ich ihre langen, ausdrucksvollen Arme, die eher kleinen, aber breiten Hände. Die Finger waren gelenkig und stark. Ihr Gesicht war geistesabwesend, und ebenso geistesabwesend fühlte ich mich auch. Sie war ein Mädchen, das strahlte und gleichzeitig fern war. Ich hatte mich damals gefragt, ob die Helligkeit, die sie ausstrahlte, von innen her kam oder von ihrer porzellanweißen Hautfarbe. Wahrscheinlich traf beides zusammen, denn sie war einer von den Menschen, an denen eigentlich alles Licht ausströmt.
Und jetzt frage ich mich, was es zu bedeuten hat, dass mir die Klänge nach so vielen Jahren noch gegenwärtig sind.
»Beethoven«, sage ich laut. »Die Klaviersonate Nummer fünf.« Ein schwieriges Stück, aber sie spielte es ganz mühelos.
»Sie hat immer viel geübt«, sagt Kazuko. »Es macht ihr nichts aus, immer und immer wieder das gleiche Stück zu spielen. Sie will, dass es sich wunderbar anhört.«
»Wie alt ist sie jetzt?«
»Fünfundzwanzig. Wie die Zeit vergeht …« Während sie erzählt, stellt sie verschiedene Schalen auf den Tisch, hebt die Deckel ab, damit ich die schön angerichteten Speisen sehen kann.
Miwa hatte an der Staatlichen Hochschule für bildende Kunst und Musik in Tokio studiert. Dann hatte sie ein Stipendium gewonnen. Ja, und jetzt war sie in Wien, wo sie an der Musikhochschule im Hauptfach Orchesterdirigat studierte.
»Ihre Eltern hatten nichts dagegen, dass sie nach Europa ging. Sie ist eine vernünftige junge Dame.«
Ich dachte, diese junge Frau gibt sich den ganzen Tag mit etwas Vollendetem ab, um es zu erspüren und es zu verstehen. Der Mensch muss zu dem stehen, was er in sich trägt.
»Sie wird eine starke junge Frau sein«, sage ich, »eine beherzte junge Frau.«
»O ja, das ist sie!«
Kazuko sieht ihre Enkel nicht oft. Aber zu Neujahr würden sie mit den Eltern in Tokio sein. Dann sei die Familie endlich wieder beisammen.
Neujahr … Ich spüre, wie Tausende kleine Nadeln mir den Schädel durchlöchern. Es gibt Momente, in denen sich der Geist in Bewegung setzt und weit entfernte Erinnerungen viel näher erscheinen.
»Wenn der erste Frost kommt …«, sage ich, fast mehr zu mir selbst als zu Kazuko. Diese nickt.
»Zu Neujahr beginnt der richtige Winter.«
Ich hole tief Luft und sage, dass ich ihre Enkel gerne sehen würde. Gleichzeitig gebe ich jedoch zu bedenken, dass sie jung sind und ich ein alter Narr bin.
Kazuko bewegt lebhaft verneinend die Hand.
»O nein! Sie sind ein interessanter Mensch.«
Immerhin ist es schmeichelhaft, als »interessant« bezeichnet zu werden. Davon abgesehen, vielleicht bin ich zu Neujahr gar nicht mehr vorzeigbar. Das Altern verläuft sukzessiv. Täglich sterben Millionen von Zellen in mir ab. Die Pflanze verkümmert ganz methodisch, bevor sie an irgendeinem Mangel eingeht.
Merkwürdig ist der durch Suggestion erzeugte Denkvorgang. Etwas in mir hat sich geregt. Etwas Unterschwelliges steigt näher und näher an die Oberfläche meines Bewusstseins. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich weiß, dass ich es früher oder später erkennen und verstehen werde. Und der Akt des Erkennens und Verstehens wird für mich von großer Bedeutung sein.
4. KAPITEL
EHRENWERTE FRAU MUTTER
Kazuko hat das Geschirr zusammengeräumt und mir eine gute Nacht gewünscht. Ich bin wieder allein und finde keinen Schlaf. Doch es macht mir nichts aus. Die Ruhe, die mein Körper gefunden hat, die angenehme Wärme der dick wattierten Decke beschert mir ein vages Glücksgefühl, das mich gleichsam entspannt und zum Denken anregt. Das Licht in der papiernen Stehlampe verleiht dem Raum eine wohltuende, gedämpfte Helligkeit; kaum stärker gefärbt als die zartfarbige Safranblüte, beruhigt sie die Augen und schimmert auf den alten Tatami-Matten. Vierzig Jahre lang haben Yae und ich in diesem Haus gelebt. Eine lange Zeit, die in Windeseile vorbeiging. Jetzt bin ich hier der einzige Bewohner.
Wer durch die Straße geht, die so eng ist, dass zwei Wagen nicht aneinander vorbeifahren können, sieht zunächst nur das Schieferdach. Das Haus ist von einer Hecke aus Buchsbäumen umgeben. Auch jetzt noch kommt der Gärtner ein paarmal im Jahr und schneidet die Büsche. Ich gebe ihm keine Anweisungen. Der Gärtner ist fast so alt wie ich, trägt einen Hörapparat und versteht kein einziges Wort. Ein niedriges Eisengitter führt zwischen Blumentöpfen zu einem Kiesweg, dann zu zwei Steinstufen, auf denen Gießkannen, Besen und Schaufeln stehen. Unter dem Vordach ist ein kleines Glöckchen aus Bronze angebracht, das bei jedem Luftzug klingelt. Das Haus hat den Krieg unbeschädigt überstanden. Wir haben uns eine moderne Küche geleistet, ein elektrisch geheiztes Badezimmer.
Ich liege in einem großen, offenen Raum, der durch Schiebetüren aus Holzlatten und Reispapier in einzelne Zimmer abgeteilt werden kann. Die Tatami, die Matten aus gepresstem Reisstroh, sind mit einem schmalen Streifen Goldbrokat umrandet. Die Tapete aus grobfaseriger Seide ist an vielen Stellen zerschlissen. Gegenüber der Tür hängt ein Rollbild. Kakemono – Sache zum Aufhängen – nennen es die Japaner. Es sollte entsprechend den Jahreszeiten ausgewechselt werden. Seitdem Yae gestorben ist, habe ich das Bild nie angerührt. Die klassische Tuschmalerei zeigt einen Raben auf einem Zweig mit Pflaumenblüten. Es ist ein Frühjahrsmotiv, inzwischen hängt es das ganze Jahr da und ist rissig geworden, wie eine welke Haut. Rings an den Wänden stehen Kommoden aus dunklem Holz, mit vielen Schubladen und Eisenbeschlägen versehen. Auf den von mir gezimmerten Regalbrettern stapeln sich Bücher und Zeitschriften. Durch die Fusuma, die Schiebetür nach draußen, kann ich den Garten überblicken. Hinter der Glasscheibe befindet sich ein Mückennetz. Der Garten mit seinen Sträuchern leuchtet in allen Schattierungen von Grün. Die Moose sind mit alten Steinen verwachsen. In Frühlingsnächten schimmern die Magnolienblüten perlweiß. Jetzt ist Sommer, und das Vibrato der Glockenzikaden erfüllt die Luft; ein sonderbares Geräusch, als ob die Bäume schrillten.
Mir ist plötzlich heiß. Ich schwitze stark in der Nacht. Eine Alterserscheinung. Ich kann nur die Decke beiseitewerfen, sonst ist da nichts zu machen. Als ich nach dem Glas Wasser taste, bemerke ich hinter dem Moskitonetz ein flimmerndes Etwas. Stur, wie sie einst war, blickt die gnädige Frau Baronin aus der Zwischenwelt auf mich herab. Sie hat genug gewartet und fordert Einlass. Es passt mir überhaupt nicht, dass sie da ist.
»Was hast du hier zu suchen? Geh weg! Ich will dich nicht sehen!«
»Was gibt dir das Recht, mich zu duzen? Sei bitte höflich zu mir.«
»Ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist.«
»Alexander! Ich bin deine Mutter.«
»Soll ich jetzt jubilieren?«
Na gut, erledigen wir also die unerfreuliche Angelegenheit. Mutters Körper ist transparent, ich sehe den Garten durch sie hindurch. Sie hat einen Zustand erreicht, da alles Erinnerung ist, weit weg und unverbindlich. Und gleichwohl scheint sie mir wirklicher als die Wirklichkeit. Sie hält sich kerzengerade, als ob sie jetzt noch – im Jenseits – ein Korsett trüge. Zu ihren Lebzeiten lag der Umfang ihrer eingeschnürten Taille bei fünfzig Zentimeter. Sie war hochgewachsen und hatte eine etwas linkische Art, sich zu bewegen, die immer den Eindruck erweckte, als spiele sie in eine Theateraufführung die Rolle der Hausherrin. Sie war längst keine Schönheit mehr, aber nach wie vor recht anziehend und elegant.
»Du hast mit deinem Vater gesprochen. Und Verletzendes über mich gesagt.«
»Verletzend ist nur, was der Wahrheit nahekommt.«
»Ich war nicht glücklich.«
»Reiche Heirat, Ballfeste, Kaffeekränzchen, Jagdausflüge, Opernabende. Und du warst nicht glücklich?«
»Ich verstehe nicht, was das mit Glück zu tun haben soll. Das war doch eine Selbstverständlichkeit. Aber das Zusätzliche jeden Tag, nein, das war zu viel. Ich habe Eugen nie geliebt. Er war …« Sie sucht nach dem passenden Wort.
»Ermüdend«, sage ich.
»Ja, ermüdend.«
Sie waren Verwandte, das kam noch hinzu und war einer der Gründe, warum wir Kinder – jedes auf seine Art – einen gewaltigen Knacks hatten. Ehen zwischen Vettern und Basen wurden von gesellschaftlichen Zwängen diktiert und weil man den erweiterten Besitz in Rechnung zog. Scheidung kam nicht infrage. Wenn es trotzdem dazu kam, verwandelten sich die Männer in jammernde Moralapostel. Man bedauerte sie zutiefst. Ihre Stellung in der Gesellschaft nahm keinen Schaden. Die geschiedenen Frauen hingegen traf der Bannfluch. Sie zogen meistens in eine andere Stadt, führten ein entbehrungsreiches Leben und teilten ihr Bett mit brotlosen Künstlern. Für gewöhnlich starben sie an Tuberkulose.
Ich sage: »Und so ging das weiter mit deinem Leben. An der Achtung der Leute lag dir viel. Der Nimbus des Namens, nicht wahr? Du ludst kluge und intelligente Gäste ein, trugst deine Münchner Kleider und erlesenen Schmuck.«
»Nur Perlen.«
»Ein unfairer Tausch. Perlen für Kompromisse.«
Als Geist geruht Mutter eine Erklärung abzugeben.
»Dein Vater war grob zu mir. Mein Fleisch war innen empfindlich. Ich hatte Schmerzen. Ich wollte in Ruhe gelassen werden.«
»Ach ja, und Onkel Günther?«
Sie spielt die Unwissende. Sie kann es auch im Jenseits nicht lassen.
»Was hat denn der arme Günther damit zu tun?«
»Fellatio und Cunnilingus.«
»Alexander! Wie kannst du diese Worte in den Mund nehmen?«
»Oh, du hast etwas ganz anderes in den Mund genommen.«
»Alexander!«
Während ich ihr die Meinung sage, überkommt mich etwas Seltsames, ein Art multidimensionales Wahrnehmen. Ich sehe sie ganz nahe und gleichzeitig in der Vergangenheit, bei Tisch, wortkarg und gelangweilt. Wenn der Diener ihr die Speisen auf dem Silberteller präsentierte, winkte sie müde ab. Sie hatte nie Appetit, nahm nur ein paar Bissen. Ihr seltenes Lächeln betraf nur die Lippen, während die Augen über alle und alles hinweg ins Leere blickten. Sie zeigte nie ein Gefühl. Was sie sagte – wenn sie etwas sagte –, war kühl, prosaisch. Sogar als Phantom kann sie nur sprechen, wie sie immer gesprochen hat.
»Ach, der Günther, der kam jeden Sonntag. Ich brauchte ihn nie einzuladen. Das war bequem. Zudem lag mir nicht mehr viel daran.«
»Das ist nicht wahr.«
»Warum sagst gerade du mir das? Ich wollte malen. Malen war für mich das Wichtigste im Leben.«
Hier sprach sie tatsächlich die Wahrheit. Mutter hatte nie die Kunstakademie besucht. Das schickte sich nicht für eine Frau aus bester Familie, weil im Unterricht nackte Modelle auf einem Hocker posierten oder auf einem Bein standen. Doch sie hatte in der Malerei ihre ursprüngliche Ausdrucksform gefunden. Das schien niemanden zu interessieren. Es machte ihr nichts aus. Täglich zog sie sich für ein oder zwei Stunden in ihr Atelier zurück. Wenn es die Jahreszeit erlaubte, ging sie mit ihrem Skizzenbuch in den Garten und stellte ihre Staffelei auf.
Und ich erinnere mich: Hinter dem Haus lag eine Wiese, die ich von meinem Fenster aus gut sah. Diese Wiese war sehr schön. Im Frühsommer duftete der Flieder, der Holunder schaukelte seine Silberschirme. Im hohen Gras wuchsen Lupinen – gelbe und blaue – und andere Wildblumen. Über den Halmen schwirrten Libellen und Schmetterlinge. Mutter ließ das Gras nur einmal im Jahr, zu Beginn des Winters, mähen. Sie benutzte die Pflanzen als Vorlage für ihre Aquarelle. Sie zeichnete diese Pflanzen immer wieder ab, zehn- oder zwölfmal, mit unendlicher Geduld, als ob sie genau wusste, dass sie nur das bestätigen konnte, was sie sah, und höchstens eine Rohskizze anfertigen konnte, die annähernd der Substanz gerecht wurde. In diesen seltenen Momenten zeigte sie eine Art von Bescheidenheit. Sie gab ihr Bestes, aber sie malte nicht, um irgendjemandem zu gefallen. Sie malte aus Begeisterung, um des Malens willen. Sie ertrug es nicht, wenn ich ihr dabei zusah, und jagte mich zum Teufel. Sie kränkte alle, die ihr zu nahe kamen. Sie war eine Expertin in der Kunst der Demütigung.
Der Herr Baron hatte nichts dagegen einzuwenden, wenn sie zum Zeitvertreib malte. Er hätte jedoch nie geduldet, dass sie sich als Künstlerin exponierte.
»Ich hätte ihn deswegen umbringen können«, gesteht die ehrenwehrte Erscheinung. Leider einige Jahrzehnte zu spät.
Der Herr Sohn zeigt ein zahnloses Grinsen.
»Das hättest du dir früher überlegen sollen.«
Sie findet zweifellos, dass ich einen fragwürdigen Humor habe.
»Hör mal, ich hatte ja die Kinder.«
»Warum hast du uns eigentlich zur Welt gebracht? Vier Kinder in vier Jahren, sozusagen am Fließband.«
»Vier? Es waren doch nur drei!«
»Bist du schlecht im Rechnen?«
Sie überhört die Bemerkung.
»Oh, das gehörte zu meinen Pflichten. Und Eugen wollte einen Stammhalter. Danach hatte ich meine Ruhe. Zum Glück war Inge zuverlässig. Sie brachte mir die Kleinen zweimal am Tag. Ich nahm sie in die Arme und spielte mit ihnen. Nette Kinder, übrigens. Die Mädchen recht hübsch. Aber dann kam der Krieg. Das prägte die Mädchen schon früh. Sie mussten auf vieles verzichten.«
»Hast du nie begriffen, dass sie frei sein wollten?«
»Die Mädchen? Wie kommst du darauf? Wir haben euch gut erzogen. Komisch, wie die Kinder sich später verändern.«
Ich war also der Stammhalter und sollte nicht als Weichling aufwachsen. Der Verzicht auf jede leibliche Bequemlichkeit galt als Vorbedingung für mein späteres Leben als Adeliger, Gutsherr und Offizier. Den Mädchen war kaum anderes vorherbestimmt: Adelige, Gutsherrinnen und Offiziersfrauen. Wir besuchten keine öffentliche Schule, sondern wurden zu Hause unterrichtet. Herr Ohnesorg, unser Lehrer, war ein magerer Griesgram mit Mundgeruch. Er glich einer der lächerlichen Lehrerfiguren aus dem Kinderbuch Max und Moritz. Aber das Lachen war uns schnell vergangen. Er war frustriert und böse und plagte uns, wie er konnte. Bewegten wir uns mitten im Unterricht oder hatten wir unsere Aufgaben nicht zu seiner Zufriedenheit gemacht, mussten wir ihm die Handfläche hinhalten, und er schlug uns mit dem Lineal. Vom Nachsitzen und hundertmaligen Abschreiben eines Wortes ganz zu schweigen. Alles auswendig lernen, von den lateinischen Verben bis zu den mathematischen Formeln. Unsere Pflichterfüllung wurde so übertrieben stark gefordert, dass es uns vollständig aus der Fassung brachte, wenn wir von der einmal festgelegten Linie abweichen sollten. Unsere Unselbstständigkeit war vollkommen. Es gibt ein Sprichwort: »Wie die Zucht, so die Frucht.«
Schon früh waren wir wurmstichig.
Es drängt mich, die ehrenwehrte Frau Mutter wieder dahin zu schicken, wo sie hergekommen ist. Aber die Vergangenheit steht vor mir wie eine Reihe von Eisbergen. Besser, ich baue sie ab. Schön methodisch. Einen Eisberg nach dem anderen.
»Amanda«, sage ich.
»Ja, was war mit Amanda?«
»Amanda war aus Prinzip zornig. Verstehst du, was ich meine? Nein? Muss ich dir das erklären? Sie war von Geburt aus zornig. Der Zorn beherrschte all ihre Gedanken. Na ja, nicht nur ihre Gedanken, sondern auch ihr Herz. Ich glaube nicht, dass ich in meinem ganzen Leben jemals einem Menschen begegnet bin, der so viel Zorn in sich trug. Soll ich dir etwas sagen? Sie hatte Angst vor nichts und war in manchen Dingen ausgesprochen blöde. Wusstest du, dass sie schon mit siebzehn einen gewissen Ruf hatte? ›Fräulein-immer-bereit‹ wurde sie genannt. Das war die Retourkutsche für dich, und da war sie wirklich blöde. Und dann ging sie nach Berlin, wurde Ausdruckstänzerin und traf Thomas Ginzberg. Sie wollten heiraten, aber es gab dieses Rassengesetz. Amanda scherte sich einen Dreck darum. Sie lebte mit Thomas zusammen. Eine Ehrensache, verstehst du? Ihre unbeschriebene Seite. Und da war sie wirklich großartig. Den Tod immer nahe zu wissen und trotzdem jeden Morgen zum Bäcker gehen und Brötchen holen mit dem Risiko, dass man vielleicht nie zurückkam und der Frühstückstisch umsonst gedeckt war. Oder scheinbar seelenruhig in einem Café die Zeitung lesen. Das war es, was in dieser Zeit tapfer zu sein bedeutete.«