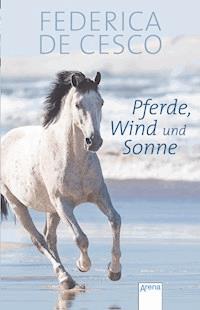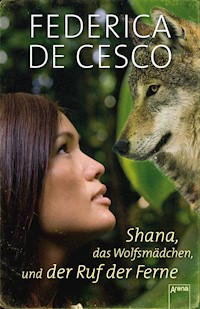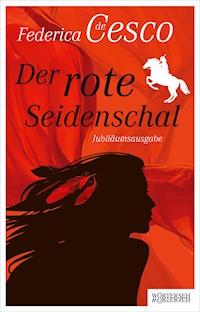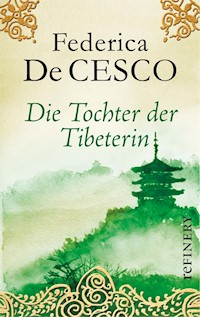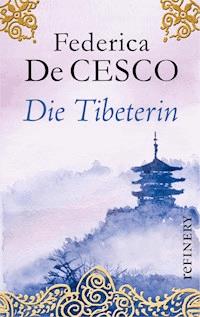
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Tibet-Romane
- Sprache: Deutsch
Immer wieder träumt die Ärztin Tara von ihrer Zwillingsschwester Chodonla, die vor etwa 25 Jahren bei der Flucht der Familie aus dem von China besetzten Tibet verlorenging. Heute lebt Tara in der Schweiz, doch sie möchte unbedingt ihre Schwester Wiedersehen. Deshalb gibt sie ihren Job auf und reist nach Nepal, um dort die tibetische Heilkunst zu erlernen und mehr über ihre Schwester herauszufinden. Im Auffanglager für tibetische Flüchtlinge lernt sie Atan kennen, der ihr erzählt, daß er gemeinsam mit Chodonla im Untergrund gegen die Chinesen kämpft. Doch die Zwillingsschwester ist schwer krank und wird bald sterben. Gemeinsam machen sich Tara und Atan auf die beschwerliche Reise über Schleichwege nach Tibet. Unterwegs erfährt Tara die Geschichte ihrer Schwester, aber auch Atan erzählt ihr viel aus seinem Leben. Als sie die Totkranke endlich finden, nimmt das Schicksal eine überraschende Wendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Immer wieder träumt die Ärztin Tara von ihrer Zwillingsschwester Chodonla, die vor etwa 25 Jahren bei der Flucht der Familie aus dem von China besetzten Tibet verlorenging. Heute lebt Tara in der Schweiz, doch sie möchte unbedingt ihre Schwester Wiedersehen. Deshalb gibt sie ihren Job auf und reist nach Nepal, um dort die tibetische Heilkunst zu erlernen und mehr über ihre Schwester herauszufinden.
Im Auffanglager für tibetische Flüchtlinge lernt sie Atan kennen, der ihr erzählt, daß er gemeinsam mit Chodonla im Untergrund gegen die Chinesen kämpft. Doch die Zwillingsschwester ist schwer krank und wird bald sterben. Gemeinsam machen sich Tara und Atan auf die beschwerliche Reise über Schleichwege nach Tibet. Unterwegs erfährt Tara die Geschichte ihrer Schwester, aber auch Atan erzählt ihr viel aus seinem Leben. Als sie die Totkranke endlich finden, nimmt das Schicksal eine überraschende Wendung.
Die Autorin
Federica de Cesco wurde 1938 in Norditalien geboren. Sie wuchs mehrsprachig in verschiedenen Ländern auf und schrieb ihr erstes Buch mit 15. Sie studierte Psychologie und Kunstgeschichte in Belgien und lebt heute mit ihrem Mann, einem japanischen Fotografen, in der Schweiz. Mit ihren Jugendbüchern wurde sie bekannt, später gelang ihr mit ihrem Roman Silbermuschel auch der Durchbruch in der Erwachsenenliteratur.
Von Federica de Cesco sind in unserem Hause bereits erschienen:
Die Tibeterin Die Tochter der Tibeterin Die Traumjägerin Seidentanz
FEDERICA DE CESCO
Die Tibeterin
Roman
Ullstein
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-96048-023-5 Neuausgabe bei Refinery
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Oktober 2009
4. Auflage 2013
© für diese Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009
© 1998 by Marion von Schröder Verlag GmbH in der Verlagshaus Goethestraße GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © FinePic®, München
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
Im Traum des Mannes, der träumte, erwachte der Geträumte zum Leben. JORGE LUIS BORGES
Für Dechen Dolkar, die mir das Tor öffnete, und für Palden, die wußte, was Mut ist.
Prolog
Der Junge rannte durch Kälte und Dunkelheit. An einigen Stellen war der Boden schon gefroren. Moos knirschte unter seinen Füßen, der Wind blies ihm hart in den Rücken. Nebel hing dicht und weiß über der Bergflanke. Uralte, knorrige Kiefern klammerten sich an die Felsabsätze; sie ragten aus dem Dunst, steinhart geworden von jahrhundertealtem Schmerz und vom Widerstand gegen die Elemente. An manchen Stellen lichtete sich der Nebel. Dann wurde im Tal die Klosterstadt sichtbar. Der Widerschein der Brände färbte die unteren Dunstschichten purpur und gelb. Über den Ruinen formten Scheinwerfer ein von Rauchwolken umgrenztes Zelt, in dessen Kern das rote Riesenherz pochte. Das Erz würde drei Tage und drei Nächte glühen, ohne seine Form zu verlieren, bevor das Feuer abkühlte. Ein wirres Klagen erscholl seltsam gedämpft aus der rauchenden Stadt – nicht wie aus tausend schreienden Kehlen, vielmehr klang es, als seufze eine einzige Stimme halb erstickt in Todesqualen. Der Junge hörte sie kaum. Unten am Berghang vernahm er andere Stimmen, heiser vor Anstrengung und schwer vom Schnaps, und dazu das Geräusch stapfender Stiefel auf dem knirschenden Nadelteppich. Sie waren zu dritt. Der Befehlshaber sprach gerade so laut, daß seine Stimme am Berg zu hören war. Er lachte dazu. Irgendwann peitschte ein Schuß, viel zu weit daneben, wie es dem Jungen schien. Er duckte sich kurz hinter einen Felsen; er wollte nicht, daß sie seine Spur verloren. Er legte beide Hände trichterförmig an den Mund. Flüche und Verwünschungen kamen ganz mühelos über seine Lippen, er hatte sie oft genug bei den Kriegern gehört. Klar und schrill flogen die Worte über die Bergflanke.
»… Feigling, räudiger Hund! Ich werde dein Herz zwischen den Zähnen tragen! Ich werde deine Leber essen, deine Hoden als Tabaksbeutel auf dem Markt verkaufen!«
Er sprang auf, rannte weiter. Sein heftig pochendes Herz drohte zu zerspringen. Er rannte, bis ihm der Atem ausging und er mit vorgeneigtem Oberkörper keuchend nach Luft schnappte. Dabei spürte er, daß seine Verfolger aufholten, und lief weiter, weil er den Vorsprung bewahren wollte. Der Berg mit seinen Krüppelbäumen, Flechten und Moosen war ihm vertraut. Verschiedene Felsinseln umgehend, stapfte er weiter. Seine Kehle war trocken, jede Bewegung, jeder Schritt erfolgte völlig automatisch. Plötzlich fand er die Witterung, die er suchte: sie war scharf, beißend, stinkend. Hier, auf halber Höhe, überfiel ihn eiskalt und heulend der Ostwind, trug ihm das vertraute Schnaufen und Grunzen entgegen. Der Junge wandte sich um, mit bleichem, wutverzerrten Gesicht, und spähte lauernd um sich. Im Nebel war nichts zu erkennen, aber sein feines Gehör schätzte die Geräusche ab. Sein Verfolger befand sich etwa zweihundert Schritte hinter ihm, näher, als er zu hoffen gewagt hatte. Die zwei anderen waren nicht allzu weit gekommen. Der Junge wischte sich den kalten Schweiß aus der Stirn.
»Wo bist du?« Er schrie aus Leibeskräften. »Komm und hol mich, du stinkendes Aas!«
Abermals hörte der Junge, wie sein Verfolger lachte. Das Lachen klang stockend und erregt. Er war ein Mann im Vollbesitz seiner Kraft, auch wenn der Schnaps seinen Schritt unsicher machte. Lichteten sich die Nebel, würde er den Jungen wahrscheinlich sehen können. Aber er würde nicht schießen, nein, das hatte er sich fest vorgenommen. Er wollte ihn nicht töten. Nicht jetzt und nicht so. Er wollte seinen Spaß mit ihm haben. Er hatte Übung in diesen Dingen und ging sehr methodisch vor. Der Junge würde noch tagelang leben.
Der Wind verstärkte sich; Nebelschwaden glitten vorbei wie Traumschleier. Der Junge kletterte ohne Unterlaß, mit blutigen Knien, rutschend, strauchelnd und zitternd. Der Moschusgeruch war jetzt so dicht, daß er ihm wie eine schwere Decke entgegenschlug. Da teilte ein Windstoß die Nebel: Gestalten kamen in Sicht, zwei, drei, eine ganze Gruppe. Wie mächtige Felsblöcke ragten sie auf. Nur ihre Schwänze bewegten sich, und ihre Nüstern zogen die Witterung ein. Manche standen mit ihren gewaltigen Körpern dicht aneinandergepreßt, wandten die Köpfe in verschiedene Richtungen. Es war, als habe es auf diesem Berg seit Erschaffung der Welt nichts anderes gegeben als diese Tiere. Ihr Atem stand in kleinen weißen Wolken vor ihren Nüstern, und an den langen Mähnen klebten Eiszapfen. Hier in der Höhe gefror der Nebel, der Wind bewegte winzige, flimmernde Körnchen in der Luft. Sie wirbelten vor den Augen des Jungen, und plötzlich war ihm, als nehme der Nebelfrost Form an. Eine Figur bildete sich in der Dunkelheit, festigte sich zusehends, nahm die Gestalt eines Riesen an. Ein Tier mit Menschengesicht schimmerte durch den Nebel. Unter dem vereisten, zottigen Haarwulst blickte das Antlitz aufmerksam und kummervoll. Die langen messerscharfen Hörner glänzten. Ein trockenes Schluchzen entfuhr dem Jungen. Er legte zwei Finger an die Lippen und pfiff. Lang anhaltend und schrill, der Stimme eines Vogels ähnlich, schwang sich der Pfiff in den Himmel, kreiste über den schwarzen Felsen. Dann – plötzliche Stille. Der Pfiff verstummte. Nichts war mehr zu hören als der Atem der Tiere und weiter unten am Berghang das Stapfen eiliger, strauchelnder Schritte. Der Riese rührte sich nicht – eine ganze Weile lang. Seine schwarzen Augen spähten starr in die Richtung, aus welcher der Pfeifton gekommen war. Unvermittelt erschütterte ein Brummen den gewaltigen Tierleib. Umweht von seiner Mähne, den Kopf zum Angriff gesenkt, setzte sich der Riese in Bewegung. Die Hörner funkelten wie Säbel. Der Junge sah ihn kommen; sein Atem flog, doch seine Füße standen fest, und er wich nicht von der Stelle. Nun spielte sich alles mit schwindelerregender Schnelligkeit ab. Das Ungeheuer raste so nahe an dem Jungen vorbei, daß die schneeverkrustete Mähne sein Gesicht peitschte, und der Luftwirbel ihm das Gleichgewicht nahm. Er stolperte, fiel rücklings in ein Gestrüpp, rutschte abwärts, krallte sich an den Zweigen fest. Der Riese stürmte den Hang hinunter. Wie unterirdische Geistertrommeln erschütterten seine Hufe den Boden. Der Junge lauschte, atmete flach. Ein paar Sekunden vergingen. Ein Schuß krachte. Noch einer. Sein Herz klopfte zum Zerspringen. Und auf einmal – ein Schrei! Das Brüllen eines Mannes in Todesnot. Das gespenstische Geheul flog durch die Dunkelheit, getragen vom Donnern der Hufe. Und entfernte sich in weiten Kreisen, fortgeweht im Sturm, unter einem Meer von Nebel. Da hob der Junge beide Arme, wie ein Sieger, schrie seinen Triumph in die Nacht hinaus. Und dann fiel er auf die Knie, von heftigem Schluckauf geschüttelt, erbrach sich fast das Herz aus dem Leib. Aber nur Spucke und bittere Gallenflüssigkeit tropften aus seinem Mund auf die eiskalte Erde.
1. Kapitel
Ich erwachte in plötzlicher Angst. Ich konnte den Wind hören und das Prasseln des Regens gegen die Fensterscheiben. Wir waren spät zu Bett gegangen. Ich sah auf die Uhr. Halb zwei. Ich war mit Kopfschmerzen eingeschlafen und hatte von Chodonla geträumt. Meiner Erinnerung nach war Chodonla in früheren Träumen als Kind vorgekommen: eine schmalgliedrige Fünfjährige, mit einem zu großen Kopf und gerade geschnittenen Stirnfransen. Die Wangen waren aprikosenfarben, die Augen schwarzblau, und über dem linken Mundwinkel befand sich ein Muttermal. Ich hatte auch eines, an der gleichen Stelle, nur kleiner. Wir waren als Zwillinge auf die Welt gekommen – Chodonla ein paar Minuten früher als ich. Mutter erzählte, daß wir als Kinder kaum zu unterscheiden waren. Sie ließ uns Kleider nach demselben Schnitt und in der gleichen Farbe anfertigen; es machte ihr Spaß, wenn man uns verwechselte.
Mein Herz klopfte stark. Warum nur? Ich fühlte in mir eine Welle undefinierbarer Erregung. Der Regen schlug an die Fenster; schon am Abend war der Himmel bewölkt gewesen. Roman lag dicht neben mir, atmete tief, etwas röchelnd. Seine Redaktion war in Basel, wir sahen uns nur am Wochenende. An diesem Abend waren wir im Kino gewesen, hatten anschließend gegessen, zu spät und zu viel. Gebratene Leber mit Zwiebeln, zum Schluß ein Stück Nußtorte. Der Wein war nicht gut gewesen. Das mochte der Grund sein, weshalb ich unruhig schlief und von Chodonla träumte. Und zum ersten Mal sah ich sie nicht als Kind, sondern als Frau, abgemagert und nicht mehr jung. Ja, das ist Chodonla, sagte ich mir im Traum. Ihr Gesicht, von eigentümlicher Schönheit, leuchtete wie Porzellan; über den Lippen lag das Muttermal als ein schwarzblauer Tupfer. Ich suchte nach den Augen; ich konnte sie mir zwar vorstellen, sah sie jedoch nicht. Ihr Mund, blutrot wie eine Wunde, öffnete und schloß sich wieder: Sie sprach einen langen, komplizierten Satz. Mit meiner ganzen Aufmerksamkeit versuchte ich ihn zu verstehen.
»Was sagst du, Chodonla?«
Sie stand vor meinem Bett, hielt die Hände verschlungen. Ihr Gesicht kam näher, und nun sah ich ihre Augen ganz deutlich: sie waren groß und haselnußbraun; mein Antlitz spiegelte sich in ihren Pupillen. Als wäre auch ich nur das Scheinbild, daß sie, die Träumerin, sah.
»Chodonla!«
Mein Herz schlug bis zum Hals. Was hatte sie gesagt? War ich wach? Und was war das für ein Geräusch? Da – schon wieder! Der Regen prasselte gegen die Balkontür. Ich stand auf, spähte durch die nassen Scheiben. Ein Blumentopf war umgefallen; der Wind rollte ihn über den Balkon. Ich drückte den Griff herunter; die Tür flog auf. Barfuß trat ich in die windgepeitschte Nacht. Der Regen fegte um die Ecken und über die Straße, hart wie der Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch. Ich hob den Blumentopf mit der kleinen Narzisse auf; der Rand war bereits zersprungen. Ich stellte die Pflanze in eine geschützte Ecke, bevor ich keuchend und durchnäßt die Balkontür schloß, in die Küche ging und Licht machte. Ich goß Milch in einen Topf und zündete die Gasflamme an. Als die Milch kurz vor dem Kochen war, füllte ich sie in ein Glas. Heiße Milch beruhigt, sagte Amla – meine Mutter. Sie hatte immer ein Rezept für jede Lebenslage, hielt ihre Ansichten für hieb- und stichfest, und meistens stimmten sie tatsächlich. So auch diesmal. Ich trank einen großen Schluck. Das Herzklopfen ließ nach, meine Muskeln entspannten sich. Nach einer Weile ging ich ins Schlafzimmer zurück. Ich öffnete leise eine Schublade, entnahm ihr ein Kästchen aus Sandelholz, made in India und kitschig. Roman wälzte sich auf die Seite, wurde aber nicht wach. Ich ging mit dem Kästchen in die Küche, setzte mich und ließ den Deckel aufspringen. Zwischen zerknitterten Luftpost-Umschlägen und alten Briefmarken lag Onkel Thubtens Brief an meine Mutter.
Eine Woche zuvor hatte sie Möbel umgestellt, Schränke ausgeräumt und in Schubladen gewühlt. Von Zeit zu Zeit überkam sie die Ordnungswut, dann warf sie Dinge weg, die sie jahrelang behalten hatte. Man mußte sie machen lassen. Ich half ihr beim Sortieren, um zu vermeiden, daß wichtige Post im Papierkorb landete. Als wir alte Unterlagen durchstöberten, kam der Brief zum Vorschein, und Amla sagte:
»Du kannst ihn haben.«
In meinem Leben existierte dieser Brief nicht mehr. Von dem Inhalt hatte ich mich distanziert. Es war ein wohlüberlegter Entschluß gewesen, damals, ein Akt der Feigheit. Und helfen konnte ich ja doch nicht.
Ich steckte den Brief in meine Handtasche und abends in die Schublade zu den anderen Briefen. Womit ich das Problem aus der Welt schaffen wollte. Aber das Problem verschwand nicht in der Schublade, sondern verharrte in meinem Kopf.
Ich trank das Glas aus, wischte mir mit dem Handrücken über die Lippen. Na schön, sehen wir uns die Sache mal an. Der Brief hatte etwas in mir ausgelöst, merkwürdige Ideenverbindungen geweckt. Chodonla war wieder ganz nahe – näher, als mir lieb war. Ich befand mich in einem Zustand, der mir nicht gefiel, beobachtete meine Reaktionen, sezierte sie wie mit dem Skalpell. Irgendwann kam mir eine Geschichte von früher in den Sinn, eine volkstümliche Legende aus einer verlorenen Welt. Der tibetische Volksglauben weiß: Die Seelen der Frauen, die im Zorn gestorben sind, verwandeln sich in kleine Dämonen. Sie werden Dumo genannt, oder auch Khandoma – Engel – wenn man sich mit einer Fürbitte an sie wendet. Ihre kleinen Statuen, maskiert und mit ihrem persönlichen Schmuck behängt, werden im Kloster Sakya, unweit der Stadt Shigatse, in einem Tempel aufbewahrt. Ein Lama hat die Aufgabe, Gebete für sie zu sprechen. Wer es sich zutraut, kann die Maske einer Dumo in einer Schatulle an sich nehmen. Sie wird durch kleine Brandopfer freundlich gestimmt und ist ein wirksamer Schutzgeist, besonders auf Reisen. Es kommt aber vor, daß eine Dumo entflieht, durch die Straßen irrt und in die Häuser eindringt. Beim ersten Hahnenschrei verschwindet sie. Aber wer durch das Erscheinen einer Dumo-geweckt wird, erlebt bald den Tod eines nahen Familienangehörigen.
Legenden dieser Art kannte ich viele. Amla konnte gut erzählen; als kleines Mädchen standen mir dabei die Haare zu Berge. Trotz meiner sachlichen Natur erweckten diese Geschichten in mir den tiefen, fast körperlichen Eindruck eines Geheimnisses, das irgendwie allgegenwärtig war, auch in dieser prosaischen Schweiz, in der ich aufwuchs. Sie gehörten zu jener Melodie der Kindheit, die nur einmal im Leben erklingt. Ich bedauerte es nie, aus einem so fernen Land wie Tibet zu kommen. Bilder und Namen waren mit räumlich und zeitlich schwebenden Erinnerungen verbunden. Bisher hatten sie mich nie aus dem Konzept gebracht. Dies hier war etwas anderes.
Wir sollten nicht heraufbeschwören, was wir nicht wahrhaben mögen. Aber unser Leben reicht weit zurück, und manchmal stößt man unfreiwillig auf Hinweise. Träume sind weniger persönlich, als man glaubt; sie sind eine mächtige Überlieferung, in vielen Jahrhunderten geformt. Wir sind die Erben dieser Erfahrung, sie hat uns wach und feinfühlig gemacht. Unser Unterbewußtsein arbeitet. Verschwommene Erinnerungen erwecken Sehnsüchte, die oft geradezu absurd sind. Daß ich von meiner Schwester träumte, hatte eine Bedeutung.
Als wir 1975 aus Lhasa flohen, ging Chodonla verloren. Jahrelang erfuhren wir nichts über sie. Amla sagte mir später, wenn sie verrückt werden könnte, wäre sie es in dieser Zeit geworden. Endlich hörten wir, daß sich Chodonla in China in einem Kinderheim befand. Die Nachricht war zuverlässig. Es gehörte zu Chinas Bildungspolitik, tibetische Kinder im sogenannten »Mutterland« aufzuziehen und kommunistisch zu schulen. Man appellierte an ihre Selbstlosigkeit, an die Notwendigkeit des Opfers, an Parteitreue und Moral. Schlagworte statt Märchen prägten ihre Kindheit; sie wuchsen auf in einer Welt, in der jedes Wort etwas völlig anderes bedeutete als bei uns. Welches Leben führte Chodonla dort? »Sie ist wohlauf, alles andere ist nicht so schlimm. Wir müssen an die Zukunft glauben und hoffen, daß sich alles zum Guten wendet«, sagte Amla. Zuversicht galt als eine Sache der Höflichkeit; wir praktizierten sie auch in tiefster Verzweiflung. Ich war, solange ich denken kann, von fröhlichen Menschen umgeben.
Dem Debakel der »Viererbande« folgten ein paar Jahre relativer Ruhe. 1988 spitzte sich die Lage zu. Demonstrationen erzeugten Vergeltungsmaßnahmen: der übliche Teufelskreis. Eine Regierung, die ihre Kinder unter Panzern zerdrückt, zeigt wenig Milde in einem besetzten Land. In Tibet herrschte das Kriegsrecht und in den Gefängnissen Platzmangel. Zu Chinas himmlischer Unberechenbarkeit gehörte das Wechselspiel von brutaler Gewalt und leutseliger Diplomatie, wie es den Gnomen in Peking gerade paßte. Ein Jahr später wurde das Blut von den Fliesen geschrubbt, die Tempel und Klöster schlampig vergoldet, und Reisegruppen zum Kommen aufgefordert. Die Volksarmee grapschte gierig nach den Dollars der Touristen: Sightseeing is money!
In dieser Zeit waren wir ohne Nachricht von Chodonla. Dann erfuhren wir, daß sie wieder in Lhasa war, wo sie die chinesische Sprache unterrichtete. Die Parteierziehung läßt kaum eine Wahl: Ein Kind kann sich entweder anpassen, oder es wird entsetzlich leiden, also paßt es sich in den meisten Fällen an. Mein Vater seufzte betrübt, murmelte etwas von karmischer Bestimmung. Amla verlor nicht ihre unbefangene Nachsicht. Es sei unwichtig, erklärte sie, wenn Menschen nach Bekenntnissen handeln, die sie im Grunde ihres Herzens nicht teilen. Der Kampf um das nackte Leben verlangt Härte, auch wenn es schmerzt. Das ist ja gut und richtig so, betonte Amla, und machte ein Gesicht, als ob sie keine Sekunde daran zweifelte.
Nach der Repression schlug das Pendel in die andere Richtung. Flüchtlinge durften wieder ihre Verwandten besuchen und auch in die Heimat zurückkehren, wenn sie wollten. Tibeter konnten ins Ausland reisen. Amla – die den Vornamen Gyala trug – hatte einen Halbbruder in Nepal. Thubten war über siebzig. Seine beiden Söhne waren Mönche im Kloster Ganden gewesen und von den Rotgardisten ermordet worden. Thubten war mit seiner Frau Tseyang und seiner jüngsten Tochter Karma geflohen. In Eis und Schnee war ihm die linke Hand erfroren. Sie hing eingeschrumpft und verdreht herab, aber Thubten wollte sie nicht amputieren lassen – aus Eitelkeit, wie Amla vermutete. Tseyang, die an Blutarmut litt, mußte viel liegen, so daß der finanzielle Unterhalt der Familie auf der sechsundzwanzigjährigen Karma lastete. Sie hatte im Bazar von Kathmandu einen Laden gemietet, wo sie Modeschmuck und billiges Kunsthandwerk verkaufte. Ihren Wunschtraum, die tibetische Heilkunst zu erlernen, hatte sie aufgegeben. Sie mußte für die Eltern sorgen.
Obwohl die Familie sehr bescheiden lebte, schrieb Thubten auf Amlas Bitte seiner Nichte einen Brief, in dem er sie zu sich einlud. Ihre Chancen, einen Paß zu bekommen, standen günstig. Chodonla konnte beweisen, daß sie Verwandte im Ausland hatte; ihre gut bezahlte Stelle in Lhasa garantierte ihre Rückkehr. Der Brief blieb unbeantwortet. In den folgenden Monaten versuchte Thubten vergeblich, mit ihr Verbindung aufzunehmen. Die Post kam nicht an oder wurde beschlagnahmt. Thubten vermutete, daß Chodonla unter Beobachtung stand, und entschloß sich, etwas in dieser Angelegenheit zu tun. Er schlug seiner Schwester vor, er werde Chodonla in Lhasa aufsuchen. Der alte Herr war von schlechter Gesundheit, aber er wollte die Heimat wiedersehen, und mit dem Reisen würde es bald vorbei sein. Amla schickte ihm Geld und Geschenke für Chodonla: Seife, Zahnpasta, Hautcreme. Thubten schickte ein Telegramm an Chodonla und kündigte sein Kommen an. Nach zwei Wochen war er wieder in Kathmandu, und sechs Monate später lebte er nicht mehr. Herzversagen. Vielleicht war alles zu viel für ihn gewesen. Aber Karma teilte uns mit, der Vater hätte längst angefangen, sich den Tod zu wünschen. Kurz nach seiner Rückkehr aus Lhasa war die Mutter gestorben. Thubten vermißte seine Frau so sehr, daß er gemütskrank wurde. Karma beklagte bitter den Verlust ihrer Eltern; immerhin konnte sie aber jetzt tun, was sie wollte. Den Laden würde sie aufgeben. Ein tibetischer Arzt, der jahrelang in chinesischer Haft gewesen war, hatte in Kathmandu eine Medizinschule gegründet und eingewilligt, sie zu unterrichten. Das alles kam mir in den Sinn, als ich um drei Uhr morgens am Küchentisch saß und den vergilbten Brief aus dem Umschlag zog.
Als Schülerin war ich samstags zum tibetischen Unterricht gegangen, hatte dort gesessen, während meine Mitschüler frei hatten. Mir war schon klar, daß der Unterricht der Erhaltung und Weiterentwicklung unserer kulturellen Werte diente. Aber die Lehrmethode war so alt wie die Knochen eines Brontosauriers. Jahrelang schrieben wir immer das gleiche ab. Wir schrieben und lasen – fertig. Das fehlende Verständnis erzeugte Verwirrung oder – was mich betraf – Gleichgültigkeit. Daß ich mich dabei in einem gewissen Konflikt, im Widerspruch mit mir selbst befand, will ich nicht leugnen. Aber ich langweilte mich. Und wenn ich mich langweilte, wurde ich bockig.
Der Brief trug das Datum vom 11. Juni 1992. Onkel Thubten hatte die klare Schriftführung seiner Generation. Im feudalen Tibet galt eine deutliche Handschrift als Voraussetzung für die Regierungsarbeit. Für neuzeitige Begriffe verwendete er englische Wörter. Seine Aufzeichnungen waren eine merkwürdige Mischung aus Brief und Tagebuch. Tagebuchähnlich wurde sein Bericht dadurch, daß Thubten seine Begegnung mit Chodonla sehr ausführlich schilderte; hier zeigte sich deutlich das Mitgefühl, das ihm nur in Momenten größerer Betroffenheit entschlüpfte. Ein paar Zeilen weiter kamen wieder die Phrasen. Thubten war ein formeller Mensch; sein Schreiben war privat, ma non troppo. Er begann mit Fragen nach unserem Befinden, Betrachtungen über das Wetter und noblen Binsenweisheiten, bis aus dem Monolog eine Schilderung wurde.
»Es war eine traurige Reise. Überall begegnete ich nur Ruinen und Zerstörungen. Verwandte und Freunde lebten nicht mehr oder hatten Tibet verlassen. Das Haus unserer Familie war zugemauert worden. Ich sah nur wenig Vertrautes oder Erfreuliches. Vielleicht liegt es an mir. Es mag sein, daß ich zu wenig Nachsicht aufbringe. Ich fühle mich zu alt für Selbstkritik. Die Chinesen sagen von sich, sie lehren die Tibeter, frei zu sein, keinen Hunger zu leiden, kein Unrecht zu dulden. Vielleicht sind ihre Herzen ehrlich. Da sie aber mit brutaler Gewalt auf rasche Erfolge aus sind, machen sie ihre guten Absichten zunichte. Sie sind wie Ärzte, die Kranken ein Gift geben und schwören, es werde ihnen gut tun. Sie hassen alle Bräuche, ob sie nun überholt sind oder nicht. Sie bringen die bizarrsten und ungereimtesten Ideen in Umlauf und würden alle Ehre und Ehrfurcht auf Erden ausrotten, um ihre Anschauung schneller zu verbreiten. So herrscht zwischen uns großes Mißtrauen. Wir werden noch lange nicht in der Lage sein, gemeinsam etwas Wertvolles aufzubauen.«
Das Reisebüro hatte Thubten in einem neuen Hotel untergebracht. Die Fahnen der Volksrepublik China wehten im Wind. Auf der Suche nach Chodonla war Thubten zunächst auf Argwohn gestoßen. Überall waren Spitzel, die Leute hatten Angst. Dann, eines Abends, als Thubten bereits im Bett lag, ein Anruf der Rezeption: eine Dame wünsche ihn zu sprechen. Thubten zog sich eilig an und fuhr mit dem Lift hinunter in die Halle.
Sie saß in einem der niedrigen Sessel und rauchte. Thubten erkannte sie auf den ersten Blick. Sie erschien ihm überaus zerbrechlich mit ihren schmalen Wangen, ihren feinen Zügen und den langen Beinen. Ihre Brauen waren dicht und schwarz, sie sah blaß aus, war aber durchaus nicht ärmlich gekleidet. Ihre Steppjacke und ihre hochhackigen Schuhe schienen neu. Sie trug, wie alle modebewußten Chinesinnen in Lhasa, eine Steghose aus schwarzem Nylon. Auf Thubten wirkten ihre Kleidung und ihr Auftreten eher unbescheiden. Ihre Nägel waren dunkel lackiert, ihre Lippen bemalt und das Muttermal schwarz betont. Ihre Hände waren klein und ausdrucksvoll, sehr weiß, so daß die Haut fast durchscheinend schimmerte. Ihr Haar hatte sie straff nach hinten gekämmt und zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie trug, von Goldohrringen abgesehen, keinen Schmuck.
»Ich setzte mich zu ihr«, schrieb Thubten, »und bestellte den rauchigen chinesischen Tee, den ich nicht mochte. Wir sagten, was die Höflichkeit erforderte. Chodonlas leise Stimme war kalt, ihr Ausdruck verschlossen. Sie musterte mich verstohlen. Das Gespräch kam nur stockend in Gang. Sie sagte, daß sie meine Briefe nie erhalten habe. Viele Briefe gingen auf dem Postamt verloren oder wurden konfisziert. Sie lachte, während sie sprach, in jener verkrampften Art, in der man über ein Unglück lacht. Das Telegramm war ihr zugestellt worden; offenbar war dem Postbeamten ein Fehler unterlaufen. Dabei zuckten ihre Mundwinkel höhnisch. Ich bat sie, von sich zu erzählen. Sie antwortete im Ton einer Wetterprognose. ›Ich bin in einem Kinderheim in Peking großgeworden und besuchte die Schule der Nationalitäten, wo ich chinesisch sprechen und schreiben lernte. Ich wurde als Lehrerin ausgebildet und beendete mein Studium auf einer Universität. Seit drei Jahren bin ich wieder in Lhasa. Ich unterrichte an einer Mittelschule.‹
Ich sah in das elfenbeinhelle Gesicht mit den roten Lippen und den seltsam glitzernden Augen. Ihre Worte sagten kaum etwas aus. Ich fühlte in ihr eine große Traurigkeit; es war, als verströme sie Kummer mit jedem Atemzug. Alte Menschen spüren solche Dinge. Aber gleichzeitig war da noch eine verbissene Kampfeslust und der besondere Mut der Verzweiflung. Ja, ja, meinte ich, das alles sei uns bekannt. Aber wie ging es weiter? Sie drückte ihre Zigarette aus, griff nach einer neuen. Ich sah, daß ihre Hände leicht zitterten. Sie hielt ihr Gesicht ein wenig abgewandt, als strebe sie von mir fort. Und obwohl ihre Stimme erstickt klang und auch jetzt noch ohne Modulation blieb, oder vielmehr gerade deswegen, erschien sie mir besonders erschreckend. Auf der Universität lernte sie Norbu kennen; man hatte ihn als Zehnjährigen von der Familie getrennt und – ebenso wie sie – im ›Mutterland‹ kommunistisch erzogen. Jahre später, in Lhasa, sah sie ihn wieder. Er hatte einen Zweijahresvertrag in Chamdo hinter sich und war jetzt im Rahmen eines Regierungsprogramms nach Lhasa versetzt worden.
›Wir stellten ein Gesuch. Man erlaubte uns zu heiraten. Wir bekamen ein Zimmer in unserer gemeinsamen Arbeitseinheit.‹ Ein plötzlicher Hustenanfall schüttelte sie. Sie lehnte sich über den Spucknapf aus Emaille neben dem Tisch. Ihr Taschentuch war mit Lippenstiftspuren verschmiert. Ihr Husten gefiel mir nicht. Ob sie erkältet sei? Sie verneinte. Nur der Staub, weiter nichts. Tatsächlich nahte der Frühling; Staubstürme wirbelten hoch über die Dächer, der Himmel war gelblich verfärbt. Auch ich verließ nicht das Hotel, ohne mir vorher einen Schal um Mund und Nase gebunden zu haben. Ich fragte, ob ich ihren Mann treffen könnte. Sie preßte die Lippen zusammen und starrte auf ihre Zigarette. Er sei tot, sagte sie. Im Gefängnis umgekommen. Von den Chinesen ermordet? Chodonla schüttelte den Kopf. Nein, er hatte sich das Leben genommen. Ich äußerte meine Betroffenheit. Im alten Tibet galt Selbstmord als schweres karmisches Vergehen. Chodonla verzog keine Miene. Ihr Gesicht glich einer Maske, in der sich nur die Lippen bewegten. Auch sie war eingesperrt worden, ein paar Monate später aber freigekommen. Sie lebte jetzt allein mit ihrer kleinen Tochter Kunsang. Ihre Arbeit als Lehrerin hatte sie aufgeben müssen, doch sie kam gut zurecht, und für das Baby war gesorgt. Sie erzählte sehr sachlich, und in ihren Augen stand Kälte. Ich sagte ihr, daß sie einen Paß beantragen sollte. Wieder glitt der höhnische Ausdruck über ihr Gesicht. Nein. Weil sie im Gefängnis gewesen war, konnte sie keinen Paß mehr bekommen. Es sei denn, illegal natürlich. Aber sie dachte an das Kind und wollte kein Risiko eingehen.
›Wir dürfen uns nicht darüber entrüsten und sollten es vom chinesischen Standpunkt aus sehen. Sie können es nicht darauf ankommen lassen.‹
Vieles, was mir vorher rätselhaft vorgekommen war, fand nun eine Erklärung. Reaktionäre, mögliche Spione und Verräter durften das Land nicht verlassen. Mein Herz wurde schwer.
›Und jetzt?‹ fragte ich. ›Was wird aus dir?‹
Sie erwiderte kalt:
›Versucht nicht, irgendetwas für mich zu tun. Ich komme schon zurecht.‹
Ihre Augen waren hart und fern; sie schob mich von sich fort und lehnte jede Verbindung mit mir ab. Ich sagte, daß ihre Eltern seit zwanzig Jahren ohne Nachricht von ihr waren und sich große Sorgen machten. Da veränderte sich ihr Ausdruck. Sie biß sich auf die Lippen.
›Einmal, im Heim, fand eine Erzieherin mich weinend. Sie sagte, daß meine Eltern der reaktionären Oberschicht angehörten, die das tibetische Volk ausbeuteten. Sie hätten mich zurückgelassen, weil sie schneller entkommen wollten. Ich war von zarter Gesundheit und hätte sie auf der Flucht bloß aufgehalten.‹
Ich wußte zuerst nicht, was ich sagen sollte.
›Und das hast du geglaubt?‹
Ihre Wimpern zuckten.
›Ich dachte, sie würde mich schlagen, weil ich weinte. Doch sie nahm mich lachend in die Arme, gab mir ein Bonbon und sagte, daß ich es noch erleben würde, eine gute Kommunistin zu sein. Es war das letzte Mal, daß ich geweint habe.‹
Wir starrten einander an im trüben Licht. Ich verstand sie jetzt besser. Sie hatte es kaum mehr gewagt, Zweifel zu empfinden oder Einzelheiten zu klären. Auch später nicht. Und doch war sie auf unglaubliche Weise unschuldig. Das verzweifelte Kind in ihr hatte früh verstanden, daß die Wahrheit nutzlos und gefährlich ist. Für sie mußte es die Zeit einer irrsinnigen Angst vor Gespenstern und Abscheulichkeiten gewesen sein. Aber sie war klug und tat, was in solchen Situationen das Beste ist: Sie tat gar nichts. Auf diese oder eine ähnliche Art war sie stark geworden. Und die Triebfeder in ihr war, wie ich jetzt erstaunt feststellte, nicht Hilflosigkeit, sondern Zorn. Sie brach als erste das lastende Schweigen.
›Meine Eltern … wie geht es ihnen? Sind sie gesund?‹
Vater und Mutter sind wohlauf, sagte ich. Als Flüchtlinge mußten sie Schweres durchmachen, aber die Ausübung ihrer Religion gab ihnen die Kraft, ihr Schicksal zu ertragen. Ihr ältester Sohn Tenzin lebte als Inkarnation in einem Kloster. Die Zweitälteste, Lhamo, war mit einem Schweizer verheiratet. Tara, die Jüngste, wollte Ärztin werden.
Unvermittelt lehnte sie sich vor. Für einen Augenblick zeigte ihr Gesicht einen Ausdruck, der sich schlecht mit ihren Zügen und ihrer anfänglichen Kühle vertrug: eine Art kindliche Neugierde. Verriet sich darin eine tiefere Regung ihres Wesens? Oder war es bloß eine Illusion, ein Nebeneffekt?
›Wir sind Zwillinge, wie Sie wissen. Gleicht sie mir noch?‹
Ich ahnte, welche Antwort sie erwartete, und erwiderte ernst: ›Wie aus dem Gesicht geschnitten.‹
Das stimmte nun freilich nicht. Chodonla sah zehn Jahre älter aus. Aber eine dunkle Regung trieb mich dazu, die Bequemlichkeit der Lüge vorzuziehen, die Chodonla selbst mir anbot. Die Zurückhaltung war von ihr abgefallen. In ihren Augen leuchtete kindlicher Glaube.
›Ist das wirklich wahr?‹
›Sie denkt viel an dich‹, sagte ich. ›Du fehlst ihr.‹
Plötzlich hielt sie im Lächeln inne, erschauderte. Mit einer Bewegung, die sie sicherlich gar nicht wahrnahm, so rasch und instinktiv war sie gewesen, zündete sie sich eine neue Zigarette an und sagte, scheinbar ungerührt:
›Wir haben ein unterschiedliches Schicksal erlebt.‹
Wieder saß sie mit abgewandtem Gesicht, in eine Art Abwesenheit versunken. Ihre Augen blickten so illusionslos, daß es die Augen einer alten Frau hätten sein können.
›Schmerzen erfahren mit der Zeit Mäßigung‹, sagte ich. ›Aber es ist nicht gut, wenn du die Dinge läßt, wie sie sind. Die Familie ahnt, daß dir Böses geschehen ist.‹
Ihre Ruhe war wie der Schatten ihrer wirklichen Gedanken. Ich entdeckte darin weniger Schmerz als eine gewisse krampfhafte Unnachgiebigkeit.
›Daran ist nichts zu ändern.‹
Ich ereiferte mich ein wenig, obwohl sich das für mein Alter nicht ziemte.
›Chodonla, sei vernünftig. Ich bin da, um dir zu helfen.‹
Jetzt sah sie auf, und es war ein Flackern in ihren Augen ›Sie lassen mich nicht weg.‹
Ich sah mich rasch um und sagte leise:
›Du könntest Tibet verlassen. Auch ohne Paß.‹
Die Sicherung der Grenzen wurde nicht immer genau eingehalten, und vielen Tibetern gelang es, über die Berge nach Nepal oder Indien zu entkommen. Ich fügte hinzu:
›Ich werde dir Geld geben.‹
Sie erwiderte ausdruckslos meinen Blick.
›Es tut mir leid, es geht nicht. Es liegt an mir.‹
Sie betonte, es sei keine Frage des Geldes, sondern der physischen Belastung. Den Strapazen der Reise sei sie nicht gewachsen. Und wer von den Grenzposten verhaftet wurde, verschwand für ein paar Jahre hinter Gittern. Was würde dann aus dem Kind?
Ihre Erklärung stimmte mich nachdenklich. Sie hatte einen Umstand klar erkannt, dem ich zu wenig Beachtung geschenkt hatte. Mir fiel auf, daß sie verstohlen meine verkrüppelte Hand musterte. Offenbar lag ihr eine Frage auf den Lippen, die sie nicht zu stellen wagte. Ich legte die Hand auf den Tisch. Ungern.
›Abgefroren. Auf der Flucht. Sie ist nichts mehr wert, aber es gibt noch einige Dinge, die ich tun kann.‹
›Dann wissen Sie ja selbst, wie schwierig es ist.‹
Ich gab es zu.
›Man muß bei guter Gesundheit sein.‹
Sie rauchte völlig mechanisch, mit diesem eigentümlich starren Ausdruck im Gesicht.
›Ich war eine Zeitlang krank. Lungenentzündunge.‹
›Wie fühlst du dich jetzt?‹
›Ganz gut. Aber ich könnte nicht reisen. Verstehen Sie?‹
Sie glaubte nicht mehr an die Welt, in der sie lebte. Durch mich vernahm sie das Echo einer anderen Welt, fern und phantastisch wie ein Märchen. Eine Welt, die jenseits ihrer Reichweite lag. Und in ihrer Weisheit verlangte sie nicht nach ihr.
Ein neuer Hustenanfall schüttelte sie. Als der Anfall vorüber war, sagte sie, daß sie jetzt gehen müsse. Und daß es besser für beide sei, wenn wir uns nicht noch einmal begegneten. Ihr Gleichmut war plötzlich dahin; sie sprach in scharfem, nahezu hysterischem Ton. Noch während ich ihren Stimmungswechsel zu verstehen suchte, zog sie mit knappem Gruß ihren Schal über den Mund und verließ fluchtartig die Halle. Ich tastete nach der Lehne des Sessels, stütze mich unbeholfen mit meiner gesunden Hand auf. Sie war fort, ehe ich alter Mann auf die Beine kam. Wieder in meinem Zimmer, schlug ich mich an die Stirn. Mein Gedächtnis taugte nichts mehr: Ich hatte Gyalas Paket vergessen! Die halbe Nacht lag ich wach und grübelte und zählte die Stunden bis zum Morgen. Mein Zimmer war für zwei weitere Tage gebucht. Ich verbrachte die meiste Zeit auf der Suche nach Chodonla. Ich wollte ihr zumindest die Geschenke geben. Meine Bemühungen blieben vergeblich. Der Tag meiner Abreise kam. Im Hotel arbeitete eine Frau, die ihre Angehörigen während der Kulturrevolution verloren hatte. Sie putzte die Spucknäpfe und hielt die Toiletten sauber. Ich ließ ihr das Paket da. Mit Tränen in den Augen umarmte und segnete sie mich. Einem Menschen eine Freude zu machen, lohnt sich immer, auch wenn mein Kummer davon nur wenig Linderung erfuhr.«
Thubten schloß den Brief mit Wünschen für gute Gesundheit und Wohlbefinden. Die Formeln hatte er im Kopf; sie klangen nobel und erbaulich, blieben aber nur Worte. Er war seine Gefühlsfracht losgeworden.
Ich hörte, wie Roman sich im Nebenzimmer regte.
»Tara?«
Ich faltete den Brief zusammen, schob ihn in den Umschlag. Dann schloß ich das Kästchen, trug es ins Schlafzimmer und legte es an seinen Platz. Roman stützte sich verschlafen auf den Ellbogen auf.
»Wo warst du?«
»Draußen. Ein Blumentopf ist umgefallen.«
»Warum bist du nicht im Bett?«
»Ich habe eine Tasse Milch getrunken.«
Ich schlüpfte unter die Decke, suchte seine Wärme, legte beide Arme um ihn. Er schob mich weg.
»Du bist ja ganz kalt!«
Er drehte sich auf die andere Seite; bald ging sein Atem wieder gleichmäßig. Verwundert stellte ich fest, daß Schlafen Distanz schafft. Aber vielleicht ist das alles nicht wichtig, dachte ich, während sich mein Körper mit langsamem Pulsschlag beruhigte. Der Regen hatte nachgelassen. Gelöst lag ich da, zwischen Traum und Wachen. Acht Jahre, dachte ich. Und kein Lebenszeichen von Chodonla. Auch Karma hatte nie mehr etwas von ihr gehört. Und nun, ganz plötzlich, sprach Chodonla zu mir, aus dem Dunkel, aus der Ferne, zärtlich und eindringlich. Ich bin von Natur aus ein logisch denkender Mensch, aber Logik kann verschiedene Aspekte haben. Wenn wir unsere Wahrnehmung nicht absichtlich verschließen, so erscheinen uns gewisse Signale weder absurd noch abwegig. Ich empfinde sie als Zeugnisse eines inneren Wissens, das unsere Vernunft übersteigt. Zwischen Zwillingen besteht eine gedankliche Verbindung. Daß sie jahrelang unterbrochen gewesen war, bedeutete nicht, daß sie nicht wieder aufgenommen werden konnte. Träumst du auch von mir, Chodonla? Weißt du noch, wie wir mit unserem kleinen Hund spielten? Ich sah ihn noch deutlich vor mir: ein quirliges, langhaariges Geschöpf, mit Augen wie schwarze Kirschen. Wir nannten ihn Momo, was eigentlich ein gefüllter Knödel ist. Was mochte aus ihm geworden sein? Die Chinesen haben kein Mitgefühl für Tiere. Sie waren besonders grausam zu unseren Haushündchen, weil sie in ihren Augen als Symbole der Müßigkeit galten. Die Soldaten riefen die Hündchen zu sich und spießten sie auf Bajonette auf. Es war leicht, diese Tiere zu töten, sagte Amla, weil sie so zutraulich waren. Du bist Kommunistin, Chodonla; vielleicht lastet auf deiner Seele kein Unbehagen. Vielleicht bist du – auf deine Weise – zufrieden. Daß du anders denkst, empfinde ich nicht als störend, aber nichts hasse ich so sehr wie den Gedanken, du könntest in Not sein. Irgendwann kommt die blitzartige Erkenntnis, die sagt: »Ich bin ein Teil von dir!« Solche Dinge stehen in den Sternen geschrieben, nicht im Anatomiebuch. Ich suchte nach dem Punkt, an welchem die ungeheure Weite, die uns trennte, überwunden werden könnte. Aber die Weite war dunkel wie der Schlaf.
2. Kapitel
Licht schimmerte durch die Vorhänge. Regungslos lag ich da und betrachtete den hellen Streifen. Sieben Uhr. Das Gewitter war abgezogen. Es würde ein schöner Tag werden. Eine Weile lauschte ich auf ferne Geräusche, sah zu, wie das Zimmer aus der Dämmerung wuchs. Dann warf ich die Decke zurück. Ich duschte, putzte mir die Zähne. Vor dem Spiegel bürstete ich mein Haar und flocht mit ein paar Handgriffen meinen Zopf. Dann trat ich vor den kleinen Hausaltar. In einer Vitrine stand, kaum handtellergroß, eine vergoldete Buddha-Statue. Gleich darunter hing ein Bild Seiner Heiligkeit, des Dalai-Lama, sowie ein schönes Thanka – ein Rollbild, mit Brokat eingerahmt. Mein Vater hatte es mir zum Abitur geschenkt. Es gehörte zu den wenigen Schätzen unserer Familie und stellte die Schutzgottheit Tibets dar: Chenresig – der Herr der Gnade, der seine ewige Wiedergeburt in der Gestalt Seiner Heiligkeit erfuhr. Ich knipste die kleinen elektrischen Lampen auf dem Tragbett an. Im Haus meiner Eltern, in Rikon, brannten noch echte Butterlampen. Amla stellte sie selbst liebevoll her, wobei sie die rußigen Flämmchen gerne in Kauf nahm. Ich bewegte mich lautlos, während ich die sieben Silberschalen mit frischem Opferwasser füllte. Abends wurde das Wasser wieder ausgeschüttet. Unser Wesen soll so klar wie eine Wasserhaut sein, hatte mir Amla als Kind beigebracht. Und sofort stellten sich bei mir Assoziationen ein: Wie ist Wasser? Weich, klar, geschmeidig, angenehm im Mund? Oder gewaltig, reißend, tosend, gefährlich? Unser Blut, unser Körper, jedes Tier, alle Pflanzen der Erde, bestehen vor allem aus Wasser. Hat Wasser Gedanken, hat Wasser Gefühle? Mein Verstand hatte eine natürliche Neigung, solchen Fragen nachzugehen. Seit ich denken konnte, verspürte ich einen starken Drang nach Wissen in mir. Meine Eltern hatten mich immer unterstützt; sie hatten gewollt, daß ich auf die Höhere Schule kam. Sie konnten mir kein Geld für das Studium geben, aber nach dem Abitur bekam ich ein Stipendium.
Ich legte die Handflächen aneinander und sprach das erste und einfachste Gebet. »Expressverfahren« nannte es Tenzin, mit Nachsicht und Ironie. Bei meinen Eltern war das allmorgendliche Herbeirufen von Segnungen lang und ausführlich. Aber ich sah das Beten nicht als Routine an; wenn ich aus irgendeinem Grund nicht dazu kam, fühlte ich mich – so trivial es klingt – wie jemand, der ohne die Zähne zu putzen aus dem Haus rennt. Das Morgengebet war ein Ritus des Wohlbefindens, weder ungewöhnlich noch exzentrisch, sondern in der Mitte des Herzens geboren. Ich liebte die friedvolle Stille, oder auch die vorherbestimmte, mit der jeder Tag begann. Vor dem Altar war diese Stille zugegen. Etwas war da, das mich in einer Umarmung hielt und froh machte; etwas, das es nicht nötig hatte zu atmen.
Ich schaltete die Kaffeemaschine ein, schob Weißbrot in den Toaster, als Roman erwachte.
»Warum bist du schon auf?«
»Gewohnheitssache.«
Täglich um zwanzig vor sieben mußte ich im Labor sein. Und vorher von Zürich nach Aarau fahren, dreißig Kilometer auf der Autobahn. Und abends das gleiche in umgekehrter Richtung. Ich maulte nie deswegen.
Roman ging ins Badezimmer. Ich hörte die WC-Spülung rauschen, die Dusche prasseln. Ich stellte gerade Butter und Marmelade auf den Tisch, als er fertig angezogen und rasiert in die Küche kam. »Riecht gut nach Kaffee!«
Er küßte mich auf den Mundwinkel, schob die Hand in mein T-Shirt. Ich lächelte ihn an. Die Kaffeemaschine blubberte. Ich goß Roman Kaffee ein. Er trank ihn schwarz und ohne Zucker.
»Hast du Lust, rauszufahren?« fragte er. »Nach Engelberg?«
»Wie du willst.«
Er betrachtete mich, die Brauen leicht gerunzelt.
»Du siehst müde aus.«
»Ich habe schlecht geschlafen. Und von Chodonla geträumt.«
»Von Chodonla?«
»Ich mache mir Sorgen um sie.«
»Hast du irgendwelche schlechten Nachrichten von ihr?«
»Nein. Aber wir sind Zwillinge, Roman.«
Er schlug einen sachlichen Ton an.
»Und deswegen glaubst du, daß du über besondere psychische Kräfte verfügst? Über Hellsichtigkeit, zum Beispiel?«
Eine Gänsehaut überlief mich. Telepathie war vielleicht nicht das richtige Wort. Womöglich gab es dafür kein richtiges Wort. »Ich weiß es nicht«, sagte ich.
»Du hast zuviel Phantasie.«
Fast hätte ich gelacht. Phantasie, ausgerechnet das, was mir am meisten fehlte! Ich stand zu dicht an den realen Dingen.
»Vielleicht. Es kann aber auch an einer Eigenart meines Charakters liegen.«
»Du machst es kompliziert«, erwiderte er.
Ich schlürfte den Kaffee; er war stark, und mir wurde heiß davon. Romans Uneinsichtigkeit rief in mir ein melancholisches Empfinden hervor. Roman war dreißig, zwei Jahre jünger als ich. Er hatte ein ebenmäßiges Gesicht, grüngesprenkelte Augen und ein jungenhaft verschmitztes Lächeln, das wie mechanisch seine Lippen hob. Er war auf seine ganz besondere Art anziehend, plauderte gut und gerne. Seine Stimme war sanft, sein französischer Tonfall charmant. Er wurde selten zornig, schmollte statt dessen, konnte trotz seiner guten Manieren plötzlich grob und trotz seiner Freundlichkeit plötzlich unausstehlich sein.
Laura hatte mal gesagt, um einen Mann richtig kennenzulernen, müßte ich mit ihm schlafen. So einfach sah ich das nicht. Man kann sich stöhnend umarmen und sich dabei weder lieben noch richtig verstehen. Ich hatte Roman aus seiner Art zu sprechen ganz gut kennengelernt.
»Du übertreibst mit deiner Familie«, brach er jetzt das Schweigen.
»Sie ist nun mal da.«
»Du hast sie ja dauernd im Kopf. Ich könnte das nicht.«
»Das verlangt ja auch keiner von dir.«
Roman stammt aus der Westschweiz, aus einer ursprünglichen französischen Hugenottenfamilie. Die Eltern waren geschieden, der Vater hatte eine Anwaltspraxis in Genf, die Mutter arbeitete in einem Schmuckgeschäft. Aus Liebhaberei, wie Roman betonte. »Elle a toujours eu une passion pour les gemmes.« Die Großeltern bewohnten ein »Seniorenheim«. Jeder lebte in seiner Kiste. Ich war in einer Großfamilie aufgewachsen, hatte dort viel Liebe und Wärme erfahren, aber auch eine starke gegenseitige Abhängigkeit erlebt. Eine Anzahl Tibeterinnen, die ich kannte, hatten seit Jahren ihren Beruf und wohnten noch immer bei Amla und Pala.
»Wie, du wohnst bei deinen Eltern?« wurde ich als Studentin oft gefragt. Man fand es kleinkariert. Ich sagte: »Bei den Eltern setze ich mich an den gedeckten Tisch. Meine Mutter kümmert sich um die Wäsche. Sie macht sogar mein Bett, wenn ich anderes im Kopf habe.«
»Und was sagt sie, wenn du abends ausgehst?«
»Nichts. Ich habe einen Hausschlüssel.«
In der ersten Zeit, als ich mein Studio gemietet hatte, hatte ich täglich mit der Familie telefoniert und nachts nicht schlafen können, weil mich das Alleinsein bedrückte. Roman meinte, daß ich am Rockzipfel meiner Mutter hing. Leute, die sich bei uns auskennen, würden das niemals sagen. Ich erklärte ihm, daß es bei uns anders lief. Daß die Familie eine mächtige Zelle war, in der wir frei waren. Die Eltern wollten, daß wir es im Leben zu etwas brachten; aber auch, daß wir die natürliche Sorglosigkeit, den Zauber der Kindheit lange bewahrten. Umgekehrt lag uns das Wohlergehen der Betagten am Herzen, obwohl uns ihr Anachronismus in akuten Fällen zur Weißglut brachte. Vorwürfe, Ermahnungen und Zähneknirschen gehörten zum Familienalltag. Das alles zählte nicht. Was wirklich zählte, war das Vertrauen, das gemeinsame Vorwärtskommen. Ich versuchte es Roman zu erklären, aber in seinem Gedächtnis blieb nur das Wort »Anachronismus« haften. Er entstammte einer Kultur der Selbstverwirklichung, handelte beflissen eigennützig und erwartete von seinen Mitmenschen das gleiche. Roman arbeitete im Redaktionsteam einer Monatszeitschrift, die von einer Bank finanziert wurde. Er hatte drei Jahre in New York verbracht, berichtete über Wirtschaft und Kultur und betreute eine wöchentliche Sendung im Fernsehen. Das Thema »tibetische Flüchtlinge« interessierte die Medien; ich wurde als Beispiel für »geglückte Integration« zu einem Interview eingeladen. Das Gespräch vor der surrenden Kamera verlief leicht und flüssig. Romans lockere Routine gefiel mir. Ich erzählte, warum wir Tibet verlassen hatten. Meine Eltern hatten zuerst geglaubt, sich mit den chinesischen Machthabern abfinden zu können. Als die Lage unerträglich wurde, entschlossen sie sich zur Flucht. Eine Zeitlang lebten sie in einem Auffanglager in Nepal. Der ältere Bruder meiner Mutter, Geshe Asur Tseten, war Abt im Kloster Sera. Von den Chinesen grausam gefoltert, war er 1960 mit einem Transport des Roten Kreuzes in die Schweiz gekommen. Acht Jahre später wurde im Dorf Rikon, im Tösstal, das »Tibet Institut« gegründet. Geshe Asur Tseten wurde als Berater zugezogen. Seiner Fürsprache verdankten wir die Einreisebewilligung. Ich wuchs in Rikon auf und ging dort zur Schule. Nach dem Abitur hatte ich Medizin studiert. Nach zwei Jahren war ich Internistin im Kantonsspital Aarau und bildete mich in Mikrochirurgie weiter.
Nach der Sendung gingen wir in die Studiokantine. Wir sprachen jetzt französisch. Ich erzählte Roman, daß ich mein Praktikum in einer Klinik in Lausanne absolviert hatte.
»Aber mit Ihrer Familie sprechen Sie tibetisch?«
»Meine Mutter spricht nur deutsch, wenn keiner da ist, der für sie übersetzt. Wir dachten, sie lernt es nie. In Wirklichkeit findet sie es bequemer, einfach dazusitzen und buddhahaft zu lächeln. Sie kommt perfekt im Leben zurecht.«
»Hat die Leidensgeschichte ihres Volkes Sie dazu gebracht, Ärztin zu werden?«
»Nein, der Ehrgeiz.«
Er sah mich an und blickte schnell weg. Tibeter umgibt eine Aura der Religiosität und Selbstaufgabe. Weisheit ist ihr Markenzeichen. Aber ich hegte eine gesunde Abneigung gegen jede Art von Verallgemeinerung. Und Schönfärberei lag mir nicht.
»Ich will den Facharzttitel. Und auf dem Gebiet der Mikrochirurgie sind Frauen im Vorteil.«
»Weil sie sticken und nähen?«
»In Tibet nähen auch die Männer«, entgegnete ich amüsiert. »Nein, Frauen haben einfach die sensibleren Hände. Das ist genetisch bedingt.«
Kleiner als eine Walnuß ist das Herz eines neugeborenen Babys. Man muß wirklich feinfühlige Hände haben, um ein so winziges und kostbares Gebilde zu flicken, wenn die Natur nicht perfekt gearbeitet hat.
»Wir lernen im Labor, unter dem Mikroskop zu nähen. Die Fäden entsprechen dem Drittel eines Frauenhaars. Man kann Gefäße zusammennähen, die nur einen halben Millimeter messen. Über ein Labor dieser Art verfügen nur wenige Krankenhäuser. Chirurgen kommen aus dem Ausland, um bei uns zu lernen.«
»Woran üben Sie?«
»Zumeist an frischen Schweinedärmen, hauptsächlich Dickdarm aus dem Aarauer Schlachthof. Der Darm des Schweines kommt dem des Menschen am nächsten.«
»Aufschlußreich!« seufzte Roman.
Ich lachte. Er nahm einen Schluck Kaffee.
»Haben Sie schon operiert?«
»In diesem Jahr einige Male. Ich assistiere Professor Kissling.«
»Verstößt unsere westliche Medizin nicht gegen die Auffassung der tibetischen Heilkunst? Haben Sie da niemals Zweifel?«
Ich blickte erst aus dem Fenster, dann auf ihn. Zweifel? Ja natürlich. Und sie kamen zu einer Zeit, da ich eigentlich jeden Grund hatte, zufrieden zu sein. Ich sagte:
»Die lamaistische Heilkunst geht auf zwei Jahrtausende zurück. Die Ärzte verwenden Präparate aus Mineralien, Kräutern, Wurzeln und Moos. Sie arbeiten auch mit Massage, Aderlaß, Hitzetherapie und Kauterisation. Dabei suchen sie nicht den schnellen Erfolg, sondern eine milde, langandauernde Wirkung.«
»Ist bei medizinischen Notfallsituationen die westliche Behandlung nicht wirksamer?«
»Sie ist eine Präzisionswaffe. Aber die Heilung der Organe wird wichtiger als die Heilung der Person. Wir forschen in der Subspezialisation und sind oft nicht mehr in der Lage, die Zusammenhänge im menschlichen Körper zu erkennen. Als Studentin glaubte ich, daß asiatische und westliche Medizin unvereinbar seien. Doch so, wie ich die Dinge jetzt sehe, wie ich sie fühle, betrachte ich unsere Kenntnisse als gemeinsamen Erfahrungsschatz. Manche Ärzte wenden schon beide Verfahren an.«
»Haben Sie je darüber nachgedacht, diesen Weg einzuschlagen?«
»Den Gedanken hatte ich oft.«
»Es ist nicht ganz realistisch, oder?«
»Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Möglichkeit.«
Danach unterhielten wir uns über die Sendung. Sie wurde zwei Tage später, vor den Abendnachrichten, ausgestrahlt; ich hatte keinen Fernseher, aber meine Schwester nahm die Sendung auf Video auf. Roman rief ein paar Tage später an.
»Nun? Wie hat Ihnen die Sendung gefallen?«
»Gut.«
»Die Reaktionen sind ausnehmend positiv. Sie haben dazu beigetragen. Tibetische Flüchtlinge genießen viel Sympathie.«
»Wohl deshalb, weil sie keine Bomben legen.«
Er sagte, daß er mich gern wiedersehen würde, und lud mich zum Essen ein.
»Am Donnerstag, da ist doch Ihr freier Nachmittag?«
»Wenn kein Notfall eintrifft. Doch, ich komme gerne.«
Ich hatte im Augenblick eine sentimentale Flaute, war seit zwei Monaten im Labor eingesperrt. Roman sah gut aus. Ich fand ihn ausgeglichener, weniger von sich eingenommen und neuen Ideen gegenüber aufgeschlossener als meine Arztkollegen, die einen akuten Größenwahn mit sich herumschleppten.
Wir trafen uns bei einem Italiener an der Schifflände, bestellten Carpaccio, dann Risotto mit Safran und Pilzen; als Tibeterin mag ich Fisch nicht besonders. Es war ein dunstiger Septemberabend, mit einem Nachgeschmack von Sommer. Der See leuchtete lila; ein weißes Schiff legte vom Ufer ab. Die Sonne spiegelte sich in den Scheiben. Auf der Bellerivebrücke stauten sich Straßenbahnen. Zürich im Abendlicht zeigte sich wohlwollend, melancholisch und von jener leicht künstlichen Anmut, die Schweizer Städten oft zu eigen ist.
Roman war ein guter Weinkenner; der frische, sprudelnde Chianti betörte mit seinem Kirscharoma. Bald nannten wir uns bei den Vornamen. Roman erzählte von sich. Er war verheiratet gewesen und hatte eine kleine Tochter, die in Genf bei seiner geschiedenen Frau – eine Bodenangestellte bei der Sabena – lebte.
Er zog seine Brieftasche hervor, zeigte mir das Bild von einem Mädchen im Vorschulalter.
»Sie heißt Anna.«
Anna war blondgelockt. Naturkrause. Ich seufzte, hingerissen und etwas neidisch.
»Sie wird sehr hübsch werden. Sie ist es jetzt schon.«
»Und du? Warst du nie verheiratet?«
Ich drehte mein Weinglas zwischen den Fingern.
»Einmal traf ich einen Italiener im Labor. Er wollte, daß ich mit ihm nach Verona gehe, ihn heirate und Bambini zur Welt bringe. Ich war nicht einverstanden.«
»Und da ließ er dich in Ruhe?«
»So nach und nach …«
»Hattest du viele Bekannte?«
Diese Frage hätte kein Tibeter gestellt. Der Anstand läßt es nicht zu, daß wir in die Privatsphäre eines Menschen eindringen. Zeitweise fühle ich mich als Schweizerin; in solchen Momenten werde ich ganz und gar Tibeterin, konservativ bis in die Knochen. Aber die Sprache der Medienmacher kennt keine feinen Nuancen. Ich reagierte locker.
»Dieser und jener. Nie etwas wirklich Festes.«
Jedes Leben kennt mehr oder weniger gefühlvolle Episoden. Ich glaubte eine Zeitlang zu lieben und zu leiden – auch das gehörte dazu. Viel Energie war dabei verlorengegangen, aber das machte nichts. Richtige Liebe schmerzt, wie eine Geburt schmerzen muß. Und ich wünschte mir ein ungemindertes Schmerzempfinden, um die lebendige Wunde zu spüren. Inzwischen bohrte Roman weiter.
»Hattest du nie einen tibetischen Freund?«
»Doch. Als Siebzehnjährige verliebte ich mich in Nambol. Ein hübscher Kerl, oh ja! Amla schleppte mich zu einem Frauenarzt, der mir die Pille verschrieb, und schickte uns ins Tessin in die Ferien. Die Reise war ein Reinfall, wir fuhren getrennt zurück. Amla wußte schon, was sie tat. Ob mein Vater informiert war, weiß ich bis heute nicht.«
Roman war überrascht.
»Deine Mutter ist sehr fortschrittlich.«
»Das ist sie.«
Auch später, als ich mein Studio bezog, lebte ich nur sporadisch als tugendhafter Single. Meine Eltern dachten sich ihren Teil, obwohl wir nie darüber sprachen.
Der Wein machte mich leicht benommen. Ich sagte zu Roman: »Nichts macht selbstsicherer, als Kranke zu heilen. Wir öffnen ihren Körper, entnehmen Gewebeproben, schneiden an ihren Organen herum, schnipp, schnipp!«
»Das klingt ziemlich zynisch.«
»Ich will damit nur sagen, daß wir eine Verantwortung tragen. Wir müssen immer das Richtige tun. Und dürfen nie unser Mitempfinden verlieren, das wäre das Ende.«
»Glauben Ärzte, daß sie Macht über den Tod haben?«
»Nein. Sie haben – bisweilen – Macht über die Krankheit.«
Der Risotto kam. Der Teller war heiß. Ich kostete vorsichtig.
»Unser Beruf verlangt menschliche Anteilnahme. Wer glaubt, es sich leisten zu können, am Bett eines Kranken unbeteiligt zu sein, sollte Steuerberater werden.«
Zuhören war eine Sache, die Roman gut konnte. Seine dunklen Augen blickten mich aufmerksam an. Vielleicht war es der Wein, aber ich war dabei, mich in ihn zu verlieben.
An diesem Abend schliefen wir miteinander, bei mir in der Ackersteinstraße, und im Laufe der nächsten Wochen pendelte sich unser Verhältnis recht gut ein. Er hatte einen festen, lebendigen Körper und Bewegungen, die er gut beherrschte. Er löschte nie das Licht; er wollte nicht, daß wir uns im Dunkeln liebten. Es machte ihm Spaß, mich anzuschauen. Er sagte, meine Haut sei ganz anders als die Haut der Europäerinnen, die immer – an irgendeiner Stelle – ein wenig rauh sei. Bei einer Asiatin, meinte er, ist alles anders: die Haut liegt fest und geschmeidig an, die Muskeln zeichnen sich wie eine Skulptur ab, die Knochen sind gelenkig. Es gefiel ihm, wie ich ihn anfaßte, mit sanftem, wissendem Griff. Freudig überließ er sich meinen Fingern, die alle empfindlichen Stellen kannten, Muskeln und Haut sanft zu kneten wußten. »Du bescherst mir Höhepunkte«, stöhnte Roman. »Wie machst du das nur?« Ich lachte leise: »Ich bin sehr geschickt!« Er war keineswegs der erste, der sich gerne von mir streicheln ließ. Die Arbeit unter dem Mikroskop machte mich feinfühlig. Oder vielmehr, ich glaubte, daß es so war; es gehörte zu meiner Art, daß ich mir über diese Dinge wenig Gedanken machte. Roman war zärtlich und aufmerksam, aber auch scharf auf Experimente, kam manchmal auf abwegige Gedanken. Tibeter sind in diesen Dingen nicht zimperlich. Aber mit Unterhaltung allein ist der Liebe nicht beizukommen. Eine Frau kann nicht nur mit den Händen, sondern mit dem ganzen Körper lügen; so wird die Liebe – oder was man dafür hält – zur erfundenen Wahrheit. Vor zehn Jahren hätte es mich geschmerzt. Später ist es nicht mehr schmerzlich, weil man kompromißbereit wird. Mir tat es leid zu sehen, wie ich mit meinen Gefühlen falsch umging. Ich könnte es auch anders ausdrücken: Mir war, als ob sich in einem komplizierten Gewebe eine Masche gelockert hatte. Ich zog an einem einzigen Faden und brachte das ganze Gewebe dazu, sich aufzulösen.
3. Kapitel
Vor der Kamera damals hatte ich unsere Flucht aus Tibet nur beiläufig erwähnt. Später wollte Roman mehr wissen. Ich ließ seine Fragen zu; sie waren konventionell, und ich rechnete es meiner Geduld hoch an, daß ich ihm immer wieder Antworten gab, die er sich kaum anhörte und auch nicht immer behielt. So kam ich auf Einzelheiten zu sprechen. Ich gestand ihm, daß ich über vieles schlecht unterrichtet war. Meine Eltern pflegten keinen rhethorischen Eifer. Amla war eine Frau mit Geschmack und von feiner Lebensart. Was sie erzählte, war durchdacht, überlegt, kultiviert und unterkühlt. Sie erweckte nie den Eindruck, daß sie bedroht und wehrlos sein könnte. Der Eindruck täuschte; die Erinnerungen waren lebendig in ihr. Sie brannten hell wie Feuer, waren oft unerträglich, auch ohne Wehklagen oder Geschrei. Und Vater – nun, Vater rauchte seine tibetische Pfeife und schwieg. Ich sah ihn wie hinter Wolken: ein schmaler, stiller Mann, der die Pfeife unendlich langsam zum Mund führte. Ich hatte ihn nie anders als wortkarg gekannt. Es handelte sich wohl weniger um eine psychologische Verschrobenheit als vielmehr um eine Art Unfähigkeit, seinen Gedanken Ausdruck zu geben. Als wisse er nicht, was er sagen wollte, wie er es sagen mußte … wenn er es hätte sagen können. Als sei Sprechen die komplizierteste Sache der Welt. Schon als Mädchen hatte ich mich gewundert, wie Amla mit ihm zurechtkam. Aber so lange ich denken konnte, war es zwischen Amla und Pala nie zu einer Meinungsverschiedenheit gekommen, geschweige denn zu einem Streit. Meine Eltern führten mich nie hinters Licht, erzählten auch nie etwas Großartiges, doch auch das Fadenscheinige hatte seine Wirkung.
»Wir wollen keine Würmer in der Gerste suchen«, sagte Amla, wenn ich sie mit einer direkten Frage überfiel. »Sobald die Gerste verschimmelt ist, hat das keinen Sinn mehr.« Wenn ich darauf bestanden hätte, gewisse Dinge zu erfahren, hätte sie vielleicht Auskunft gegeben – aber da sie nichts sagen wollte, schwieg auch ich. Tibetische Kinder widersprechen den Eltern nicht. So blieb mir – zumindest am Anfang – vieles verborgen. Was mich mit meinen Vorfahren verband, waren Sedimente in meiner Erinnerung – in Anbetracht der Umstände nichts oder kaum etwas. Immerhin ließ sich die Vergangenheit nachprüfen; ich wollte sie nicht als ein Stück Legende sehen. Im Laufe der Zeit manövrierte ich mich in die Sache hinein. Und die Geschichte, die ich Jahre später Roman erzählte, war, von gewissen Einzelheiten abgesehen, ziemlich ausführlich.
Als Mitglied der tibetischen Oberschicht hatte mein Großvater Tsering Dorje Kelsang in Indien studiert und sprach fließend Englisch. In den dreißiger Jahren war er als Ingenieur maßgebend für den Straßenbau in Lhasa gewesen. Meine Großmutter Dechen war die Tochter eines Regierungsbeamten und hatte neun Kinder, von denen sechs überlebten. 1959 fielen die Chinesen in Tibet ein; es folgte die inzwischen sattsam bekannte Tragödie. Aber die Geschichte macht deutlich, daß die Chinesen am Anfang bestrebt waren, die herrschende Elite zu schonen. Die Privilegien sogenannter »patriotischer« Familien, von denen man annahm, daß sie dem Regime nützlich sein konnten, blieben – jedenfalls teilweise – bis zur Kulturrevolution unangetastet. Als Ingenieur war Dorje Kelsang ein wichtiger Mann; seine reaktionäre Haltung nahm man in Kauf. Während Tausende flüchteten, glaubten meine Großeltern, sich anpassen zu können. Die Chinesen bauten Schulen und Krankenhäuser. Sie beschlagnahmten einen Teil der landwirtschaftlichen Erträge, die sie an die benachteiligten Klassen verteilten – was an sich eine gute Sache war. Sie behaupteten, hohe Ansprüche an die Moral zu stellen. Das gefiel den Großeltern, weil sie feudalistisch dachten und das Prinzip der Tugendhaftigkeit als Weisheit ansahen. Wenn China tatsächlich ihrer Heimat aus Unwissenheit und Armut heraushalf, nun, dann wollten sie chinesisch lernen. Tashi, der älteste Sohn, wurde nach Peking geschickt, wo er Agrarwissenschaft studierte. Nach vier Jahren erreichte ihn ein Telegramm seiner Mutter: Tsering Dorje war von einem Gerüst gestürzt und lag mit einem Schädelbruch im Krankenhaus. Als Tashi in Lhasa eintraf, war der Vater bereits tot. Nach der Trauerzeit arbeitete Tashi für die chinesische Regierung. Ein paar Monate später heiratete er Gyala Tschodak. Gyala verwaltete damals das Gut, das sie als einziges überlebendes Kind beim Tod ihrer Eltern geerbt hatte. Die tibetischen Familiennamen stammen von den Gütern, und der Tschodak-Besitz lag bloß eine Tagesreise zu Pferd von Lhasa entfernt. Gyala kümmerte sich um die Gersten-, Weizen- und Erbsenernte, verbrachte viele Tage zu Pferd, um die Herden zu überwachen. Sie erledigte alle Papierarbeit, führte Buch über Ausgaben und Einnahmen, verglich, kalkulierte und sprach sich mit dem Verwalter ab, der bereits ihren Eltern gedient hatte. Daneben war sie sehr großzügig, sorgte dafür, daß alle Bauern gut gekleidet waren und ausreichend Nahrung hatten, und daß ihre Kinder – wenn sie das Zeug dazu hatten – eine Schule besuchten. Sie war bei jedem Wetter draußen, stand den Leuten bei ihren Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Das Getreide wurde gespeichert, das Tsampa – Gerstenmehl – in einer eigenen Mühle gemahlen. Das Senfsamenöl stammte aus der eigenen Presse. Gyala überwachte all diese Arbeiten. Sie studierte landwirtschaftliche Broschüren und Magazine, die sie in Indien bestellte, träumte von modernen Pflügen, von Traktoren und elektrischen Melkanlagen.
Gyalas erstes Kind, Tenzin, kam ein Jahr später zur Welt. Im Alter von drei Jahren wurde er als Wiedergeburt Chensal Tashis, eines berühmten Mönchgelehrten erkannt, der 1953 im Großkloster von Chamdo gestorben war. Ein wiederverkörperter Erwachter, wie wir diese Wesen nennen, heißt bei uns in Tibet Tulku. Wir hatten schon einige in der Familie. Tenzins Labrang – so wird die Wohnstätte oder der Landbesitz einer hohen Inkarnation genannt – befand sich in der osttibetischen Provinz Kham. Fortan sollte der Junge nach den Regeln der Gelupga (der Gelbmützen, der reformierten Tradition also) erzogen werden. In der Hierarchie der Tulkus – der Inkarnationen – nehmen sie einen hohen Rang ein. Kleine Tulkus wurden möglichst bald in den Labrang ihres Vorgängers gebracht, damit sie die Erziehung und den religiösen Unterricht bekamen, die ihrer Stellung gemäß waren. Tenzin jedoch war ein zartes Kind; bei jeder Erkältung floß ihm Eiter aus den Ohren. Gyala machte sich Sorgen. Sie bat den Abt des Großklosters, den Kleinen in der Familie zu lassen, bis er ein paar Jahre älter und kräftiger war. Diese Bitte wurde ihr gewährt.