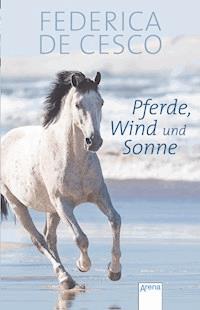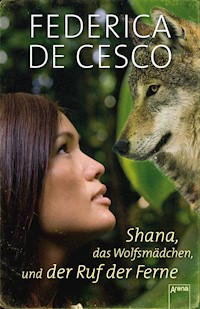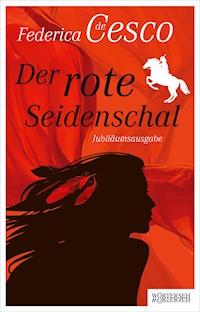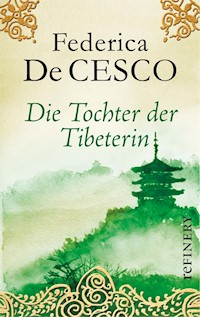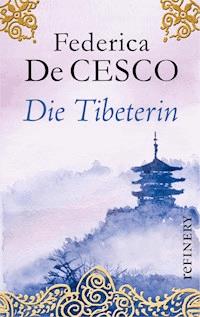Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Rosa wird auf Kuba als Enkelkind deutscher Immigranten geboren. Mit Beginn der Kuba-Krise kehren die Eltern nach Deutschland zurück, passen sich an die herrschenden Verhältnisse an und werden schon bald von der Stasi angeheuert. Die kleine Tochter beobachtet viel und macht sich ihre eigenen Gedanken. Um der bitteren Realität zu entgehen, erschafft sie sich eine eigene Fantasiewelt und führt endlose Gespräche mit zwei imaginären Figuren, Frau Tam und Herrn Tim, die sie wie lebendige Personen behandelt. Irgendwann hat ihre Mutter ihr ewiges Geplapper satt und zwingt Rosa symbolisch dazu, sich von ihren Fantasiegestalten zu trennen. Nach der Wende studiert Rosa in Berlin und wird Juristin. Doch sie ist unzufrieden mit ihrem rationalen Leben. Ihr Nachbar Dan, ein Schauspieler, gewährt ihr einen Einblick in die mitreißende Welt des Theaters. Rosa ist fasziniert. Sie gibt ihren Job als Anwältin auf und lässt sich zur Puppenspielerin ausbilden. Bald kreiert sie ihre eigene Show, in der sie mittels zweier Handpuppen – den Figuren ihrer Kindheit, die sie selbst gestaltet hat – das politische und gesellschaftliche Leben aufs Korn nimmt. Ihre bissigen Dialoge kommen beim Publikum gut an, gefallen jedoch nicht allen. Man stört sich daran, dass Rosa unter dem Deckmantel der Satire Wahrheiten ans Licht bringt, die lieber verborgen bleiben sollten. Dass sie sich dabei mächtige Feinde macht, übersieht sie. Sie merkt auch kaum, wie die frühere Fantasiewelt sie einholt, wie sie von den Puppen-Spiegelbildern ihres Selbst zunehmend manipuliert wird. Hilfe kann sie nur von ihrem Partner Alexis erwarten. Er durchschaut sie, akzeptiert ihre Eigenarten, vermag aber nicht, sie von ihren Dämonen zu erlösen. Und wer ist Lea, eine geheimnisvolle junge Frau, die ein dunkles Geheimnis verbirgt und Rosa zunehmend in ihren Bann zieht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FEDERICA DE CESCO
ROMAN
Die Freiheit der Puppen
1. eBook-Ausgabe 2025
1. Auflage
© 2025 Europa Verlag in der Europa Verlage GmbH, München
Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © Chiara Fersini / Trevillion Images
Layout & Satz: Margarita Maiseyeva
Redaktion: Franz Leipold
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-448-4
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise- nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b
UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für Produktsicherheit
Europa Verlage GmbH
Monika Roleff
Johannisplatz 15
81667 München
Tel.: +49 (0)89 18 94 733-0
E-Mail: [email protected]
www.europa-verlag.com
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Epilog
Wie immer, für Kazuyuki
1. Kapitel
»Wann ist dir aufgefallen, dass mit deinen Eltern etwas nicht so war, wie es sein sollte?«, hatte mich später Alexis gefragt, nachdem ich ihm endlich die Geschichte erzählt hatte.
»Keine Ahnung mehr«, hatte meine Antwort gelautet. »Man sagt, Kinder achten kaum auf das, was Erwachsene sagen oder tun. Sie leben in ihrer eigenen Welt. Aber das stimmt nicht. Sie beobachten alles ganz genau. Sie denken noch nicht logisch, aber sie fühlen Dinge, die sie eigentlich nicht fühlen sollten.«
»Wie Hunde oder Katzen?«
»Genau. Haustiere spitzen die Ohren und nehmen sofort jede Veränderung wahr.«
»Hast du auch die Ohren gespitzt?«
»Auf meine Art, ja. Ich sah aus, als ob ich in den Wolken schwebte, aber mir entging nichts. Ich ließ mich nie ablenken von dem, was für mich interessant war. Ich hatte schon damals ein großes Talent zwischen Normalität und Pseudonormalität zu unterscheiden.«
»Hing das mit deinen Eltern zusammen?«
»Mit ihrer Geschichte? Zweifellos. Aber das ist mir erst später klar geworden. Du weißt ja inzwischen, dass mein Großvater Horst aus Dresden stammte und mit seiner Frau Liselotte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert war. Das habe ich dir ja längst gesagt. Beide waren Kommunisten, was die Nazis nicht schön fanden. Als dann Hitler an die Macht kam, wurden die Kommunisten zu Staatsfeinden und Landesverrätern erklärt. Die absolut böse Konkurrenz. Erwischte man sie dabei, ihre Propaganda zu verkünden, holte man sie im Morgengrauen aus dem Bett und knüpfte ihnen einen Strick um den Hals.«
»Heutzutage geht es ja wieder los. In manchen Ländern jedenfalls.«
»Was willst du! Die Menschen kommen nie aus ihrer Scheiße heraus. Nicht jetzt und nicht in dreitausend Jahren.«
»Du redest wie auf der Bühne.«
»Auf der Bühne rede nicht ich. Da reden Frau Tam und Herr Tim.«
»Erzählen sie immer die Wahrheit?«
»Sie erzählen das, was ich will. Ich bin der Trickster.«
»Und was sagt der Trickster jetzt?«
»Der Trickster sagt: Maul halten und zuhören!
Meine Großeltern ließen nur gute Freunde wissen, was sie dachten. Jemand denunzierte sie. Sie wurden verhaftet und den ganzen Tag verhört, mit Kolbenschlägen und Fußtritten. Liselotte wurde auf einem Tisch vergewaltigt. Sie kamen knapp mit dem Leben davon. Es gelang ihnen, Deutschland zu verlassen. Sie schifften sich nach Kuba ein. Eine halbe Weltreise, und überall herrschte ein Riesenchaos. Dass sie schließlich wohlbehalten in Kuba ankamen, grenzt an ein Wunder.«
»Warum ausgerechnet Kuba?«
»Dass du immer deinen Senf dazugeben musst! Also: weil man im Jahr 1925 den Partido Comunista de Cuba gegründet hatte und sie dort unter Gleichgesinnten waren. Damals lag noch eine gewisse Aufbruchsstimmung in der Luft, und meine Großeltern wurden freudig empfangen. Horst war Straßenbauingenieur, Liselotte Hebamme. In Kuba wurden solche Leute gebraucht. Den Krieg in Europa beobachteten beide aus der Ferne und mit wachsendem Entsetzen. Endlich kehrte wieder Frieden ein, aber inzwischen hatten sich meine Großeltern an ihr neues Leben gewöhnt.«
»Wollten sie nicht wieder zurück?«
»Keine Ahnung. Kurzum: Helmut, mein Vater, wurde in La Habana geboren, in einer kräftigen Inszenierung sozialistischer Gedanken. Als meine Großeltern in den späten Fünfzigerjahren kurz hintereinander starben, war Helmut schon erwachsen, Ingenieur wie sein Vater und schwer damit beschäftigt, eine Frau zu suchen. Der Kommunismus zelebrierte aggressiv die Ehe.«
»Mochte man keine Männer auf dem Solotrip?«
»Nein. Sie sollten Kinder haben und vorbildlich für die Familie sorgen.«
»Es fehlte ihnen gewiss nicht an Auswahl.«
»Der Kommunismus mochte keine Frauen, die mit dem Po wackelten. Keinen Bananengürtel, gefälligst, sondern Hammer und Sichel. Kurzum, mein Vater durchwühlte einige Betten – was großzügig toleriert wurde – und heiratete schließlich Clara de Silva – meine Mutter.«
»Trug sie als junge Frau einen Bananengürtel?«
Nicht, dass ich wüsste. Aber sie war ein genetisches Potpourri: Zu ihren Vorfahren zählten Ureinwohner, Portugiesen, Afrikaner und Holländer. Man hatte jahrhundertelang fröhlich durcheinander kopuliert. Die sichtbaren Konsequenzen: Clara hatte schwarze Augen und üppiges, rotblondes Haar. Du hast ja die Fotos gesehen!«
»Und du bist schwarz gelockt, mit blauen Augen, überaus charmant.«
»Danke.«
»Willst du mir nicht zeigen, wie man mit dem Po wackelt?«
»Später. Jedenfalls lässt sich der Habitus der nächsten Generation nicht voraussagen. Die Genetik kennt keine kontrollierte Evolution.«
»Zum Glück!«
»Beide hatten ihren Beruf. Clara war Lehrerin, eine bedeutende Aufgabe in einem Land, wo der Unterschied zwischen Arm und Reich noch sehr ausgeprägt war. Und dann betrat Fidel Castro die politische Szene. Alle waren von ihm begeistert. Ein charismatischer Staatsmann, voller revolutionärem Enthusiasmus und Tatendrang. Castro bot den Großmächten die Stirn, baute Kuba neu auf, besiegte die Armut. Und jedes Kind lernte kostenlos lesen und schreiben. Castro war ein Diktator, aber ein erleuchteter. Man himmelte ihn an. Ein Politiker seines Ranges braucht einen Namen, sozusagen als Markenzeichen. Hitler war der ›Führer‹ gewesen, Mussolini der ›Duce‹ und Mao Tse-tung der ›große Steuermann‹. Alle voller Macken und nicht beispielgebend. Castro wurde zunächst ›El Barbudo – der Bärtige‹ genannt.«
»Hat ihm der Name gefallen?«
»Ganz und gar nicht. Castro wollte kein Barbudo sein. Barbudos sehen alt aus. Folglich nannte man ihn ›El Líder‹. Ein Líder ist das Gleiche wie ein Führer, aber die spanische Sprache macht die Benennung salonfähig. Doch für die Kubaner war ›El Líder‹ nicht imposant genug. Und folglich avancierte Castro zum ›El Líder Máximo‹. Für meine Großeltern war Castro stets ein Ideal gewesen, eine Statue aus Marmor, auf einem Bein und mit einem vergoldeten Lorbeerkranz.«
»Stand er wirklich auf einem Bein?«
»Nur symbolisch gemeint. Ja, aber als die Kuba-Krise losbrach und Sowjets und Amerikaner sich hinter Atomraketen böse anstarrten, leistete sich El Líder Máximo einen Patzer. Chruschtschow sollte Atomwaffen einsetzen und die Welt in die Luft sprengen, bevor die Amerikaner ihm zuvorkamen. Am besten sofort. Das kubanische Volk – so Castro – wäre gerne dazu bereit, seine Pflicht gegenüber dem Vaterland und der Menschheit zu erfüllen.«
»Was für ein Angeber!«
»Das nennt man Größenwahn. Aber das kubanische Volk wollte nicht mitmachen. Das Denkmal krachte von seinem Sockel. Zum Glück dachten Chruschtschow und Kennedy pragmatisch. Ein Weltkrieg? Nicht opportun!«
»Die Waffenarsenale waren nicht voll genug.«
»Noch etwas Geduld, please! Nur eine Frage der Zeit … Aber ein Krieg musste ja her. Das war dann der ›Kalte Krieg‹ ohne Waffen. Man hat sich nur angeschnauzt. Helmut brauchte einige Monate, bevor er Clara überzeugen konnte, dass Kuba nicht mehr das richtige Pflaster für sie war und dass sich in Deutschland wundervoll leben ließ. Mit Nürnberger Lebkuchen, Sachertorte und Kirschkompott. Es war nicht leicht, aus Kuba herauszukommen, aber Helmut und Clara manövrierten geschickt zwischen vertrauten Relationen und subtilen Erpressungen.«
»Kurzum, die DDR im Winter hieß sie gnädig willkommen. Berlin war eiskalt, die Mauer ein fieser Anblick. Dazu unfreundliche Leute und schlechtes Essen.«
»Kein Streuselkuchen?«
»Nix davon. Nur Kartoffelbrei mit Wirsing oder Zwiebel, abends Brot mit Margarine und etwas Aufschnitt. Dazu Muckefuck.«
»Was ist denn das?«
»Kaffee-Ersatz.«
»Und die Wohnung?«
»Die Wohnung war das einzige Schöne. Mit Parkettböden und Stuckarbeiten an den Wänden.«
»Très chic, und gar nicht kommunistisch.«
»Doch, sehr. Die Wohnung war gnadenlos heruntergekommen. Die Tapeten verschimmelten, der Boden verweste. Es gab keine Heizung und Wasser nur während zwei Stunden am Tag. Immerhin hatten sie einen Ofen, aber der Kohleneimer musste täglich drei Stockwerke hoch- und runtergeschleppt werden. Das machte Helmut. Die Expatriierten seufzten, aber passten sich an. Wenigstens hatten sie ein gewisses Know-how und setzten ihre Erfahrungen in aller Diskretion ein. Und es dauerte nicht lange, da waren ihnen diese Erfahrungen tatsächlich von Nutzen. Clara hatte es schwer gehabt. Sie sprach nach ein paar Monaten fließend Deutsch, allerdings mit einem besonderen Tonfall. Sie hatte eine zu laute Stimme, ein zu lockeres Mundwerk und lachte, dass die Wände wackelten. Ging gar nicht. Hierzulande hatte man seriös zu sein. Man gab ihr zu verstehen, dass sie impertinent war. Sie hielt sich zurück, weil sie ihrem Mann nicht schaden wollte, verlor aber nach und nach ihre Lebensfreude, das sieht man auf den Fotos.«
»Ich finde sie hübsch. Nach wie vor.«
»Am Anfang schneiderte sie sich ihre Kleider selbst, weil sie in der DDR ja nichts Schönes fand. Aber bald trug sie nur noch ihre alten Klamotten. Keine Lockenwickler mehr, keinen Lippenstift. Wie sie aussah, interessierte sie kaum noch. Und als sie mit mir schwanger war, sowieso nicht.«
»Und wann wurde dein Vater ein Stasi-Mann?«
»Recht bald, nehme ich an. Ich entsinne mich vage, dass er täglich am Schreibtisch saß, den Kopf vornübergebeugt wie ein Huhn, das Würmer pickt. Homeoffice nennt man das heute. Er rauchte Zigarren, die er auf irgendwelchen Wegen aus Kuba bezog. Er schrieb eine politische Kolumne, die Beachtung fand, weil er durch sein Leben im Ausland innovative Perspektiven öffnete. Ein ferner Blickwinkel, der die Leute mit Vergleichsmöglichkeiten konfrontierte. Sehr im Sinne der Partei, natürlich. Er war auch viel weg, bisweilen tagelang.«
»Was trieb er denn so den ganzen Tag?«
»Keinen blassen Schimmer. Als Kind habe ich das nicht hinterfragt. Es hat mich auch nicht besonders interessiert. Jahre später habe ich erfahren – mit recht kindischer Enttäuschung –, dass er kein James Bond war, leider nicht. Seine Aufgabe bestand darin, Informationen nachzuspüren, die von politischer Relevanz waren. Langweilig, eigentlich. Das war genau jene Zeit, als Moskau ungehindert die deutsche Ostpolitik instrumentalisierte, in aller Diskretion Politiker, Beamte und Industrielle auf seine Seite holte. Mein Vater ließ sich nie anmerken, was er in Wirklichkeit dachte. Dafür war er viel zu schlau. Er folgte der Realpolitik in eigener Sache. ›Politik kommt und geht‹, sagte er einmal zu mir, als ich alt genug war, um das zu verstehen. ›Es ist besser, man steht über den Dingen und wartet ab, was kommt.‹«
»Clever. Und deine Mutter?«
»Ebenso clever. Aber sie musste Opfer bringen, was sie in Kauf nahm. Sie arbeitete in einem Altersheim. Das hatte die Stasi natürlich eingefädelt. Man wollte wissen, wie es mit ihrer Parteitreue stand. Vom vielen Bettenmachen litt sie ständig unter Ischiasschmerzen. Sie biss die Zähne zusammen, hielt durch. Dazu kam, dass sie diese alten Menschen, die nur noch vor sich hin vegetierten, allmählich in ihr Herz geschlossen hatte. Dann wurde sie schwanger, schleppte sich Tag für Tag kraftlos zur Arbeit und brachte mich sechs Jahre vor der Wende auf die Welt.«
»Da glaube ich dir kein Wort!«
»Wieso nicht?«
»Ich dachte, du wärest erst neunzehn!«
»Dir fehlt es an Takt und Feingefühl.«
»Ist doch ein Kompliment!«
»Ich habe eine gute Beauty-Routine.«
»Weiter!«
»Ich war ein recht aufgewecktes Kind, erschreckend gescheit und widerlich. Und ich merkte bald, dass etwas mit den Eltern nicht stimmte. Ich hatte zwei Figuren erfunden: Frau Tam und Herrn Tim, in die ich abwechselnd schlüpfte. Ich stand im Schlafzimmer vor dem Spiegel und redete mit mir selbst.
›Mein Vater lügt …‹ ließ ich Herrn Tim sagen.
›Das stimmt überhaupt nicht‹, sagte Frau Tam.
›Doch. Alles was er schreibt, ist nicht wahr. Ich habe es ihm gesagt.‹«
»Und was hat dein Vater gesagt?«
»Er hat gesagt, ›geh spielen, Rosa, ich muss mich konzentrieren‹.
Ich redete laut und hemmungslos. Meine Eltern sollten hören, was ich sagte. Es musste für sie der pure Stress gewesen sein. Ich redete sogar beim Essen, denn Frau Tam und Herr Tim saßen auch bei Tisch, zu beiden Seiten von mir. Ich redete pausenlos. Ich mischte mich überall ein, konnte mich auf einzelne Fragen auf gemeine Art fokussieren. Meine Eltern ertrugen das, einige Wochen lang. Meine Mutter reagierte mit zunehmender Ungeduld.
›Steh nicht dauernd vor dem Spiegel und rede Unsinn. Dein Vater lügt nicht.‹
Du lügst auch, sagte ich. Aber mein Vater lügt besser.
Irgendwann riss Clara der Geduldsfaden. Das war eines Tages beim Mittagessen. Es gab Pellkartoffeln mit Rotkohl, daran erinnere ich mich genau. Und beim Essen unterhielt ich mich – wie gewohnt – mit Frau Tam und Herrn Tim.
Ich weiß, was er macht, sagte ich in verschwörerischem Tonfall, indem ich abwechselnd den Kopf hin und her drehte. Er schreibt über Leute, die nicht wissen, dass er über sie schreibt.
Clara explodierte. Sie packte mich, zerrte mich vom Stuhl und schleifte mich durchs Zimmer. ›Jetzt ist der Spaß vorbei!‹
Lass mich los!, keifte ich.
Sie verpasste mir eine Ohrfeige, dass mir Hören und Sehen verging. So was machte man in Kuba. In der DDR natürlich auch, aber nicht so komplexlos. Ich schrie aus Leibeskräften. Clara stieß mich vor sich hin, riss die Wohnungstür auf.
›Fertig mit Tim und Tam! Los! Schick sie weg!‹
Nein!, kreischte ich.
Sie hob drohend die Hand. Ich duckte mich, schrie noch lauter und sah, wie Frau Tam und Herr Tim sich langsam zurückzogen. Ich wunderte mich, dass sie mir so ähnlich sahen. Sie waren ein Teil von mir, aber ich konnte sie nicht zurückhalten. Sie entfernten sich im Treppenhaus, langsam, dann immer schneller. Sie lösten sich auf wie in einem Nebel und verschwanden.«
»Krass! Aber wirksam.«
»Ja. Rückblickend kann ich sagen, dass Clara – trotz ihrer Wut – meine Irrealität sehr subtil ins Spiel gebracht hat.«
»Emotional großartig.«
»Ja. Sie hat mir Frau Tam und Herrn Tim ausgetrieben, genau so, wie man früher böse Geister verscheuchte. Sie lebte in Ostberlin, aber ihr Wissen entstammte einem anderen Zeitalter und einer anderen Welt.«
»Und danach?«
»Danach wurde ich krank, ziemlich schwer sogar. Eine Hirnhautentzündung zog mich eine Zeit lang aus dem Verkehr. Meine Mutter pflegte mich kompetent und geduldig. Als ich wieder klar denken konnte, erzählte sie mir, dass man die Mauer zerstört hatte, dass wir jetzt hingehen konnten, wo wir wollten, und dass wir von jetzt an ganz anders leben würden. Auch die Stasi existierte auf einmal nicht mehr. Sie hatte sich, wie Frau Tam und Herr Tim, im Nebel aufgelöst. Der KGB musste sich zunächst reorganisieren. Was natürlich nicht von heute auf morgen ging. Intern herrschte große Verwirrung. Bisher verlief von oben bis unten alles nach dem gleichen Schema: Ich habe zu gehorchen, du hast zu gehorchen und so weiter in allen Richtungen. Das funktionierte plötzlich nicht mehr. Offiziell, meine ich. Die Leute mussten lernen, selbstständig zu denken. Zumindest sollten sie so tun.«
»Verstehe.«
»Mein Vater wurde arbeitslos. Eine Zeit lang war es Clara, die den Unterhalt für die Familie verdiente. Dann fand Helmut einen Verlag, der sich auf zeitgenössische politische Themen spezialisiert hatte. Er veröffentlichte Bücher, hielt Vorträge. Später arbeitete er als Lektor und beratender Historiker. Zerstreut, wie er war, wurde er 2008 von einer Straßenbahn erfasst und war auf der Stelle tot.
Clara und ich litten sehr. Meine Mutter verlor allmählich ihr Gedächtnis, war nur noch Haut und Knochen. Ich war immer für sie da, auf unsentimentale Art allerdings. Bald musste ich sie in Pflege geben. Sie wurde zunehmend misstrauisch, verschloss ihre Schranktür mit Klebestreifen aus Angst, dass man ihr die Wäsche klaute. Sie wusste nicht mehr, wer ich war. ›Rosa? Wer bist du? Ich kenne dich nicht.‹
Damals war ich bereits Anwältin und hatte mich daran gewöhnt, dass ich nur noch einen Schatten als Mutter hatte. Und als ihr Ende kam, traf es mich nicht unvorbereitet. Ich war beruflich erfolgreich, lernte verschiedene Männer kennen, die ich nichtssagend oder auch dreist fand. Wahrscheinlich habe ich nie den Richtigen getroffen.«
»Bin ich der Richtige für dich?«
»Ich kann es noch nicht beurteilen.«
»Zu früh?«
»Könnte sein. Du bist kein Intellektueller.«
»Ach nein?«
»Nein. Intellektuelle erklären stundenlang, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und sie bewegen sich ständig im Kreis. Rationale Analysen kann man von ihnen nicht erwarten.«
»Danke immerhin für den Versuch!«
»Dich sollte man besser kennenlernen. Bei dir verbirgt sich der Kerngedanke unter verschiedenen Schichten, wie bei einer Zwiebel.«
»Ich bin ein Anarchist.«
»Ich denke eher, ein Poet.«
»Selbsterhaltungstrieb.«
»Gut begründet.«
Ich gab ihm eine Kostprobe von dem, was später kommen würde.
»Hör mal, wir können von jedem Zeitpunkt der Geschichte ausgehen, wir finden immer das gleiche Schema. Kommen Alleinherrscher an die Macht, zeigen sie Macht.
Früher saßen sie auf einem Thron. Heutzutage sitzen sie in einem komfortablen Polstersessel. Sie lassen hundert Raketen steigen und fünfhundert Panzer aufziehen. Oder sie stehen unter Flaggen in einer schicken Uniform mit spiegelblanken Stiefeln. Derzeitig eher im schwarzen Anzug. Und alle Umstehenden spenden Beifall.«
»Weil der Anzug perfekt sitzt?«
»Klar doch. Sie können sich ja die besten Schneider leisten.«
»Italiener, nehme ich an.«
»Wer denn sonst? Italiener beherrschen die Schneiderkunst. Machthaber fressen zu viel und haben einen dicken Bauch, den man elegant zu kaschieren hat. Das war schon im Mittelalter nicht anders. Früher gab es die Untertanen, heute die Bevölkerung. Alles Trottel, die sich mittels eines GPS-Trackers vom Morgenkaffee bis zur abendlichen Gulaschsuppe kontrollieren lassen. Proteste? Wozu? Jede Menge devote Uniformierte marschieren im Takt durch die Straßen, drehen die Augen zur Tribüne, alle in der gleichen Sekunde. Wer nicht gehorcht, kommt hinter Stacheldraht. Das ist das Rezept, ganz einfach und effizient.«
»Nicht immer und überall. Aber bis auf Weiteres …«
»Siehst du? Darüber unterhalte ich mich oft mit Frau Tam und Herrn Tim. Die nehmen nie ein Blatt vor den Mund. Ich selbst bringe das nicht fertig.«
»Warum nicht?«
»Weil ich ein schüchterner Mensch bin.«
»Das ist mir noch nicht aufgefallen?«
»Warum schaust du mich denn so an? Das stimmt doch, oder? Meine Puppen wissen besser Bescheid als ich. Sie sagen, dass man sich der Weltgeschichte anpassen muss, wenn man von ihr nicht überrannt werden will.«
»Da mögen sie recht haben.«
»Meine Eltern, die dreifach qualifizierten Spione, hielten sich selbst gut im Griff. Rückblickend imponiert mir ihre Fähigkeit, sich selbst zu tarnen und das eigene Denken nach Bedarf zu verändern. Sie waren nie bedingungslos ehrlich. Sie kontrollierten ihre Emotionen. Emotionen haben mit dem Instinkt zu tun, mit etwas Willkürlichem, Wildem. Goethe, der sich in diesen Dingen gut auskannte, sagte dazu einleuchtendes:
›Wer sie nicht kennt, die Elemente
Ihre Kraft und Eigenschaft
Wäre kein Meister über die Geister.‹«
»Die Geister, die sich heutzutage anmaßen, unsere Welt zu leiten?«
»Das war schon immer so. Wir müssen sie nur in Schach halten.«
»Meister über die Geister also?«
»Wir sind eine perverse Gattung, bis zur letzten Konsequenz durchtrieben. Was uns in den Sinn kommt, kommt auch den Puppen in den Sinn.«
»Gut dressierte Dämonen lassen sich also nutzbar machen, stimmt das?«
»Stimmt. Aber wir müssen sie gut im Auge behalten. Man kann ja nie wissen.«
2. Kapitel
Ich erzählte Alexis, wie es für mich weitergegangen war. Nicht alles auf einmal, eher so, wie es mir in den Sinn kam. Mein Leben auf Umwegen. Ich erzählte ihm, dass ich in der Schule immer gute Zeugnisse hatte. Die besten, eigentlich. Und dass ich – als es nach der Wiedervereinigung ums Studium ging – zu wissen vermeinte, was zu mir passte. Folglich machte ich Abitur und studierte Rechtswissenschaft. Das waren schöne Jahre. Ich machte den Bachelor und drei Jahre später den Master. Großartig. Mit zweiunddreißig war ich selbstständige Anwältin in Berlin.
Er wunderte sich.
»In so kurzer Zeit?«
»Eigentlich nicht außergewöhnlich. Und ja – das passte zu mir. Ich war hartnäckig, zungenfertig, dominant. Wie gemacht für Rededuelle.«
»Brenzlige Situationen? Hoffnungslose Fälle?«
»Kein Grund, um mir die Haare zu raufen! Ich setzte mich als eloquente Verteidigerin in Szene, hielt dramatische Plädoyers. Ich übertrieb gerne, mit der nötigen Anmaßung, weil ich meine Unterlagen gut im Kopf hatte. Die viel gerühmte Unschuldsvermutung rechtfertigte sich, wenn alles hinlänglich klar war. Ich trieb ein bisschen Schönfärberei, ließ die Gefühle heraus und hatte für eine gerechte Sache geschwitzt. Man war mir dankbar, man fiel mir um den Hals. Das waren schöne Augenblicke. Leider habe ich vielfach meine Zeit vergeudet, indem ich auch Halunken aus der Klemme zog.«
»Wie hast du dich dabei gefühlt?«
»Wie eine Komplizin, und das war mies.«
»Wie hast du das ertragen?«
»Schlecht. Irgendwann hatte ich es satt, Hinterfotzigkeiten an mir abprallen zu lassen, weil es mein Job war – einer, der mir immer mehr zuwider wurde. Heucheleien standen bei mir seit der Kindheit auf dem Stundenplan. In diesen Dingen war ich ziemlich abgebrüht, aber die ständige Anstrengung zerrte an meinen Kräften. Ich konnte den ganzen Tag Schokolade futtern, ich wog alles in allem acht Kilo weniger als vor drei Jahren.«
»Was dachtest du jeden Morgen auf der Waage?«
»Ich dachte, Scheiße, es klappt nicht!«
»Schwarze Schokolade stärkt die Neuronen.«
»Nicht, wenn der Kopf vollgepackt ist mit der ganzen Misere dieser Welt.«
»Wie hat sich das angefühlt?«
»Wie eine Plastiktüte voller Müll.«
»Und wo hast du damals gelebt?«
»In einer Wohnung, neu und ohne Schnickschnack. Ein absoluter Gegensatz zu der verschnörkelten Umgebung meiner Kindheit. Die Wohnung gefiel mir, aber ich wollte weg. Das ganze Zeug hinter mir lassen.«
»Und der Müll?«
»Ich hatte einen großen Abfalleimer. Und einmal in der Woche kam die Müllabfuhr.«
3. Kapitel
»Tatsächlich hatte ich das Ganze satt. Auch Deutschland, auch Berlin. Ich kündigte beim Gericht, wo man meine Beweg- gründe als spleenig empfand, mir es jedoch nicht offen sagte. Das hatte ich auch nicht erwartet. Kurzum, ich räumte ohne Seelenzustände mein Büro auf, stopfte Unterlagen von mehreren Jahren in den Keller. Tschüss Vergangenheit, willkommen Neuanfang! Ein herrliches Gefühl von Befreiung. Ich kündigte auch meine Wohnung, packte den Rucksack und stieg in den Zug. Ich hatte etwas Geld, eine Auszeit konnte ich mir wohl leisten. Ein paar Wochen lang sah ich mir Europa an, bewunderte die Vielfältigkeit der Kulturen, kämpfte mit Sprachschwierigkeiten.«
»Konntest du kein Französisch?«
»Nein. Weder Französisch noch Italienisch, lediglich ein bisschen Spanisch und Dilettanten-Englisch.«
»Mit Dilettanten-Englisch kommst du überall durch.«
»Englisch genügte vollkommen. Ich wollte meinen Kopf ausmisten, eine andere werden.«
»Und? Hat’s geklappt?«
»Es waren meine Lehr- und Wandermonate.«
»Mit einem Mann?«
»Selten. Ich war auf Selbstfindungstrip.«
»Verstehe. Da lenkt ein Mann nur ab.«
»Und tatsächlich – nach einigen Monaten hatte ich auch das Herumreisen satt.«
»Wir Franzosen haben einen Ausdruck dafür: ›Plus ça change, plus c’est la même chose.‹«
»Zutreffend.«
»Irgendwann kam es mir so vor, als fiele meine alte Haut von mir ab. Die neue war noch am Wachsen, aber ich hatte keine Eile. Ich wollte keinen Rucksack mehr, ich wollte Entspannung. Und beschloss, einen Ort für einen Neuanfang zu suchen.
In dieser Zeit hielt ich mich in der Schweiz auf und kam durch Zufall nach Luzern.
In Luzern gab sich der Reichtum bescheiden. Kein Sich-Verleugnen, sondern diskrete Noblesse. Selbst die Banken, die Hotelpaläste an der Uferpromenade, die Juweliergeschäfte ließen ihre Opulenz nur ahnen. Zwischen Fluss und See war Luzern eine Stadt für fröhliche Menschen, die sich herzlich begrüßten und lebhaft unterhielten. Unter zwei Brücken trat die Reuss aus dem See. Der See war blau, der Fluss war grün. Schwäne ließen sich tragen, Möwen landeten im Sturzflug. Auf einer Brücke brauste der Verkehr. Die andere, schräg gegenüber, lebte abseits ihrer eigenen Träume. Dunkles Gebälk, ein Ziegeldach, in der Brückenmitte ein alter Wasserturm. Im Dachgestühl, auf dreieckigen Holztafeln, zeigten farbige Gemälde beheimatete Legenden oder geschichtliche Episoden. Sie erzählten von Zeiten, da Symbole und Überlieferungen ein Eigenleben annahmen, sich ihre spezifischen Bilder schafften und schließlich aus eigenem Willen heraus fortbestanden.
Ich starrte zu den Gemälden empor, bis ich einen steifen Nacken hatte. Ein paar Sekunden lang befand ich mich in einem Anderswo. Warum weckte dieser Ort fremde Gedanken in mir? Vielleicht, weil ich mich selbst nicht kannte. Weil meine eigene Fremdheit keine Stärke war, sondern ein Amalgam von Widersprüchen, Schlacken einer schlecht gelebten Vergangenheit.
Halbe Sachen waren nicht mein Ding. Ich war eine Perfektionistin. Und ich wollte diese Schlacken endlich abschütteln, mich selber kennenlernen. Warum nicht hier?
Ich beantragte eine Aufenthaltsbewilligung. Als Beruf gab ich ›Studentin‹ an, was eigentlich nicht falsch war. Es gab etliche alte Studenten, die vorgaben, das Leben zu studieren.«
»War es leicht für dich, eine Wohnung zu finden?«
»Ich hatte Glück. In einem der neueren Gebäude in Seenähe wurde ein Zwei-Zimmer-Apartment frei. Die Mieterin hatte von heute auf morgen gekündigt und suchte in aller Eile eine Nachfolgerin. Ich unterschrieb sofort den Mietvertrag und kaufte ihr diese paar Möbel ab. Ich hatte schon damals wenig Sachen. Ein Neuanfang ohne Ballast.«
»Und was wolltest du studieren?«
»Das Leben. Weißt du, was? Ich kam mir vor wie auf einem Fahrrad mitten auf der Straße, schwanke, mal hierhin, mal dorthin. Und keine Ahnung, in welcher Richtung.«
»In die nächste Depression?«
»Hätte durchaus sein können. Aber das Glück war zum zweiten Mal nett zu mir. Kurze Zeit nachdem ich eingezogen war, lernte ich Dan kennen. Dan hieß eigentlich Daniel und war Schauspieler. Er hatte zunächst zum Film gewollt, hatte ein paar Rollen in kleineren Produktionen übernommen, bis er merkte, dass ihm das Theater mehr lag. Er wohnte im gleichen Gang, nur drei Türen weiter. Ich traf ihn eines Abends, als er verzweifelt und auf allen vieren seinen Wohnungsschlüssel im Treppenhaus suchte.
›Mist!‹, jammerte er. ›Hier ist ja kein Licht! Miete zahle ich doch genug! Muss ich mir obendrein noch eine Taschenlampe besorgen?‹ Letztendlich steckte der Schlüssel in seiner Jackentasche, und er kam sich reichlich doof vor. Seit dieser Begegnung geschah es häufiger, dass wir ins Gespräch kamen, zunächst im Hausflur, danach entweder bei mir oder bei ihm. Dabei entdeckten wir ziemlich bald, dass wir wiederholt das Gleiche dachten. Es kann ja sein, überlegte ich zynisch, dass zwischen Schauspielern und Anwälten kein großer Unterschied besteht. Nur dass Anwälte ein höheres Gehalt haben.
Ich fragte Dan, warum er lieber beim Theater war. Er gab eine seltsame Antwort: ›Wegen der Gleichzeitigkeit.‹ Ich bat ihn, mir das besser zu erklären. Was er liebte, ließ Dan mich wissen, war die unmittelbare Nähe des Publikums, die Spannung, die fühlbare Übereinstimmung.
Dan fuhr fort: ›Eigentlich ist die Bühne ein Ort für Egozentriker, jeder sieht sich in Verbindung mit den anderen, aber betrachtet nur sich selbst, wie in einem Spiegel. Eine Art von Konfrontation. Und gleichzeitig ein Ort der Verwandlung, der Metamorphose.‹
Diese Sprache war mir fremd. Ich fragte Dan, wie er das meinte. ›Ich meine, dass Schauspieler sich mit der Gestalt, die sie verkörpern, identifizieren müssen. Und sich von dieser Gestalt verhexen lassen.‹
Das ist der Unterschied, dachte ich. Rechtsanwälte dürfen nie die Kontrolle verlieren. Ihr Gehirn muss klar denken, es geht ja nicht darum, loszulassen, sondern ein Ziel zu erreichen. Ich sagte: Ich beneide dich!
›Warum?‹
Weil du Narrenfreiheit hast!
›Kann ich davon leben?‹
Worauf kommt es an?
›Ob ich ein festes Engagement habe oder nicht.‹
Und wenn nicht?
›Na ja, dann kommen nur Spaghetti auf dem Teller.‹
Ich liebe Spaghetti. Am liebsten alla carbonara. Mit viel Parmesan.
›Aber doch nicht jeden Tag?‹
Jeden Tag. Die DDR konnte uns ja nicht füttern. Und es gab keine Spaghetti zum Trost, nur Kartoffeln. Ich habe ein gewaltiges Nachholbedürfnis.«
»Und die Männer?«, warf Alexis irrelevant dazwischen.
»Wenig zufriedenstellend, leider.«
»Und ich, bin ich zufriedenstellend?«
»Das wird sich bei Gebrauch zeigen.«
Alexis verzog das Gesicht.
»Hört sich an wie beim Kauf eines Staubsaugers!«
»Dan kam aus einer Welt, die mir fremd und doch sonderbar vertraut war. Eine Welt, für die ich eine diffuse Sehnsucht empfand. Aber woher kam diese Sehnsucht? Er und ich hatten unser Leben geführt, getrennt voneinander. Dennoch entstand zwischen uns bald ein vertrautes Gefühl. Dass wir uns verstanden, hatte eigentlich wenig mit Erotik zu tun. Dan war schwul. Auf eine nette, empathische Art. Er spürte, dass ich unzufrieden mit meinem Leben war. Dan hatte einen ähnlichen Zustand gekannt. Noch als Schüler hatte man ihn als verhaltensgestört abgestempelt, gemobbt und verprügelt. Sogar die Lehrer schienen etwas gegen ihn zu haben. Er hatte Jahre gebraucht, bis er endlich wusste, warum, und sein Leben in den Griff bekam.
›Deswegen‹, sagte Dan.
Nur, weil du schwul warst?
›Die Zeiten haben sich geändert.‹
Jetzt bist du komplett trendy.
›Ich könnte sogar zwei Kinder adoptieren.‹
Um Himmels willen, bloß nicht. Sonst wirst du Hausfrau.
Wir lachten, bis wir nicht mehr konnten.
›Als Anwältin hattest ein gutes Gehalt‹, sagte Dan, als wir wieder zu Atem kamen. ›Willst du es jetzt aufs Spiel setzen?‹
Lass das meine Sorge sein. Ich bin noch nicht obdachlos.
›Also vorläufig noch keine Spaghetti?‹
»Nein. Ein Viergangmenü im Restaurant. Komm, ich lade dich ein!«
4. Kapitel
Bis auf Weiteres hatte Dan ein festes Engagement im Kellertheater Luzern. Dieses Theater existierte seit Ende der Sechzigerjah-re, zeigte aber noch heute ein vielfältiges Programm: Kabarett, Tanzkreationen, Kindertheater, Musik- und Literaturabende. Standen Kammerspiele auf dem Programm, gab es immer eine Rolle für Dan.
»Wenn es dich interessiert, kann ich dir das Theater mal zeigen.«
»Jetzt gleich?«
»Warum nicht? Heute gibt es keine Vorstellung.«
Zunächst fand ich das Theater enttäuschend. Es war im Erdgeschoss eines nichtssagenden Mietshauses untergebracht und gab sich diskret, wenn nicht unscheinbar. Dan erklärte mir jedoch, dass das Kellertheater nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland bekannt war.
»Man wird es sogar in Berlin kennen!«
»Nie davon gehört.«
Dan wusste, dass das Theater mit seinem ganzen Drum und Dran nie meine Welt gewesen war. Er erklärte mir, dass das Luzerner Kellertheater als Sprungbrett für eine erfolgreiche internationale Karriere galt. Nicht wenige international erfolgreiche Künstler hatten auf dieser Bühne ihr Debüt gegeben.
»Wir sind nicht selten ausverkauft.«
Ich ersparte mir eine weitere dumme Bemerkung und hörte aufmerksam zu. Mein Interesse war erwacht. Das Theater mit seinen Sitzreihen war nicht sehr groß, bot aber für etwa zweihundert Leute Platz. Ich blickte über den schwach erleuchteten Zuschauerraum hinweg auf die leere Bühne, und vor mir öffnete sich sachte, aber beständig eine gänzlich unbekannte Welt. Ich entdeckte Räume, die sich im Dämmerlicht verloren, erlebte zum ersten Mal das spezifische Gefühl einer ungewissen Stimmung. Ich stellte mir das Publikum vor, zweihundert Gesichter, die alle auf mich starrten und mit Spannung auf jedes Wort warteten, das ich sagen würde.
Ich fragte zerstreut: »Was ist das?«
Dan sah mich an. »Was meinst du?«
»Dieses Gefühl? Woher kommt es?«
»Warst du noch nie in einem Theater?«
Ich schüttelte wortlos den Kopf.
»Willst du mal einen Blick hinter die Kulissen werfen? Ich werde dir eine Karte besorgen für meine nächste Vorstellung«, sagte Dan. Alle Schauspieler sind eitel und wollen gesehen werden!
Ich stieg hinter ihm ein paar Stufen hinauf. Dan erklärte mir die Bühnentechnik, zeigte mir die Beleuchtungsbrücke, die sich über die ganze Bühnenbreite zog.
»Hast du gewusst, dass man die Trennung zwischen Bühnenraum und Zuschauerraum den ›eisernen Vorhang‹ nennt?«