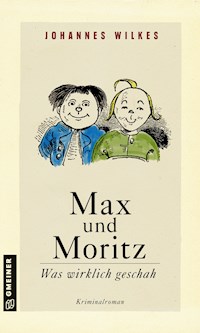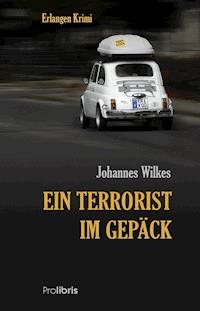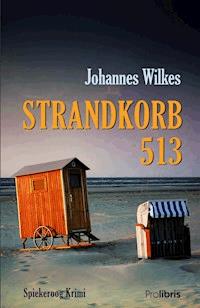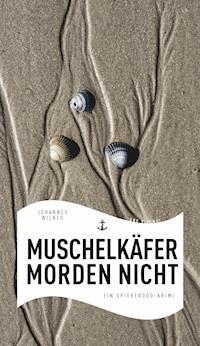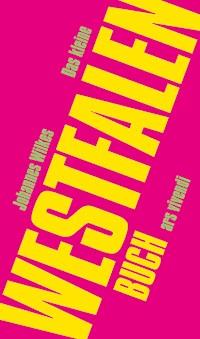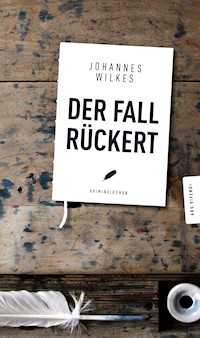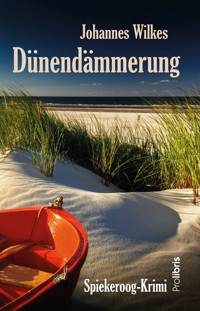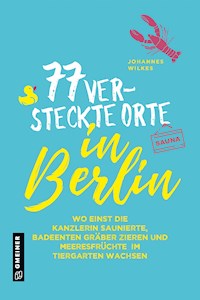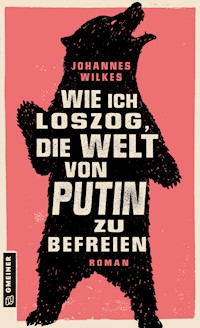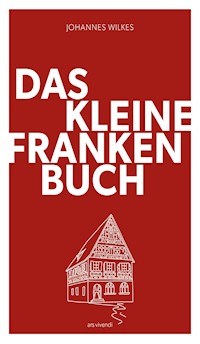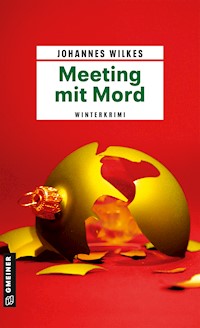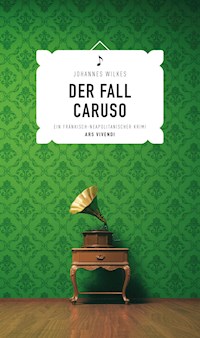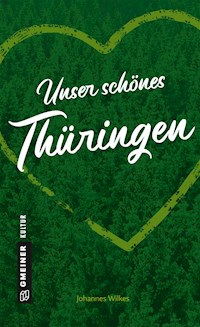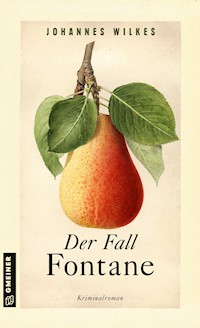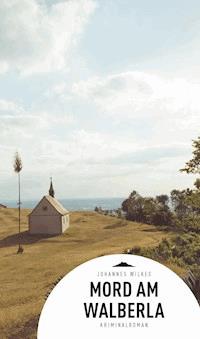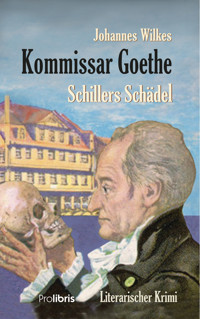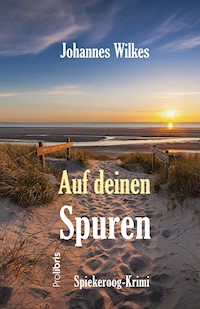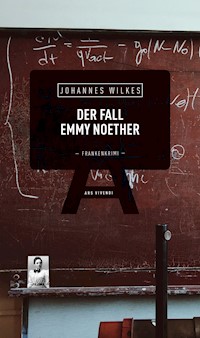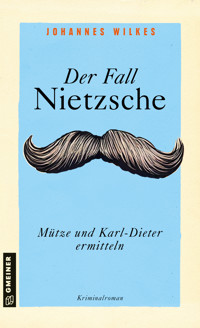
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Mütze
- Sprache: Deutsch
Entsetzen in Erlangen: Kurz vor der Besetzung des renommierten Schelling-Lehrstuhls wird der heißeste Anwärter erschossen in der Neischl-Grotte gefunden. Es handelt sich um Markus Nüsslein, einen ausgewiesenen Nietzsche-Kenner und ehemaligen Studenten der Friedrich-Alexander-Universität. Kommissar Mütze ermittelt und stößt auf Missgunst und Intrigen im Umfeld des Ermordeten. Steckt ein Konkurrent um den Lehrstuhl hinter der Tat? Was verbirgt die undurchsichtige Witwe des Toten? Und was hat Nietzsches Zeit in Erlangen 1870 mit dem Fall zu tun?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Johannes Wilkes
Der Fall Nietzsche – Mütze und Karl-Dieter ermitteln
Kriminalroman
Zum Buch
Wille zum Mord Erlangen fiebert der Neubesetzung des renommierten Schelling-Lehrstuhls entgegen. Ein echter Höhepunkt des kulturellen Lebens in der Stadt, in der man stolz auf seine traditionsreiche Universität ist. Doch dieses Mal kommt es im Vorfeld der Vergabe zu einer Katastrophe: Der aussichtsreichste Kandidat springt kurzfristig ab, der neue Favorit auf den Lehrstuhl und ausgewiesene Nietzsche-Kenner, Professor Markus Nüsslein, wird tot im Botanischen Garten aufgefunden, erschossen in der Neischl-Grotte. Seine Frau hatte Kommissar Mütze bereits vor Nüssleins Tod gebeten, ihren Mann zu suchen. Mütze hatte ihren Wunsch nur müde weggelächelt, nun steckt der Ermittler in größten Schwierigkeiten. Die Welt der Philosophie ist ihm fremd und das akademische Umfeld gleicht einer Schlangengrube. Zwischen den Anwärtern auf den Lehrstuhl herrscht ein erbitterter Konkurrenzkampf, es gibt offene Rechnungen, und eine mysteriöse Lippenstiftspur sorgt für zusätzliche Verwirrung …
Johannes Wilkes, Jahrgang 1961, lebt in Bayern. Der Autor von Romanen, Krimis und Reisebüchern ist mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden, seine Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: Lutz Eberle mit Adobe Firefly
ISBN 978-3-7349-3204-5
Zitat 1
O Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht?
»Ich schlief, ich schlief –,
Aus tiefem Traum bin ich erwacht:
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht,
Tief ist ihr Weh –,
Lust – tiefer noch als Herzeleid:
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit –,
– will tiefe, tiefe Ewigkeit!«
Friedrich Nietzsche: Zarathustras Rundgesang
Zitat 2
Mancher findet sein Herz nicht eher, als bis er seinen Kopf verliert.
Friedrich Nietzsche
Montag
1
Maxi war wie immer die Erste. Pünktlich um acht, wenn Siegfried, der Gärtner, das Gittertor aufschloss, stand die betagte Dame schon am Eingang, an der Leine ihren Wichtel, der dem Moment der Öffnung stets schwanzwedelnd entgegenfieberte. Maxi liebte den Botanischen Garten über alles. Jeden Morgen brach sie von ihrer kleinen Wohnung in der Unteren Karlstraße auf, kreuzte die Universitätsstraße und ging durch den Schlossgarten an der Orangerie vorbei zum Eingangstor am Redoutensaal. Ihr Hund hätte den Weg bestimmt auch allein gefunden. Selbst falls sie erblinden sollte, würde Wichtel sie noch sicher führen, sagte sich Maxi oft, und die Vorstellung beruhigte sie ein wenig, denn ihre Augen ließen tatsächlich nach.
»Was willst du denn im Botanischen Garten, wenn du nichts mehr sehen kannst?«, hatte ihre Freundin Doris mit der ihr eigenen Direktheit bemerkt. So war Doris. Jeder andere hätte die Freundschaft längst beendet. Aber Maxi wusste, dass Doris es nicht so meinte. Doris stammte aus Berlin, da war der Ton ein anderer.
»Wenn ich tatsächlich erblinden sollte«, hatte Maxi erwidert, »so werde ich immer noch Gefallen an meinem Garten haben.«
War der Botanische Garten nicht etwas für alle Sinne? Wie bezaubernd war der Gesang der Vögel, die in den alten Bäumen saßen. Wie köstlich konnte man sich über das Quaken der Frösche amüsieren, über ihr Platschen, wenn sie vom Beckenrand erschrocken in das Bassin sprangen. Wie emsig schwirrten und summten die Bienen und Hummeln zwischen den Blüten. Eine große Sinfonie in Natur-Dur. Nur vor einem Geräusch fürchtete sich Maxi, ja sie hasste es geradezu. Zum Glück störte dieses Geräusch den Frieden nur selten, meist konnte sie sich unbeschwert am Gesang der Amseln und Buchfinken erfreuen. Besonders liebte sie das Lied der Goldammer. Wenn sie ihr Wie-wie-wie-hab-ich-dich-lieb anstimmte, blieb die alte Dame wie verzaubert stehen, schaute zu den Eukalyptusbäumen hinüber und lauschte. Betörender noch als der Gesang der Vögel waren die Düfte. Das ganze Jahr über wurde die Nase umschmeichelt. Allein die Aromastauden bei den Gewächshäusern! Kein Besuch verging, bei dem Maxi nicht über die unscheinbaren Blätter strich, die schmale Hand zur Nase führte und sich an einem neuen Duft erfreute. Die Pflanzen rochen besser als das edelste Parfum, das Hugo ihr von einer seiner Dienstreisen aus Paris mitgebracht hatte.
Maxi beugte sich runter und streichelte wehmütig Wichtels dunkles Fell. Hugo, ihr Hugo! Ihr Mann war bereits vor vielen Jahren verstorben. Jeden Sonntag besuchte sie sein Grab auf dem Neustädter Friedhof und legte eine Rose ab, die verwelkten nahm sie mit und steckte sie daheim hinter Hugos gerahmtes Bild.
Eigentlich hieß sie Maximilienne. Ihren Mann hatte sie beim Tanztee im Schwarzen Amboss in Hausen kennengelernt, der berühmt-berüchtigten Location der Swinging Sixties, sechzig Jahre her. Hugo hatte sie nach dem ersten Kuss Maxi genannt; den Kosenamen hatten mit der Zeit alle ihre Freunde und Bekannten übernommen. Vielleicht wäre Maxi häufiger zum Grab ihres Mannes gegangen, jedoch waren Hunde auf Friedhöfen nicht erlaubt, und Wichtel am Eingang anzubinden, traute sie sich nicht.
Nach Hugos Tod war die Stille nur schwer zu ertragen gewesen, die Wohnung war Maxi mit einem Mal viel zu groß erschienen. Eine Zeit lang hatte sie ein Zimmer an Studenten vermietet. Nachdem der letzte Student ausgezogen war, hatte sie sich Wichtel ins Haus geholt. Der Mischling kam aus Rumänien, ein Straßenhund, dem es sehr schlecht ergangen sein musste. Die ersten Wochen war er verschüchtert und mit eingeklemmtem Schwanz herumgelaufen. In seinen Augen hatte die nackte Angst gestanden. Wer weiß, was er in Rumänien erlebt hatte. Nach und nach hatte sich seine Furcht gelegt und er war zutraulicher geworden. Vorsichtig war er allerdings immer noch und hielt Abstand zu Menschen und Hunden, die er nicht kannte. Der Botanische Garten war auch für ihn ein Paradies, hier fühlte er sich sicher und zu Hause.
Stets drehten sie die vertraute Runde: auf dem mit fantasievollen Granitplatten gepflasterten Hauptweg geradeaus zu den Gewächshäusern, an den Gärten der fünf Erdteile vorbei bis zum Gebäude der Virologie, dann rechts durch das Barockgärtchen zurück zu dem kleinen Wäldchen, schließlich durch die Moorlandschaft und an der Neischl-Grotte vorbei wieder zum Ausgang.
Dieses Mal war etwas anders. Als sie die Neischl-Grotte erreichten, fing Wichtel an, nervös zwischen den Gitterstäben zu schnüffeln, die den Eingang zur künstlichen Höhle verschlossen. So etwas tat er sonst nie.
»Was ist denn, mein Guter?«, fragte Maxi verwundert.
Wichtel hörte nicht auf sie, sondern schnüffelte aufgeregt weiter.
»Komm schon«, sagte Maxi und zog an der Leine.
Bestimmt hat er eine Maus gerochen, die sich in der Höhle versteckt hat, dachte sie. Seine Nase beschäftigte ihn unaufhörlich. Sein Geruchssinn war erstaunlich, vielleicht hatte er ihm sogar das Leben gerettet. Sonst hätte er in Rumänien wohl kaum überlebt.
2
»Ermordet! Mein Mann ist ermordet worden!« Mit erregtem Gesicht starrte Claudia van der Vaart den Kommissar an.
Mütze war baff. Es kam nicht häufig vor, dass jemand in ihrer gemütlichen Erlanger Polizeidirektion vorbeikam, um einen Mord anzuzeigen. »Führen Sie uns zu seiner Leiche!«, entgegnete er voller Tatendrang und warf sich die Schimanski-Jacke über.
»Das ist es ja! Ich weiß nicht, wo er ist.«
»Aber Sie sagten doch, er sei ermordet worden?«
»Er ist verschwunden, verstehen Sie? Er ist nicht mehr da, seit gestern Abend nicht mehr. Sie müssen ihn suchen!«
Mütze atmete tief durch und rollte genervt die Augen. Also kein Mord, nicht mal ein Toter. Nur eine Vermisstenanzeige. Es fiel ihm schwer, nicht laut zu werden. Mit Ehemännern, die eine Nacht nicht nach Hause kamen, könnte man das Westfalenstadion füllen.
»Meinem Mann ist etwas passiert, ganz bestimmt ist es das. Finden Sie ihn, Herr Kommissar, bitte finden Sie ihn!«
Claudia van der Vaart war eine Frau Anfang fünfzig. Eine gepflegte Erscheinung, würde Karl-Dieter wohl sagen. In ihrem eng gegürteten Trenchcoat machte Frau Doktor – mit dem Titel hatte sie sich vorgestellt – eine gute Figur. Ihre Augen waren wegen der getönten Brillengläser nicht zu erkennen, ihre Hände, mit denen sie sich auf den Schreibtisch stützte, zitterten so heftig, dass das Clubfähnchen auf Big-Chips Computer ängstlich zu flattern begann.
»Was ist mit seinem Handy? Geht er nicht dran?«, wollte Mütze wissen.
»Hat er im Zimmer liegen lassen.«
»Wo wollte er denn hin?«
»Er wollte noch mal seinen Vortrag durchgehen, dafür spaziert er gerne in einem Park.«
»Im Schlossgarten?«
»Vermutlich, ich bin nicht von hier. Nach einer Stunde ist er sonst immer zurück. Ich hab im Hotelzimmer auf ihn gewartet. Als er nach einer Stunde noch nicht da war, habe ich mir noch nichts gedacht. Vielleicht hatte er ja einen alten Bekannten getroffen. Nach zwei Stunden hab ich’s nicht mehr ausgehalten. Ich bin los und hab ihn gesucht, überall, im Schlossgarten, in der Stadt. Dann bin ich zurück zum Hotel und hab auf ihn gewartet, die ganze Nacht. Kein Auge habe ich zugetan. Wissen Sie, wie mir zumute ist?«
»Hat Ihr Mann vielleicht gesundheitliche Probleme? Zucker? Bluthochdruck?«
Frau van der Vaart starrte den Kommissar an. »Marcus? Marcus ist keine vierzig, ihm fehlt nichts.«
»Er wird sicher bald wieder auftauchen, liebe Frau Doktor. 99 Prozent aller Vermissten tun das.«
»Und was ist mit dem restlichen Prozent?« Mit wütendem Blick starrte die Dame Mütze an, ehe sie sich mit einer raschen Bewegung umdrehte und davonstürmte.
3
Der Tag ging ja gut los … Mütze war heilfroh, die nervöse Person wieder los zu sein. Er hatte ihr hinterherrennen und versprechen müssen, eine Suchaktion zu starten, falls ihr Mann bis zum Abend nicht wieder auftauchen würde.
»Andere würden einen Sekt aufmachen, wenn ihr Mann mal für ein Weilchen verschwindet«, lachte Big-Chip, der mit gespitzten Ohren an seinem Computer gesessen hatte.
Big-Chip war Mützes Kollege. Sobald es einen verdächtigen Todesfall gab, bildeten die beiden ein Ermittlungsteam. Jedoch waren verdächtige Todesfälle in Erlangen in etwa so häufig wie brütende Karpfen auf dem Kamin des Steinbach Bräu.
»Hast du was Dringendes für mich?«, fragte Mütze.
»Nö«, sagte Big-Chip, »willst du schon wieder weg?«
»Nur mal kurz in die Stadt.« Big-Chip musste ja nicht alles wissen.
Heute feierten Mütze und Karl-Dieter ihren »Zoom-Day«, wie Karl-Dieter den 13. Juni nannte. »Zoom« hatte nichts mit neumodischen Videokonferenzen zu tun. Am 13. Juni vor exakt 19 Jahren hatten sie sich kennengelernt. »Und es hat Zoom gemacht«, sagte Karl-Dieter lächelnd, »wenigstens bei mir!« Mütze hatte es nicht so mit Gedenktagen. Selbst den Geburtstag seiner Schwester vergaß er, was regelmäßig für Missstimmungen sorgte. Karl-Dieter lebte dagegen von Gedenktag zu Gedenktag. Wie ein Wanderweg in der Fränkischen Schweiz mit Wegweisern, so war sein Jahr mit persönlichen Erinnerungstagen markiert. Karl-Dieter brauchte keinen Kalender, er hatte alles in seinem Hirn gespeichert. Allein für ihn und Mütze existierten mindestens drei weitere Partnerschaftsgedächtnistage. Neben dem Zoom-Day gab es noch den 18. August als den Tag, an dem sie ihre Freundschaftsringe getauscht hatten (dass Mütze seinen nie trug, bereitete Karl-Dieter manch geheimen Kummer), den 21. November, als sie zum ersten Mal öffentlich gemacht hatten, dass sie ein Paar waren, im engsten Kreis, mit Uli und Bernd bei einem Bierchen in der Dortmunder Hafenkneipe. Und dann gab es noch den 22. Juni … (Die Geschehnisse dieses Tages müssen vom Autor des vorliegenden Buches aus Diskretionsgründen verschwiegen werden, zumindest so lange, bis Karl-Dieters und Mützes Einverständnis vorliegt.) Heute jedenfalls war ihr Zoom-Tag, und an dem gingen sie immer zusammen frühstücken. Tradition war Tradition, daran hielt Karl-Dieter eisern fest.
Mütze kam fünf Minuten zu spät. Karl-Dieter saß bereits an einem der Tischchen, die draußen vor dem Mengin standen. Manschän nannten die alten Erlanger das Traditionscafé, dessen Gründer hugenottischer Abstammung gewesen waren. Erlangen war stolz darauf, eine Hugenottenstadt zu sein. Offen aus Tradition, so lautete der städtische Slogan. Historiker lächelten darüber. Im 17. Jahrhundert hatte es in Erlangen sicher mindestens so viele Widerstände und Vorurteile gegen die Neubürger aus Frankreich gegeben wie heutzutage in manchen Tälern des Erzgebirges gegen die Migranten aus Syrien und Afghanistan.
»Im Rückblick verklärt sich manches«, bemerkte Mütze.
»Auch unser Kennenlernen?«, fragte Karl-Dieter und lächelte schelmisch über sein rundes Gesicht.
Mütze hatte ihn mit einem Schulterklopfen begrüßt, andere Begrüßungsformen mied er wie ein Nürnberger den Besuch der westlichen Nachbarstadt. Zumindest in der Öffentlichkeit blieb Mütze stets förmlich. In vielen Dingen war der Freund eben noch von gestern, seufzte Karl-Dieter still. Zumindest ein hingehauchter Wangenkuss hätte an diesem Tag schon drin sein können. 19 Jahre, das war doch was.
Die Freunde ließen sich auf den Stühlen nieder, Seite an Seite, sodass sie Schloss und Schlossplatz im Blick hatten. Seit Jahren war das Erlanger Schlossgebäude durch einen Bauzaun eingesperrt, und nichts deutete darauf hin, dass es jemals von ihm befreit werden würde. »Hoffen aus Tradition sollte man den Slogan nennen«, sagte Karl-Dieter und griff nach einem der Sektkelche, die ihnen der nette ältere Kellner stilvoll serviert hatte. »Auf uns, Mütze!«
»Auf uns!«, sagte Mütze und hob sein Glas.
Es war ein schöner Frühlingsmorgen, der Sonnenball rollte glänzend über die Dächer, fröhlich perlten die Bläschen in den Kelchen.
Mütze deutete auf das Schloss. »Welcher König mag hier einst sein Zepter geschwungen haben?«
»Mensch, Mütze!« Karl-Dieter verdrehte die Augen. Manchmal war es wirklich zum Verzweifeln. Musste Mütze denn der ewige Ruhrpott-Proll bleiben? Ja, Karl-Dieter schien es, der Freund, den er heimlich seinen Mann nannte, war geradezu stolz auf seine Nicht-Bildung.
»In Erlangen hat es nie einen König gegeben, lieber Mütze. Das Schloss war eine Witwenresidenz für die Markgräfinnen von Bayreuth.«
»So ’ne Art fürstliches Altenheim also?«
»Wenn du so willst … Markgräfin Sophie Caroline hat es dann zur Universität gemacht.«
»Akademie für Seniorenbildung, verstehe.«
Karl-Dieter gab auf. Es war zwecklos. Was Bildung anging, blieb Mütze ein hoffnungsloser Fall. Selbst den großen Friedrich Rückert kannte Mütze nur, weil er einen Mord in der Uni-Bibliothek hatte aufklären müssen, bei dem es um Werke des großen Dichters und Sprachgelehrten gegangen war. Während Karl-Dieter als Theatermann und genialer Kulissenbauer jedes Feuilleton verschlang, war sein Freund ein echtes Bildungswüstenkamel, der Joana Mallwitz für eine Langenzenner Würstchenverkäuferin hielt und Albert Camus für einen französischen Linksaußen. Obwohl – bei dieser Vermutung hätte er ja irgendwie richtiggelegen. Karl-Dieter musste lächeln. Die Aufstellung der letzten Meistermannschaft seines BVB konnte der Herr Kommissar im Schlaf herunterbeten. Sei’s drum, heute war ihr Zoom-Tag, heute wollten sie ihre Zweisamkeit genießen.
»Hättest du dir vor 19 Jahren träumen lassen, dass wir fast zwei Jahrzehnte später hier sitzen und gemeinsam Sekt schlürfen?« Karl-Dieters Stimme bekam einen träumerischen Klang.
»Niemals!«, sagte Mütze entschieden.
Verschnupft sah Karl-Dieter ihn an. »Okay«, sagte er mit gedehnter Stimme und sein Blick wurde trübe. »Du hast also nicht an eine gemeinsame Zukunft geglaubt.«
»An eine gemeinsame Zukunft vielleicht«, sagte Mütze, »aber nicht an eine im Land der Franken.« Er ließ seine Hand liebevoll auf Karl-Dieters Schulter sausen. »Jetzt schau doch nicht wie ein depressives Meerschweinchen, Knuffi«, sagte er. »Was sollte ich denn ohne meine Schwabbelbacke machen?«
Zwei Herren in Anzügen eilten an ihnen vorbei. Sie verließen den Schlossgarten und gingen Richtung Marktplatz. Mütze musste an die aufgeregte Dame denken, die ihn in aller Früh im Bunker aufgesucht hatte, wie sie ihre Polizeiinspektion liebvoll-spöttisch nannten. Ob Frau Doktor ihren Gatten mittlerweile wiedergefunden hatte? Vielleicht lief er ja weiter durch den Schlossgarten und memorierte seinen Vortrag.
»Hast du schon mal was von einer Schelling-Professur gehört?«, fragte er Karl-Dieter unvermittelt.
»Von einer Schelling-Professur? Du meinst die Schelling-Professur! Aber sicher. Renommierte Sache. Ein Stiftungslehrstuhl an der Erlanger Uni, der aktuell neu besetzt wird. Wieso fragst du? Willst du dich bewerben?«
»Idiot!«, knurrte Mütze. »Einer der Kandidaten ist verschwunden, seine Frau war eben bei mir.«
»Oje! Wer ist es denn?«
»Nüsslein. Marcus Nüsslein.«
»Nie gehört«, sagte Karl-Dieter. »Was aber nichts heißen will. Mit dem Philosophennachwuchs kenne ich mich so gut aus wie mit den Spielern deiner Borussia. Vielleicht hat der Kandidat kalte Füße bekommen. Das Vorsingen für den Schelling-Lehrstuhl soll eines der härtesten sein.«
»Vorsingen?«
»Nun, der Akt, wenn sich die Kandidaten vorstellen und ihre Probevorlesungen halten. Eine öffentliche Veranstaltung, soll am Donnerstag über die Bühne gehen, so stand’s wenigstens in der Zeitung. Wird sicher spannend.«
Mütze brummte. Er las gewöhnlich nur den Sportteil. Karl-Dieter wusste mal wieder alles und mit seiner Vermutung lag er möglicherweise richtig. Vielleicht war Dr. Nüsslein tatsächlich auf und davon. Philosophen stellte sich der Kommissar als dünnhäutige Gewächse vor. Dennoch, etwas kam ihm seltsam vor. Wenn Nüsslein getürmt war, warum hatte er seiner Frau nicht Bescheid gesagt?
»Vielleicht verhält es sich ja ganz anders, vielleicht hatte er einen Unfall«, sagte Karl-Dieter und sein Blick verschattete sich bei dieser Vorstellung. »Vielleicht ist der Herr Doktor beim nächtlichen Philosophieren am Schwabachufer ausgerutscht, den steilen Hang hinuntergepurzelt und wurde von einem spitzen Ast aufgespießt. Und nun hängt er sterbend im Gestrüpp und wimmert um Hilfe.«
Mütze sah Karl-Dieter schräg an. Da war sie, eine von Karl-Dieters Horrorvisionen. Wenn man als Polizist stets das Schlimmste annahm, kam man rasch in Teufels Küche. Das Häufige war und blieb nun mal häufig, und die Statistik sagte klipp und klar, dass verschwundene Ehemänner schneller auftauchten, als es ihren Frauen lieb war. Nein, sie würden bei ihrem üblichen Vorgehen bleiben. Erst wenn es am Abend immer noch kein Lebenszeichen gab, würden sie mit der Suche beginnen.
Karl-Dieter betrachtete versonnen den Rest des Sektes und hielt ihn ins Licht, um sich an dem Perlenspiel zu erfreuen. »Angenommen, ich würde plötzlich verschwinden. Wann würdest du mich vermissen?«
»Spätestens, wenn’s nichts zum Abendessen gibt«, lachte Mütze, und auch Karl-Dieter musste grinsen, wenngleich etwas gezwungen.
4
Das Gasthaus Mein lieber Schwan war ein beliebtes Speiselokal an der Bayreuther Straße, nicht weit von der Schwabach entfernt, eingerichtet in einer alten Brauerei. Mehr als drei Jahrhunderte hatte der Fachwerkbau bereits auf dem Buckel. Vor Jahren hatte man ihn liebevoll restauriert, die mächtigen Balken freigelegt und auch Teile des Mauerwerks aus Natursandstein. Ging man die Treppe hinauf, so gelangte man zu einem Nebenzimmer, das für geschlossene Gesellschaften genutzt wurde. Es war zur Mittagsstunde, als an diesem Ort die Berufungskommission zusammenkam, die über die Neubesetzung des Schelling-Lehrstuhls zu befinden hatte, vier Herren und eine Dame. Der älteste von ihnen war ein eindrucksvoller Greis, dem die Haare büschelweise aus den Ohren wuchsen, Professor Arminius Donnerkiel. Der gebürtige Breslauer war der amtierende Inhaber des Schelling-Lehrstuhls. Vor zwölf Jahren hatte er die damals frisch gestiftete Professur erhalten und sich lange in deren Glanz gesonnt. Aus Altersgründen schied er nun aus – nicht ganz freiwillig. Obgleich er die Pensionsgrenze längst überschritten hatte, hätte er gerne noch das eine oder andere Jährchen drangehängt. Nachdem man seinem Verlängerungswunsch bereits fünf Jahre hintereinander zugestimmt hatte, zuletzt mit zunehmendem Zähneknirschen, hatte ihm das Kuratorium der Stiftung nun unmissverständlich bedeutet, dass es Zeit für eine Neubesetzung des Lehrstuhls sei. Neben Donnerkiel saß ein schmächtiges Männlein mit hängenden Schultern, in dem ein Unkundiger nie und nimmer den Vorsitzenden des Gremiums erkannt hätte. Professor Nils Gremlin, Ordinarius für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, war ein Neo-Junghegelianer, ein stiller Harmoniemensch, der jedem Streit aus dem Weg zu gehen versuchte. Ihm zur Seite saß Frau Professor Tilde Süderhoff, die Verfasserin des Süderhoffs, der als Standardwerk über den deutschen Idealismus galt. Neben der energischen Dame, die nicht nur wegen ihrer Frisur an die streitbare Theologin Uta Ranke-Heinemann erinnerte, saß ein schlaksiger Blondschopf, der nachlässig die Unterlagen auf seinem I-Pad durchscrollte. Professor Francis Goulderman gab dem Gremium die internationale Note. Der tiefenentspannte Amerikaner lehrte in Princeton, was Diplom-Ingenieur Ferdinand Schaffeldick, der an seiner Seite saß, mit nicht geringem Stolz erfüllte. Schaffeldick war Schraubenfabrikant aus dem nahen Herzogenaurach und Stifter des Lehrstuhls. Die Fabrik hatte er vor mehr als 20 Jahren von seinem Vater übernommen und erfolgreich weitergeführt, im Grunde seines Herzens fühlte er sich aber nicht als Mann der Schrauben, er sah sich als Denker, ja als Philosoph. Selten versäumte er es, darauf hinzuweisen, als Student in Frankfurt eine Gastvorlesung bei Adorno besucht zu haben, und zwar als einer der wenigen, die bis zum Ende der Vorlesung mitgeschrieben hätten. Deshalb sah er es als Selbstverständlichkeit an, der Berufungskommission persönlich anzugehören. Ein Anspruch, der den anderen Kommissionsmitgliedern sauer aufstieß, fühlten sie sich doch durch den philosophischen Dilettanten in ihrer fachlichen Bedeutung herabgesetzt. Offen zu protestieren wagte allerdings keiner, da Schaffeldick ein überaus spendabler Goldesel war, der nicht nur den Stiftungslehrstuhl finanzierte, sondern in großzügiger Weise auch für den Arbeitsaufwand der Kommissionsmitglieder aufkam. Als Bonbon stand jedem von ihnen zudem jährlich die Ferienvilla des Fabrikanten am Gardasee für zwei Wochen zur Verfügung, kostenfrei, inklusive des Hauspersonals und des Badestegs. Da sah man über manches hinweg.
»Es sind die unsichtbaren Schräubchen, die die Welt im Inneren zusammenhalten«, sagte Schaffeldick zu Professor Goulderman und setzte eine bedeutende Miene auf.
»Of course, Ferdinand«, erwiderte Goulderman zerstreut, wobei er »Ferdinand« auf wunderbar amerikanische Weise aussprach.
Professor Nils Gremlin klopfte mit einem Espressolöffelchen zart an sein Wasserglas und räusperte sich vernehmlich, worauf die Zwiegespräche verstummten.
»Verehrte Kommissionsmitglieder, hiermit eröffne ich unsere heutige Sitzung. Ich stelle Vollzähligkeit fest. Die Tagesordnung ist Ihnen ja rechtzeitig zugegangen, muss aber – zu meinem größten Bedauern – in einem wichtigen Punkt ergänzt werden.« Daraufhin griff sich das schmächtige Männchen mit den steil abfallenden Schultern einen Umschlag vom Tisch und zog einen Brief heraus. »Das Schreiben stammt von Professor Schüpferling. Ich erhielt es erst heute, sonst hätte ich Sie natürlich vorab informiert. Professor Schüpferling teilt uns mit, dass er seine Bewerbung zurückzieht, aus persönlichen Gründen, wie er schreibt.«
Die folgenden Bemerkungen des Vorsitzenden gingen im Gemurmel unter, das sich erhob. Auf die Gesichter der Kommissionsmitglieder trat eine Mischung aus Unverständnis und Bedauern; alle waren sie von der Nachricht sichtlich überrascht. Die allgemeine Erregung war nicht zuletzt darin begründet, dass Schüpferling als heimlicher Favorit gegolten hatte. Professor Georg Schüpferling lehrte in Jena und war ein ausgewiesener Experte für die frühen Schriften Schellings, insbesondere seine Naturphilosophie. Die Natur in ihrer Komplexität zu erfassen, sie in ihren allgemeinen und speziellen Strukturen zu beschreiben war zur Zeit der ausgehenden Romantik revolutionär gewesen und hatte die erwachenden Naturwissenschaften begleitet, ihnen das notwendige theoretische Fundament gegeben. Schüpferling war das Kunststück gelungen, die Kerngedanken Schellings auf die heutige Physik zu übertragen, durchaus im dialektisch-kritischen Sinn. Seine populärwissenschaftliche Schrift »Was würden wir alles tun, wenn wir es dürften?« hatte ihn mit einem Schlag einem größeren Publikum bekannt gemacht, sogar auf die Couch von Markus Lanz hatte er es geschafft. Seine plötzliche Popularität hätte seiner Bewerbung aber eher geschadet, wenn er nicht weiterhin auf höchstem wissenschaftlichem Niveau publiziert hätte. Popularität galt in ernsthaften akademischen Kreisen als suspekt. Nicht auszuschließen war auch ein gewisses Quantum an Neid seiner Fachkollegen. Und nun die plötzliche Absage. Was steckte dahinter? Der Erlanger Schelling-Lehrstuhl galt als Krönung eines wissenschaftlichen Lebenswerkes. Frei und ungebunden forschen zu können, ohne die lästigen Verpflichtungen des universitären Alltags. Wem war so etwas schon vergönnt? Schüpferling gab persönliche Gründe für seinen Rückzug an. Was mochte es damit auf sich haben?