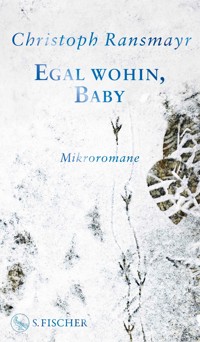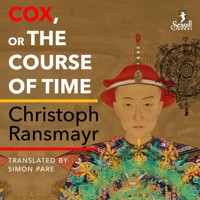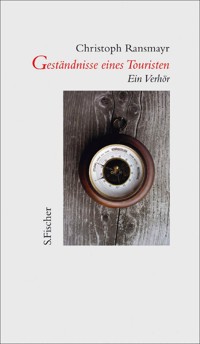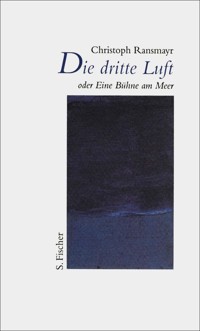9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christoph Ransmayrs epischer Roman über die Suche nach dem vermeintlich letzten Weißen Fleck der Weltkarte. Den Geschichten dieses Erzählers zu folgen, bedeutet beispielsweise am Gipfel des Everest die atlantische Brandung zu hören. ›Der fliegende Berg‹ ist die Geschichte zweier Brüder, die von der Südwestküste Irlands in den Transhimalaya, nach dem Land Kham und in die Gebirge Osttibets aufbrechen, um dort, wider besseres (durch Satelliten und Computernavigation gestütztes) Wissen, einen noch unbestiegenen namenlosen Berg zu suchen, vielleicht den letzten Weißen Fleck der Weltkarte. Auf ihrer Suche begegnen die Brüder nicht nur der archaischen, mit chinesischen Besatzern und den Zwängen der Gegenwart im Krieg liegenden Welt der Nomaden, sondern auf sehr unterschiedliche Weise auch dem Tod. Nur einer der beiden kehrt aus den Bergen ans Meer und in ein Leben zurück, in dem er das Rätsel der Liebe als sein und seines verlorenen Bruders tatsächliches, lange verborgenes, niemals ganz zu vermessendes und niemals zu eroberndes Ziel zu begreifen beginnt. Verwandelt von der Erfahrung, ja der Entdeckung der Wirklichkeit, macht sich der Überlebende am Ende ein zweites Mal auf den Weg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Der fliegende Berg
Roman
Über dieses Buch
Christoph Ransmayrs epischer Roman über die Suche nach dem vermeintlich letzten Weißen Fleck der Weltkarte.
Den Geschichten dieses Erzählers zu folgen, bedeutet beispielsweise am Gipfel des Everest die atlantische Brandung zu hören.
›Der fliegende Berg‹ ist die Geschichte zweier Brüder, die von der Südwestküste Irlands in den Transhimalaya, nach dem Land Kham und in die Gebirge Osttibets aufbrechen, um dort, wider besseres (durch Satelliten und Computernavigation gestütztes) Wissen, einen noch unbestiegenen namenlosen Berg zu suchen, vielleicht den letzten Weißen Fleck der Weltkarte. Auf ihrer Suche begegnen die Brüder nicht nur der archaischen, mit chinesischen Besatzern und den Zwängen der Gegenwart im Krieg liegenden Welt der Nomaden, sondern auf sehr unterschiedliche Weise auch dem Tod. Nur einer der beiden kehrt aus den Bergen ans Meer und in ein Leben zurück, in dem er das Rätsel der Liebe als sein und seines verlorenen Bruders tatsächliches, lange verborgenes, niemals ganz zu vermessendes und niemals zu eroberndes Ziel zu begreifen beginnt. Verwandelt von der Erfahrung, ja der Entdeckung der Wirklichkeit, macht sich der Überlebende am Ende ein zweites Mal auf den Weg.
»Für eine extreme Welt findet Ransmayr eine so noch nicht gehörte Sprache, seinen Sprachgesang: eine Ausnahmeerscheinung in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.«
Ludger Lütkehaus in ›Die Zeit‹
»›Der fliegende Berg‹ enthält Passagen von berauschender Schönheit und leuchtender Intensität.«
Volker Hage in ›Der Spiegel‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: Manfred Walch, Lorsbach
Coverabbildung: Manfred Wakolbinger
Erschienen bei FISCHER E-Books
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2006
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403254-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Judith, für dich.
Notiz am Rand
1 Auferstehung in Kham. Östliches Tibet, 21. Jahrhundert.
2 Horse Island. Das Erbe in West Cork.
3 Schlaflos am Yangtsekiang. Schlaflos in den Cahas.
4 Ankunft der Meermenschen. Ein Täuschungsmanöver.
5 Master Kaltherz. Billard im Schnee.
6 Sie sagt ihren Namen. Ort ohne Träume.
7 Der fliegende Berg: Nyemas Geschichte.
8 Am Vogelberg. Der Vermummte. Eine Parade im Schnee.
9 Die Himmelsbraut. Glückliche Rückkehr. Warnungen.
10 Am See. Die Erfindung der Schrift. Lehrstunden.
11 Sternbilder. Der Untergang eines Riesen.
12 Alleingänge. Ein Hüter seines Bruders.
13 In der Tiefe. Trost der eigenen Kraft.
14 In der Höhe. Himmelserscheinungen.
15 Drogsang oder die schöne Weide. Im Basislager.
16 Vorläufer, Nachläufer. Eine Seilschaft.
17 In Gefangenschaft. Das Geschenk.
18 Epilog: Schritte.
Judith, für dich.
Notiz am Rand
Seit die meisten Dichter sich von der gebundenen Rede verabschiedet haben und nun anstelle von Versen freie Rhythmen und dazu einen in Strophen gegliederten Flattersatz verwenden, ist da und dort das Mißverständnis laut geworden, bei jedem flatternden, also aus ungleich langen Zeilen bestehenden Text handle es sich um ein Gedicht. Das ist ein Irrtum. Der Flattersatz – oder besser: der fliegende Satz – ist frei und gehört nicht allein den Dichtern.
CR
1 Auferstehung in Kham. Östliches Tibet, 21. Jahrhundert.
Ich starb
6840 Meter über dem Meeresspiegel
am vierten Mai im Jahr des Pferdes.
Der Ort meines Todes
lag am Fuß einer eisgepanzerten Felsnadel,
in deren Windschatten ich die Nacht überlebt hatte.
Die Lufttemperatur meiner Todesstunde
betrug minus 30 Grad Celsius,
und ich sah, wie die Feuchtigkeit
meiner letzten Atemzüge kristallisierte
und als Rauch in der Morgendämmerung zerstob.
Ich fror nicht. Ich hatte keine Schmerzen.
Das Pochen der Wunde an meiner linken Hand
war seltsam taub.
Durch die bodenlosen Abgründe zu meinen Füßen
trieben Wolkenfäuste aus Südost.
Der Grat, der von meiner Zuflucht
weiter und weiter
bis zur Pyramide des Gipfels emporführte,
verlor sich in jagenden Eisfahnen,
aber der Himmel über den höchsten Höhen
blieb von einem so dunklen Blau,
daß ich darin Sternbilder zu erkennen glaubte:
den Bärenhüter, die Schlange, den Skorpion.
Und die Sterne erloschen auch nicht,
als über den Eisfahnen die Sonne aufging
und mir die Augen schloß,
sondern erschienen in meiner Blendung
und noch im Rot meiner geschlossenen Lider
als weiß pulsierende Funken.
Selbst die Skalen des Höhenmessers,
der mir irgendwann aus dem Klumpen
meines Handschuhs gefallen
und in die Wolken hinabgesprungen war,
blieben wie eingebrannt in meine Netzhaut:
Luftdruck, Meereshöhe, Celsiusgrade …
jeder Meßwert des verlorenen Instruments
eine glühende Zahl.
Als zuerst diese Zahlen
und dann auch die Sterne verblaßten
und schließlich erloschen, hörte ich das Meer.
Ich starb hoch über den Wolken
und hörte die Brandung,
glaubte die Gischt zu spüren,
die aus der Tiefe zu mir emporschäumte
und mich noch einmal hochtrug zum Gipfel,
der nur ein schneeverwehter Strandfelsen war,
bevor er versank.
Das Krachen des Steinhagels,
der mir die Hand wundgeschlagen hatte,
das Fauchen der Böen, mein Herzschlag …
verhallten in der Flut.
War ich am Grund des Meeres?
Oder am Gipfel?
In einem schmerzlosen Frieden,
von dem ich heute weiß,
daß er tatsächlich das Ende war, mein Tod
und nicht bloß völlige Erschöpfung,
Höhenwahn, Bewußtlosigkeit,
hörte ich eine Stimme, ein Lachen:
Steh auf!
Es war die Stimme meines Bruders.
Wir hatten uns im Wettersturz
der vergangenen Nacht verloren.
Ich war gestorben.
Er hatte mich gefunden.
Ich öffnete die Augen. Er kniete neben mir.
Hielt mich in seinen Armen. Ich lebte.
Mein Puls tobte in der Steinschlagwunde
an meiner Hand; mein Herz.
Wenn ich heute
an jene Mondnacht zurückdenke,
in der ich mit meinem Bruder
aus der Gipfelregion jenes Berges,
den die Nomaden von Kham Phur-Ri nennen:
Der fliegende Berg,
in die Tiefe zurückgeklettert, zurückgetaumelt war,
einen vom Eis verglasten Grat hinab,
blankgewehte Felsrinnen, schwarze Eiskamine hinab
und dann durch den hüfthohen Schnee jenes Sattels,
auf dem wir uns verloren …
Wenn ich an diesen Irrweg durch ein Eislabyrinth
in die bewohnte Welt denke,
die irgendwo unter Wolkentürmen im Abgrund lag,
dann sehe ich immer auch Nyema,
höre ihre besänftigende Stimme,
das Klimpern der Korallen- und Muschelketten um ihren Hals
und spüre die Wärme ihrer Hände,
sehe Nyema,
als wären es ihre Arme
und nicht die meines Bruders gewesen,
die mich damals umfingen:
Niemand, höre ich Nyema sagen,
niemand stirbt auf seinem Weg nur ein einziges Mal.
Nyema Dolma: Wie beharrlich sie war,
wenn sie mir ein Wort ihrer Sprache
oder bloß einen Handgriff zu erklären versuchte.
Wie warm ihr Atem,
wenn sie den Namen einer Pflanze
an meinem Ohr buchstabierte.
Ihr geflochtenes Haar roch nach Yakwolle
und Rauch, und während sie sprach,
schrieb sie mit ihrem Zeigefinger
manchmal schnelle, fliegende Zeichen
auf meinen Arm, meinen Handrücken –
Spiralen, Wellenlinien, Kreise.
Steh auf!
Ich hatte die Spur meines Bruders
in einem Schneesturm verloren,
in dem der Mond wie unter einer Sturzwelle
schwarzen Wassers erloschen war.
Der Sturm hatte uns auseinandergerissen
und mich in einer Finsternis,
in der allein der von Eiskristallen zersiebte
Schein meiner Stirnlampe zu sehen war,
in den Windschatten einer Felsnadel gejagt.
Dort hatte ich bis zum Sonnenaufgang überlebt.
Steh auf!
Mein Bruder kniete neben mir.
Hielt mich in seinen Armen.
Erhob sich dann wie unter einer Zentnerlast
und versuchte auch mich hochzuziehen.
Lachte.
Fluchte vor Ratlosigkeit.
Sein Gesicht, seine Sturmmaske,
war eine Fratze aus Eis.
Wieviel Zeit war seit unserer Trennung vergangen?
Die Sonne stand nun hoch über dem Gipfelgrat.
Der Himmel: wolkenlos.
Und im Schatten der Felsnadel,
im Schatten meiner Zuflucht: Windstille.
Ich lebte.
Es schneite.
Schwarzer Schnee?
Schwarzer Schnee:
Wie verkohltes,
von einem unsichtbaren Feuer zerrissenes Papier
taumelten schwarze Flocken
aus der Wolkenlosigkeit.
Aber als sich eine dieser Flocken
auf den eisverkrusteten Handschuh
meines Bruders setzte,
eine andere auf seine Schulter,
auf meine Brust, meine Stirn,
sah ich Fühler!
sah ich die Fadenglieder von Insekten,
Flügel: In einem Panzer aus Rauhreif,
der ihre Facettenaugen, Saugrüssel und Flügelschuppen
übertrieb und vergrößerte,
schneiten tote Schmetterlinge
auf mich und meinen Bruder herab,
zuerst vereinzelt, dann zu Hunderten,
schließlich in einem wirbelnden,
den Himmel verfinsternden Schwarm.
Manche dieser filigranen Kadaver
schienen beim Aufprall auf meiner Brust,
auf dem Handschuh meines Bruders
zu zerspringen,
und ich glaubte ein Klirren zu hören.
Ein Klirren?
Nein, es war still.
Vollkommen still.
Aus einem Himmel, der im Zenit
schon die Schwärze des Alls anzunehmen schien,
fielen eisstarre Falter, Apollofalter,
wie wir sie vor Wochen in den Tälern von Kham
gesehen hatten, in riesigen Schwärmen
über den Gebetsfahnengirlanden
eines zerstörten Klosters,
über einem Gletschersee,
einem Rhododendrenwald.
Ich war müde, unsagbar müde.
Wollte liegenbleiben.
Liegenbleiben, schlafen.
Schlafen.
Steh auf!
Mein Bruder zog, zerrte mich hoch,
sank mit mir in den Schnee zurück.
Und ich kauerte in seinen Armen,
6840 Meter über dem Meer,
und starrte durch einen dunklen Flockenwirbel
auf die Eisfahnen des Phur-Ri,
auf den blendenden Gipfel des fliegenden Berges,
auf dem ich unsere Namen
mit dem Schaft meines Eispickels
in den Schnee geschrieben hatte.
Ich lebte.
Du glaubst, geschlafen zu haben,
höre ich Nyema sagen und sehe,
wie sie Tashi, einen rußigen, weinenden Säugling,
auf ihren Armen wiegt,
du glaubst, geschlafen, geträumt zu haben,
und warst doch tot: deinem Leben fern.
Warst tot und bist zurückgekehrt,
weil eine Hand dich zurückgezogen,
eine Stimme dich zurückgerufen hat.
Nyema lachte oft, wenn sie sprach.
Ich glaube, es war ihre Heiterkeit,
die mir bewußt werden ließ, daß es an jenem Morgen
unter der Gipfelpyramide des Phur-Ri
wohl nicht die Worte meines Bruders gewesen waren,
die mich ins Leben zurückbefohlen hatten,
sondern sein Lachen.
Er hielt mich in seinen Armen
und lachte, rief lachend es schneit!
Es schneit Schmetterlinge! Steh auf!
Es war, als ob sich erst in diesem Lachen
auch alle anderen Geräusche und Worte
wieder aus der vollkommenen Stille lösen durften:
das Kreischen eines Steigeisens
auf dem vom Eis glasierten Fels,
das Klingen des Blutes in meinem Kopf,
unser Atemgeräusch,
das in der dünnen Luft dieser Höhe
dem Hecheln von Tieren glich.
Vielleicht sah mein Bruder an meinen Augen,
daß es vor allem sein atemloses Reden war,
das meine Aufmerksamkeit gefangennahm
und mich Satz für Satz in unser Leben zurückzog.
Er sprach so eindringlich und hastig,
als wären seine Worte die letzte Möglichkeit,
mich zu erreichen,
und ich müßte für immer verschwinden,
wenn er verstummte.
Aus einer allmählich schrumpfenden Ferne
hörte ich ihn erinnerst du dich …,
weißt du noch sagen
du mußt dich erinnern, erinnere dich.
Wenn ich die Augen schloß,
rief er meinen Namen, immer wieder,
und dazu die Namen von Hochträgern
aus Nyemas Clan, Namen von Pässen,
die wir während unseres wochenlangen Anmarsches
zu den Eiswänden des Phur-Ri überquert hatten,
Namen, Namen, hörst du mich,
erinnerst du dich, steh auf!
Auf diesem Marsch
hatten wir Schmetterlingsschwärme
als Hunderte Meter lange, tanzende Bänder gesehen.
Sie flatterten selbst über höchste
schneeverwehte Pässe in unbewohnte,
von Schmelzwasserbächen durchzogene Täler,
folgten vielleicht einer Nahrungskette,
die blühende Sümpfe mit Gletschern verband,
vielleicht aber auch bloß
einer zum Irrweg gewordenen Route
einer Erinnerung, die in jene Urzeit zurückreichte,
als sich zwischen dem Ort ihres Aufbruchs
und ihrem Ziel
noch kein Eisgebirge erhoben hatte,
sondern nur sanftes, fruchtbares Hügelland.
Hörst du mich!
Steh auf!
Schon einmal, es war an jenem Nachmittag,
an dem uns der Gipfel des Phur-Ri
zum erstenmal wolkenfrei
und in großer Ferne erschienen war,
hatten wir gesehen,
wie einer dieser Schmetterlingsschwärme
von den Turbulenzen der Jahreszeit erfaßt
und in Säulen warmer Luft hochgewirbelt wurde
in die Unsichtbarkeit, in die Kälte, in den Tod
und dann, von der erschöpften Thermik
endlich losgelassen und vom Frost bereift,
auf die Gletscher zurückschneite.
Erinnere dich.
Nyema … Es war Nyema, die gesagt hat,
daß mein Bruder mich im Windschatten
meiner letzten Zuflucht wohl aus dem Tod
ins Leben zurückerzählte,
indem er mit seiner Litanei von Namen
eine gemeinsame Erinnerung beschwor,
so unauslöschlich,
daß sie die Vergangenheit in Gegenwart verwandeln
und mich selbst aus einer Ferne zurückrufen konnte,
in der ich schon verschwunden war.
Ich erinnere mich, daß ich versuchte
den herabtaumelnden Faltern
mit meinem Blick zu folgen,
daß mich darüber ein rasender Schwindel erfaßte
und daß der erste Satz, den ich in den Armen
meines Bruders mit Mühe aussprach,
eine Frage war: Sind sie tot?
Und ich erinnere mich, daß mein Bruder
in seiner Begeisterung über mein Erwachen,
oder über die herabtaumelnden Kadaver
in ihren Reifpanzern, nicht aufhörte zu lachen
und mir aus einer Atemwolke,
die sein Gesicht verhüllte, zurief:
Aber sie fliegen! Sie fliegen immer noch!
Mein Bruder ist tot.
Seit mehr als einem Jahr liegt er nun
im Eis begraben,
am Fuß der Südwand des Phur-Ri,
durch die wir damals drei Tage und zwei Nächte
hinabgeklettert waren, schneeblind,
von Halluzinationen immer wieder in die Irre gelockt,
auf die donnernde Wolke jener Lawine zu,
in der er verschwand.
Ich glaube, Nyema war der erste Mensch,
der Wochen später das Furchtbare aussprach:
Sie bestrich meine blutigen Fingerkuppen
und die langsam vernarbende Steinschlagwunde
an meiner Hand mit einem zähflüssigen Absud
und sagte dein Bruder ist tot.
Tot.
Er hatte mich in einem Wirbel aus eisstarren Faltern
in den Armen gehalten.
Er hatte mich gewärmt
und mich ins Leben zurückerzählt
und war mir dann eine qualvolle Ewigkeit lang
durch die von Lawinen zerrissene Südwand
des Phur-Ri in eine Tiefe vorangeklettert,
die vor uns noch kein Mensch durchstiegen hatte.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Stunden ich im Schutt
des Lawinenkegels nach ihm gegraben habe.
Ich hatte keine Fingernägel mehr,
als mich ein Hirte aus Nyemas Clan
auf der Suche nach verlorenen Yaks
in der Nähe eines verlassenen Lagers fand.
Meine Hände waren schwarz,
meine Zehen schwarz von Erfrierungen,
aber ich war am Leben.
Ich erinnere mich an bohrende Schmerzen,
als mich der Hirte auf einem aus Ästen, Fellen
und Lederriemen zusammengebundenen Schlitten
ein Hochtal hinauszog und -zerrte
und dabei manchmal in einen keuchenden
monotonen Gesang verfiel.
Ich wollte mich aufrichten,
nach dem Sänger greifen, ihn berühren,
um mich zu vergewissern,
daß er körperlich war, wirklich war
und nicht wieder nur eine von den Wahngestalten,
die mich auf dem Weg in die Tiefe begleitet
und sich in Schnee, in Steine
und Wolken verwandelt hatten,
wenn ich auf ihre Fragen geantwortet oder
nach ihren ausgestreckten Armen gegriffen hatte.
Ich wollte diesen Sänger umarmen
und blieb doch nur eine stöhnende Last,
bewegungsunfähig auf seinem Schlitten,
hatte nicht einmal mehr die Kraft,
einen mit Tee und Yakbutter gekneteten Klumpen
gerösteter Gerste zum Mund zu führen.
Der Sänger mußte mich füttern.
Heute,
während ich auf Horse Island
durch das sonnendurchflutete Haus
meines Bruders gehe
von einem leeren, hallenden Zimmer zum anderen,
und durch ein von den Salzblüten der Gischt
fast blind gewordenes Fenster die Brandung sehe,
die Steilküste,
den von den Sturmböen der letzten Tage
aufgewühlten Atlantik, heute weiß ich,
daß uns ein Lachen vielleicht ins Leben zurückholen,
uns dort aber nicht halten kann.
Was Nyema, was ihren Clan
und mich und wohl die meisten von uns
am Leben erhält,
muß mit dem manchmal tröstlichen,
manchmal bedrohlichen Rätsel zu tun haben,
daß wir, wo immer wir sind,
nicht die einzigen sind:
Immer ist noch jemand da,
der zumindest von uns weiß, der uns nicht losläßt
oder von dem wir nicht lassen können,
jemand, der durch unsere Erinnerungen,
Ängste und Hoffnungen geht,
uns in den Armen hält, wärmt, füttert
oder uns keuchend, singend
auf einem Schlitten aus Ästen und Fellen
durch ein Geröllfeld schleift.
Der Hirte brauchte manchmal alle Kraft,
um mich über einen Schmelzwasserbach zu schaffen,
über eine Felsbarriere oder schuttbedecktes Toteis.
Wenn dabei ein Stein oder auch nur Wasser
an meine schwarzen, nägellosen Hände
oder an meine Füße schlug, schrie ich vor Schmerz.
Aber er ließ sich nicht beirren,
sondern nahm jeden meiner Schreie
wie ein neues Motiv in seinen Gesang auf
und wiederholte ihn, bis er sich einfügte
in die monotone Melodie seiner Lieder,
und sang mich so in eine Ohnmacht, in den Schlaf.
Ich erwachte,
als er mich vor einem schwarzen Zelt
vom Schlitten hochzuziehen versuchte
und dabei immer wieder die Gesichtszüge
meines Bruders annahm.
Wie ein unzerstörbares Bauwerk
ragte das Zelt in einen kreisrunden Himmel,
der von Federwolken durchzogen
und von menschlichen Gesichtern eingefaßt war:
Es waren die lachenden, neugierigen, mißtrauischen
und erschreckten Gesichter meiner Retter.
Sie beugten sich über mein Elend,
über einen von der Sonne und vom Frost
verbrannten Fremden,
der mit blutenden Händen zu ihren Füßen lag
und der nach den Erzählungen des Sängers
vom fliegenden Berg gefallen war,
aus dem Himmel
in den Schnee.
2 Horse Island. Das Erbe in West Cork.
Mein Bruder Liam
besaß zwölf Hochlandrinder,
mehr als einhundert Targhee-Schafe,
fünf Hirtenhunde
und zwei schnelle Rechner,
vor deren Bildschirmen er ganze Tage
und manchmal auch die Nächte verbrachte.
Bis zu unserem Aufbruch nach Kham
hatte Liam alles, fast alles, was er besaß
oder was für sein Leben von Bedeutung war,
auf diesen Flüssigkristallschirmen erscheinen
und wieder verschwinden lassen:
die mit dunklem Schiefer gepflasterte Einfahrt
seines hoch über den Klippen
von Horse Island gelegenen Hofes,
digitalisierte Gletscherpanoramen
aus dem Himalaya und Karakorum,
nautische, topographische und astronomische Karten,
Wertpapierkonten, Heiratsannoncen,
Briefe aus Neuseeland und Pakistan
und auch die rätselhaften Flugrouten
von Papageientauchern,
die auf einem von weißem Kot wie beschneiten Felsturm
im äußersten Westen von Horse Island brüteten.
Gelegentlich war aber auf allen der insgesamt fünf
in Arbeitszimmer, Wohnzimmer, selbst Küche
und Schlafzimmer installierten Bildschirme
nur das zum Meer abfallende,
von einer sturmsicher versiegelten elektronischen Kamera
Tag und Nacht angestarrte Weideland zu sehen,
auf dem sein Vieh das ganze Jahr
unter Möwenschwärmen graste.
Ich kann heute nicht mehr mit Bestimmtheit sagen,
welche von den über die Jahre
gestreuten Einladungen meines Bruders
mich am Ende bewogen hat,
nach Irland zurückzukehren
und ihm auf eine nahezu unbewohnte
und in Sturmtagen unerreichbare Insel zu folgen.
Welche von diesen Postkarten
mit immer neuen Ansichten der Westküste,
welcher von diesen Briefen,
für die er leer gebliebene Logblätter
des Leuchtturms von Dunlough verwendete
und denen er oft Fotos beilegte:
War es der Brief, aus dem mir ein Bild
unseres vermummten Vaters entgegenfiel?
Eine Farbfotografie,
die einen schwergewichtigen Mann
mit einer blauen Wollmaske zeigte.
Er hielt einen Hummer triumphierend
an den auseinandergezogenen Scheren
wie einen Gekreuzigten hoch.
(Beim Betrachten dieses Fotos hörte ich jedesmal
das durch die Wollmaske gedämpfte Kichern
meines Vaters.)
Oder war es das mit den Namen
von Ausflugszielen bekritzelte Foto
jenes rostzerfressenen Ford Galaxy,
in dem wir an so vielen Sonntagen unserer Kindheit
den Bergen von Kerry und Cork
entgegengeschaukelt waren?
In Efeu und Brombeergestrüpp versunken,
ohne Räder und Motorhaube
lag das Wrack auf diesem Bild
an der Einfahrt unseres Elternhauses.
Aus den leeren Wagenfenstern,
die auf Bergstraßen stets aufgekurbelt worden waren,
weil Liam in den Serpentinen
hinauf zum Healy Pass oder Moll’s Gap
seekrank wurde, winkten Farne.
Gelegentlich schmückte Liam seine Briefe
mit Skizzen: Darstellungen
seiner astronomischen Beobachtungen
(wie etwa jener der Merkurschleife),
Plänen zur Erweiterung seines Bootshauses
oder der Position eines vor Jahrzehnten
oder Jahrhunderten am Dunlough Head gestrandeten
und gesunkenen Schiffes.
Komm nach Hause! Du mußt aus dem Wasser!
schrieb er dann zwischen diese Zeichnungen
und setzte dahinter stets ein Rufzeichen.
Obwohl Liam über seine Rechner Tag und Nacht
mit einem globalen Datennetz verbunden bleiben wollte,
mit Wetterberichten, Satellitenbildern,
Nachrichten von Katastrophen
und Kämpfen im Irgendwo, Aktienmärkten,
Archiven, Bibliotheken und elektronischer Post,
benutzte er dieses Netz niemals,
wenn er mich aufforderte, mein Leben zu ändern:
Komm nach Hause!
las ich nur auf Ansichtskarten
oder auf dem vergilbten Papier von Dunlough
(von dem er ganze Stapel besaß),
niemals auf einem Bildschirm.
Dabei waren wir jahrelang fast ausschließlich
über dieses Netz in Verbindung geblieben –
er vor den Rechnern seines Hofes,
ich vor dem Schirm irgendeiner Reederei
oder am Funktisch eines jener Frachter,
auf denen mich manchmal das Heimweh befiel.
Aber wenn ich ihm in einer digitalen Flaschenpost
von diesem Heimweh berichtete,
überging er in seiner Antwort meine Klagen
und schrieb mir erst viel später
und mit der anachronistischen Langsamkeit
eines Kurierdienstes in seiner jagenden Handschrift:
Du mußt aus dem Wasser!
Mein Entschluß, ein Leben in Maschinenräumen
und Wellentunnels von Frachtschiffen
oder in kahlen, lauten Hafenhotels aufzugeben
und wie ein Schiffbrüchiger auf Horse Island,
einem Felsen im Atlantik, festen Boden zu suchen,
rührte an eine Sehnsucht,
die mich wohl mit vielen, über drei Kontinente
verstreuten Auswanderern unserer Familie
und auch mit meinem Bruder verband:
Eine Sehnsucht nach etwas,
das er in einem seiner Briefe
als unverrückbaren Ort unter einem
unverrückbaren Himmel beschwor.
Natürlich wußten wir insgeheim beide,
daß es einen solchen Ort nicht geben konnte,
zu keiner Zeit, nirgends,
aber selbst wenn er mir Horse Island
nach einer seiner am Teleskop verbrachten Nächte
wie einen fliegenden, von Westwinden
und auf- und untergehenden Sternbildern
umwirbelten Teppich beschrieb,
der eine elliptische Bahn um die Sonne zog,
tauchte am Ende selbst solcher Schwärmereien
ausgerechnet diese von Ruinen übersäte Insel
immer wieder als Zuflucht
aus dem Atlantik bei Dunlough:
eine umbrandete Geborgenheit,
herausgehoben aus der Zeit
und so entrückt und unzerstörbar wie eine Utopie.
Ich kam nach Horse Island.
Und die Signale des Leuchtfeuers am Dunlough Head
(automatisierte Lichtblitze in der Finsternis)
huschten Nacht für Nacht
über die Wand meines Schlafzimmers
und ließen mich in der ersten Zeit auf der Insel
nicht schlafen.
Wer auf Horse Island lebt, ist wie an Bord
eines weit draußen auf Reede liegenden Schiffes
mit Irland und allem Land entweder
durch den Atlantik verbunden
oder durch ihn von allem getrennt.
Selbst der kaum zwei Seemeilen breite Meeresarm,
über den wir mit dem Fährschiff oder unserem eigenen Kutter
zwei- und dreimal jede Woche nach Dunlough übersetzten,
blieb in den Winterstürmen manchmal tagelang unpassierbar.
Dann fielen nicht nur Besorgungsfahrten aus,
sondern auch die Abende in Eamon’s Bar,
auf deren mit Sägemehl bestreutem Boden
die salzigen Schuhe der Gäste
Spuren wie von einem Kampf hinterließen.
Als ich am ersten Tag der Räumung unseres Hofes
den tibetischen Teppich einrollte, den mein Bruder
im Jahr vor unserem Aufbruch nach Kham
bei einem Händler in Dublin gekauft hatte,
fielen aus einem feingeknüpften Ornament weißer,
von mythischen Schneelöwen bewachter Bergketten
Sägespäne aus Eamons Bar.
Der Teppich lagert nun mit den Rechnern
und Bildschirmen, den Teleskopen,
Büchern und allem Mobiliar
in Plastik gehüllt und bereit für Käufer
in einem Schuppen hinter der Bar.
Zwei Wochen habe ich mit der Räumung
des hellen, luftigen Hauses verbracht,
das mein Bruder aus Schieferstein, Teak und Glas
auf den Fundamenten eines Gehöftes erbaut hat
(der Hof war zur Zeit der katastrophalen Hungersnöte
des neunzehnten Jahrhunderts verlassen worden
und seither wie alle anderen Häuser auf Horse Island
verfallen).
Vier Sturmtage in diesen beiden Wochen
erschwerten meine Fahrten zwischen Insel
und Festland, aber schließlich war alles Vieh,
die Rinder in Paaren, die Schafe in Familien
(mit zusammengebundenen Hufen),
die Truthühner, ein Pfauenpaar, die Hunde,
mein Erbe,
mit unserem Kutter, meinem Kutter,
an die Mole von Dunlough verfrachtet.
Schafe, Geflügel und Hunde
wurden dort auf die Pick-ups von Farmern verladen,
mit denen Liam Handschlaggeschäfte gemacht hatte.
Die Kühe, schottische Hochlandrinder
(mit gälischen Namen), verschwanden
im Transporter eines Viehhändlers aus Cork,
denn Schotten blieben an unserer Küste
trotz der widerstandsfähigen Züchtungen
meines Bruders so fremd wie tibetische Yaks
und gaben an den Theken von Dunlough
bis Skibbereen immer wieder Anlaß
zu Kopfschütteln oder Gelächter:
Die Horsemen, die Cliffhanger
und ihre schottischen Büffel!
Auch wenn man am Festland manchmal
anerkennend auf den Eifer meines Bruders trank,
der auf Horse Island, der Hungerinsel,
der Ruineninsel, nach mehr als
einhundertfünfzig Jahren der Verlassenheit
ein Licht nach dem anderen
wieder zum Leuchten gebracht hatte –
das landwirtschaftliche Experiment
auf diesem Felsen dort draußen
galt den Küstenbauern als teure Verrücktheit,
nicht als bäuerliche, erschöpfende Arbeit.
Ich war aus der Handelsschiffahrt
nach Horse Island gekommen,
mein Bruder Jahre zuvor
aus den Programmierabteilungen
der Computerindustrie:
Da konnten das dünnwandige,
hellhörige Haus unserer Eltern
und ihre sauren Weiden und Torffelder
noch so nahe, fast in Sichtweite! liegen
(keine zwei Fahrstunden von Dunlough entfernt
an den Abhängen der Caha Mountains) –
um in Eamon’s Bar in Fragen
der Schaf- oder Rinderzucht
ernst genommen zu werden,
kamen wir vermutlich doch von zu weit.
Der zumeist gutmütige Spott am Tresen
hat meinen Bruder nie gestört:
Cliffhanger, Buffalo Liam …
Abweisend, ja grob konnte er aber manchmal werden,
wenn ihn dort jemand einen Aussteiger nannte: Drop-out.
Er sei niemals! und nirgendwo!
aus-, sondern immer nur eingestiegen
und dabei immer und Schritt für Schritt höher
und niemals zurück oder hinab, Arschloch!
Tatsächlich lebten wir auf Horse Island
in der Fülle jener technischen Möglichkeiten,
die selbst Inselbewohnern erlaubten,
bezahlte Arbeit am Bildschirm zu verrichten,
mit dem Festland oder transatlantischen Partnern
zu korrespondieren, zu verhandeln, Geschäfte zu machen,
ohne auch nur einen Schritt aus dem Haus zu tun,
und nebenher Schafe und Rinder zu halten
oder einer gärtnerischen Leidenschaft zu folgen,
Baumfarne zu züchten, Orchideen
oder gegen die Salzluft unempfindliche Strauchrosen.
Horse Island lag auf der Höhe der Zeit,
und wir hielten dort über das Netz
Kontakt mit der Welt und mit einem Leben,
das tiefer in die Vergangenheit zurückreichte
und langsamer und breiter dahinfloß
als jeder Datenstrom.
Der Insel droht nun wieder die alte Verlassenheit.
Obwohl von Liam mit der irischen Westküste
durch einen submarin verlegten Kabelstrang vernäht,
blieben auch nach ihrer schütteren Neubesiedlung
mein Bruder und ich die einzigen,
die hier das ganze Jahr über lebten.
Unsere drei Nachbarn,
Sommer- und Schönwettergäste
aus Kerry, Cork und Dublin
(unter ihnen Deirdre, eine Patentanwältin,
und Kieran, ein Verleger von Bildbänden),
bewohnten ihre ebenfalls über Ruinen errichteten,
schiefergedeckten Häuser nur zur Erholung,
genossen die Abgeschiedenheit als Luxus
und flüchteten lange vor den Winterstürmen
wieder in ihre Städte.
Am deutlichsten wird die Leere
unseres verlassenen Gehöfts
seltsamerweise draußen auf den Weiden
und nicht im blankgefegten Inneren des Hauses,
dessen Glasschiebewände immer noch
die Abschnitte eines vertrauten Panoramas enthalten:
den von Wolkenschatten gefleckten Atlantik
(in langen Farbskalen von Bleigrau, Silber
Lichtgrün, Nachtblau);
die schwarzen Zähne vorgelagerter Riffe und Felseninseln;
die am Bildrand nach Westen davonjagenden Linien
der irischen Steilküste; die Gischtlichter der Dünung
unter den Blitzen des Leuchtfeuers von Dunlough …
Obwohl auf den von Mauern aus bemoosten,
unbehauenen Steinen und einem dornigen Geflecht
aus Draht und dürren Stechginsterzweigen
gefaßten Rinder- und Schafweiden
das Gras nun so hoch wogt, daß die Böen darauf
als silbrige Schatten sichtbar werden
und die Möwen wie je im Aufwind
über dem Gittermast unserer Windmühle stehen,
wirken gerade die Weiden
wie von einer Katastrophe heimgesucht
und trotz ihrer Fruchtbarkeit wüst.
Ich habe sie in meinen Jahren auf Horse Island
niemals so leer gesehen.
Wer die hüfthohen Grenzwälle dieser Weiden
auf der westlichen Meerseite durchbricht
oder einfach übersteigt, hat noch einen drei,
vier Meter breiten Streifen sanftes,
von Heidekraut, Brombeergestrüpp und Farnen
durchsprengtes Grasland vor sich,
bis er erkennt, daß er über dem Abgrund steht
auf einem überwucherten Felsbalkon,
unter dem nur noch die brausende Tiefe liegt.
Schwarze, von Seevögeln umschwärmte Wände
stürzen hier an manchen Stellen zweihundert Meter
senkrecht und überhängend
in den anrollenden, alles unterspülenden,
alles zertrümmernden Atlantischen Ozean.
Ich habe diese brüchigen Felswände und Klippen
bis zum Tag unserer Abreise
nach Westchina und Tibet
auf Dutzenden Routen verschiedenster
Schwierigkeitsgrade durchklettert,
zumeist gemeinsam mit meinem Bruder,
an seinem Seil,
manchmal auch ohne Sicherung dicht neben ihm,
und ein einziges Mal,
es war während eines Gewitters,
das wie eine Explosionswolke
über der Roaringwater Bay aufgeraucht
und dann auf Horse Island zugestürmt war,
allein, seilfrei
und wie betäubt vor Angst:
Aus einer finsteren Höhe
prasselten mir damals Hagelschloßen
und Steine entgegen, während mich die Böen
aus der Wand zu reißen drohten.
Tief unter mir schlugen Hagel und Steine
lautlos in die Brandung.
An Sommertagen, wenn der Ozean
in manchen Buchten so glatt und still wurde,
daß selbst der Flossenschlag
einer von Sonnenfelsen ins Wasser gleitenden Robbe
weithin zu hören war,
näherten wir uns diesen schwarzen Wänden
mit dem Boot, suchten im Fernglas
nach neuen Einstiegen und Aufstiegsvarianten,
ankerten in sicherer Entfernung vor den Riffen,
sprangen ins Wasser, schwammen die Felswand an
und ließen uns dann vom Meer selbst emporheben
zum ersten Tritt eines Weges in die Wolken,
die wir hoch oben
ungerührt hinausgleiten sahen
über den äußersten Rand der Weiden.
Schwimmend hatte ich manchmal das Gefühl,
über Abgründen, Tälern,
Gipfeln dahinzufliegen.
Wehende Algenfelder kippten tief unter mir
ins submarine Dunkel
und muschelbesetzte, versunkene Felsbänder,
an denen vorbei die unter den Krallen
auffliegender Möwenschwärme losbrechenden,
von Vogelkot geweißten Kiesel und Steine
taumelnd hinabsanken
und sanken
bis an einen Wandfuß, einen Grund,
an den kein Lot hinabreicht.
Schwimmend empfand ich die sanfte,
kaum spürbare Dünung
wie einen thermischen Auftrieb,
der mich über alle Schlünde hinwegsegeln ließ
und höher und höher emporhob,
dem Gipfel eines schwarzen, aus dem Meer
(und darin gespiegelten Wolken)
ragenden Berg entgegen.
Faßte ich schließlich Tritt
auf einem überspülten Felsen
und zog mich am ersten Griff
aus dem Wolkenspiegel,
dann ließ ich mich manchmal
mit dem enttäuschten Seufzer
eines aus Flugträumen Erwachten
gleich wieder in die Schwerelosigkeit,
ins Meer zurückfallen
und begann so einen Aufstieg
zweimal, dreimal von neuem.
An solchen Sommertagen
kletterten wir stets ohne Seil,
sprangen vor unüberwindlichen Passagen
ins Wasser zurück
oder machten aus einem spielerischen Versuch Ernst,
bis wir zu hoch für einen Sprung waren
und plötzlich weiter und immer höher mußten
bis hinauf zu jenem zerrissenen, dunklen Rand,
der Horse Island vom Himmel trennt.
Aber standen wir dann endlich oben,
dort, wo es keine Zweifel mehr am Ziel geben konnte,
weil uns der nächste Schritt nicht mehr höher,
sondern nur noch ins Leere geführt hätte,
fanden wir uns nicht auf einem Gipfel,
sondern vor grasenden Kühen wieder
auf einer sommerlichen Weide,
sahen tief unter uns das Boot
inmitten blendender Lichtreflexe schaukeln
und kehrten erleichtert (auf einem
in die Felsen geschlagenen Serpentinenpfad)
wieder an den Meeresspiegel zurück.
So begannen alle unsere Wege in die Höhe
mit einem Abstieg ans Meer.
Entsprechend der Tatsache,
daß selbst die Höhen und Gipfel
des küstenfernsten Wüstengebirges
als Meereshöhen vermessen werden
und so jeder Aufstieg
einem Weg aus dem Wasser gleicht,
tauften wir unsere Routen nach Fischen,
Turbot, Hake oder Cod,
beließen sie aber ohne Markierung und Wegzeichen,
sondern führten nur über Verlauf, Schwierigkeit
und die Dauer des Aufstiegs genau Buch.
Die einzige Route, die keinen Fischnamen trug,
war eine der schwierigsten und hieß
Passage to Kham,
weil jener Berg, in dessen Schatten
mein Bruder schließlich verschwinden sollte,
uns schon lange vor unserem Aufbruch
nach Tibet nicht mehr schlafen ließ.
Ich erinnere mich gut an jene Nacht,
in der er mich weckte,
weil er meine Hilfe beim Festmachen einer
im Sturm schlagenden Blechverkleidung brauchte.
Das Blech hatte sich von seinem Observatorium
(einer der Ostseite des Hauses angebauten Kuppel)
gelöst und drohte davongeweht zu werden.
Der Winddruck riß uns die meterlange Blechbahn
dann aber aus den Händen,
warf sie als donnerndes Segel
über den Rand der Weiden in die Tiefe hinab,
und wir kehrten durchnäßt
und fluchend ins Haus zurück.
Dort zeigte mir Liam auf dem Bildschirm
seines Arbeitszimmers eine Schwarzweißfotografie
aus dem vergangenen Jahrhundert:
Er hatte in dieser Nacht auf einem
(vom Sturm unterbrochenen) Streifzug im Netz
nach historischen Details zur Geschichte
der Vermessung des Transhimalaya gesucht,
war dabei auf diese Fotografie gestoßen
und schien wie besessen von dem Gefühl,
eine Entdeckung gemacht zu haben:
Das von der Tragfläche eines Flugzeugs
überschattete, ja überdachte Bild
zeigte eine von Hängegletschern, Verschneidungen
und Lawinenstrichen zerrissene Wandflucht –
die südlichen Abstürze eines Berges,
dessen Höhe ein chinesischer Bomberpilot
auf neuntausend Meter geschätzt hatte,
ein Berg höher als der Mount Everest!
Der Pilot hatte während des aussichtslosen
Widerstandes der Krieger von Kham
gegen eine aus Peking befehligte Besatzungsarmee
eine Klosterfestung bei Dege in Brand geschossen,
als ihn auf dem Rückflug eine Gewitterfront
zu einem weiträumigen Ausweichmanöver zwang.
Das Manöver drückte ihn dicht an die Flanken
eines Berges ohne Namen,
dessen gespenstische Gipfelhöhe
er in einem patriotischen Funkspruch
seiner Basis zuschrie: Dieser Berg,
dieser Koloß! sei die höchste Säule
der revolutionären Welt!
Rückfragen des Bodenpersonals
zersprangen allerdings unbeantwortet
im atmosphärischen Rauschen
eines Schneesturms über Chamdo,
in dem der Bomber dann
ohne eine weitere Meldung verschwand.
Das Wrack sollte erst zwanzig Jahre später
von Zoologen entdeckt werden,
die einen Schneeleoparden verfolgten.
Der Pilot blieb verschwunden.
Keine Spuren. Keine Reste.
Wer sich mit Atlanten und Karten
einer auf Erdsatelliten und Lasertechnik
gestützten Landvermessung beschäftigte
wie mein Bruder Liam,
wer geodätische Computerprogramme
zu schreiben imstande war, wie Liam,
der die Schraffur von Höhenlinien
im Käfig der Koordinaten
mit einigen Tastenschlägen auf seinem Rechner
dazu bringen konnte,
sich zu dreidimensionalen Hügelketten
und Gebirgszügen aufzubäumen,
zu virtuellen Landschaften, über deren Faltenwurf
die Schatten des Tagesverlaufs
oder die Farbtöne der Jahreszeiten huschten –
der kannte natürlich viele solcher Funksprüche
und Gerüchte aus der Vermessungsgeschichte,
Träumereien von vermeintlich unentdeckten
Geheimnissen der Erdkruste,
von im Himalaya oder Karakorum verborgenen,
unzugänglichen Talschluchten, riesigen Bergen
oder unter Gletschern begrabenen Vulkanen …
Liam simulierte auf seinen Rechnern
die Bewegungen der Erdkruste
für digitale Atlanten und Globen,
verkaufte seine Animationen über das Netz
in jeden beliebigen Winkel
der bis auf die Bruchteile einer Bogensekunde
vermessenen Welt und wußte selbstverständlich,
daß sich Bildlegenden wie jene,
die zu der eisig strahlenden Fotografie
auf seinem Schirm gehörten,
immer wieder als Irrtum, Fehlmessung, Scherz
oder bloße Lüge erwiesen hatten.
Immerhin, auch das rief er in jener Sturmnacht
auf seinen Bildschirm, immerhin
hatte eine im Jahr nach dem Bomberflug
unternommene Vermessungsexpedition ergeben,
daß die Wandflucht zu einem von osttibetischen Nomaden
Cha-Ri genannten Massiv gehöre, nur zu einem von vielen
sechstausend Meter hochragenden Gipfeln der Welt,
und Cha-Ri, so schloß die Legende, bedeute Vogelberg.
Wenn ich mir den Anfang unseres Weges
von den Stränden Horse Islands nach Kham
vorzustellen versuche, den Aufstieg
vom atlantischen Meeresspiegel zu den Pässen
von Sichuan und des tibetischen Hochlandes
über wolkenverhangene, von Gletschern
begrenzte Yakweiden zu den Feuern
und schwarzen Zelten von Nyemas Clan
bis in die Lawinenstriche des fliegenden Berges,
dann finde ich mich stets in der Erinnerung
an das nächtliche Arbeitszimmer
meines Bruders wieder,
an das im Halbdunkel leuchtende Abbild
einer wie aus dem Zenit stürzenden Eiswand.
Auch wenn zwischen jener Sturmnacht
und unserem Verhängnis in Kham
noch fast zwei Jahre vergehen sollten,
lag der Anfang unseres Wegs wohl in jenem Rätsel,
das mein Bruder damals entdeckte –
ein kaum sichtbares Detail auf dieser Fotografie:
An ihrem Rand, von der Tragfläche des Flugzeugs
und einer anbrandenden Wolkenfront
fast vollständig verdeckt,
war über einem vergletscherten Sattel
ein weiterer Grataufschwung zu sehen,
der nach seiner Mächtigkeit und Steilheit
zu einem zweiten Gipfel, höher! als die Zinnen
der sichtbaren Eiswand, zu führen schien.
Aber alle topographischen Raster
aus Atlanten und Kartenwerken,
mit denen mein Bruder das Bild der Eiswand
überblendete, zeigten in der Umgebung des Vogelberges
nur Höhenlinien unter der Siebentausendergrenze,
eine unbesiedelte Wildnis ohne Wege, ohne Namen.
Gewiß, es gab gute Gründe,
an der Genauigkeit dieser Karten zu zweifeln,
aber Liam war mit vielen Möglichkeiten vertraut,
Fragen oder widersprüchliche Höhenangaben
über geodätische Quellen, manchmal sogar
über militärgeographische Institute, zu klären,
aber er tat es nicht,
er tat es in diesem Fall nicht,
sondern begann in den Tagen nach der Sturmnacht
erstmals von einer Reise
in den Osten Tibets zu schwärmen.
Vielleicht ist jenes Bedürfnis
tatsächlich unstillbar,
das uns selbst in enzyklopädisch gesicherten Gebieten
nach dem Unbekannten, Unbetretenen,
von Spuren und Namen noch Unversehrten suchen läßt –
nach jenem makellos weißen Fleck,
in den wir dann ein Bild unserer Tagträume
einschreiben können.
Projektionen der Phantasie oder der bloßen Gier
haben schließlich ganze Flotten
in Bewegung zu versetzen vermocht,
Karawanen oder Schlittenhundegespanne,
Armeen von Eroberern und Entdeckern,
die sich im Zweifelsfall
lieber von den Fluchtlinien eines Traums
als von Meßwerten leiten ließen.
Noch Liams astronomische Beobachtungen,
die er mit computergesteuerten Teleskopen betrieb,
erinnerten mich manchmal daran,
daß selbst mit Präzisionsinstrumenten
nach Welten Ausschau gehalten wurde,
die vielleicht nirgendwo anders zu finden waren
als in unserem Kopf.
Und so lag wohl der Fuß des fliegenden Berges
nicht in Tibet, nicht im Land der Khampas,
sondern am Meer,
dort, wo die schwarzen Felswände Horse Islands
vor dreihundertfünfzig Millionen Jahren
aus der Brandung gestiegen waren.
Denn Monkfish, Turbot, Hake und Cod
und alle unsere nach Fischen benannten
Routen durch diese Wände
führten aus dem Wasser
durch Gischtnebel und über brüchige Felsbänder
und vorüber an Seevogelnestern
nicht bloß bis an den Rand einer Viehweide,
sondern von dort über das Leben
und alle Weiden hinaus
bis ins Eis der Gipfelpyramide des Phur-Ri.
Wir jedenfalls gerieten mit jedem Schritt,
mit dem wir uns vom Meeresspiegel entfernten
und an Höhe gewannen,
gleichzeitig tiefer in unsere eigene Geschichte.
Denn wie jede Fluchtlinie,
die an die Ränder des Lebens führt,
verbanden uns auch Kletterrouten
schon vom ersten Aufstieg an
nicht nur mit dem Fernsten, sondern ebenso
mit dem Nächsten, Vertrautesten,
mit Erinnerungen an früheste Wanderungen,
Kindheitswege zu den hochgelegenen Torffeldern
und Schafweiden unseres Vaters
und zu sommerlichen Bergseen in Kerry und Cork,
an deren felsigen Ufern Klettern
ein Spiel gewesen war.
Selbst die von Gebeten
und Marienliedern begleiteten Familienwallfahrten
zu einer in den Caha Mountains sprudelnden Quelle
tauchten aus dieser Tiefe wieder empor:
Ein Band mußte an dieser wishing well in die Zweige
eines Rhododendronstrauches geflochten
und ein Schluck Quellwasser
aus der hohlen Hand getrunken werden,
um einen lange gehegten, geheimen Wunsch
seiner Erfüllung näher zu bringen.
Wer das Geheimnis dieses Wunsches
jemals preisgebe,
so hatte man uns auf diesen Wallfahrten gedroht,
werde bis an sein Ende
von unstillbaren Sehnsüchten geplagt.
In den ersten Wochen nach Liams Tod,
auf meinem Krankenlager in einem der schwarzen Zelte
von Nyemas Clan, habe ich geträumt,
daß es nicht Fernweh oder die Sehnsucht
nach einem unbetretenen weißen Fleck
der Weltkarte gewesen war,
was uns nach Kham geführt und dort