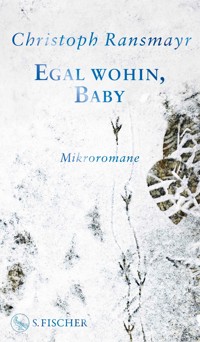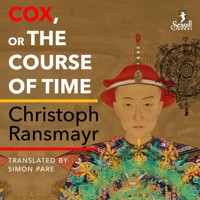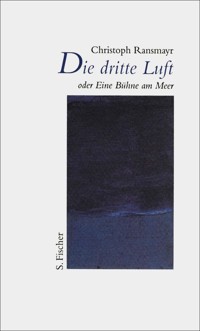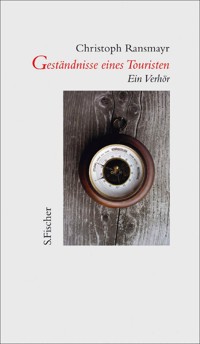
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neben seinen großen Romanen erkundet Christoph Ransmayr in einer losen Reihe von in Leinen gebundenen Bändchen »Spielformen des Erzählens«. In den ›Geständnissen eines Touristen‹ hat Christoph Ransmayr Gespräche, die im Interesse von Journalen wie »Der Spiegel«, »Neue Zürcher Zeitung«, »New York-« und »London Times«, »Corriere della Sera« oder »Le Monde« geführt wurden, in ein fiktives Verhör verwandelt, in dem nach Geschichte und Abenteuer, Politik, Literatur, Kritik, auch dem Verschwinden gefragt wird. Und stets antwortet ein Autor, der nicht als Schriftsteller oder Dichter sprechen will, sondern lieber als Durchreisender, ja als gelassener, zorniger – oder ratloser Tourist. »Wer fragt, will Geschichten hören. Wer antwortet, erzählt. Erzählen erfordert Vorstellungskraft, Mitgefühl, fordert das auch von Lesern und Zuhörern – und Rohheit, politische oder religiöse Dummheit, Dogmatismus sind zum Teil ja auch ein ungeheurer Mangel an Vorstellungskraft.« Die ›Geständnisse eines Touristen‹ setzen die Reihe der »Spielformen des Erzählens« fort, in der unter anderem »Eine Bühne am Meer« und »Tirade«, »Bildergeschichte«, »Duett« und »Ansprachen« als Varianten einer ebenso vergnüglichen wie vielschichtigen Prosa erschienen sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Geständnisse eines Touristen
Ein Verhör
FISCHER E-Books
Inhalt
Wer fragt, will Geschichten hören. Wer antwortet, erzählt. So können Gespräche, selbst Interviews, zu einer Quelle und Spielform des Erzählens werden. Natürlich sprudeln aus solchen Quellen manchmal Fragen, die sich der Befragte nie oder ganz anders stellen würde. Dann wird das Spiel zum Verhör, in dem sich wiederum nur ein Erzähler vor der Neugier retten kann.
In den Geständnissen eines Touristen hat Christoph Ransmayr Materialien zu Gesprächen, die im Verlauf von Jahren und im Interesse von Journalen wie Der Spiegel, Neue Zürcher Zeitung, Washington Post, New York- und London Times, Corriere della Sera oder Le Monde geführt wurden, in ein fiktives Verhör verwandelt, in dem nach Politik und Abenteuer, Literatur, Geschichte, Kritik, auch dem Verschwinden gefragt wird. Und stets antwortet ein Autor, der von sich und den Dingen der Welt nicht als Schriftsteller oder Dichter sprechen will, sondern lieber als Durchreisender, ja als gelassener, lachender, zorniger – oder ratloser Tourist.
»Ich habe die friedlichste Gesinnung.Meine Wünsche sind: eine bescheidene Hütte,ein Strohdach, aber ein großes Bett, gutes Essen,Milch und Butter, sehr frisch, vor dem FensterBlumen, vor der Tür einige schöne Bäume, undwenn der liebe Gott mich ganz glücklich machenwill, läßt er mich die Freude erleben, daß andiesen Bäumen etwa sechs bis sieben meinerFeinde aufgehängt werden.«
Heinrich Heine, Gedanken und Einfälle
Wie? Ob ich schwerhörig bin? Ja, manchmal. Nein: zu oft. Dann quält mich ein Klingen im Kopf, selbst wenn es um mich herum still ist, vollkommen still. Manchmal wird dieses Klingen lauter, über Tage hinweg lauter, so laut, daß es schließlich Maschinenlärm, Stadtgeräusche durchdringen kann, erst recht Blätterrauschen, Stimmen, Musik, Wind, selbst die Brandung, die mich in stilleren Zeiten besänftigt. Dann wird dieser verfluchte Ton furchtbar. Droht, mich wahnsinnig zu machen. Nicht hinhören. Nur nicht hinhören! Aufhören! Hör endlich auf!
Manchmal ist es wie singendes Glas, im rechten Ohr stärker – schwächer, aber ebenso unüberhörbar, im linken. Wie? Ja, ich weiß: Tinnitus, sagen die Mediziner. Ich kenne auch die lang und länger werdende Liste wirkungsloser Heilmethoden. Tinnitus, eine der sogenannten Volkskrankheiten, in hochindustrialisierten Gesellschaften besonders verbreitet, aber harmlos – ausgenommen für einige Befallene, die dieses unaufhörliche Singen und eine damit wie verschweißte, ebenso verzehrende wie vergebliche Sehnsucht nach Stille zum Selbstmord treibt. Richtig, Sie sagen es: Harmlos wie das Leben, das solche Gesänge erzeugt.
Seit wann? Neuseeland, glaube ich. Jedenfalls erinnere ich mich gut an diesen schneereichen August auf der Südinsel Neuseelands, an einen stundenlangen Weg über die Flanken des Mount Cook, dessen Gletscherzungen bis in die Baumfarnwälder an der Küste hinabfließen. Eis! Haushohe Eiswände inmitten dichtesten Grüns. Der durch Buschwerk und Baumkronen schimmernde Eisblink erschien mir damals wie der Glanz einer aus dem Urwald auftauchenden gläsernen Stadt. Ein Maori führte mich durchs Dickicht, über Geröllhalden und dann durch ein schwarzes Felsportal steil in die Tiefe, hinab in eine dieser Wurmhöhlen, die in den Gebirgen Neuseelands aufklaffen, Touristenattraktionen, gewiß, manche aber so entlegen und schwer zugänglich wie je.
In der Finsternis dieser Höhlen lebt eine Fliegenart, deren Larven neun Monate lang als phosphoreszierende, leuchtende Würmchen an Felsdecken und Wänden auf ihre Verwandlung und Befreiung zur Flugfähigkeit warten und dabei mit unsichtbaren Angelschnüren, klebrigen Gespinsten, Beute aus der Nacht fischen – glasige Käferchen, winzige Mücken, die von der Zugluft in die Tiefe geweht werden. Dieses trügerische Leuchten, das Opfer verführen, anlocken soll – Millionen und Abermillionen schimmernder Lichtpunkte in der Finsternis –, läßt tief im Inneren des Gebirges ein Abbild des Himmels entstehen und verzaubert schwarze Höhlenschächte in ein scheinbar grenzenloses, von Sternhaufen, Spiralnebeln und sich kreuzenden Milchstraßen durchschossenes All. Aber die Fliege, die aus diesem Leuchten und nach neun Monaten aus ihrer Larvenhülle kriecht, entschwirrt in den Hungertod: Sie kommt ohne Verdauungs- und ohne Freßorgane zur Welt, ein blindes, mundloses Wesen, das gerade noch genug Kraft hat, um sich in tiefster Finsternis fortzupflanzen und so den Weiterbestand dieses unterirdischen Firmaments zu sichern. Nach einem ersten und letzten blinden Akt, dochdoch, nennen wir es ruhig Liebesakt, und der Eiablage wartet ja nur noch der Tod.
Unter jedem unserer Schritte knisterte damals ein dicker Teppich aus toten Fliegen. Manchmal bis an die Knöchel in diesen Teppich einsinkend, erreichten wir einen unterirdischen See und dort einen vertäuten Kahn, den der Maori losband und an das andere, in ebenso undurchdringlicher Dunkelheit liegende Ufer zu staken begann. Er empfahl mir, mich während der Überfahrt mit offenen, himmelwärts gerichteten Augen auf die Planken zu legen. Und so schaukelte ich, schwebte ich unter Spiralnebeln und Sternhaufen dahin. Als der Fährmann das Ruder irgendwann sanft aus dem Wasser hob und sanft in den Kahn legte und seine Stirnlampe löschte, wurde es unter den namenlosen, in der Tiefe der Erde verborgenen Sternbildern so still, daß ich in meinem Kopf das Klingen des Blutes hörte.
Ich war nicht beunruhigt, sondern zunächst nur erstaunt, als dieser singende Ton, den ich auch früher in der Stille von Salzbergwerksstollen und in alpinen, von Eis verglasten Riesenhöhlen schon gehört hatte, nicht verklang. Selbst als wir Stunden später wieder ins Gletscherlicht hinaustraten, ins tiefe Grün, in den Wind und in einen rauschenden Regen, hörte ich dieses Klingen. Wenn ich mich recht erinnere, war das der Anfang, das erste Mal, daß es in meinem Kopf tagelang, nächtelang, wochenlang nicht mehr still wurde, und ich wußte noch keinen Namen dafür.
Ein Schriftsteller? Ein Dichter? Nein, ich erhebe keinen Anspruch auf solche Titel. Ein Erzähler? Nennen Sie mich, wie Sie wollen.
Auf Formularen, gebe ich zu, schreibe ich der Einfachheit halber gelegentlich Autor, aber das könnte ja auch der Verfasser von Gebrauchsanweisungen sein. Auf Formularen sind mir die Felder am liebsten, in die sich einfach Tourist setzen läßt, denn Ahnungslosigkeit, Sprachlosigkeit, leichtes Gepäck, Neugier oder zumindest die Bereitschaft, über die Welt nicht bloß zu urteilen, sondern sie zu erfahren, zu durchwandern, von mir aus: zu umsegeln, erklettern, durchschwimmen, notfalls zu erleiden, gehören wohl mit zu den Voraussetzungen des Erzählens. Aber wie lange muß einer die Welt bloß betrachtet, ihre Zurufe, Zeichen und Gesten gedeutet, verstanden oder mißverstanden, sich dabei oft verirrt und doch über nicht viel mehr verfügt haben als seine Augen und Ohren, aber über keine Stimme, keine Sprache – bis, ja bis er sich endlich ein Herz fassen und so etwas Ähnliches, so etwas Wunderbares und Maßloses wie es war einmal sagen kann; behaupten kann: Es war einmal.
Nein, keineswegs, ich verzichte nicht aus Bescheidenheit auf durchaus ehrende Titel, aber Schriftsteller oder Dichter erinnern mich stets daran, daß mir in meinem Leben noch keine Arbeit schwerer gefallen ist als das Schreiben. Keine andere Arbeit hat mich zu so wüsten Selbstverfluchungen und meinen Schlaf und Frieden störenden Selbstzweifeln getrieben; nichts ist mir jemals mühseliger erschienen, nichts unerträglicher geworden.
Reden! Ach, redend kann ich mir selber und meinen Zuhörern oder Freunden eine Geschichte so leicht wie leidenschaftlich erzählen, im Reden sind halbe Sätze, Bruchstücke, lange, verwirrende Pausen, ist alles erlaubt, darf eine Aussage noch einmal von vorn und wieder und wieder beginnen, aber im Schreiben … Eine Geschichte zu erzählen, ihren Inhalt so ungefähr und unter Umständen stockend zu beschreiben, befreit ihren Urheber ja schließlich nicht von der entscheidenden und oft quälenden Frage: Wie lautet denn nun ihr erster, unwiderruflich geschriebener Satz? Wie lautet der notwendige Ausdruck, der einzig mögliche Satz in einer nahezu unendlichen Anzahl von Sätzen?
Auf und davon!, könnte dabei als Spruchband oder Trauerflor meine Schreibtische verhängen, ja als Banner von den Tastaturen meiner Notebooks flattern, auf und davon!, nein, nicht auf der Flucht vor dem leeren, unbeschriebenen, sondern vor dem bis zur vollkommenen Schwärze mit Schriftzeichen, Buchstaben, Worten übersäten Papier, das Verbesserungen fordert, Präzisierungen, Entscheidungen, immer neue Versionen und Varianten fordert … Nichts wie weg!, keine Sekunde länger verharren im Schein eines von Zeilen und Zeilen verfinsterten Bildschirms, auf dem ein Satz den nächsten nach oben und weiter, über den Schirmrand hinaus drängt, ins Verschwinden, ins Nichts stemmt, um Platz zu schaffen für die nächste Version, die sofort ebenso hochgestemmt, verworfen, zum Verschwinden gebracht, umgeschrieben und wieder und wieder und manchmal, ja, manchmal bis zum sinnlosen Gestammel umgeschrieben werden muß …
Aber kaum ist so und trotz aller Fluchten und gescheiterten Versuche endlich doch ein Satz, eine Geschichte an ihr Ende gebracht, höre ich noch durch das Klingen in meinem Kopf Fragen wie Und weiter? Wie geht es weiter? Und wo? Wie lautet der nächste Satz? Und der nächste?, Fragen, die ungerührt die Rückkehr zum Anfang fordern, zehn, hundert Felder zurück!, an die Ränder endloser weißer Flecken auf einem Globus, der bestenfalls in Fragmenten, Küstenabschnitten, Inselchen, Klippen zu kartographieren ist, während sich ganze Kontinente, submarine, von Ozeanen bedeckte Gebirge, riesige Städte, Wüsten – der ungeheuerliche Rest! – aufgespießt zwischen unerreichbaren Polen, unvermessen, unausgesprochen, unerzählt an mir vorbei und unter meinen Füßen weg und weiter und immer weiter drehen.
Nein!, ich brauche Ihr Wasserglas nicht. Ich beruhige mich ja schon. Wie? Aber ja, wem sagen Sie das, natürlich hat selbst diese fragmentarische Kartographie, hat der Zauber, wenn schon nicht alles, so doch wenigstens etwas zur Sprache zu bringen, in Sprache zu verwandeln, mit …, ja, auch mit Glück zu tun. Nichts kann mich weiter, über alle Ränder von Bildschirm, Schreibtisch, Papier hinausführen in einen Raum, in dem ich die Höhe von Gebirgen bestimme, ich die Tiefe des Meeres, die Dauer eines Lebens oder einer ganzen Epoche. Ich bestimme, wann die Sonne auf- und wieder untergeht, und ebenso die Auf- und Untergänge von Sternbildern und Mond. Denn wenn sich Menschen samt ihren Häusern, Feldern und Schlachtfeldern, Palästen, Bunkern, Denkmälern – und Himmeln! in Sprache verwandeln, kann das bloß Mögliche, selbst das Paradiesische schon im Stakkato einiger Nebensätze wirklich werden, während das Monumentale, scheinbar. Unzerstörbare, Unbesiegbare, Unvergängliche ebenso spielend leicht und mit anderen Worten wieder verschwindet.
Nur im Kopf, sagen Sie?, nur in der Vorstellungskraft des Erzählers und seiner Zuhörer? Ja, natürlich. Wo denn sonst? Erst dort wird die Welt schließlich vollständig, nur im Erzählraum liegen Mögliches, zumindest Plausibles – und Notwendiges, Tatsächliches, kurz: alles, was der Fall ist – bloß durch hauchdünne, oszillierende Membrane getrennt nebeneinander. Was nicht ist, kann noch oder augenblicklich werden und – auch das ist in diesem Raum so gewiß wie nirgendwo sonst: was ist, kann nicht bleiben. Was für ein Glück – und gleichzeitig, wenn es unsere Liebsten und unser Liebstes betrifft: wie traurig.
Das verstehen Sie nicht? Finden Sie es denn nicht traurig, daß, sagen wir von nun an, von diesem Augenblick an gemessen, in ein paar Jahrzehnten, nein, sagen wir der Sicherheit halber: in neunzig, hundert Jahren, vieles so sein wird wie jetzt: der gleiche Himmel, vom Westen her aufklarend, im Osten noch verhangen …, vor dem Fenster die Schafweide mit ihren Inseln aus Stechginster, dahinter die Steilküste, ein paar Mantelmöwen über dem ausladenden Schirm der Scotch Pine, ein bellender, seidenhaariger Setter im Hof … alles wie jetzt, nur wir, wir und unsere Liebsten – keiner mehr da. Und worüber wir uns gefreut oder manchmal sogar ein bißchen überlaut gelacht haben, der auf dem Küchentisch hinterlassene Zettel, darauf dieses Strichmännchen mit einem Blumenstrauß in den Krallen, die Einkaufsliste und der ans Ende gekritzelte Filmtitel für die abendliche Verabredung im Kino – alles vorbei, alles vergessen.
Gewiß, auch das Glück der Verwandlung von etwas in Sprache kann nichts wirklich festhalten, nichts bewahren, befreit mich aber zumindest von quälenden Fragen, für einen Augenblick selbst von der nach dem nächsten Satz. Besänftigt mich. Ein Augenblick Stille. Wunderbar.
In diesem Augenblick, nur für eine verfliegende Frist, bin ich zu vielem imstande, was ansonsten in unerreichbarer Ferne liegt: Geduld, Langmut, Gelassenheit, ja sogar Trost … Was ich manchmal in den Geschichten jener Erzähler oder Dichter finde, denen ich zuhöre oder die ich lese, kann ich dann ein paar Herzschläge lang selber anbieten: nicht Ablenkung, nicht Betäubung, aber jenen Trost, der das Verschwinden nicht leugnet, sondern davon erzählt und so erträglich macht.
Haben Sie jemals von der Himmels- oder Vogelbestattung gehört, wie sie an manchen Orten des tibetischen Hochlandes Brauch ist? Dort werden die Toten auf den Plattformen von Türmen des Schweigens den Geiern zum Fraß vorgelegt, damit diese in brausend auffliegenden Schwärmen, als Engel sozusagen, eine verbrauchte Hülle der Seelenwanderung stückweise und in alle Himmelsrichtungen davontragen. Es ist dabei die Aufgabe von Turmwärtern – von Alkohol oder anderen Rauschmitteln abgestumpften Gehilfen –, den Leichnam unter den Augen der Trauergäste fraßgerecht für die Geier zu zerkleinern. Vor atemlosen, wie versteinerten Zeugen – Frauen, Ehemännern, Söhnen, Töchtern – greifen diese Türmer zu Axt und Schlachtmesser und zerhacken, zerschneiden den leeren Körper eines geliebten Menschen, zerschlagen seinen Kopf mit einer Keule, die großen Knochen, die Knie, bis der Fraß klein genug, leicht genug ist, um in den Himmel, in die Wolken, ins Blaue gehoben zu werden.
Und um die nun weinenden, manchmal schreienden Trauernden, um die – vorerst – Zurückbleibenden, Überlebenden nehmen sich dann Asketen an, als heilig verehrte Tröster, deren einzige Aufgabe darin besteht, den Verzweifelten beizustehen, ja, sie nicht bloß zu trösten, sondern zum Lächeln zu bringen: Sie halten die Trauernden in den Armen, hören ihnen zu, schweigen mit ihnen, erzählen ihnen Geschichten von den labyrinthischen Wegen der Seele, bleiben bei ihnen und verlassen sie nicht mehr – bis sie lächeln.
Sie winken ab? Diese esoterischen Anekdoten wollen Sie nicht hören? Nun, ich will ja auch nicht sagen, daß ich mich als glücklicher Erzähler am Ende einer Geschichte tatsächlich auch dazu imstande fühlen würde …, ja, wahrscheinlich würde ich an einem solchen Zuspruch scheitern, aber versuchen …, versuchen würde ich es. Denn am Ende einer Geschichte, vielmehr: in ihrem Inneren, bin ich so zuversichtlich, so überzeugt vom Sinn aller menschlichen Anstrengungen wie in keinem anderen Augenblick meines Lebens.
Größenwahn, sagen Sie? Vielleicht haben Sie recht. Aber hat nicht jeder Anspruch, etwas zu benennen, zur Sprache zu bringen, mit diesem Wahn zu tun? und kann wie jeder Wahn enden – mit einem Sturz ins Bodenlose. Denn wehe, wehe!, wenn der Versuch scheitert und sich die Sprache gegen mich selbst wendet und nichts, kein Satz, keine Beschreibung Form und Gestalt annehmen will, nichts gelingen und alles wieder und wieder und immer anders beschrieben sein will – dann werde ich selber so verstört, so ratlos, bedürftig nach Trost wie ein Trauergast auf der Plattform eines tibetischen Turms.
Ach, das kennen Sie? Sie kennen das also. Und wozu?, wozu der ganze Zauber, fragen Sie? Wozu Literatur, Erzählen? Das fragen Sie ausgerechnet mich? Abgesehen davon, daß sich wohl keine Geschichte, die auch nur eine Stimme und ein Ohr findet, um Rechtfertigungen kümmert, läßt sich vermutlich unabhängig von Zeit und Ort kaum sagen, was Erzählen grundsätzlich bewirken soll: Aufklärung? Besänftigung, Trost, Unterhaltung? Politische Aufbrüche …?
Lesen Sie doch ein und dasselbe Gedicht oder Stück Prosa an der nächsten Straßenecke laut, ja, warum nicht, vielleicht auch schreiend vor – dann einmal diesseits, einmal jenseits irgendeiner mit Stacheldraht und Minenfeldern bewehrten Grenze, dann in einer Moschee, einer Wallfahrtskirche, in einem Theater oder auf einem sogenannten Parteitag –, und Ablehnung, Wut, Langeweile oder Beifall werden sich entsprechend unterschiedlich zeigen. Die Wirkung, die eine erzählerische oder poetische Arbeit in verschiedenen gesellschaftlichen, historischen Räumen erzeugt, ist für ihren Urheber wenn überhaupt, dann nur in wenigen Skandalfällen vorherzusehen oder gar vorherzubestimmen.
Ein Erzähler, Schriftsteller, Dichter kann bloß seinen Absichten folgen, seinen gestalterischen, obsessiven, von mir aus: auch erzieherischen, politischen Absichten, aber was aus dem Ergebnis seiner Arbeit, erst recht jenseits des Endes seiner eigenen Lebensgeschichte gemacht wird, entzieht sich der Planung. Was Literatur vermag, was sie soll