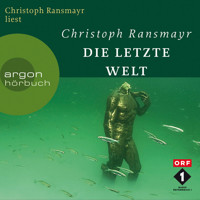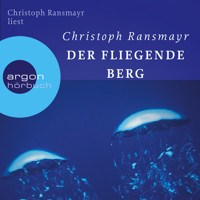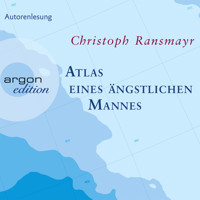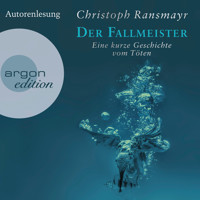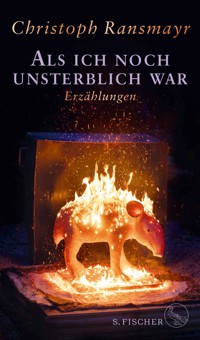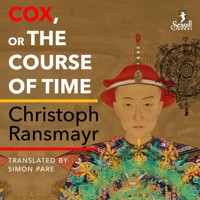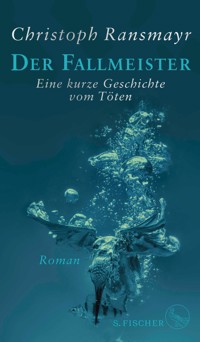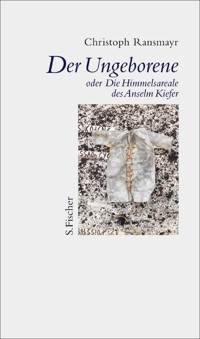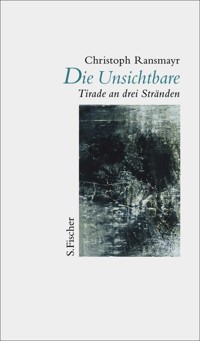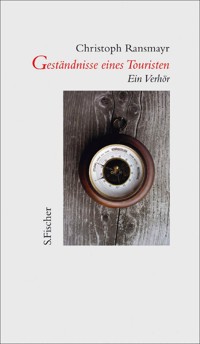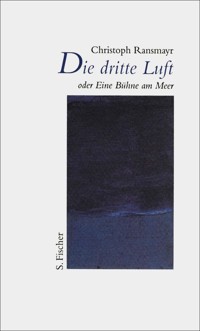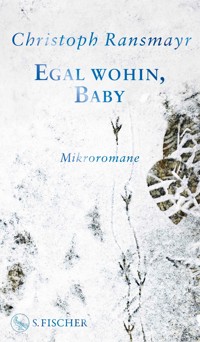
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Siebzig Bilder, siebzig Geschichten, siebzig literarische Glanzlichter Hier macht einer sein Leben in Schnappschüssen sichtbar, überfliegt dabei erzählend Kontinente und Zeiten und bringt die Flüchtigkeit des Augenblicks manchmal ironisch, aber immer mit Leidenschaft und virtuos zur Sprache. In Erinnerung an das klassische Fotoalbum, in dem unter oft unscharfen Bildern die Abenteuer des Augenblicks in Stichworten dokumentiert wurden, erzählt Christoph Ransmayr in »Egal wohin, Baby« siebzig zu Mikroromanen kondensierte Geschichten zu siebzig seiner Fotografien in Schwarz-Weiß. Jedes Foto eine optische Notiz, geschuldet der Zufälligkeit der Anwesenheit und im Vorübergehen aufgezeichnet mit einem Smartphone oder einer Digitalkamera. Jeder Text zum Bild wird zu einem in sich geschlossenen, ausgefeilten Stück Prosa: zu einem Mikroroman. Denn von Expeditionen in die Augenblicke der Wirklichkeit und in die Grenzenlosigkeit der Phantasie kann auch in wenigen Zeilen erzählt werden – zumal, wenn es mit der Beobachtungsgabe und der Formulierungskunst des welterfahrenen Christoph Ransmayr geschieht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Christoph Ransmayr
Egal wohin, Baby
Mikroromane
Über dieses Buch
Das unter Gletschern begrabene Franz-Josef-Land an der Route zum Nordpol, die brasilianische Regenwaldküste, eine überwucherte Rolltreppe hinab zur U-Bahn, ein Garten der irischen Grafschaft Cork, die umkämpfte Wildnis zwischen Uganda und dem Kongo, Japans bebende Erde, Felsentürme des Toten Gebirges in Österreich, im Südpazifik verlorene Inseln vor den globalen Schauplätzen der Barbarei und der Grausamkeit … und immer weitere Aufbrüche in die Erinnerung. Christoph Ransmayr überfliegt erzählend Kontinente und Zeiten und hält die Flüchtigkeit des Augenblicks manchmal ironisch, immer aber mit Leidenschaft und Virtuosität in Geschichten fest, die zu Romanen werden könnten: hier zu siebzig Mikroromanen. Ransmayrs Blick richtet sich auf Details vor dem nächsten Schritt oder schweift über den Horizont und erfaßt historische wie geographische Panoramen. Da wie dort wird die Betrachtung zur Expedition und immer zur Begegnung mit dem Drama der Wirklichkeit.
Ausgehend von seinen wie in einem klassischen Bilderbogen angeordneten Fotografien, verwandelt Christoph Ransmayr Bilder und Erfahrungen seines Reiselebens in Sprache und damit in ein weltumspannendes, farbenprächtiges Leseabenteuer.
»Christoph Ransmayr ist neugierig auf die Welt und verfügt über eine Sprache, diese Neugier in Texten von hypnotisierender Schönheit ansteckend zu machen.« Denis Scheck, Druckfrisch
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Christoph Ransmayr, 1954 in Wels/Oberösterreich geboren, lebt nach Jahren in Irland und auf Reisen wieder in Wien. Neben seinen großen Romanen wie »Die letzte Welt«, »Cox oder Der Lauf der Zeit« sowie dem »Atlas eines ängstlichen Mannes« erschien in jüngster Zeit ein Band mit gesammelten Erzählungen unter dem Titel »Als ich noch unsterblich war«. Für seine Bücher, in mehr als 30 Sprachen übersetzt, erhielt Christoph Ransmayr zahlreiche, auch internationale literarische Auszeichnungen, zuletzt im Jahr 2023 den südkoreanischen Park-Kyung-ni-Preis.
Inhalt
Ein Taufschein
Die Nebelkrone
Eisgeister
Im Schatten der Sonnenpyramide
Die Hirnkoralle
Das Elefantenfest
Der Wilde Fall
Ein Alphabet der Mühsal
Nach uns nichts Nennenswertes
Egal wohin, Baby
Die zitternde Welt
Spuren, dahin und dorthin
In der Heimat des Schnees
Käfer an der Kette
Im Garten des Castlehaven House
Venusdurchgang
Ikarus
Schießereien im Grenzgebiet
Die Kathedrale
Der Stollen
Deirdre, unerbittlich
Robinson
Falsche Richtung
Lebensrettung
Ferngespräch
Ordnung
Der Verlassene
Golgotha
Pega Leve
Massenmörder
Liebende
Im Edelweißbett
Telemachs Bucht
Vogel oder Ei?
Gebotener Einhalt
Major’s Garden
Czernowitzer Gastfreundschaft
Zeitreise
Ein Vertrag
Am Nilursprung
Distelfinken
Ein Tor zum Ozean
Selbstporträt mit Lorcan
Gegurtete Munition
Sirtaki
Trachila
Spielzeug der Götter
Der Siniweler
Andi gibt Oma die Hand
Piedra del Sol
Eine Errettung
Im Nest einer Hand
Cheops
Der Tag hat sich geneiget
Im Raumschiff
Im Bermudavieleck
Heiliges Wasser
Hochwürden
Karner
Hades
Schatzkammer
Der Nordpol
In Thun?
Familie im Regen
Über Land
Gefallener Himmel
Ballspiel
Am Ende der Welt
Gezeitentänzer
Große Musik
Der Beherrscher der Heroen
Ein Taufschein
als Vorwort
Auch wenn sämtliche Dokumente, Türschilder und Reisepässe meines Lebens – und selbst der Schutzumschlag des vorliegenden Buches diese Behauptung widerlegen: Mein Name ist Lorcan. Richtig: Ich habe mich Lorcan getauft. Zumindest für die Länge und Dauer der folgenden siebzig Mikroromane.
Es gehört ja vermutlich zu den befreiendsten Spielen der Phantasie, jenen Namen abzulegen, der über die meisten von uns ohne jede Wahlmöglichkeit in den Tagen verhängt wurde, in denen wir ohne Vernunft und Sprache in Windeln lagen und unseren Willen nur wortlos, weinend oder rot vor Empörung und Schmerz in die Welt schreien konnten.
Aber was für ein triumphaler, nicht nur in der Welt des Verbrechens, der großen und kleinen Fluchten, standesamtlicher Rituale und des Betrugs gepflegter, revolutionärer Akt, diesen verliehenen Namen abzustreifen, sich selbst noch einmal und neu zu taufen! und sich so in eine Gestalt des eigenen Willens zu verwandeln: Ich nicht als ich.
Ich erinnere mich an zumindest drei Namen, die ich in den Jahren meiner Kindheit für die Dauer eines Spiels oder ganzer Tage nacheinander annahm, um mich in jemand zu verwandeln, der ich gerne gewesen oder geworden wäre – Namen, die allesamt aus Büchern und Erzählungen stammten, die mich begeistert, ja gefangengenommen hatten. Und nun, Jahrzehnte später, ist es noch einmal ein Name aus einer Erzählung, die mich in diesen Tagen beherrscht und wohl noch lange beherrschen wird: Lorcan. Ein Name aus einem bislang nur aus Kritzeleien bestehenden, noch ungeschriebenen Roman, der den Titel tragen soll Swan oder Der Puls der Sterne und von der Entdeckung der wahren Größe des Universums handeln soll.
Natürlich werden die Tatsachen meines bis in die Gegenwart geführten Lebens und alle damit verbundenen Geschichten mit diesem Namenswechsel nicht abgestreift, sondern bleiben, was sie waren und sind – im vorliegenden Fall: meine Erfahrungen, meine Erinnerungen. Bleiben dies auch in den siebzig, an meine Mikroromane gehefteten Fotos, die, das nur nebenbei, zu keiner Zeit mehr waren als optische Notizen.
Aber wahre und wahrhafte autobiographische Bilddokumente und ihre Beschriftungen einem Fremden zuzuordnen verschafft mir, verschafft allen von uns jenen Freiraum, über den wir im Schatten einer von amtlichen Dokumenten bezeugten Identität niemals verfügten: Jetzt, endlich, könnten wir uns auch in das Personal eines Romans oder eines Drehbuchs einreihen und die Privilegien einer bloßen Phantasiefigur in Anspruch nehmen.
Wie die Sammlung meiner siebzig, im Vorübergehen und ohne gestalterischen und technischen Aufwand entstandenen Fotos enthalten auch meine Mikroromane ausschließlich Tatsachen und Fragmente meines Lebens. Alle wurden sie an den angegebenen Orten und zu den angegebenen Zeiten tatsächlich erfahren, ausgestanden oder erlitten. Bemerkenswert dabei, in welchem chaotischen Wirbel sich Bilder und Erzählungen gelegentlich aneinanderfügten: Nachrichten von Liebe und Krieg an die von einer Geburt oder einem Garten Eden, ein Märchen an einen Frontbericht oder die Erinnerung an eine Segelfahrt durch die Südsee an den Gestank eines Schlachtfeldes. Nicht nur in Fotoalben und Archiven werden scheinbar durch Welten und Jahrhunderte voneinander getrennte Tatsachen nebeneinander erkennbar, sondern wirbeln manchmal durch einen einzigen Tag, in dramatischen Zeiten schon durch eine einzige Stunde des wirklichen Lebens.
Indem hier einer sein Leben als Lorcan zur Sprache bringt und Szenen und Augenblicke daraus mit Schnappschüssen sichtbar macht, befreit er sich vom Gewicht seiner Erinnerungen und verwandelt einen erschöpften Touristen oder einen von Neugier und Fernweh erfüllten Reisenden in einen gelassenen Erzähler.
Pozo de los Frailes, Andalusien, im März 2024
Die Nebelkrone. Der hocharktische Sommer war vorüber. Die Sonne kreiste nun nicht mehr in einem endlosen Tageslauf um das Schiff, sondern sank wieder unter den Horizont und ließ die Tafelberge und unter Gletschern begrabenen Inseln des Franz-Josef-Landes in einer blauen Dämmerung zurück. Lorcan stand an der Reling eines russischen Eisbrechers, der seinen Namen Yamal – in der Sprache der sibirischen Nenzen Das Ende der Welt – auf einer langen, donnernden Fahrt durch meterdickes Packeis zum Nordpol erfüllt hatte. Von dort sollte der von zwei Atomreaktoren getriebene Koloß aus dem höchsten Norden durch eine Packeiswüste und das von Eisschollen gefleckte, offene Wasser zwischen den unbewohnten Inseln des Franz-Josef-Archipels zur Halbinsel Kola und nach seinem Heimathafen Murmansk zurückkehren.
Nach so vielen sonnenhellen Nächten wurde Lorcans Kabine in dieser Abendstunde nur vom Bildschirm eines Notebooks erhellt, mit dem er Tag für Tag schreibend das Innere einer Geschichte zu erreichen versuchte. Als der Nukleareisbrecher die südlichsten Inseln des Archipels passierte, sah Lorcan durch das Bullauge vor seinem Schreibtisch in der blauen Dämmerung einen im Seegang tanzenden Tafelberg. Thermische Aufwinde hatten die Dunstbänke über diesem Berg zu einem Nebelhut geformt und ihm wie zur Ergänzung seiner Gestalt einen Wolkengipfel aufgesetzt, eine Nebelkrone, die schließlich der im schwarzen Eismeer zurückbleibenden Erscheinung in den Nachthimmel entflog.
Eisgeister. Lorcan war mit jenem Freund, der nun so schwer atmend und von Chemotherapien entstellt im Bett einer Krebsstation vor ihm lag, jedes Frühjahr zum Portal einer kilometertiefen Höhle des oberösterreichischen Höllengebirges emporgestiegen. Auch wenn in der undurchdringlichen Finsternis dieser Höhle konstante Plusgrade herrschten, wuchsen im Dämmerlicht des Eingangsbereiches in der Zugluft meterhohe Eissäulen aus Schmelz- und Sickerwasser, die im Tauwetter des Frühjahrs zu gläsernen Höhlenwächtern schmolzen, Eisgeistern, die sich mit einer Sammlung von mitgebrachten Stirn- und Grubenlampen zum Leuchten bringen ließen.
Lorcan hatte dem Freund ein Foto dieser Geister mitgebracht und ihn zum ersten Mal in ihrer langjährigen gemeinsamen Geschichte belogen: Wir werden, hatte er sich zu dem Kranken, den selbst ein lautes Wort zu schmerzen schien, hinabgebeugt und geflüstert: Wir werden die Geister gemeinsam wieder besuchen, sie erwarten dich. Aber der zu Tode Ermattete, der in eben erst vergangenen Zeiten bei der schweren Arbeit in den Steilhängen und im Hochwald seines Bergbauernhofes immer wieder scheinbar unerschöpfliche Kräfte gezeigt hatte, wenn er die geborstenen Stämme eines Windwurfs zersägte, in der Scheune zentnerschwere Heuballen zurechtrückte oder ein entlaufenes Kalb in felsigem Gelände verfolgte, war zu schwach, um ihm auch nur den Kopf zuzuwenden. Die halb geschlossenen Augen gegen eine leere Wand gerichtet, hauchte er kaum hörbar: Die Eisgeister. Sie erwarten mich.
Im Schatten der Sonnenpyramide.Lorcan hatte am Rand eines der chaotischen Verkehrsströme von Mexico-City – der einst Venedig gleichenden, prachtvollen Metropole Tenochtitlán der Azteken – das Angebot eines Polizisten angenommen, ihn mit seinem knallgelben VW-Käfer zur Pyramidenstadt Teotihuacán zu bringen.
Yaotl, der Polizist, hatte Taxifahrten an seinen dienstfreien Tagen zum Nebenverdienst gemacht, trug aber auch auf diesen Fahrten stets seine Uniform. Teotihuacán, die vor mehr als zweitausend Jahren vom rätselhaften Volk der Tolteken gegründete Stadt mit ihren ungeheuren Pyramiden und Prozessionsstraßen war von den Azteken, Yaotls Vorfahren, bereits verlassen vorgefunden worden, als sie im 13. Jahrhundert als Nomaden ins mexikanische Hochland einwanderten. Die Einwanderer hatten die kolossale Pyramidenstadt als Geschenk der Götter angenommen, sie zu ihrem Heiligtum gemacht und ihr einen neuen Namen gegeben: Teotihuacán: Wo der Mensch zum Gott wird.
Der längsten und breitesten Straße dieser im Norden von einer Reihe erloschener Vulkane, im Süden durch Bergketten von knapp 3000 Metern Höhe begrenzten Geisterstadt gaben sie den Namen Miccaotli: Die Straße der Toten. Denn wer in die Sphäre der Götter aufsteigen wollte, mußte zuvor die Welt der Menschen verlassen.
Yaotl, der seine Uniform jeden Morgen von einer Kolumbianerin in ihrem Zeitungskiosk bügeln ließ, führte seinen Fahrgast wie einen Schutzbefohlenen oder einen Gefangenen vom steinigen Parkplatz in die Pyramidenstadt, nahm ihn am Fuß der Sonnenpyramide sogar an der Hand, empfahl ihm, diesen Himmelsberg zu besteigen und sich so zunächst zwar nicht in einen Gott, aber in etwas zu verwandeln, das in seiner vergleichsweisen Winzigkeit einem Insekt glich, einer roten Ameise, an der die göttliche Übermacht mit überwältigender Deutlichkeit erlebbar werden sollte.
Das Wunderbarste an dieser Pyramide, sagte Yaotl, ja an dieser ganzen Stadt, die als eine der größten der damaligen Welt einmal von mehr als 200000 Menschen bewohnt worden war, sei nicht ihre magische Architektur, sondern die Tatsache, daß dieses Weltwunder ohne Schrift, ohne Alphabet und Rechentafeln erschaffen worden war. Diese himmelhohen, allesamt nach astronomischen Gesetzen errichteten Monumentalbauten zeigten ja, daß der Weg zu den Göttern allein mit der Kraft des Körpers, der Kraft und Entschlossenheit eines Kriegers beschritten werden könne. Und Yaotl, sein Name, den er auf dem Messingschild seiner Uniformjacke trug, bedeute im Nahuatl der Azteken Krieger.
Nein, Yaotl hatte die Sonnenpyramide schon so oft bestiegen, er wollte nun im Schatten einer Prozessionsplattform auf seinen Fahrgast warten. Und als Lorcan in der prallen Mittagssonne mit einer Schar von Wallfahrern und Touristen emporstieg, glaubte er im keuchenden, betenden, singenden und murmelnden Menschenstrom mit jedem Schritt zu schrumpfen und, während er den Wolken mit jedem Schritt näher kam, kleiner und kleiner zu werden, bis er an den Abhängen dieses aus drei Millionen Tonnen Vulkangestein aufgetürmten Himmelsberges verschwand.
Die Hirnkoralle. Das Unwetter hatte sich den Stränden der brasilianischen Küstenstadt Ubatuba als plötzlich aufrauchende, schwarzblaue Wolkenwand so schnell genähert, daß Lorcan nach einem Bad in der Brandung das kleine Gepäck seiner Küstenwanderung in aller Eile zusammenraffte. Erst vor seinem am Morgen im Schatten einer Zuckerrohrmühle geparkten Wagen bemerkte er, daß ihm die Autoschlüssel fehlten. Er mußte sie auf dem Fluchtweg vor dem Unwetter oder schon davor verloren haben.
Die Sturmböen, das Strickwerk der Blitze und die jagenden Wasserschleier eines Wolkenbruchs ließen keine unmittelbare Suche zu, aber als die Gewitterfront nach den Höhenzügen von Paraty und den Urwäldern des Bundesstaates Rio de Janeiro weiterzog, begann Lorcan den überspülten Resten seiner Spuren im Sand zunächst zum Ort seines hastigen Aufbruchs zu folgen und, nach der erfolglosen Suche an seinem Badeplatz, Schritt für Schritt seine Küstenwanderroute zurückzugehen. Unfähig, sich an verläßliche Orientierungspunkte dieses Weges zu erinnern – welche Klippe, welchen Ausläufer des Regenwaldes hatte er passiert … war er links oder rechts dieses geborstenen Palmenstammes, links oder rechts dieser gestrandeten Boje gegangen? –, begann er sich selbst und seine Achtlosigkeit zu verfluchen: Wie konnte einer den Autoschlüssel verlieren an einem Küstenstrich, an dem nur zweimal am Tag ein Bus verkehrte? Scheiße, murmelte, ja schrie er in den Brandungslärm wieder und wieder – bis er nach einer halben Wegstunde die an ein rotes Plastikband geknüpften Wagenschlüssel vor einem abgewrackten, halb im Sand versunkenen Fischkutter liegen sah. Die Hirnkoralle! Wie hatte er darauf vergessen können.
Im Schatten dieses Wracks hatte er doch am Nachmittag diese an ein menschliches Gehirn erinnernde Steinkoralle fotografiert. Wie ein ohne Schädeldecke aus dem Sand aufsteigender Erdtaucher hatte die Koralle plötzlich vor ihm gelegen. Die Schlüssel mußten ihm aus der Tasche gefallen sein, als er seine Kamera hervorgezogen hatte.
In der Erleichterung über den Fund, der ihm viel Ärger ersparte, wurde Lorcan der eben noch verfluchte, orientierungsarme Weg wieder zum Spaziergang, und er sah, was er ohne dieses Hochgefühl wohl übersehen hätte – immer weitere vom ablaufenden Gezeitenwasser freigelegte Hirnkorallen, die offensichtlich der Korallenbleiche zum Opfer gefallen, von Schleppnetzen zertrümmert oder von Sammlern aus ihren Verbänden gemeißelt worden waren.
Hunderte Jahre brauchten Steinkorallen für die Bildung ihrer submarinen Kolonien, tausende Jahre für den Aufbau eines Riffs. Was konnte ein menschliches Gehirn von der Größe eines tausendjährigen Korallenstocks wohl alles denken, alles erfinden, ahnen, speichern? Lorcan konnte trotz seines glücklichen Fundes unter dem Eindruck der wütenden Suche nach den verlorenen Schlüsseln nur daran denken, was ein solches Riesengehirn wohl alles vergessen, alles verlieren, verdrängen konnte: unzählige Erfahrungen, unzählige Namen, Wege und Kreuzungen – und unzählige Schlüssel.
Das Elefantenfest. Eine Prozession von bloß zwölf Elefanten zum Thrissur-Pooram-Fest, dem Fest der Elefanten in Mararikulam, war selbstverständlich nicht vergleichbar mit den Umzügen in den großen Städten Südindiens, bei denen manchmal mehr als hundert, mit goldenen Zierblechen, Perlenketten, Pfauenfedern, seidenen Fahnen und Messingglöckchen geschmückte Elefanten durch die Straßen zogen. Aber dem Mahout Jadoo, einem Elefantenreiter aus Mararikulam im Bundesstaat Kerala, waren die zwölf Bullen, die zu Thrissur Pooram zur Musik von Schalmeien, Sanduhrtrommeln und Schneckenhörnern unter Baldachinen durch das Dorf stampften, Fest genug. Denn diese Prozession wurde seit Jahren angeführt von Jadoos Bullen, dem größten von allen.
Als Lorcan am Vorabend des Thrissur-Pooram-Umzugs in Mararikulam nach einem Mahout fragte, hatte man ihm Jadoo genannt, Jadoo, weil der darauf stolz sein konnte, seinen Bullen ohne eiserne Haken und ohne die in der weichen Haut hinter den Elefantenohren besonders schmerzenden Stachelstöcke führen zu können, mit denen andere Mahouts einem Arbeitselefanten ihren Willen aufzwangen. Jadoo benötigte nur einen Bambusstock – und auch den nicht zum Schlagen, sondern bloß, um auf die Elefantenhaut zu klopfen oder den Bullen zu dirigieren, wenn etwa in der Waldarbeit oder im Steinbruch schwerste Transport- und Schleppdienste zu verrichten waren.
Jadoo konnte einem Ahnungslosen wie Lorcan sogar vorführen, daß er seinen Elefanten, der schon seinem Vater gehorcht hatte, nur mit zwei Fingern berühren mußte, um ihm zu bedeuten, daß er etwa einen Schritt nach vor oder seitwärts tun sollte. Nur mit zwei Fingern! Jadoos Vater hatte den Bullen bis an sein Lebensende geführt und ihn zwei Monate vor seinem Tod Jadoo übergeben. So mußte es sein: Mahout und Elefant waren eine Lebensgemeinschaft, die zumeist länger hielt als die Ehe zwischen Menschen. In gewisser Weise liebten sie einander ja auch. Ein Elefant verzieh allerdings auch niemals, wenn er gequält wurde.
Jadoo erzählte bereitwillig eine Geschichte weiter, die ihm von einem singhalesischen Touristen aus Sri Lanka mitgebracht worden war. Dort, in den Bergen von Kandy, fand alljährlich wohl die prachtvollste Elefantenprozession der Welt statt, in deren Mitte der größte und schönste Bulle des Landes eine kostbare Reliquie, einen Zahn Buddhas, in einem goldenen Schrein durch die Stadt trug. Und in Kandy hatte ausgerechnet jener Bulle einen Menschen zertrampelt, der als der stärkste zum Zahnträger bestimmt worden war. Der Bulle war an diesem Festtag plötzlich aus dem Trott der Prozession ausgebrochen, hatte sich, zunächst noch durchaus behutsam, einen Weg durch die Menge gebahnt und dann aber einen Mann aus Tausenden mit seinem Rüssel umfaßt, ihn hochgehoben, mit aller Wucht zu Boden geschleudert und unter dem panischen Geschrei der Festbesucher zertrampelt.
Erst in den Tagen danach wurde klar, daß der Zerschmetterte als ehemaliger Mahout den späteren Zahnträger mit seinen Messern, Haken und Stachelstöcken so schwer mißhandelt hatte, daß die Blutrinnsale hinter seinen Ohren niemals trockneten. Der Besitzer des Bullen hatte den Rohling deswegen trotz des üblichen Lebensbundes irgendwann davongejagt und den Elefanten dann jenem Mahout anvertraut, der den Gequälten pflegte, ihn mit den Menschen versöhnte und schließlich als Träger des heiligen Zahns in der großen Prozession führte.
Und dort hatte der Bulle seinen Peiniger nach fast dreißig Jahren in der vieltausendköpfigen Menge wiedererkannt. Auch wenn die Mahouts in Kandy Buddhisten und die in Kerala Hindus waren, sagte Jadoo, begingen sie doch aus der Sicht eines Elefanten die gleichen Fehler oder lebten mit ihren Schutzbefohlenen in vergleichbarem Einvernehmen, ja Frieden. Denn Elefanten kannten keinen Gott außer jenem, der ihnen mit seinem Stock im Nacken saß.
Der Wilde Fall,mit dem die im oberösterreichischen Toten Gebirge entspringende Traun in ihren Unterlauf stürzt, um aus einem Bett tosender Gischt den Weg nach Osten und zu ihrer Mündung in die Donau fortzusetzen, war für die Flußschiffahrt jahrhundertelang eine lebensgefährliche Falle. Erst als zu Beginn des 16. Jahrhunderts entschlossene Wasserbautechniker begannen, den Fluß mit Boots- und Floßgassen auch für schwere Zillen schiffbar zu machen, mit denen tonnenschwere Salzfracht aus den Bergwerken einer Salzkammergut genannten Alpenregion an die Donau und von dort weiter bis an das Schwarze Meer verschifft werden konnte, verlor der Wilde Fall seine Schrecken zwar nicht, forderte nun aber weniger Opfer.
Lorcans Urgroßvater war der letzte jener Fallmeister genannten Schleusenwärter gewesen, die Salzzillen über ein komplexes System von Kanälen und Schleusentoren über den Wilden Fall in den Unterlauf des Flusses absenken konnten. Als der Salztransport auf dem Wasser in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts auf Schienen und Straßen verlegt und die Zillen abgewrackt wurden, blieb der Urgroßvater zwar arbeitslos im Wasserstaub des Fallmeisterhauses zurück, durfte aber das strohgedeckte Quartier auf einem Uferfelsen weiterhin bewohnen. Dort kam auch seine einzige Tochter zur Welt, Lorcans Großmutter, die ihr Leben lang gegen die Melancholie kämpfen sollte und auf der vergeblichen Suche nach Glück zwei uneheliche Kinder zur Welt brachte. Die Namen der Väter, zweier Schichtarbeiter aus flußaufwärts gelegenen Papierfabriken, gab sie niemals preis. So wuchs das ältere dieser beiden, mit dem Makel der Unehelichkeit behafteten Kinder, Lorcans Vater, nur von einer traurigen Mutter behütet auf. Er brachte es als Armenschüler zum Gymnasiasten und als Spätheimkehrer nach einer jahrelangen Kriegsgefangenschaft auf der Halbinsel Krim schließlich zum Lehrer in einer zwei Kilometer östlich des Wilden Falls gelegenen Dorfschule. Dort unterrichtete er Lorcan und drei andere seiner Kinder nicht nur in den Grundrechenarten, sondern zeigte ihnen in den Sommermonaten auch, wie man selbst im brodelnden Weißwasser unterhalb des Falls schwimmen konnte, indem man sich den Wirbeln vertrauensvoll überließ und nicht in Panik verfiel, wenn man von ihrer unbändigen Kraft unter Wasser gedrückt, dann aber verläßlich wieder in den von der Linse des Wildwassers verzerrten Himmel entlassen wurde.
Lorcan erinnerte sich an unzählige Sonntagsspaziergänge vom Dorf zum Fall, an Wallfahrten in die Vergangenheit des Vaters, der auf diesen Wegen von seiner Kindheit am Fluß und dem unablässigen Tosen erzählte und immer auch davon, wie er selber im glatten Zugwasser oberhalb der Fallkante schwimmen gelernt hatte. In diesen Lehrstunden band ihm seine Mutter eine Leine um die Hüften, deren langes Ende sie um ein Stuhlbein wickelte, und ließ, während sie auf dem Stuhl in der Sonne saß und strickte, ihren Sohn an der straff gespannten Leine wie einen Fisch an der Angel zunächst strampeln, dann im Auftrieb der Strömung – schwimmen.
Ob er dabei nie gefürchtet habe, die Leine würde reißen oder die Mutter sich gedankenverloren von ihrem Stuhl erheben, die Leine freigeben und er den brüllenden Fall hinunterstürzen? Er habe kein einziges Mal daran gedacht, sagte der Vater, sein Vertrauen in die Mutter sei so groß gewesen, daß ihm ein solches Unglück niemals auch nur in den Sinn kam.
Lorcan sollte nach dem Traunfall seiner Kindheit noch staunend vor weitaus größeren Wasserfällen stehen – den Victoriafällen, den Niagarafällen, den Iguazúfällen zwischen Brasilien und Argentinien, vor dem japanischen Shōmyō-Fall oder dem höchsten von allen, dem Salto Ángel in Venezuela, dessen himmelhoher Wassermantel beinahe tausend Meter in eine dunkle Tiefe fiel – aber durch jedes dieser Wasserwunder hatte er den Traunfall wie ein Wasserzeichen schimmern sehen.
Seine Schwester Maria hatte ihn in einem froststarren Winter, in dem der Fall bis auf ein lautlos über ein Moosbett gleitendes Rinnsal zu meterdicken, mächtigen Eistürmen gefroren war, vor dieser gläsernen Festung fotografiert. Aber wann immer Lorcan später dieses Bild betrachtete und sich als grinsenden Zwerg vor Eistürmen posieren sah, hörte er, obwohl seine Schwester damals den Auslöser in einer tiefen winterlichen Stille gedrückt hatte, das Tosen des Falls.
Ein Alphabet der Mühsal.Auf einer winterlichen Nilfahrt stromaufwärts unter den Segeln einer zweimastigen Feluke hatte Lorcan bei Landgängen in Kom Ombo, Luxor, Karnak und den antiken Steinbrüchen von Jabal al-Silsilah immer wieder Reihen von Kerben, Schleif- und Schabrillen an den tonnenschweren Sandsteinblöcken mächtiger Tempelbauten und pharaonischer Totenpaläste bemerkt. Ein Bootsmann, der ihn manchmal von den Anlegeplätzen am Stromufer zu den Heiligtümern begleitete, deutete die tief eingegrabenen Zeichenreihen in halb arabisch, halb italienisch vorgebrachten Erklärungen als Schleifspuren, die vor drei- oder viertausend Jahren von Bauarbeitern und Steinmetzen beim Schärfen ihrer Meißel und Beile hinterlassen worden waren, als ein Alphabet der Mühsal, das in die Außenmauern pharaonischer Monumente geschlagen worden und dadurch so unvergeßlich geworden war wie die Tempel, Paläste und Pyramiden selbst.
Zurück an Bord der Feluke und von einer Brise erfrischt, die das Großsegel füllte, befragte Lorcan das allwissende Große Netz über sein Mobiltelefon zu den Schleifspuren, fand aber keine unbezweifelbaren Erklärungen, sondern nur eine Liste von Vermutungen, die einander oft widersprachen: