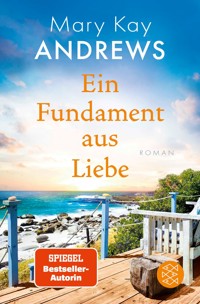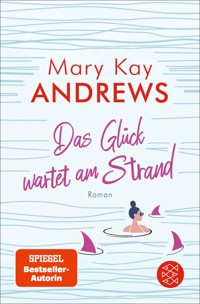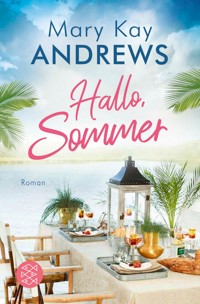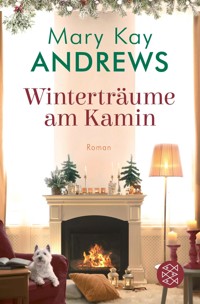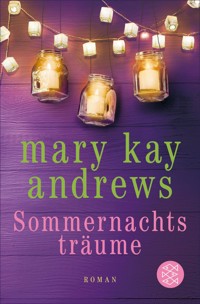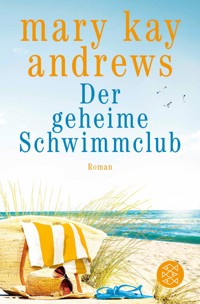
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Sommerbuchreihe
- Sprache: Deutsch
Vier Freundinnen, ein geheimer Schwimmclub und eine Insel, die zum Träumen einlädt Sie waren jung, als sie ihren geheimen Schwimmclub auf der verwunschenen Insel Talisa gründeten: Josephine, Millie, Ruth und Varina. In den langen Sommernächten gingen sie nachts schwimmen, vertrauten einander ihre Geheimnisse und Lebenswünsche an – bis ein schicksalhaftes Ereignis die Frauen trennte. Jetzt, viele Jahrzehnte später, ist Josephine schwer erkrankt, und sie möchte ihre Freundinnen unbedingt noch einmal wiedersehen. Also beauftragt sie die junge, alleinerziehende Anwältin Brooke, sie zu finden und nach Talisa zu bringen, um dann das Rätsel von damals zu lösen. Noch mehr glückliche Lesestunden mit Mary Kay Andrews: ›Die Sommerfrauen‹, ›Sommerprickeln‹, ›Weihnachtsglitzern‹, ›Sommer im Herzen‹, ›Winterfunkeln‹, ›Liebe kann alles‹, ›Ein Ja im Sommer‹, ›Mit Liebe gewürzt‹, ›Kein Sommer ohne Liebe‹, ›Auf Liebe gebaut‹, ›Zurück auf Liebe‹, ›Sommernachtsträume‹, ›Zweimal Herzschlag, einmal Liebe‹, ›Liebe und andere Notlügen‹, ›Der geheime Schwimmclub‹, ›Sommerglück zum Frühstück‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 705
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Mary Kay Andrews
Der geheime Schwimmclub
Biografie
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
[Widmung]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
Epilog
Danksagung
Dieses Buch widme ich von ganzem Herzen Andrew Rivers Trocheck; seine Liebe für die wilden Seiten Georgias war es, die mich inspiriert hat.
Prolog
Die drei jungen Frauen schauten in das Loch hinab, das sie in den Hügel aus Muschelschalen gegraben hatten. Ihre dünnen pastellfarbenen Kleider waren feucht und zerknittert, schwankend standen sie auf den hohen Absätzen ihrer zierlichen Sandalen. Ihre geröteten Gesichter glänzten vor Schweiß. Die Vierte im Bunde war ein siebzehnjähriges Mädchen mit karamellbrauner Haut, das einen Arbeitsoverall und abgetretene Lederschuhe trug. Ihre Augen waren vor Entsetzen weit aufgerissen. Durch die knorrigen Äste der moosbehangenen Lebenseichen tasteten sich vorsichtig die morgendlichen Sonnenstrahlen und fielen auf den Austernsplitt.
»Gib mir mal die Schaufel!«, sagte die größte der jungen Frauen. Das junge Mädchen gehorchte.
Das Schaufelblatt stach durch den Muschelsplitt in den Boden. Die große Frau warf den Sand auf die Gestalt im Loch, dann reichte sie das Werkzeug wortlos an die Rothaarige neben sich weiter. Die zuckte mit den Achseln und tat es ihrer Vorgängerin nach. Bedächtig streute sie den Splitt auf den Kopf des Toten. Dann drehte sie sich zu der dritten jungen Frau um, einer hübschen Blondine, die beide Hände vor den Mund geschlagen hatte.
»Mir wird gleich schlecht«, brachte sie hervor, krümmte sich und würgte.
Die Rothaarige hielt ihr ein Taschentuch hin, die Blondine wischte sich damit die Lippen ab. »Entschuldigung«, flüsterte sie. »Ich habe noch nie einen Toten gesehen.«
»Glaubst du etwa, wir?«, fuhr die Große sie an. »Kommt, bringen wir es hinter uns! Wir müssen zurück sein, bevor jemand fragt, wo wir sind.«
»Und der?« Die Rothaarige wies auf die Leiche im Loch. »Meinst du, niemand wundert sich, wenn er nicht zum Frühstück erscheint?«
»Wir sagen einfach, er hätte davon gesprochen, jagen zu gehen. Gestern war er doch auch frühmorgens unterwegs. Noch vor Sonnenaufgang. Millie kann sagen, sie hätte gehört, wie er sein Zimmer verlassen hat. Sein Gewehr liegt ja hier, also passt das. Ihm kann alles Mögliche zugestoßen sein. Er könnte sich im Dunkeln verlaufen haben und in einen Bach gefallen sein.«
»Hier gibt es Alligatoren«, sagte das junge Mädchen im Overall. »Riesige Dinger.«
»Und Schlangen«, ergänzte die großgewachsene Frau. »Klapperschlangen, Mokassinottern, Korallenottern. Und Wildschweine. Die laufen in Rotten herum. Wenn die einen erwischen …«
»Du liebe Güte!«, sagte die Rothaarige. »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich niemals gestern Abend im Dunkeln rausgeschlichen. Schlangen und Alligatoren?« Sie erschauderte. »Wildschweine? Gruselig.«
»Wir wissen von nichts«, sagte die Große mit Nachdruck und sah die anderen eindringlich an. »Verstanden?«
Ein leises Schluchzen entschlüpfte ihrer blonden Freundin. »O Gott! Was ist, wenn es jemand herausfindet?«
»Das findet keiner heraus«, sagte die Rothaarige. »Wir haben uns doch geschworen, dass wir nichts verraten, oder?«
»Ja. Hier kommt auch kaum jemand hin. Die Geechees haben Angst vor diesem Hügel. Sie glauben, hier gibt’s Geister. Stimmt’s, Varina?«
Die Siebzehnjährige schaute auf ihre staubigen Schuhe. »Kann schon sein.«
»Genau, sie sind überzeugt, hier würde es spuken«, wiederholte die Große. »Gardiner und ich haben den Hügel zufällig mal entdeckt, als wir noch Kinder waren. Er soll noch von den Indianern stammen.«
Die Blondine riss die braunen Augen auf. »Meint ihr wirklich, es ist ein Grabhügel? Dass da unten noch mehr Tote liegen?«
»Wer weiß?« Ein Regentropfen fiel der großgewachsenen Frau ins Gesicht. Sie spähte durch die Baumwipfel in den Himmel, der sich zugezogen hatte. »Jetzt fängt es auch noch an zu regnen! Kommt, wir bringen das jetzt zu Ende und gehen zurück zum Haus, bevor wir alle klatschnass und unsere Schuhe ruiniert sind. Dann müssen wir nämlich wirklich viele Fragen beantworten. Wo wir gewesen sind und was wir gemacht haben.«
Der jungen Blondine traten Tränen in die Augen, unwillkürlich rieb sie über die blauen Flecke an ihren nackten Armen. Lautlos weinte sie vor sich hin. »Wir kommen alle in die Hölle. Wir hätten gestern nicht schwimmen gehen dürfen. Was ist, wenn jemand herausbekommt, was passiert ist? Dann fällt der Verdacht auf uns. Auf mich!«
Die Rothaarige wurde nachdenklich. »Es ist unwichtig, wer ihn umgebracht hat. Es hätte jede von uns sein können. Er war ein schlechter Mensch. Für das, was er getan hat, wird er in die Hölle kommen. Du hättest dich niemals mit ihm verloben dürfen, Millie.«
»Hat sie aber. Das ist nicht mehr zu ändern«, sagte die Große. »Mädels, es wird eine Menge Fragen geben, wenn herauskommt, dass er verschwunden ist. Man wird ihn suchen, und mein Vater ruft mit Sicherheit den Sheriff. Aber wir wissen alle von nichts, verstanden?«
Die Blonde blickte forschend die Rothaarige an, die wiederum die Große anschaute, die ihrerseits erwartungsvoll das junge Mädchen ansah, das pflichtschuldig nickte. »Wir haben keine Ahnung.«
1.
Brooke Trappnell machte sich nur selten die Mühe, an ihr Bürotelefon zu gehen, schon gar nicht, wenn im Display »Unbekannte Nummer« stand, denn dann wollte der Anrufer meistens etwas verkaufen, das sie entweder nicht brauchte oder sich nicht leisten konnte. Aber an diesem Tag gab es nichts zu tun, und die Büronummer stand schließlich auf ihrer Visitenkarte, also hob sie ausnahmsweise ab.
»Trappnell und Partner«, meldete sie sich forsch.
»Ich möchte gerne mit Miss Trappnell sprechen.« Die Stimme schien einer älteren Frau zu gehören. Sie klang dünn und zittrig. Der schwere Südstaatenakzent, den man an diesem Teil der Küste Georgias sprach, war nur schwach herauszuhören.
»Am Apparat.« Brooke griff zu Stift und Notizblock, nur für den Fall, dass am anderen Ende tatsächlich eine potenzielle Mandantin war.
»Oh.« Die Frau klang enttäuscht. Oder vielleicht desorientiert. »Verstehe. Nun, ich bin Josephine Warrick.«
Es kam Brooke vor, als ob sie den Namen irgendwo schon einmal gehört hatte, sie wusste nur nicht, wo. Schnell tippte sie ihn in die Suchmaschine ihres Computers.
»Josephine Warrick von Talisa Island«, wiederholte die Frau ungeduldig, als hätte sie von Brooke eine andere Reaktion erwartet.
»Aha. Was kann ich für Sie tun, Mrs. Warrick?« Brooke warf einen kurzen Blick auf den Monitor und klickte auf einen vier Jahre alten Artikel der Zeitschrift Southern Living, der die Überschrift trug: »Josephine Bettendorf Warrick und ihr Kampf um Talisa Island.« Sie betrachtete das Farbfoto einer älteren Frau mit langen weißen Haaren, die mit trotzigem Gesichtsausdruck vor einer Villa stand. Das Haus glich einer rosa Hochzeitstorte. Die Dame trug einen bodenlangen Pelzmantel und hohe Turnschuhe. In ihrer rechten Armbeuge ruhte eine doppelläufige Flinte.
»Ich möchte, dass Sie herkommen und mich besuchen«, sagte Mrs. Warrick. »Ich kann Sie morgen um elf Uhr von meinem Boot in St. Ann’s abholen lassen. Ist das in Ordnung?«
»Ähm, könnten Sie mir bitte sagen, um was es geht? Handelt es sich um eine juristische Angelegenheit?«
»Natürlich ist es was Juristisches. Sie sind doch Anwältin, oder? Und Sie haben die Befugnis, im Bundesstaat Georgia zu praktizieren?«
»Ja, aber …«
»Es ist zu kompliziert, um das am Telefon zu erklären. Seien sie pünktlich um elf am Anleger, ja? C.D. holt Sie ab. Und machen Sie sich keine Gedanken ums Mittagessen. Ich lasse etwas vorbereiten.«
»Aber …«
Die Anruferin hörte Brookes Einwand nicht mehr. Sie hatte bereits aufgelegt. Und schon war der nächste Anrufer in der Leitung.
Brooke verzog das Gesicht, als sie den Namen im Display las: Dr. Himali Patel. Rief die Kinderorthopädin tatsächlich an, um an die Bezahlung von Henrys teuren Behandlungskosten zu erinnern?
»Hallo?«
»Hallo, Brooke. Hier ist Dr. Patel. Ich wollte mich nur erkundigen, wie Henry die Physiotherapie bekommt.«
»Sehr gut, danke. Er hatte diese Woche seinen letzten Termin.«
»Das freut mich«, sagte die Ärztin. Dr. Himali Patel war eine Frau der leisen Töne, eine indische Kinderärztin, die Henrys gebrochenen Arm behandelt hatte. Brooke wurde ganz anders, wenn sie an die Tausende von Dollar dachte, die sie dem Krankenhaus noch für die Operation schuldete. Sie hatte sich vor Jahren für eine günstige Krankenversicherung mit hoher Selbstbeteiligung entschieden, doch dann war Henry auf dem Spielplatz vom Klettergerüst gestürzt und unglücklich auf den Arm gefallen, so dass sie mit ihm in die Notaufnahme gemusst hatte. Was folgte, waren eine OP und wochenlange Physiotherapie.
»Falls er Schmerzen haben sollte oder sein Bewegungsradius kleiner wird, kommen Sie mit ihm her. Sonst kann alles wieder seinen gewohnten Gang gehen.«
»Danke, Dr. Patel.« Die Ärztin hatte gut reden. Brooke musste unbedingt bei der Abrechnungsstelle des Krankenhauses anrufen, um einen Teilzahlungsplan zu vereinbaren.
Der Artikel in Southern Living war an Josephine Warricks fünfundneunzigstem Geburtstag erschienen. Demnach musste sie jetzt neunundneunzig sein. Brooke holte den Eistee und das Sandwich mit Erdnussbutter und Gelee heraus, das sie von zu Hause mitgebracht hatte. Dann las sie den Zeitschriftenbeitrag und noch ein halbes Dutzend andere, die sie online fand, um sich über das ereignisreiche Leben der Josephine Bettendorf Warrick zu informieren.
Brooke kannte Talisa Island flüchtig, da sie vor fast fünfundzwanzig Jahren mit den Pfadfinderinnen einen kurzen Campingausflug dort hatte verbringen wollen, der allerdings unter keinem guten Stern gestanden hatte. Ihre Erinnerung war verschwommen, weil sie auf der Hinfahrt seekrank geworden war und dann das Kunststück vollbracht hatte, zuerst von einer Qualle verbrannt zu werden und anschließend durch Giftsumach zu laufen. Die Betreuerinnen hatten ein Boot organisieren müssen, das Brooke vorzeitig zurück zum Festland brachte. Ihre Eltern waren aus dem fast zwei Stunden entfernten Savannah angereist, um sie abzuholen. Es war Brookes erster und letzter Zelturlaub gewesen. Der Name Talisa weckte bei ihr Erinnerungen an die Lotion gegen Giftsumach, an verbrannte Marshmallows und ihren Vater am Lenkrad des Cadillacs, der vor unterdrückter Wut einen roten Nacken bekam, weil er sein samstägliches Golfspiel verpasste.
Beim Lesen machte Brooke sich Notizen und vertilgte ihr Sandwich. Talisa, erfuhr sie, war eine knapp fünftausend Hektar große Düneninsel, die mit der Fähre eine halbe Stunde von der Stadt St. Ann’s entfernt war, wo Brooke lebte. Im Jahr 1912 hatte Samuel G. Bettendorf zusammen mit zwei Cousins die Insel erworben, um die Wintermonate in der Wärme Georgias zu verbringen. Die drei waren Inhaber einer Reederei in Boston. 1919 hatten Samuel Bettendorf und seine Frau Elsie auf Talisa ein Herrenhaus mit fünfzehn Zimmern im mediterranen Stil errichtet, das sie Shellhaven nannten.
1978 hatten dann die Erben der beiden Cousins ihre Anteile dem Bundesstaat Georgia verkauft, der dort ein Naturschutzgebiet einrichtete. Deshalb hatte Brookes Pfadfindergruppe auf der Insel zelten können. Samuel Bettendorf hatte sein Grundstück behalten. Es lag am südöstlichen Ende der Insel, direkt am Meer.
Samuels Tochter und einzige Erbin Josephine Bettendorf Warrick lieferte sich schon seit dreißig Jahren einen Rechtsstreit mit dem Staat, der ihr unbedingt den Rest der Insel abkaufen wollte.
Aus welchem Grund hatte Josephine Warrick Brooke zu sich bestellt? Die Anwältin runzelte die Stirn. In den ersten drei Jahren ihrer Berufstätigkeit hatte Brooke in einer führenden Anwaltskanzlei in Savannah gearbeitet und war dort hauptsächlich mit Zivilklagen und Firmenrecht beschäftigt gewesen. Nachdem sie ihren Verlobten vor dem Altar hatte sitzen lassen und an die Küste geflohen war, hatte sie ihre eigene Kanzlei eröffnet. Der »& Partner«-Teil von Trappnell & Partner war dabei allerdings reines Wunschdenken. In dem gemieteten holzverkleideten einstöckigen Bürogebäude auf der Front Street gab es keine Partner, nur eine Vorzimmerdame in Mini-Teilzeit. In der Kanzlei praktizierte ausschließlich die vierunddreißigjährige Brooke Marie Trappnell, managte ihren Job und den Rest ihres Lebens. Brooke übernahm Scheidungen, Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer oder Körperverletzung und hin und wieder mal eine kleine zivil- oder strafrechtliche Sache. Wenn es Josephine Warrick um den Rechtsstreit mit dem Staat ging, würde Brooke ihr kaum weiterhelfen können, denn sie wusste so gut wie nichts über Liegenschaftsrecht. Dafür brauchte man eine besondere Qualifikation.
Und genau das würde sie Josephine Bettendorf Warrick auch sagen. Am nächsten Tag. Warum auch nicht? Um neun Uhr hatte Brooke einen Termin mit einer Mandantin, die seit einer Woche wegen Körperverletzung im Knast saß, nachdem sie mit der Kassiererin des örtlichen KwikMarts aneinandergeraten war, die ihr neunundneunzig Cent für einen Becher Chrushed Ice hatte abknöpfen wollen. Der Rest von Brookes Kalender war leer. Das kam in letzter Zeit öfter vor.
Nach Brookes Schätzung gab es mindestens drei Dutzend Anwälte in St. Ann’s, alles alteingesessene, erfahrene Kollegen, die sich sämtliche lukrativen Fälle unter den Nagel rissen, die in der Siebzehntausend-Seelen-Stadt zu bekommen waren. Brooke konnte sich glücklich schätzen, wenn für sie ein paar Krümel übrig blieben, die von den Großen verschmäht wurden.
Wenn sie der Wetter-App auf ihrem Handy glauben konnte, würde der nächste Frühlingstag wunderbar sonnig. Was sprach dagegen, mit dem Boot nach Talisa zu fahren, sich die Insel anzusehen und die legendäre Josephine Warrick zu treffen?
2.
Als Brooke am Freitagmorgen ihren Volvo vor dem Büro geparkt hatte, hörte sie bereits, dass laute Musik aus ihrem Büro dröhnte. Jaulende Gitarren, harte Drums, rockige Countrymusik. Brooke holte ihr Pfefferspray aus der Tasche und schlich lautlos zur leicht angelehnten Tür.
Mit dem Fuß trat sie dagegen und schob vorsichtig den Kopf hinein.
Der Eindringling war so konzentriert und beschäftigt, dass er nicht mal aufsah: Brookes Angestellte Farrah saß an der Empfangstheke, die nackten Füße auf der Arbeitsfläche, und sang mit wippendem Kopf das Lied aus dem Radio mit. »Play it again, play it again, play it again«, wiederholte sie und trommelte auf die Tischplatte.
Brooke reckte sich nach dem kabellosen Lautsprecher auf dem Aktenschrank und schaltete ihn aus.
Das Mädchen erschrak und sprang auf.
»Mensch, Brooke!«, rief sie und griff zu dem Fläschchen mit Nagellack, mit dem sie ihre Zehennägel lackiert hatte. »Du hast mir einen Riesenschreck eingejagt!«
»Und ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich die Musik gehört und die offene Tür gesehen habe«, gab Brooke zurück. Sie hob das Pfefferspray hoch. »Du kannst von Glück sagen, dass ich nicht sofort gesprüht habe.«
»Was machst du denn hier? Ich dachte, du müsstest heute Vormittag zu Brittni ins Gefängnis«, sagte Farrah und schielte zu der Uhr über den Aktenschränken.
»Und ich dachte, du hättest in der zweiten Stunde Englisch.«
Farrah Miles war im letzten Jahr an der Highschool und außerdem Henrys Babysitterin. Brooke kannte die Schülerin seit September, als sie ihren Rechtsanwaltsberuf an der örtlichen Highschool vorgestellt hatte. Während Brookes Vortrag hatten die meisten Jugendlichen vor sich hin gedöst oder auf ihr Handy gestarrt. Doch am Tag danach war Farrah, ein zierliches blondes Mädchen mit einem winzigen Goldstecker in der Nase, blau-grünen Strähnen und einer Schwäche für Cowboystiefel und super kurz geschnittene Jeans, in Brookes Kanzlei aufgetaucht und hatte verkündet, sie würde sich für Jura interessieren und einen Job suchen.
Farrah war klug und tüchtig – wenn sie wollte –, und so hatten die beiden sich geeinigt, dass Farrah fünf Tage nach der Schule im Büro arbeitete und zusätzlich als Babysitterin für den dreijährigen Henry einsprang.
Farrah setzte sich wieder und fuhr mit ihrer Pediküre fort. Sie tupfte violetten Lack auf den großen Zeh. »Mr. Barnhart ist so mies! Bis zum Abschluss sind es nur noch zwei Wochen, und mein Notendurchschnitt steht eh schon fest, aber trotzdem will er mich nicht von der letzten Prüfung befreien wie alle anderen Lehrer.«
»Heißt das, du schwänzt? Farrah, er kann dich immer noch durchrasseln lassen. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Wenn du an die Universität von Georgia willst, brauchst du einen richtig guten Notendurchschnitt.«
Farrah machte ein genervtes Gesicht. »Die nehmen mich doch sowieso nicht, Brooke. Wozu der ganze Aufwand? Lieber geh ich auf ein Community College, wie alle anderen. Kein Ding.«
Brooke rollte mit ihrem Schreibtischstuhl zu Farrah hinüber und hielt wenige Zentimeter vor ihr an. Das Mädchen senkte den Kopf und tat, als würde sie sich auf ihre Füße konzentrieren. Brooke hob Farrahs Kinn hoch, um ihr in die Augen zu sehen.
»Hör mal zu, Farrah Michele Miles! Du hast wirklich gute Chancen. Dein Durchschnitt ist mit 3,9 Punkten wirklich nicht schlecht, und du hast fast nur fortgeschrittene Kurse belegt, dazu kommt noch dein Engagement außerhalb der Schule. Deine Bewerbungsaufsätze waren gut, und deine Lehrer haben hervorragende Empfehlungsschreiben verschickt. Also, verbock es nicht, ja?«
»Ich verbocke gar nichts.« Farrah wechselte das Thema. »Wie ist es heute Morgen mit Brittni gelaufen?«
»Ich war drüben im Knast. Brittnis Stiefvater weigert sich immer noch, Kaution für sie zu hinterlegen, und ihre Verhandlung ist erst nächste Woche, von daher kann ich nicht viel machen. Sie muss einfach durchhalten und vor allem darauf achten, dass sie sich nicht mehr prügelt.«
Farrah schüttelte den Kopf. »Auch wenn sie meine Cousine ist – sie ist so bescheuert! Hätte sie doch einfach die neunundneunzig Cent für das Eis bezahlt! Ist ja nicht so, als hätte sie kein Geld dabei gehabt.«
»Das habe ich ihr auch gesagt«, erwiderte Brooke, »aber Brittni meint, die Kassiererin vom KwikMart hätte es auf sie abgesehen. Sie würde immer behaupten, Brittni hätte ihr den Freund ausgespannt.«
»Stimmt. Sie heißt Kelsy Cotterell, und sie hasst Brittni wirklich, weil Brittni ihr den Freund ausgespannt hat. Und dann ist Brittni auch noch losgerannt und hat sich seinen Namen quer über die Brust tätowieren lassen. Dabei sieht das nicht mal besonders heiß aus, trotz ihrer Brust-OP«, sagte Farrah. »Brittni meint, nur weil sie mal Cheerleaderin war, wäre ihr die Welt was schuldig. Die Einstellung hat sie von Tante Charla, sagt meine Mutter, genauso wie ihren fetten Arsch.«
Brooke presste die Lippen aufeinander, um nicht laut über Farrahs treffende Bemerkung zu lachen. »Gut. Genug jetzt von Brittni. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch arbeiten. Du müsstest mal ins Netz gehen und etwas für mich recherchieren. Guck mal nach, was du über den Prozess Bundesstaat Georgia gegen Josephine Warrick herausfinden kannst. Druck alles aus und leg eine Akte an.«
»Josephine Warrick? Ist das nicht die alte Frau, der ganz Talisa gehört? Was ist mit der?«
»Sie hat mich gestern angerufen, wollte aber nicht sagen, um was es geht. Nur dass sie mich wegen einer rechtlichen Angelegenheit sprechen will. Ich muss gleich zu ihr rüber.«
»Wow! Eine neue Mandantin. Deshalb bist du heute so schick angezogen. Du siehst übrigens gut aus.«
»Danke«, sagte Brooke. »Und mir gefällt dein Nagellack. Wie heißt die Farbe?«
»Violet Femmes«, sagte Farah und hielt das Fläschchen hoch. »Willst du auch?«
»Nein, danke. Ich bleibe bei meiner Farbe. In meiner Branche darf man nicht zu auffällig herumlaufen.«
Am Morgen hatte Brooke statt ihrer lässigen Bürokleidung tief in den Kleiderschrank gegriffen und einen teuren maßgeschneiderten Hosenanzug in Dunkelblau hervorgeholt. Dazu trug sie eine weiße Seidenbluse, Perlenohrringe und schwarze Loafer von Tod’s aus Eidechsenleder, Überbleibsel ihrer Garderobe aus der Zeit in Savannah, für die sie in St. Ann’s üblicherweise nur wenig Verwendung fand.
»Diese alte Frau ist wirklich stinkreich, weißt du das?«, sagte Farrah.
»Ich glaube nicht, dass sie mir letztendlich ein Mandat erteilt. Auf dem Fachgebiet, in dem sie rechtliche Unterstützung braucht, kenne ich mich nicht aus.«
»Du bist doch Anwältin, oder? Warum sollte sie dich nicht nehmen?«
»Für den Job bin ich nicht ausreichend qualifiziert. Ich habe ein bisschen recherchiert, und demnach sieht es aus, als ob sie jemanden braucht, der sich mit Enteignung auskennt. Aber sie scheint eine eindrucksvolle Person zu sein, deshalb fahre ich trotzdem hin.«
»Schick mir ein paar Fotos vom Haus, ja? Ich war noch nie da drin. Jaxson und ich sind letzten Sommer mit dem Boot von seinem Bruder auf die Insel gefahren und waren oben in dem alten Leuchtturm, aber jetzt soll da ein bewaffneter Sicherheitsdienst rumlaufen.«
»Die Insel ist Privatbesitz. Halt dich mit deinen Freunden besser von ihr fern«, sagte Brooke und versuchte, ernst dreinzuschauen. »Es sei denn, du willst dir eine Zelle mit deiner Cousine teilen.«
»Schon gut.« Farrah stellte das Fläschchen Nagellack zur Seite und machte die Musik wieder an.
Umgehend drehte Brooke sie leiser. »Wer ist das überhaupt?«
Die Schülerin riss die Augen auf. »Soll das ein Witz sein? Hast du noch nie von Luke Bryan gehört?«
»Meine Playlist besteht momentan aus Kinderliedern und Gutenachtgeschichten.«
»Mannomann, du musst echt mal in diesem Jahrtausend ankommen«, sagte Farrah und rasselte ihre beliebtesten Country-Interpreten herunter. Dann unterbrach sie sich. »Hey, das Beste habe ich ja ganz vergessen!«
»Was denn?«
»Ich habe uns vielleicht neue Kundschaft besorgt. Jaxsons Mutter hat seinen Vater diese Woche wieder verlassen, dieses Mal angeblich für immer. Ich hab ihr deine Karte gegeben. Wenn sie dich mit der Scheidung beauftragt, bekomme ich dann so was wie eine Provision?«
Brooke lachte. »Wir müssen wirklich eine Möglichkeit finden, dich an der Uni von Georgia unterzubringen. So knallhart, wie du verhandelst.«
Gegen Mittag war es ruhig am städtischen Anleger. Es herrschte Ebbe, die meisten Fischer waren früh am Morgen rausgefahren. Möwen stießen kreischend nieder, um Winkerkrabben aufzupicken, die über den Schlick am Flussufer huschten. Zwei heruntergekommene Krabbenboote lagen knarzend an ihren Liegeplätzen am Ende des Hafenkais, zusammen mit einer Handvoll offener Flachbodenschiffe, wie sie die örtlichen Krabbenfischer bevorzugten. Entlang dem Kai hatten auch sieben oder acht glänzende neue Kajütboote und drei Segelboote festgemacht, doch die meisten größeren, teuren Schiffe fand man weiter oben an der Küste, auf St. Simon’s Island, wo sich die Reichen und Schönen tummelten.
Brooke schaute am langen Kai entlang und fragte sich, welches der Boote wohl Josephine Warrick gehörte.
Da ertönte ein gellender Pfiff. Sie drehte sich suchend um, wusste nicht, ob sie gemeint war.
Am Ende des Hafens entdeckte sie schließlich ein bescheidenes Boot in verblasstem Gelb, das auf dem Wasser schaukelte. Im Bug stand ein Mann und winkte ihr zu. Er legte die Hände um den Mund und rief: »Sind Sie Brooke?«
Sie nickte und eilte zu ihm.
Er war mager und hatte dünnes Haar, das er im Nacken zu einem struppigen grauen Zopf geflochten hatte. Der Mann hatte O-Beine und war dunkelbraun gebrannt. Ein offenes altes grünes Army-Hemd mit abgeschnittenen Ärmeln gab den Blick auf seine nackte Brust frei. Seine abgeschnittene Jeans hatte auch schon bessere Tage gesehen. Am Gürtel hing ein Holster mit einer großen Pistole. Brooke kannte sich nicht besonders gut mit Waffen aus, aber vermutete, dass es sich um eine 9 mm handelte.
Das Gesicht des Mannes lag im Schatten einer Baseballkappe voller Schweißflecken, seine Augen versteckten sich hinter einer billigen Pilotensonnenbrille. Trotzdem spürte Brooke die Intensität seines Blicks.
»Sind Sie C.D.? Von Talisa Island?«
»Richtig«, sagte er und hielt ihr die Hand hin. »C.D. Anthony, höchstpersönlich. Kommen Sie an Bord!«
Er bedeutete ihr, sich auf eine gepolsterte Bank im Heck zu setzen, dann machte er sich daran, die Leinen zu lösen.
»Startklar?«, fragte er. Ohne auf Brookes Antwort zu warten, legte er den Gang ein und entfernte sich gekonnt rückwärts vom Anleger.
Als das Boot ruhig durch die Hafenzone tuckerte, drehte er sich zu ihr um.
»Schöner Tag für eine Bootstour«, sagte er unvermittelt. »Waren Sie schon mal auf der Insel?«
»Vor sehr langer Zeit«, erwiderte Brooke.
»Glaube nicht, dass sich da viel verändert hat, egal, wie lange es her ist«, sagte er. »Sind Sie eine Freundin von Miss Josephine?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»Sie kriegt nicht viel Besuch. Haben Sie vielleicht geschäftlich mit ihr zu tun?«
Brooke wand sich unter seinem Blick. »So ähnlich.«
Er musterte sie eingehend. »Sind Sie Anwältin? Ja, Sie sehen wie eine Anwältin aus.«
»Gut geraten«, sagte Brooke in bemüht lockerem Tonfall. »Und Sie? Ich nehme an, Sie arbeiten für Mrs. Warrick, ja? In welcher Position?«
»Ich erledige alles, was so anfällt«, antwortete C.D. »Boot fahren, Autos reparieren. Lebensmittel auf dem Festland kaufen. Solche Sachen.«
»Schön.«
»Sie ist nicht gerade bei bester Gesundheit. Letzten Monat habe ich sie nach Jacksonville zum Arzt gebracht. Sie redet nicht gern drüber, aber ich glaube, es waren keine guten Nachrichten. Louette, das ist in Shellhaven sozusagen die Haushälterin, hat gesagt, Josephine würde kaum noch was essen. Logisch. Als ich hergekommen bin, war sie noch kräftig, aber jetzt ist sie richtig dürr. Wahrscheinlich der Krebs.«
Brooke fragte sich, was Josephine Warrick wohl davon hielt, dass ihr Angestellter mit einer völlig fremden Person über ihren Gesundheitszustand sprach.
»Wenn das stimmt, tut es mir leid«, sagte sie höflich.
Sie wandte sich ab, um C.D. zu signalisieren, dass das Gespräch für sie beendet war, und schaute zurück zum Festland. Es waren fünf Meilen bis Talisa, und Brooke hatte keine Lust, sich die ganze Zeit mit diesem Westentaschen-Popeye zu unterhalten.
Er verstand die subtile Andeutung und drehte den Motor auf, sobald das Boot den letzten Pfahl des Hafengebiets passiert hatte. Brooke musste sich mit beiden Händen festhalten. Nach wenigen Minuten war sie völlig durchnässt von der Gischt, die aufspritzte, wenn das kleine Fahrzeug ins nächste Wellental fiel.
Irgendwann entdeckte Brooke einen grünen Streifen am Horizont, und zehn Minuten später drosselte C.D. den Motor, um in einen schmalen Priel einzufahren. Als der Wasserweg breiter wurde, entdeckte Brooke einen langen Steg. Am Ende stand ein kräftiger Schwarzer mit vor der Brust verschränkten Armen. Neben ihm hockte ein Kind von acht oder neun Jahren mit einer Angelrute aus Rohr. Lange Dreadlocks mit Perlen reichten ihm bis auf die Schultern.
»Hey, Lionel!«, rief C.D. »Was gefangen?«
Der Junge schaute hoch und winkte. »Heute beißt keiner an. Darf ich bei dir mitfahren?«
»Geht nicht, Kumpel, tut mir leid. Vielleicht ein andermal.«
Als sie sich dem Steg näherten, legte C.D. den Leerlauf ein. Der Mann warf ihm vom Ufer aus eine dicke Leine zu, die C.D. an einer Klampe im Bug befestigte.
»Hallo«, sagte er dann und nickte Brooke höflich zu.
»Das ist Shug«, stellte C.D. ihn vor. »Der bringt Sie zum Haus rüber.« Er nestelte am Steuerpult herum.
Shug beugte sich vor und streckte die Hand nach Brookes Ellenbogen aus, um ihr den halben Meter vom Boot auf den Steg zu helfen.
»In Ordnung?«, fragte er. »Haben Sie alles?«
»Oh, nein!« Brooke wies auf die Bank im Heck. »Meine Tasche liegt da noch.«
C.D. brummte, holte die Tasche und warf sie genervt in Richtung Anleger. Shug fing sie gerade noch in der Luft auf, bevor sie ins Wasser fallen konnte.
»Viel Spaß!«, wünschte C.D. »Wenn Sie zurückwollen, sagen Sie Bescheid: Ich bin da.«
Ein uralter, verrosteter Ford-Pick-up in Meergrün stand am Ende des Kais inmitten einer bunten Sammlung von Schrottautos.
Brooke klopfte auf die abgerundete Motorhaube. »Wow! Wie alt ist das Schätzchen denn?«
»Hm, ich denke, der Wagen ist so Ende der Fünfziger gebaut worden«, erwiderte Shug und öffnete die Beifahrertür. »Ich weiß nur, dass Mr. Preiss Warrick ihn damals neu gekauft hat. Mr. Preiss ist schon lange tot, aber Miss Josephine hängt an den Sachen, die ihm gehört haben. Sie will, dass alles genauso bleibt, wie es war, als er noch lebte.«
Shug drehte den Schlüssel im Zündschloss und trat mehrmals aufs Gaspedal. Der Motor heulte auf und erstarb. Shug schüttelte den Kopf und wiederholte die Prozedur noch zweimal, ehe der Wagen ansprang. Kurz darauf rumpelten sie über die schmale Straße aus Muschelsplitt. Brooke schob den Kopf aus dem Fenster und bewunderte die Landschaft.
Die mit Moos behangenen knorrigen Lebenseichen links und rechts der Straße bildeten ein dichtes, fast undurchdringliches Dach aus grünem Laub. Durch die üppigen Palmettopalmen, Kanookas, Pinien und Zedern wanden sich Jasminranken und erfüllten die Luft mit ihrem schweren Duft. In einer Kurve entdeckte Brooke zwei Blaureiher, die in einem flachen Graben nach Essbarem suchten. Die nächste Kurve gab den Blick auf eine Marschlandschaft frei, in der sonnengebleichtes Treibholz und Kniewurzeln von Zypressen Dutzenden großer brauner Vögel Platz zum Nisten boten.
»Das sind Waldstörche.« Shug wies hinüber und grinste Brooke an. Sie schätzte ihn auf Mitte fünfzig. Er war von kräftiger Statur und hatte sehr muskulöse Arme. Gekleidet war er in eine gebügelte Jeans und ein kurzärmeliges blaues Arbeitshemd. »Wir haben hier jede Menge Vögel. Die Insel ist berühmt dafür. Sind Sie zum ersten Mal auf Talisa?«
»Jein«, sagte Brooke. »Ich war vor Ewigkeiten mal zu einem Pfadfinder-Zeltlager hier. Das war aber keine so schöne Erfahrung.«
»Sie waren bestimmt am anderen Ende der Insel«, vermutete Shug. »Da sieht es ganz anders aus.«
»Es ist wunderschön hier«, schwärmte Brooke. »So … so wild. Und friedlich. Wohnen Sie auch auf Talisa?«
»Jetzt ja. Louette, also meine Frau, die ist hier geboren und aufgewachsen. Früher haben wir mal in Brunswick gewohnt, wegen der Arbeit, aber dann wurden unsere Kinder groß und sind weggezogen, und ich hab meinen Job im Hafen verloren. Kurz darauf erzählte uns Louettes Schwester, die hier immer noch lebt, dass Miss Josephine eine Haushaltshilfe sucht. Wir sind hergekommen und haben mit ihr gesprochen, und seitdem sind wir hier. Müssten jetzt elf oder zwölf Jahre sein.«
»Mir war gar nicht klar, dass außer den Bettendorfs und Warricks noch andere Menschen auf der Insel leben.«
»Oh, doch! In Oyster Bluff gibt es eine ganze Siedlung von Schwarzen, die wurde schon direkt nach dem Bürgerkrieg gegründet. Auf der Insel war damals eine Plantage. Die haben die Yankees aber niedergebrannt, weil sie dachten, die Besitzer würden die Konföderierten heimlich mit Waffen versorgen. Später bekamen die ehemaligen Sklaven von der Regierung ein kleines Stück Land oben in Oyster Bluff. Wollte sonst keiner haben, das Land. Sumpfgebiet, die Leute hatten Angst vor Gelbfieber. Aber die Schwarzen haben sich da angesiedelt, lebten von der Hand in den Mund: Landwirtschaft, Fischen, Jagen. Die Schwarzen hier nennt man Geechees. Louettes Leute, das sind alles Geechees.«
»Und denen gehört das Land immer noch?«, fragte Brooke, fasziniert von diesem Kapitel der Geschichte Georgias, von dem sie nur wenig wusste.
»Nee«, erwiderte Shug. »Die Leute sind weggezogen und haben ihre Grundstücke an die Bettendorfs verkauft. Sie hatten zwar viele Kinder, aber keins wollte hier bleiben, da haben sie die Häuser einfach verlassen. Jetzt wohnen in Oyster Bluff höchstens noch zehn, zwölf Familien, und alles gehört Miss Josephine. Sie ist ja nett, verlangt nur ganz wenig Miete, aber das ist trotzdem nicht dasselbe, als wenn man selbst was besitzt, wissen Sie?«
»Das weiß ich nur zu gut«, erwiderte Brooke und dachte wehmütig an das bescheidene Häuschen mit den zwei Schlafzimmern in St. Ann’s, das sie gemietet hatte. Wie anders war da die komplett restaurierte dreistöckige Villa im mediterranen Stil in der historischen Altstadt von Savannah, auf die sie verzichtet hatte, als sie ihre Verlobung mit Harris Strayhorn löste.
Der Pick-up bog um die nächste Kurve, und vor ihnen erstreckte sich eine weite grüne Rasenfläche. Das Gras wuchs ungleichmäßig, überall sprossen Löwenzahn, Bärlauch und Wassernabel. Auf dem leicht abfallenden Gelände standen traurig wirkende Azaleen und Kamelien in terrassenförmig angelegten Beeten, die von Unkraut überwuchert waren. Eine Reihe Palmen verriet, dass man sich dem Anwesen der Familie Bettendorf näherte.
»Da wären wir!«, verkündete Shug und hielt an, damit Brooke aussteigen und sich umsehen konnte.
3.
Auf dem höchsten Punkt des Hangs stand eine wundersame rosa Hochzeitstorte von Villa, ein zweistöckiges Hauptgebäude mit maurisch angehauchten Rundbögen, zwei Türmchen auf dem Dach und einem breiten, zinnenbewehrten Balkon über dem Portal mit Wagenauffahrt. Rechts und links an das Haus schlossen zwei Flügel an, die fast genauso auffällig gestaltet waren. Vor jedem wachte eine hoch aufragende Palme. Das Dach war mit blassgrün gebrannten Tonziegeln gedeckt, die Brooke an den Zuckerguss eines Lebkuchenhauses erinnerten. Das Haus war geradezu überladen mit Bleiglasfenstern, schmiedeeisernen Balkönchen, schweren Stuckverzierungen und Schnörkeln. Ein dichter grüner Teppich aus Efeu zog sich über die Fassade, und eine dunkelrote Bougainvillea zierte den Balkon über dem Portal.
»Wow!«
»Hm«, machte Shug. Er ließ den Wagen wieder an, und im Näherkommen erkannte Brooke, dass die gewundene Auffahrt voller Schlaglöcher war, dass der rosafarbene Putz ausblich und bröckelte und im Dach große Lücken prangten, wo Dachpfannen kaputt waren oder fehlten.
Shellhaven sackte so langsam und unerbittlich in sich zusammen wie eine alte Torte.
»Sieht nicht mehr richtig gut aus«, sagte Shug betrübt. »Ich kümmere mich um alles, so gut ich kann, aber ich bin der Einzige. Früher hatten wir drei Mann allein für das Grundstück. Einer war nur für die Rosen zuständig. Wir hatten einen Traktor zum Rasenmähen und einen Obstgarten mit den schönsten Apfelsinen, Zitronen und Pampelmusen, die man sich vorstellen kann. Natürlich Pfirsiche und Pekannüsse. Es gab sogar ein Treibhaus, da wurden Blumen und Orchideen fürs Haus gezogen. Davon ist nichts mehr da. Eine Pinie ist aufs Treibhaus gefallen, und die Obstbäume haben irgendeine Krankheit bekommen, Mehltau oder so. Vielleicht besser so, weil es heutzutage kaum noch jemand gibt, der hier draußen leben und ehrliches Geld verdienen will. Außerdem hat Miss Josephine die Dollars nicht gerade locker sitzen.«
Wenn Josephine Warrick wirklich so reich war, wie erzählt wurde, dann fragte sich Brooke, warum die Frau ihr Anwesen derart verfallen ließ.
»Sie tun bestimmt Ihr Bestes, und Miss Warrick ist Ihnen sicherlich sehr dankbar«, sagte Brooke höflich.
Shug hielt unter dem Balkon und wies auf die geschnitzten schweren Flügeltüren des Portals. »Gehen Sie rein! Louette wartet schon. Sie bringt Sie zu Miss Josephine.«
Brooke schob die Tür auf und trat vorsichtig ein. Im ersten Moment konnte sie nichts sehen. Sie musste warten, bis sich ihre Augen vom grellen Sonnenlicht an die Dunkelheit des Eingangsbereichs gewöhnt hatten.
Im schwachen Licht einer nackten Glühbirne in einem angelaufenen Messingwandhalter konnte sie einen hohen Raum mit schwarz-weißen Bodenfliesen, Rissen in den verputzten Wänden und vom Alter nachgedunkelten Holzbalken unter der Decke ausmachen. Der Kristalllüster, der in einem schmuckvollen Stuckmedaillon hing, war mit Spinnenweben und Staub überzogen. Die Luft war drückend.
»Hallo?« Brookes Stimme hallte durch das leere Foyer.
»Ich komme!«, rief eine Frau aus der Dunkelheit. Kurz darauf eilte eine Angestellte herbei, die Louette sein musste. Sie wirkte jünger als ihr Mann. Ihr kurzgeschnittenes Haar war nur leicht ergraut, sie hatte Sommersprossen, und ihr karamellbrauner Teint war zwei Töne heller als der ihres Mannes. Louette hatte eine gemütliche Figur mit den Rundungen der mittleren Lebensjahre und trug einen weißen Synthetikkittel.
»Miss Brooke? Ich bin Louette. Sind Sie gut angekommen? Ist C.D. auch nicht zu schnell über den Fluss gefahren?« Ihr Akzent hatte einen angenehmen Singsang.
»Hat ein bisschen geruckelt, aber ich habe es heil hierher geschafft«, sagte Brooke.
»Tja, wir kriegen nicht mehr viel Besuch, und Miss Josephine ist schon ganz aufgeregt, Sie zu sehen, deshalb bringe ich Sie am besten gleich zu ihr.«
Sie gab Brooke ein Zeichen, ihr durch einen breiten Flur zu folgen. Bogentüren führten rechts und links in zwei Salons, eingerichtet mit dicken Sofas und gepolsterten Stühlen, schweren Tischen und Truhen voller Schnitzereien.
Vor einer verschlossenen Tür am Ende des Flurs blieb Louette stehen. »Dies war früher die Bibliothek, aber Miss Josephine kann keine Treppen mehr steigen, deshalb haben Shug und ich hier ein Schlafzimmer für sie eingerichtet. Sie hört nicht mehr sehr gut, Sie müssen etwas lauter sprechen, und sie ist sehr krank, deshalb achten Sie bitte darauf, dass Miss Josephine sich nicht übernimmt. Aber glauben Sie nicht, dass sie nicht mehr ganz richtig im Kopf ist oder so, nur weil sie fast hundert Jahre alt ist. Von wegen! Miss Josephine entgeht so gut wie nichts.«
Louette klopfte an die Tür, wartete kurz und schob den Kopf hinein. »Miss Josephine? Ihr Besuch ist da. Soll er hereinkommen?«
»Ist das die Anwältin, die ich bestellt habe? Bringen Sie sie zu mir, Louette!«
Die Bibliothek von Shellhaven musste einst ein prächtiger Raum gewesen sein. Jetzt hatte die dunkle Mahagonivertäfelung ihren Glanz verloren, die Vorhänge an den Fenstern waren verschossen und fransig. An drei Wänden standen Regale, vollgestopft mit Büchern und den auffälligen strahlend gelben Heftrücken des National Geographic. Auf jeder verfügbaren Fläche sammelte sich Nippes: Vogelnester, sonnengebleichte Muscheln, Korallenstücke, sogar der vergilbte Kieferknochen eines Hais. Ein ausgestopfter Rotfuchs auf einem Podest in der Nähe des Fensters riss fauchend den Fang auf. Sein gelbes Fell rieselte auf den Boden aus dunklem Pinienholz. Das ein Meter fünfzig lange Skelett eines Alligators lag auf einem der eingebauten Bücherregale, daneben drängten sich große Apothekergläser mit Haifischzähnen, Strandglas und etwas, das wie kleine Vogelschädel aussah.
In der hinteren Ecke stand ein Krankenbett, teilweise verdeckt von einem dreiteiligen Paravent mit chinesischem Muster.
Eine Klimaanlage surrte in einem der beiden geöffneten Fenster, aber konnte weder die Hitze noch den Geruch von Desinfektionsmittel vertreiben.
Die Dame des Hauses saß in einem braunen Liegesessel. Brooke hatte mit einer etwas schmaleren Version der waffenschwingenden kühnen Erbin im Nerz gerechnet, die sie in der Southern Living gesehen hatte, aber die Jahre waren ebenso grausam zu Josephine Warrick gewesen wie zu ihrem Haus.
Die wallende weiße Mähne war einer dunkelblauen Baseballkappe gewichen, die den fast kahlen Kopf nicht recht verdecken konnte. Blasse Haut voll brauner Altersflecke zog sich über die vorstehenden Kieferknochen und das spitze Kinn. Die schmalen Lippen waren blutleer. Buschige weiße Brauen spannten sich über dunkle Augen hinter einer übergroßen Brille mit gelben Gläsern. Die Augen musterten Brooke aufmerksam, als sei auch sie ein Ausstellungsstück.
Bei ihrer kurzen Recherche hatte Brooke Dutzende Fotos von Josephine Warrick gesehen. Sie war einst eine auffällige Erscheinung gewesen, bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt eine ernste, schlanke Debütantin mit der gewellten Kurzhaarfrisur jener Zeit, in den Fünfzigern dann eine attraktive Braut, aus der in späteren Jahren eine eindrucksvolle, langgliedrige Dame wurde, die sich nichts vormachen ließ. In den Klatschspalten der Zeitungen von Savannah, Atlanta und Palm Beach war Josephine Bettendorf Warrick in Golfkleidung, Tennissachen und teuren Designerkleidern abgebildet gewesen, aber auch in Jagdausrüstung, einen Fuß auf einem erlegten Hirsch.
Die Frau, die in dem Sessel aus rissigem Vinyl unter einem Berg von Strickdecken und Überwürfen saß, wog vielleicht noch vierzig Kilo. Eine Sauerstoffflasche stand neben dem Sessel, zwei dünne Plastikschläuche hingen an der durchsichtigen Atemmaske auf ihrem Gesicht.
»Hallo, Mrs. Warrick!«, sagte Brooke nach dem ersten Schock. »Ich bin Brooke Trappnell.« Sie wollte auf den Sessel zugehen.
»Grrrr.«
Erschrocken hielt sie inne. Sie hatte die zwei Hunde übersehen, die auf dem Sessel saßen. Sie waren sehr klein und hatten fast dieselbe Farbe wie die Decke.
»Grrrr.«
Die beiden Mini-Chihuahuas wollten ihr Frauchen verteidigen; sie stellten die Nackenhaare auf und fletschten die Zähne.
»Ruhig, Teeny und Tiny!« Die alte Frau streichelte den beiden über den Rücken und tätschelte ihre Köpfe. »Kümmern Sie sich nicht um sie«, sagte sie zu Brooke. »Die tun nichts. Nur, wenn ich es ihnen sage. Setzen Sie sich dort hin!« Sie wies auf einen ausgeblichenen Ohrensessel mit Chintzbezug. »Und Sie brauchen mich nicht Mrs. Warrick zu nennen. ›Josephine‹ reicht völlig, und ich sage Brooke zu Ihnen, wenn Sie einverstanden sind. Die Ärzte prophezeien mir die ganze Zeit, ich würde taub, aber das bin ich noch nicht. Die Leute haben sich nur angewöhnt, vor sich hin zu murmeln. Sie sprechen nicht mehr klar und deutlich.« Die alte Frau warf Brooke einen prüfenden Blick zu. »So eine sind Sie doch nicht, oder? Leute, die sich was in den Bart nuscheln, kann ich nämlich nicht ausstehen.«
Brooke setzte sich und balancierte ihre Aktentasche auf den Knien. »Nein, Ma’am«, sagte sie laut. »Ich habe viele Fehler, aber der gehört nicht dazu.«
»Sie haben doch keinem verraten, warum Sie heute hier sind, oder?«
»Nein, Sie haben mir ja auch noch nicht anvertraut, warum Sie mich sprechen wollen.«
Die alte Dame schmunzelte. »Sie waren neugierig auf mich und diese Insel, deshalb sind Sie gekommen. Habe ich recht?«
»So ungefähr.«
»Dann kommen wir mal zur Sache, ja? Wie Sie an meinem jämmerlichen Aussehen erkennen können, habe ich nicht mehr viel Zeit für höfliches Geplauder.«
»Ihre Haushälterin hat erzählt, dass Sie krank sind. Das tut mir leid.«
»Louette macht gerne mehr daraus, als es ist. Ich habe zu lange und zu viel geraucht, habe schon seit einigen Jahren COPD. Jetzt ist es in Lungenkrebs umgeschlagen, das ist schon etwas anderes. Ich habe Bestrahlungen bekommen, aber bei Chemo ist bei mir Schluss. So viel dazu. Sprechen wir über etwas anderes, in Ordnung?«
»Natürlich.«
»Wissen Sie irgendwas über diese Insel, Brooke?«
»Nach Ihrem Anruf habe ich ein wenig recherchiert, außerdem war ich als Kind mal kurz hier, zum Zelten.«
»Am anderen Ende der Insel, das die Erben der elenden Cousins dem Staat Georgia 1978 für ein paar Pennys verkauft haben«, sagte Josephine und schüttelte den Kopf. »Wenn die mir das angeboten hätten, hätte ich zugegriffen.«
»Warum haben sie das nicht getan?«
»Böses Blut. Wir hatten uns jahrelang wegen des Grenzverlaufs in den Haaren, dann ein alberner Kleinkrieg wegen Wasserrechte und solcher Sachen.« Josephine zuckte mit den Schultern. »Außerdem habe ich gehört, dass sie Geld brauchten. Wie Sie vielleicht wissen, hat mein Vater, Samuel Bettendorf, zusammen mit zwei Cousins die Insel 1912 gekauft.« Josephine wies auf die Bücherregale. »Da liegt irgendwo noch die Abschrift des alten Kaufvertrags. Jeder hat zehntausend Dollar gezahlt. Das klingt heute nicht mehr viel, aber damals entsprach das einer Summe von 2,4 Millionen pro Person. Meine Mutter mochte den kalten Bostoner Winter nicht, deshalb kaufte mein Vater die Insel und baute schließlich dieses Haus. Die Frauen seiner Cousins wollten nicht an einem so abgelegenen Ort wie Talisa leben, deshalb teilten die drei das Land irgendwann auf. Mein Vater entschied sich für diesen Teil der Insel. Seine Cousins bekamen mehr Fläche, was anderes interessierte sie nicht. Mein Vater hat ihnen nach und nach noch Teile abgekauft und immer das behalten, was wichtig war: dieses Gebiet. Es ist hoch gelegen, hat Zugang zum Meer und die einzige Süßwasserquelle auf der Insel.«
»Sehr klug von ihm«, bemerkte Brooke.
»Er war wirklich brillant«, bestätigte die alte Frau. »Sein Geld hat er mit den Schiffen der Reederei verdient, aber interessiert hat er sich für alles: Naturwissenschaften, Jura, Literatur, Kunst. Er hat darauf bestanden, dass ich aufs College ging. Das war damals für Mädchen nicht üblich.« Sie seufzte. »Er war so gerne hier. Er mochte das Klima, die Tierwelt, die Ruhe. Deshalb muss ich sein Vermächtnis bewahren.« Josephine machte eine ausholende Armbewegung. »Talisa zu schützen, die Insel zu erforschen und ihre Schönheit zu verstehen – das war sein Lebensinhalt. Und als ich Preiss heiratete, haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht.« Ihre Stimme wurde rau. »Deshalb habe ich all die Jahre so hart darum gekämpft, dass der Staat mein Land nicht bekommt!«
Brooke öffnete ihre Aktentasche und holte einen gelben Notizblock und einen Stift heraus. »Ich hatte nicht viel Zeit zum Recherchieren, aber ich habe gelesen, dass Ihre Anwälte aus Atlanta die Angebote des Staates bisher immer zurückgewiesen haben.«
»Der Staat hat den Campingplatz gebaut, wo Sie gezeltet haben, er hat die Straßen asphaltiert, und dann hat er einige der ältesten Bäume fällen lassen, um noch einen Campingplatz, Holzhütten und ein fast tausend Quadratmeter großes Konferenzzentrum zu bauen. Können Sie mir verraten, warum Talisa ein Konferenzzentrum braucht?«
»Vielleicht als Treffpunkt?«, mutmaßte Brooke.
»Diese Fährverbindung, die der Staat Georgia eingerichtet hat, geht viermal am Tag hin und her«, krächzte Josephine. »Hunderte von Besuchern trampeln hier herum, lassen Plastikverpackungen vom Essen, Bierdosen und schmutzige Windeln liegen. Das ist eine Schweinerei. Die Menschen sind Schweine!«
»Wie ist der aktuelle Stand, was die Verhandlungen angeht?«, fragte Brooke.
»Das letzte Gebot vor fünf Jahren war genauso hoch wie die Summe, die sie meinen Cousinen vor fast vierzig Jahren gezahlt haben«, antwortete Josephine verbittert. »Das ist eine Beleidigung. Als ich ablehnte, ließ der Staat mir offiziell mitteilen, dass ich enteignet würde. Zum öffentlichen Wohl.« Angewidert verzog sie die Lippen. »Die Öffentlichkeit hat kein Recht, über dieses Land zu laufen. Das erlaube ich nicht.«
»Und was glauben Sie, wie ich das verhindern kann?«, fragte Brooke. »Sie werden doch bereits von der besten Anwaltskanzlei in Atlanta vertreten.«
»Ich will aber Sie«, sagte Josephine.
»Warum? Sie kennen mich doch gar nicht.«
»Ich habe Ihre Karriere in der Zeitung verfolgt. Sie haben Mumm. Ich brauche jemanden mit Mumm. Außerdem haben Sie doch die Nationalparkverwaltung verklagt, oder?«
»Und verloren«, ergänzte Brooke.
»Aber Sie haben sich drei Jahre mit Händen und Füßen gewehrt, haben diese Ratten so richtig weichgekocht.«
»Eigentlich nicht. Gerade Sie müssten doch wissen, wie das ist. Die Nationalparkverwaltung hat argumentiert, dass Loblolly, das Haus meiner Familie auf Cumberland Island, rechtswidrig gebaut sei. Deshalb wurde es abgerissen. Und wir dürfen nichts Neues hinbauen.«
»Und genau aus diesem Grund müssen Sie meinen letzten Kampf ausfechten«, sagte Josephine. »Ich bin nicht mehr lange da. Aber ich weiß, was die da oben im Schilde führen. Ich kenne ihren geheimen Bebauungsplan. Als Erstes werden sie dieses Haus abreißen. Das kann ich nicht zulassen. Ich kann nicht sterben, wenn ich weiß, dass hier alles kaputt gemacht wird. Unsere jahrelange Arbeit.«
»Shellhaven soll abgerissen werden? Warum sollte der Staat das tun?«
»Sie sehen ja, in welchem Zustand es ist. Die Restaurierung würde Millionen kosten. Es ist deutlich billiger, es einfach abzureißen und noch ein paar Blockhütten oder ein Konferenzzentrum zu bauen. An meinen privaten Anleger soll eine große Marina hingesetzt werden – wir haben hier den einzigen tiefen Zugang auf der Insel.«
Brooke schaute auf die paar Zeilen, die sie sich notiert hatte. »Josephine, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich Ihnen helfen kann. Ja, ich bin Anwältin, aber dies ist wirklich nicht mein Fachgebiet.«
»Es ist allgemein bekannt, dass ich krank bin«, fuhr Josephine fort, ohne auf Brookes Einwand einzugehen. »Die waren schon hier, haben herumgeschnüffelt. Vor ein paar Wochen hat C.D. ein ganzes Schiff voller Leute vertrieben. Vermessungsingenieure, haben sie gesagt. Die hatten schon an unserem Anleger festgemacht, als C.D. mit den Einkäufen vom Festland zurückkam. Er hat ein paar Warnschüsse in die Luft abgegeben, da sind sie abgehauen. Aber die kommen wieder.«
Brooke schüttelte entsetzt den Kopf. »Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war.«
»Die haben mein Privatgrundstück widerrechtlich betreten! Solange ich lebe, bleibt das hier ein Privatgrundstück. Die haben kein Recht darauf, hier herumzuschnüffeln! Ich will das geklärt haben, bevor ich zu krank bin, um mich zu wehren.«
»Und wie wollen Sie das anstellen?«, fragte Brooke.
»Ich will, dass mein Land und mein Haus geschützt sind, in einer Stiftung oder so, egal wie, damit niemand, und ich meine wirklich niemand, auf diesem Teil der Insel bauen oder das Haus abreißen kann.«
»Wer wäre denn der Begünstigte einer solchen Stiftung?«, fragte Brooke. »Haben Sie Familie?«
Die alte Dame lehnte den Kopf an und schloss die Augen. »Nicht richtig. Mein Bruder Gardiner ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Preiss und ich hatten keine Kinder.« Sie lächelte kurz. »Wollten keine. Ich habe erst mit Mitte dreißig geheiratet. Er war sechs Jahre jünger als ich. Das wussten Sie bestimmt nicht, was? Nein, ich habe andere im Sinn. Meine Freundinnen. Meine ältesten, liebsten Freundinnen. Die Mädchen vom geheimen Schwimmclub.«
4.
Ruth hatte die Idee, den alten Packard meines Vaters »auszuleihen« und damit die Insel zu erkunden. Mit dreizehn war sie die Älteste, unsere Anführerin. Ich war noch zwölf, Millie die Jüngste. Sie hatte erst in der letzten Augustwoche Geburtstag. Das war der Abend, an dem der geheime Schwimmclub gegründet wurde.
Unser Internat hatte Frühjahrsferien, wir waren mit dem Zug von Boston gekommen. Gute fünf Tage später würde der Rest unserer Familien folgen.
Da wir das Haus fast für uns hatten und meistens unbeaufsichtigt waren, verbrachten wir die Woche damit, Radio zu hören, endlos Canasta zu spielen und uns abwechselnd die anzüglichen Stellen aus Lady Chatterleys Liebhaber vorzulesen, das wir in der Wäscheschublade meiner Mutter gefunden hatten.
Es war der Abend, bevor meine Eltern mit Gardiner kamen.
»Mir ist langweilig. Kommt, wir fahren mit dem Auto!« Ruth sprang auf und lief die Treppe hinunter. Millie und ich folgten ihr. Wir liefen bis in die Scheune, in der früher Rennpferde gestanden hatten. Jetzt beherbergte sie Papas »Inselautos« – eine unansehnliche Sammlung von Automobilen, die zu Hause in Boston nicht mehr vorzeigbar, aber immer noch gut genug für Talisa waren.
Ruth setzte sich sofort hinters Lenkrad des Packard. Früher, als Mama damit immer einkaufen gefahren war, hatte der schwarze Lack geglänzt, die Chromteile hatten geblitzt, und das Lederpolster war weich gewesen. Jetzt war die Windschutzscheibe kaputt, die Stoßstangen waren eingedellt. Das Leder war rissig, das Chrom fleckig von der salzigen Seeluft.
»Was glaubst du, was du da machst?« Die Hände in die Hüften gestemmt, stand ich vor den leuchtenden Scheinwerfern des Autos. Irgendwie war es Ruth gelungen, den Motor anzulassen. Sie drückte so heftig auf die Hupe, dass Millie und ich zusammenfuhren und ein Huhn zeternd von einem Deckenbalken auf den mit Sägemehl bedeckten Boden flatterte.
»Kommt!«, rief Ruth und drückte wieder auf die Hupe.
»Aber … aber …«, stotterte Millie. »Du kannst doch gar nicht fahren! Du bist nicht alt genug.«
»Und ob ich alt genug bin«, gab Ruth zurück. »Ich fahre schon seit Ewigkeiten Auto. Meine Schwester Rose hat es mir beigebracht.«
Das reichte mir. Ich zog die Tür auf und setzte mich auf den Beifahrersitz.
Millie sah uns ungläubig an und versuchte, uns zur Vernunft zu bringen. »Was ist, wenn das jemand rausfindet? Dann bekommen wir mächtig Ärger.«
Ruth kramte im Handschuhfach herum, dann schaute sie genervt hoch. »Pah! Wer soll uns denn verpetzen? Wir haben die ganze Insel für uns.«
»Das stimmt nicht«, entgegnete Millie. »Mrs. Dorris ist da, die anderen Angestellten auch, dann die Leute vom kleinen Lädchen und der Mann, der uns mit dem Boot übergesetzt hat …«
»Mrs. Dorris geht um sieben ins Bett, und die übrigen Dienstboten kümmern sich besser um ihren eigenen Kram, sonst sage ich Papa, dass er sie entlassen soll«, verkündete ich großspurig, obwohl ich das niemals getan hätte. Mein Vater würde ohnehin nie jemandem kündigen, nur weil ich das verlangte, aber das konnte Millie ja nicht wissen.
»Guckt mal hier!«, rief Ruth. Sie hielt eine durchsichtige Halbliterflasche mit einer bräunlichen Flüssigkeit hoch. »Schnaps!«
»Ruth Mattingly, wag es nicht!«, sagte Millie.
Da musste Ruth die Flasche erst recht öffnen. Sie roch daran und trank einen Schluck. Sofort hustete und würgte sie, wischte sich den Mund mit dem Handrücken ab und reichte die Flasche an mich weiter. Ich tat so, als würde ich trinken, und verstaute den Schnaps dann schnell unter dem Beifahrersitz.
»Kommst du jetzt mit, oder was?«, fragte Ruth. »Schisshase!«
Kaum war Millie eingestiegen, da hatte Ruth bereits den Rückwärtsgang eingelegt, trat aufs Gas und schoss rückwärts aus der Scheune.
»Halt!«, rief Millie. Der Packard ruckelte über den schmalen geteerten Weg, der von den Insulanern »Dixie Highway« genannt wurde. Ruth lachte nur und gab noch mehr Gas. Unsere Haare wurden vom Wind herumgepeitscht, die Scheinwerfer leuchteten gelblich weiß in der Tintenschwärze.
»Wo sollen wir hinfahren?« Ruth sah mich fragend an. Sie war erst zum zweiten Mal auf Talisa, ich hingegen kannte die Insel wie meine Westentasche, weil ich seit meiner Kindheit herkam.
Plötzlich hatte ich eine famose Idee. Ich zeigte nach vorn, zur nächsten Gabelung, wo eine große Lebenseiche mit drei Stämmen stand. »Bieg da mal links ab! Wir fahren zum Mermaid Beach.«
Ohne auf die Bremse zu treten, riss Ruth das Lenkrad so heftig nach links, dass wir beinahe von der Straße abgekommen wären. Ein tief hängender Ast kratzte über das Dach und die rechte Seite des Packard. Ein langer Streifen spanischen Mooses landete auf Millies Schoß.
»Hey!«, protestierte ich. »Wir sind beinahe im Graben gelandet!«
Ruth lachte nur hämisch.
Millie hielt sich mit beiden Händen am Armaturenbrett fest. »Pass auf! Da vorne ist was auf der Straße.«
Ruth trat auf die Bremse. Vor uns watschelte ein anderthalb Meter langer Alligator mit gelblich funkelnden Augen über den Asphalt. Wie versteinert sahen wir zu.
Millie schrie laut, es hallte in der schweren Nachtluft wider. Dann fuhr Ruth weiter.
Ohne Vorwarnung war die Asphaltdecke zu Ende, und wir fanden uns in der wildesten Ecke unserer wilden Insel wieder. Der Weg war nur noch ein schmaler Pfad aus zerdrückten Muscheln. Palmettopalmen, Wachsmyrte und Eichen drängten sich dem Packard entgegen; die Palmwedel schlugen an die Seiten.
»Wo sind wir?« Millie griff bang nach meiner Hand. Ich umklammerte sie fest, gab mich mutiger, als mir zumute war, zum einen, weil ich noch nie zuvor abends am Mermaid Beach gewesen war, aber vor allem, weil meine dreizehnjährige Freundin den Wagen meines Vaters fuhr. Nachts, im Dunkeln.
»Dauert nicht mehr lang«, sagte ich und wies auf eine Stelle hundert Meter weiter, wo der Weg hinter einem grünen Vorhang zu verschwinden schien.
»Wir stellen das Auto hier ab!«, sagte ich zu Ruth. »Den Rest müssen wir zu Fuß gehen.«
Doch sie hielt erst, als sich der Packard in einem Gewirr aus Glyzinienranken und Ackerwinde verfing.
Als wir vorsichtig ausstiegen, regnete es Blätter und Zweige auf unsere Köpfe.
»Mir gefällt es hier nicht«, sagte Millie und umklammerte den Türgriff. »Ich rühre mich nicht von der Stelle.«
»Wie du willst.« Ruth setzte sich als Erste in Bewegung. Mit einem dicken Ast, den sie auf dem Boden gefunden hatte, stocherte sie im Unterholz herum. »Haut ab, ihr Schlangen!«
»Komm!«, drängte ich Millie und nahm ihre Hand. »Es ist nicht mehr weit.«
Schwüle Luft nahm uns in Empfang. Als wir uns durch die Ranken schoben, stiegen regelrechte Mückenschwärme auf.
»Aaargh!«, rief Millie.
Die Insekten waren in unseren Haaren, im Mund, in der Nase.
»Lauft, schnell!«, forderte ich die anderen auf. Zu dritt rannten wir durch den grünen Vorhang zum Wasser. Ich hoffte, dass die Bucht dort war, wo ich sie vermutete, nachdem ich sie mit meinem Bruder Gardiner immer nur tagsüber besucht hatte.
An der Stelle, wo sich der Weg zu einer silbern schimmernden Welt öffnete, blieb Ruth stehen.
Sie breitete die Arme aus, als wollte sie die Schönheit der Bucht umarmen.
»Wow!«, stieß sie aus.
Atemlos kamen Millie und ich zum Stehen.
Der breite Sandstrand reichte bis zum Atlantik hinunter. Ein großer Vollmond leuchtete am samtschwarzen Himmel. Es war Hochwasser. Die silbrigen Wellen brachen sich nur wenige Zentimeter vor unseren Füßen.
»Was ist das für ein magischer Ort?«, fragte Ruth. Sie schlüpfte aus den Schuhen und grub die Zehen in den kühlen weißen Sand.
»Wir nennen ihn Mermaid Beach«, erwiderte ich und ließ mich in den Sand fallen, um meine Schnürsenkel zu öffnen.
»Wunderschön!«, sagte Millie. Sie legte den Kopf in den Nacken und schaute hoch in den Himmel. »Habt ihr schon mal so einen schönen, großen Mond gesehen?«
»Das ist ein rosa Mond«, erklärte ich meinen Freundinnen und fühlte mich wichtig, so etwas zu wissen. »Ich glaube, den gibt es nur ein-, zweimal im Jahr.«
Ich schielte zu Ruth hinüber, weil ich damit rechnete, dass sie widersprach oder sich über mich lustig machte, doch zu meiner Verwunderung fing sie an, ihre Baumwollbluse aufzuknöpfen. Sie ließ sie in den Sand fallen und öffnete den karierten Rock, den sie am Morgen angezogen hatte. Auch er fiel in den Sand.
»Was machst du da?«, fragte ich.
»Ich gehe schwimmen«, erwiderte sie und beugte sich vor, um den BH aufzuhaken, den sie erst seit dem Frühjahr trug.
»Du hast aber keinen Badeanzug dabei«, bemerkte Millie.
»Brauche ich auch nicht. Ich habe mein Evakostüm an.« Ruth legte den BH ab, dann war ihr Slip an der Reihe. Sie tänzelte auf die Wellen zu und wackelte dabei mit dem nackten Hintern, wie wir es bei den Mädchen vom Tingeltangel gesehen hatten, wenn in der Stadt Jahrmarkt war. Über die Schulter sah sie sich nach uns um. »Kommt, ihr Angsthasen!«
Mir war warm, ich schwitzte und spürte, wie die juckenden Mückenstiche auf meinem Gesicht und den Armen anschwollen. Schnell zog ich mir das Kleid über den Kopf und legte den Schlüpfer und das eklige Baumwollhemdchen ab, das meine Mutter mir immer aufzwang. Dann war ich splitterfasernackt. Die Brise zerzauste meine Haare. Ich schaute zu Millie hinüber, die schamhaft den Blick senkte.
»Komm, Millie!«, forderte ich sie auf. »Das ist echt schön!«
»Ich kann das nicht«, flüsterte sie.
Ruth hüpfte und sprang in den Wellen herum. Sie zog die Nadeln aus ihren langen roten Haaren und ließ sie auf ihre knospenden Brüste fallen. »Guckt mal, Josie, Millie! Ich bin eine Meerjungfrau!« Sie tauchte unter und strampelte mit den Beinen.
»Ich komme!«, verkündete ich und sprang mit Anlauf in die Brandung. Noch nie hatte ich mich so frei und verwegen gefühlt. Das Wasser war warm wie in der Badewanne. Ich ließ mich auf dem Rücken treiben, schaute hinauf in den samtigen Himmel, zu den Tausenden von Sternen und dem tiefstehenden rosa Mond. Die Flut trug mich zurück ans Ufer, und als mein nackter Po den Meeresboden streifte, drehte ich mich um und schaute zum Strand. Millie hockte im Sand, die Knie an die Brust gezogen. Sie sah so traurig aus.
»Wenn du nicht sofort reinkommst, spreche ich nie wieder mit dir!«, rief ich.
»Und ich sage Du-weißt-schon-wem, dass du in ihn verliebt bist.« Ruth lief auf Millie zu und spritzte sie nass.
»Hör auf, Ruth!«
Ich tat es ihr nach, und innerhalb kürzester Zeit war Millie patschnass. Widerwillig musste sie lachen.
»Ach, was soll’s«, sagte sie schließlich, zog ihr Kleid aus und lief kreischend in die Wellen. Ihre Unterwäsche behielt sie an.
»Das ist ungerecht«, sagte Ruth und spritzte Millie wieder nass. »Wir haben beide nichts mehr an.«
»Stimmt«, bestätigte ich. »Du kannst nicht in unserem Club sein, wenn du nicht absolut splitterfasernackt bist.«
Millie tauchte so weit unter, dass nur noch ihr Kopf und ihre Schultern zu sehen waren. »So was Dämliches«, murrte sie. Dann schoss sie hoch und warf ihre Unterwäsche an den Strand.
»Siehst du? Fühlt sich das nicht herrlich an?«, fragte Ruth.
Millie warf sich ins Meer und kam wieder hoch. Mit gespitzten Lippen prustete sie einen Wasserstrahl heraus, wie der Brunnen im Garten unserer Schule. Sie schüttelte den Kopf, die Tropfen spritzten in alle Richtungen. »Ja! Stimmt. Das ist wunderbar!«
Und dann lachten wir und spritzten uns nass, ließen uns treiben und schwammen, bis unsere Arme und Beine so müde waren, dass wir kaum noch ans Ufer kamen. Anschließend lagen wir rücklings im Sand und schauten zum Mond empor. Unsere Fingerspitzen berührten sich fast.
»Du hast gesagt, wir wären ein Club.« Millie setzte sich auf und suchte nach ihrer Kleidung. »Jetzt gehöre ich auch dazu. Schließlich habe ich nackt gebadet. Wie heißt unser Club denn?«
»Hm.« Ruth fand Millies zusammengeknülltes Kleid und warf es ihr zu.
»Der geheime Schwimmclub«, schlug ich vor.
»Genau!«, bestätigte Ruth. Sie fand ihren Rock und holte ein Päckchen aus der Tasche, aus dem sie eine Zigarette und ein Streichholzbriefchen klopfte.
»Ruth Mattingly! Ich wusste nicht, dass du rauchst!«, staunte Millie mit großen Augen.
»Klar rauche ich«, sagte Ruth lässig und hielt uns die Packung hin. »Auch eine?«
»Nein, danke«, sagte Millie.
Ich schüttelte den Kopf. Ruth zuckte mit den Schultern, zündete sich eine Zigarette an, atmete tief ein, legte den Kopf in den Nacken und formte mehrere perfekte Rauchkringel.
»Welche Regeln hat unser Club?«, fragte Millie und zog sich an.
»Also, vor allem müssen wir nackt baden«, sagte Ruth. Sie schnippte die Asche in den Sand, zog wieder an der Zigarette und reichte sie mir. Ich zögerte, dann nahm ich auch einen kleinen Zug. Er brannte in der Lunge. Ich hustete und gab ihr die Zigarette zurück.
»Aber nur bei Vollmond«, sagte Millie. »Das ist einfach viel herrlicher.«
»Und bei Hochwasser«, fügte ich zwischen zwei Hustenanfällen hinzu.
»Nächstes Mal in diesem Sommer«, sagte Ruth, »seid ihr alle in unser Haus in Newport eingeladen.« Sie fuchtelte mit ihrer Zigarette vor unseren Gesichtern herum.
»Also, vergesst euer Evakostüm nicht!«
5.
Josephine schloss die Augen. Ihr fiel das Kinn auf die Brust, kurz darauf schnarchte sie leise, und die Chihuahuas drückten ihre Schnäuzchen in die Armbeugen ihres Frauchens. Brooke wartete taktvoll. Ob sie nun gehen sollte?
Sie erinnerte sich an Louettes Mahnung, Josephine nicht zu überanstrengen, verstaute leise ihre Notizen in der Aktentasche und schlich auf Zehenspitzen zur Tür.
Josephine öffnete die Augen. »Wo wollen Sie hin?«
Die Chihuahuas horchten auf und gähnten, ihre großen Augen fixierten den Gast erwartungsvoll.