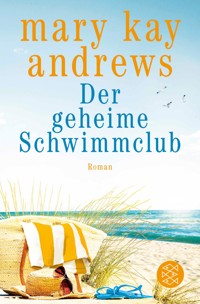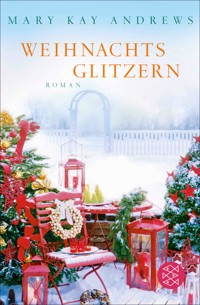8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Sommerbuchreihe
- Sprache: Deutsch
Das Leben könnte so schön sein: Das wärmende Sonnenlicht, die historische Häuserpracht und die frische Brise vom Meer machen Savannah zum perfekten Ort – zumindest für die Antiquitätenverkäuferin Eloise Foley. Doch dann gerät sie ins Zentrum einer Mordermittlung. Jemand hat Caroline DeSantos umgebracht. Zu dumm, denn Caroline war die neue Flamme von Eloises frisch geschiedenem Ehemann. Prompt wird sie zur Hauptverdächtigen. Und das ausgerechnet jetzt, da sie eine Verabredung mit dem Chefkoch des lokalen Sternerestaurants hat und zum ersten Mal wieder das lang vermisste Kribbeln in der Bauchregion verspürt. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin BeBe Loudermilk schmiedet Eloise einen Plan, der ihre Unschuld beweisen soll. Und auch ihr Ex soll dabei sein Fett wegkriegen, denn Eloise hat mit ihm noch eine Rechnung offen: Immerhin hat ihr früherer Ehemann sie hinterhältig betrogen und das gemeinsame Haus an sich gerissen und mit seiner Neuen bezogen. Der Streitfall kostet Eloise ganz schön viele Nerven, doch die Gefühle für den süßen Sternekoch geben ihr Rückenwind. Denn Liebe macht erfinderisch – auch wenn es um die juristischen Feinheiten einer Polizeiuntersuchung geht. Genieße traumhafte Momente an der Küste Georgias mit Mary Kay Andrews, die auch mit diesem Roman dein Herz schneller schlagen lassen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mary Kay Andrews
Zweimal Herzschlag, einmal Liebe
Roman
Über dieses Buch
Eloise Foley hat es gerade wirklich nicht leicht: Anstatt sich den Traum vom eigenen Antiquitätengeschäft zu erfüllen, muss sie mit ansehen, wie Caroline DeSantos, die neue Frau von Eloises untreuem Exmann, in ihr ehemaliges Zuhause einzieht. Als Caroline eines Tages tot aufgefunden wird, gerät Eloise unter Verdacht. Wie gut, dass ihr ihre beste Freundin BeBe Loudermilk beisteht. Und Daniel, der unwiderstehlich gutaussehende Küchenchef des Sternerestaurants Guale. Zusammen machen sie sich auf, im Küstenstädtchen Savannah die Wahrheit herauszufinden. Wer hat Caroline wirklich auf dem Gewissen? Und was hat die herrschaftliche alte Villa Beaulieu mit allem zu tun?
Weitere Titel der Autorin:
»Die Sommerfrauen«, »Sommerprickeln«, »Sommer im Herzen«, »Ein Ja im Sommer«, »Kein Sommer ohne Liebe«, »Sommernachtsträume«, »Weihnachtsglitzern«, »Winterfunkeln«, »Zurück auf Liebe«, »Liebe kann alles«, »Auf Liebe gebaut«, »Mit Liebe gewürzt«, »Liebe und andere Notlügen«, »Das Glück zum Schluss«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Mary Kay Andrews wuchs in Florida, USA, auf und lebt mit ihrer Familie in Atlanta. Im Sommer zieht es sie zu ihrem liebevoll restaurierten Ferienhaus auf Tybee Island, einer wunderschönen Insel vor der Küste Georgias. Seit ihrem Bestseller »Die Sommerfrauen« gilt sie als Garantin für die perfekte Urlaubslektüre.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER digiBook
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel ›Savannah Blues‹ im Verlag HarperCollins, New York.
© 2002 Whodunnit, Inc.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Vignette Kapitelanfang: Selected by freepik
Covergestaltung: bürosüd°, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490314-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
1
Als es heftig an der Haustür klopfte, wusste ich, wer es war. Vor dem Milchglasfenster der Eingangstür zeichnete sich Caroline DeSantos’ schlanke Silhouette ab. Nach wiederholtem vergeblichen Klingeln rüttelte sie nun energisch mit einer Hand am Türknauf und schlug mit der anderen den Messingklopfer.
»Eloise? Mach auf! Mir reicht’s! Dein Mistvieh hat es schon wieder getan. Ich bestelle den Hundefänger her. Ich hab mein Handy dabei und tippe in diesem Moment seine Nummer ein. Ich weiß, dass du mich hörst, Eloise.«
Tatsächlich hielt sie etwas vor der Brust, das wie ein Handy aussah.
Auch Jethro war ganz Ohr. Er hob die dunkle Schnauze mit den niedlichen Punkten, die wie helle Sommersprossen aussahen, spitzte die Ohren und verkroch sich, als er die Stimme des Feindes erkannte, vorsorglich unter dem Wohnzimmertisch.
Ich kniete mich hin und kraulte ihn mitfühlend am Hals.
»Stimmt das, Jethro? Hast du wirklich schon wieder in die Kamelien gestrullt?«
Jethro ließ den Kopf hängen. Streuner bleibt Streuner, aber immerhin log er mich so gut wie nie an, was ich von keinem anderen männlichen Wesen behaupten konnte, mit dem ich mich bisher eingelassen hatte.
Zum Dank für seine Aufrichtigkeit tätschelte ich ihm den Kopf. »Braver Hund. Nur zu, tu dir keinen Zwang an! Pinkle da drüben auf alles, was sich dir bietet, und für einen ordentlichen Haufen auf der Eingangstreppe gibt’s den größten, saftigsten Knochen in ganz Savannah.«
Unterdessen ging das Rütteln und Klopfen unvermindert weiter. »Eloise. Ich weiß, dass du da bist. Ich hab deinen Pick-up an der Straße gesehen. Ich hab Tal angerufen, und Tal verständigt seinen Anwalt.«
»Petze«, murmelte ich und stellte den Karton mit Trödel, in dem ich gerade gestöbert hatte, auf den Boden.
Die abgezogenen Kiefernholzdielen fühlten sich unter den nackten Füßen angenehm kühl an, als ich in die Eingangsdiele tapste. Caroline legte sich so ins Zeug, dass ich um die alte Ätzglasfüllung bangte.
»Miststück«, zischte ich.
Jethro stimmte mir mit lautem Kläffen zu.
»Schlampe.« Begeistertes Wedeln mit dem Schwanz. Wir wappneten uns beide für das bevorstehende Trommelfeuer. Jethro kam unter dem Tisch hervor und setzte sich dicht hinter mich. Es hatte etwas Tröstliches, seinen warmen Atem an den Knöcheln zu spüren.
Ich riss die Haustür auf. »Fass, Jethro«, befahl ich laut. »Beiß die böse Frau.«
Caroline wich einen kleinen Schritt zurück. »Das hab ich gehört!«, kreischte sie. »Wenn ich diesen Köter noch ein einziges Mal in meinem Garten erwische, werde ich ihn …«
»Was?«, fiel ich ihr ins Wort. »Was wirst du? Ihn vergiften? Erschießen? Oder fährst du ihn mit deinem rassigen Schlitten platt? Sähe dir ähnlich, nicht wahr? Einen kleinen, wehrlosen Hund zu überfahren.«
Zur Bekräftigung meiner Verteidigungsstrategie stemmte ich die Hände in die Hüften und betrachtete meine Gegnerin von oben herab. Das heißt, mental, da Caroline DeSantos gut zehn Zentimeter größer war als ich, zuzüglich ihres modischen Markenzeichens, der Stilettos.
Sie wurde rot. »Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. In dieser Stadt herrscht Leinenzwang, falls du es noch nicht weißt, und wenn du wirklich an dem Köter hängst, solltest du ihn nicht frei herumlaufen lassen.«
Sie machte einen adretten Eindruck, das musste ich Caroline lassen; selbst in der mörderischen Sommerglut von Savannah glich sie einer frisch gepflückten Gardenienblüte. Ihr glänzendes dunkles Haar hatte sie im Nacken zu einem strengen Knoten gebunden, aus dem kein Strähnchen entwischte. Die lindgrüne Leinenbluse, zur passenden Caprihose, schmeichelte ihrem makellosen zartgebräunten Teint, der dezente U-Boot-Ausschnitt ließ den Brustansatz erahnen. An diesem Tag hätte ich auf diesen Anblick gut verzichten können.
»Ah, verstehe«, setzte ich zum Konter an. »Jethro treibt sich herum. Das stört dich also an meinem armen Hündchen? Dabei solltest gerade du Verständnis für einen Streuner haben, findest du nicht, Caroline? Oder muss ich dich daran erinnern, dass du es mit meinem Mann gut ein halbes Jahr lang getrieben hast, bevor ich euch endlich auf die Schliche kam und ihn aus dem Haus warf?«
Wie sich zeigen sollte, hatte ich Tal dabei nicht weit genug geworfen, denn so schnell, wie er draußen war, war er auch wieder drinnen. Der Scheidungsrichter war ein alter Kumpel von Big Tal, meinem Schwiegerpapa. Im Zuge der Vermögensregelung hatte er Tal das Stadthaus anno 1858 zugesprochen. Mein Anwalt musste dem Mann erst gewaltig einheizen, bevor er sich dazu herabließ, auch mir – im buchstäblichen Sinne – einen Knochen hinzuwerfen: das schwindsüchtige, zweistöckige Kutscherhaus hinter der großen Villa.
Die Tinte unter dem Scheidungsbeschluss war noch nicht trocken, als Tal Caroline ins große Haus holte, und seitdem ließen wir beide keine Gelegenheit aus, uns Nettigkeiten an den Kopf zu werfen.
Mein Anwalt, übrigens mein Onkel James, hatte mich beschworen zu verkaufen und wegzuziehen, am Ende aber kleinbeigegeben, denn wenn sich ein Foley etwas in den Kopf gesetzt hat, helfen, wie er sehr wohl wusste, keine noch so gutgemeinten Worte. An meinem Entschluss, in der Charleton Street die Stellung zu halten, war nicht zu rütteln. Den Süden verlassen? Nur mit den Füßen zuerst.
Caroline strich sich ein imaginäres Haar aus der Stirn, musterte mich von oben bis unten und verzog das Gesicht zu einem süffisanten Lächeln.
Es war Donnerstag. Ich hatte bereits im Morgengrauen die schmalen Straßen von Savannah abgeklappert, um vor den Villen der Hautevolee der Müllabfuhr die Beute wegzuschnappen. Was mein eigenwilliges Erscheinungsbild erklärte. Nach dem Wühlen in mehreren Müllcontainern hatte ich es mit dem Used-Look meines zweckmäßigen Outfits, blaues Jeanshemd zu schwarzen Leggins, vielleicht übertrieben. Mein kurzes, rotes Haar war von Spinnweben verklebt, meine Nägel waren dreckig und abgebrochen, und an meinen Fingerknöcheln hing abgeblätterte Farbe.
Der Ertrag war diesmal allerdings mehr als dürftig ausgefallen. In der Barnard Street hatte ich mich hinter einem Brownstone-Haus im italienischen Stil auf zwei riesige Kartons mit alten Büchern gestürzt, die jedoch nur schimmelige, vollkommen wertlose Gesangbücher einer Methodistenkirche aus den dreißiger Jahren bargen. Bei dem hübschen Service aus der japanischen Besatzungszeit, das ich in der Washington Avenue auf einem Haufen Krempel in einer Kiste entdeckt hatte, fand sich nicht ein Stück ohne abgeplatzte Glasur, Bruchstellen oder Risse. Der einzige halbwegs vielversprechende Fund war eine alte Keksdose mit Knöpfen, die ich auf dem Heimweg im Vorgarten eines Hauses für zwei Dollar erstanden hatte.
Auf diese Dose hatte ich mich gerade gestürzt, als Caroline zum Sturm auf meine Haustür ansetzte.
Hinter mir war ein leises Pupsen zu hören. Caroline nahm mich ins Visier, rümpfte ihre gerade, lange Nase und schürzte die vollen Lippen. »Mein Gott«, platzte sie heraus, »was ist das für ein abartiger Gestank?«
Ich schnupperte und sah mit einem unauffälligen Blick über die Schulter, wie sich Jethro ins Haus verdrückte.
»Jedenfalls nicht der Hund«, sprang ich Jethro zur Seite und deutete auf das gusseiserne Geländer der Eingangsstufen, über dem ein abgewetzter Häkelteppich zum Lüften hing.
»Ist wahrscheinlich der Teppich«, fügte ich hinzu. »Den hab ich aus einem alten Crack-Haus in der Huntingdon Street vor der Abrissbirne gerettet. Echte Handarbeit. Reine Wolle. Kaum Flöhe oder Motten.«
Caroline machte einen Satz zurück, als sei der Teppich ein leibhaftiges Stinktier.
»Nicht zu fassen, was für ein Dreckzeug du anschleppst«, fing sie an. »Einfach ekelhaft. Kein Wunder, dass ich drüben alle zwei Wochen Insektenspray sprühen lassen muss. Ich hab’s ihm gesagt: ›Eloise holt uns das Ungeziefer ins Haus.‹«
In dem winzigen Wohnzimmer hinter mir klingelte das Telefon.
»Also dann«, sagte ich. »Das Geschäft ruft.« Damit knallte ich ihr die Tür vor der Nase zu und ließ das Riegelschloss einschnappen.
Jethro schleckte mir dankbar die Zehen. »Ro-Ro«, sagte ich in nachsichtigem Ton, um seine Gefühle nicht zu verletzen. »Das war übel, Kumpel, wirklich übel. Sandwich mit Fleischwurst ist ab sofort gestrichen.«
Beim vierten Klingelzeichen nahm ich ab.
»Eloise, das glaubst du nicht!«
Es war BeBe Loudermilk, meine beste Freundin, deren Mutter nach acht Kindern in zehn Jahren beim neunten und letzten so erschöpft gewesen war, dass sie bei der Namensgebung nur noch »Baby« hauchte oder auch »Bay-Bay«, was nach der französischen Variante klang.
Als Letzte versuchte BeBe von Anfang an, die Erste zu sein, und war bei ihrer Aufholjagd permanent in Eile. An höfliche Floskeln wie »Hallo«, geschweige denn »Wie geht’s, wie steht’s« verschwendete sie keine Zeit.
»Rate mal!«
»Du heiratest wieder?«
Erst wenige Monate zuvor hatte BeBe ihrem Gatten Nummer drei den Laufpass gegeben, doch BeBe war wie gesagt kein Mensch, der etwas anbrennen ließ. Die Frau blickte nach vorn, und ohne einen Mann lief bei ihr gar nichts.
»Nein, im Ernst, Eloise«, beharrte BeBe. »Rate mal, wer gestorben ist!«
»Richard?«, fragte ich hoffnungsvoll. Richard, BeBes Nummer Zwei mit einer Schwäche für Telefonsex. Bis heute schlug sich BeBe mit unbezahlten Rechnungen der Hotline YOU-SKRU herum.
»Sehr witzig!« BeBe verlor die Geduld mit mir. »Heute Morgen rief Emery Cooper an. Emery, klingelt’s bei dir, Schätzchen? Cooper wie Cooper-Hale, das Bestattungsinstitut! Bekniet mich seit Wochen, mit ihm essen zu gehen, aber ich hab ihm natürlich gesteckt, dass ich grundsätzlich nichts mit einem Mann anfange, der nicht mindestens seit einem Jahr geschieden ist. Zugegeben, Emery ist süß, aber er hat Kinder. Du kennst mich ja. Und ich mach nicht gern mit jemandem rum, der tagsüber mit Toten hantiert. Findest du das mies von mir?« Eine Antwort wurde nicht erwartet.
»Ach, was soll’s, Eloise. Jedenfalls rückte Emery am Telefon damit raus, Anna Ruby Mullinax sei letzte Nacht gestorben. Die war siebenundneunzig, hast du das gewusst? Und hat bis zum Schluss in demselben Haus gewohnt, in dem sie zur Welt gekommen ist. Und dreimal darfst du raten, wer die Beerdigung übernimmt.«
Schon wieder spürte ich Jethros Zunge an den Zehen. Er musste raus, doch bis sich Carolines Wut abgekühlt hatte, waren ihre Kamelien erst einmal tabu. Ich klemmte mir das Telefon ans Ohr.
»Freut mich für ihn, BeBe«, sagte ich. »Aber kannst du dich später noch mal melden? Jethro muss dringend vor die Tür!«
»Eloise«, rief BeBe. »Schnallst du’s immer noch nicht?«
»Was denn? Emery Cooper will dir an die Wäsche. Glaubst du, er riecht nach Formaldehyd?«
»Nein«, antwortete BeBe gedehnt, »er riecht gut. Geld stinkt nicht. Aber allmählich mache ich mir Sorgen um dich, Kindchen. Hörst du mir überhaupt zu? Anna Ruby Mullinax? Das Haus, in dem sie gelebt hat, von der Wiege bis zur Bahre? Wir reden hier von Beaulieu, Süße. Macht’s endlich klick?«
Ich spürte ein zartes Kribbeln im Nacken. Beaulieu, der Name war Programm: prächtiges Herrenhaus, endlose Reisplantagen. Ich senkte den Blick und registrierte die Gänsehaut an meinen Armen.
»Siebenundneunzig, sagst du?«, fragte ich heiser. »Irgendwelche Hinterbliebenen?«
»Keine Menschenseele«, erwiderte BeBe triumphierend. »Ach, hatte ich’s schon erwähnt? Emery sagt, die Hütte ist gerappelt voll mit schönen alten Sachen. Und jetzt frage ich dich: Wer war noch gleich die allerbeste Freundin auf der Welt?«
»Du! Ich ruf dich gleich zurück.«
2
Kaum hatte ich Caroline aus meinen Gedanken verbannt, ließ ich die Nachricht vom Tod der Anna Ruby Mullinax sinken – der letzten Erbin von Beaulien, jener Reisplantage am Skidaway River, sieben Meilen außerhalb der Stadt mit dem halb verfallenen Herrenhaus.
Die Mullinaxes gehörten zu den angesehenen alteingesessenen Familien der Stadt. Ihr Stammbaum, daran ließen sie keinen Zweifel aufkommen, ging auf die ersten Siedler in Georgia zurück, die 1733 mit General James Oglethorpe angelandet und, den Geschichtsbüchern der Yankees zum Trotz, alles andere als Versager waren. In Savannah beißt du dir lieber die Zunge ab, bevor dir das Wort »Schuldnerkolonie« über die Lippen kommt.
Meiner Mutter zufolge, und meine Mutter kennt sich mit diesen Dingen aus, galten die Mullinaxes einmal als die reichste Familie an der Küste und Beaulieu als das herrschaftlichste Plantagenhaus im ganzen Süden. Damit nicht genug, war die Plantage als letzte ihrer Art noch in Betrieb, als 1970 Hurrikan Brenda von Charleston herauf über den Süden hinwegfegte und mit der Sturmflut so viel Salzwasser in die Kanäle spülte, dass es mit der gesamten Ernte auch die Familie ruinierte.
Schon seltsam. Im selben Jahr, in dem die Mullinaxes ihr Geld verloren, kam ich zur Welt.
Ich hab’s nachgeschlagen. 1970 war auch das Jahr, in dem sich die Beatles trennten, Nixon Präsident war, US-Truppen in Kambodscha einrückten und »Die Partridge Familie« im Fernsehen für Furore sorgte. Kaum zu glauben, dass im selben Jahr Jimi Hendrix und Janis Joplin starben. Mit gerade mal siebenundzwanzig Jahren. Außerdem war es das Jahr des Kent-State-Massakers, bei dem vier Studenten im Zuge einer Anti-Vietnamkriegs-Demo in Ohio starben.
Mochte es für das übrige Amerika ein Jahr der Revolution gewesen sein, für die Foleys in Savannah war es das Jahr, in dem meine vierzigjährige Mutter ein leibhaftiges Wunder hervorbrachte – mich.
Bis es meiner Mutter dämmerte, dass ihr übles Sodbrennen einer Schwangerschaft geschuldet war, hätte niemand gedacht, dass Marian Foley für irgendeine Überraschung gut sein könnte. Mit vierzig ein Baby zu bekommen war das Letzte, womit sie noch gerechnet hatte. Ich musste es wissen, denn jedes Mal, wenn sie im Lauf der Jahre sauer auf mich gewesen war, hatte sie mich daran erinnert.
»Mit vierzig«, sagte sie dann und schlug sich in klassischer Märtyrer-Matronen-Pose auf die Brust, »wer hätte das gedacht! All die Jahre hab ich auf dich gewartet. Ein Wunder. Es war wie ein Wunder. Du warst ein Geschenk unserer Lieben Jungfrau, das hat auch Father Keane gesagt. Für all die Gegrüßet seist du, Maria, die ich gebetet habe.«
Als mein Vater mal bei einem Familienfest mit ein paar bösen Onkels mit dem schlechten Einfluss zu tief ins Whiskyglas geschaut hatte, bekam er die Geschichte einmal zu oft von meiner Mutter zu hören.
»Blödsinn!«, schnauzte er. »Lass endlich Maria aus dem Spiel! Es lag an dem geplatzten Kondom!«
Nach diesem Abend hatte Mama ein halbes Jahr lang nicht mit ihm geredet.
Und so machte ich mich knapp dreißig Jahre nach jener ungestümen Verhütungspanne an einem glühend heißen Julitag auf den Weg nach Beaulieu, um der verblichenen Anna Ruby Mullinax die letzte Ehre zu erweisen. Und, nebenbei, die Schätze der Villa zu sichten.
Ich weiß noch, wie Daddy, als ich klein war, langsamer fuhr, damit wir die schier endlose, von alten Eichen gesäumte Zufahrt bestaunen konnten. Das Haus selbst war von der Straße aus nicht zu sehen, sondern nur die von Louisianamoos behängten Bäume und das rostige, schmiedeeiserne Tor mit dem Namen Beaulieu in geschwungener Schrift.
Als junges Mädchen nahm mich mein damaliger Freund mal zu einer Bootsfahrt auf dem Skidaway River mit und zeigte mir vom Wasser aus die halbverfallenen Ruinen der Sklavenquartiere von Beaulieu, die durch das goldgrüne Sumpfgras an der Uferböschung nur so eben zu erkennen waren. Früher hatte einmal ein langer Steg über das Brackwasser bis zu einer Anlegestelle am Fluss geführt, doch in den späten achtziger Jahren waren davon nur noch die halbverrotteten Pfähle übrig gewesen, auf denen riesige braune Pelikane saßen und in die erbarmungslose Sonne blinzelten.
Da gerade Flut war, konnten wir am lehmigen Ufer anlegen und uns heimlich auf das Grundstück schleichen. Mein Freund hieß Danny Stipanek, und das mit uns hielt keine zwölf Wochen, was im Wesentlichen daran lag, dass Danny, neunzehn Jahre alt und entschlossen, zu den Marines zu gehen, permanent geil war, ich dagegen ständig Angst hatte, schwanger zu werden und – in einer Stadt wie Savannah die Steigerungsform von schwanger – mich in Verruf zu bringen. An dem Tag jedoch kam es einfach über mich; weniger der allzeit bereite Danny Stipanek – der natürlich auch –, sondern vor allem die schillernde, unberührte Schönheit von Beaulieu.
Ich wurde nicht schwanger, sondern holte mir nur einen Sonnenbrand und Sandflohstiche an den unmöglichsten Stellen. Danny Stipanek verschwand aus meinem Leben und heuerte bei den Marines an, als ich an der Highschool in die letzte Runde ging. Später kam mir Danny immer dann wieder in den Sinn, wenn ich im Fernsehen die Werbespots der Truppe sah: die Auserwählten, die Stolzen, die Geilen.
Für meinen Vater waren die Todesanzeigen »der irische Sportteil«, weil wir Iren so gerne zu Beerdigungen gehen wie andere ins Stadion. Einen Tag nach BeBes Anruf sprang mir die Meldung von Anna Ruby Mullinax’ Tod ins Auge. Auch in zwei weiteren Punkten behielt meine beste Freundin recht: Es gab keine Hinterbliebenen, und in Beaulieu war eine Gedenkfeier anberaumt. Die perfekte Gelegenheit für eine unauffällige Sichtung.
An besagtem Freitag steckte ich mein bestes Kleid in eine Plastikhülle und drapierte es behutsam über dem Beifahrersitz des Pick-ups. Für mich war das Kleid eine Hommage an Zelda Fitzgerald – rapsgelber Seidenvoile, knöchellang, mit einem passenden seidenen Unterrock. Vor einem Jahr hatte ich es zusammen mit anderen alten, in einen Müllsack gestopften Kleidern aus einem viktorianischen Haus an der East Thirty-Eighth kurz vor dessen Abriss geborgen.
In meinen bewährten weiten, khakifarbenen Shorts, einem verwaschenen T-Shirt und Sneakers drehte ich wie jeden Freitagmorgen meine Runde. In den Kleinanzeigen der Savannah Morning News hatte ich vier Haushaltsauflösungen angestrichen, jedoch nur bei einer davon etwas Lohnenswertes gefunden. Von dort ging es zu den karitativen Gebrauchtwarenläden, zu Goodwill Store am Victoria Drive, St. Vincent DePaul und zum krönenden Abschluss zu This N’ That.
Den TNT betrieb Mr Meshach Greenaway. Jahrelang hatte er in dem unscheinbaren kleinen Betonklotz Rasenmäher repariert, bis er eines Tages herausfand, dass es lukrativer für ihn war, den Trödel der Weißen abzuschleppen, als die kaputten Grasrasierer der Schwarzen zusammenzuflicken.
Der TNT lag in Roosevelt Park, für meine Mama »das Quartier«, ein bescheidenes, überwiegend von Schwarzen bewohntes Viertel, wenige Meilen von der Ranch-House-Siedlung meiner Eltern entfernt, in der die Weißen unter sich waren.
Mr Greenaway sah mich kommen. Als er mir öffnete, verzog er das schweißbedeckte, dunkle Gesicht zu einem Lächeln, während er auf einen riesigen Stapel Kartons an der Eingangsseite der Werkstatt deutete.
»Hab schon auf dich gewartet, Eloise«, sagte er, setzte den Styroporbecher mit Eiswasser, den er in jeder Lebenslage bei sich trug, an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck. »Sieh dir das an, Mädchen, sämtliche Sachen, die der alte Mr Arnold Lowenstein von der East Fourty-Sixth Street bis zu seinem Tod auf dem Speicher und in der Garage gehortet hat.« Für den Fall, dass uns jemand belauschte, senkte er die Stimme.
»Ardsley Park. Mr Lowenstein, Inhaber von Low-Low Liquors. Das heißt, ehemaliger Inhaber, jetzt ist er ja unter der Erde. Dem hat dieses große rote Klinkerhaus mit der Hecke rings ums Grundstück gehört, Ecke Atlantic Avenue.«
Die Adresse gehört zu einer stinkfeinen Gegend mit großen alten Villen und ebenso altem Geld.
»Komm«, ermunterte mich Greenaway und stupste mich am Arm. »Sieh dir das Gerümpel an!«
Und was für ein Gerümpel!
Die Low-Low-Liquor-Lowensteins verkehrten in den besten Kreisen von Savannah, das verstorbene Ehepaar hinterließ erwachsene Kinder. In der Mickve-Israel-Synagoge gab die Familie den Ton an. Cissy Lowenstein war an der Vincent Academy eine Klasse über mir, Walter an der Benedictine Prep-School eine Klasse unter mir gewesen. Das mag ein bisschen verwirrend klingen, aber in Savannah läuft das so: Die Kinder reicher weißer Protestanten angelsächsischer Herkunft gehen an die Country Day School, während katholische Arbeiter und reiche jüdische Familien ihren Nachwuchs auf die konfessionellen Schulen schicken.
Natürlich hatten sich die Kinder schon die »guten« Sachen gesichert, da ging ich jede Wette ein. Sterlingsilber, Bleikristall oder feines Porzellan, alles mit englischem Stammbaum oder französischem Akzent konnte ich vergessen. Was blieb, war ein ansehnlicher Fundus solider, amerikanischer Babyboomer-Stücke.
Die Lowensteins, Gott hab sie selig, gehörten offensichtlich noch nicht zur Wegwerfgeneration und hatten seit Mr Arnold Lowensteins Rückkehr aus dem Zweiten Weltkrieg alles aufbewahrt, auch wenn leider nichts dabei war, was meine Händler vor Ort im mindesten interessieren würde.
Ich sichtete einen Karton voller Fire-King-Jadeit-Geschirr, darunter Speiseteller, passende Kaffeebecher, Müslischalen und Teller mit erhöhtem Rand, genug, um damit ein kleines Restaurant im Fünfziger-Jahre-Stil auszustatten. Ein Händler aus New Jersey, der jedes Jahr auf seiner Einkaufstour durch Florida einen Abstecher zu mir machte, würde mir locker sechshundert Dollar dafür zahlen.
In einem weiteren Karton fand ich bestens erhaltene Zeitschriften aus den dreißiger und vierziger Jahren, wie etwa Field and Stream, Boys Life, Argosy, Colliers’ und Vanity Fair. Die Titel-Illustrationen stammten von den namhaftesten Grafikern der Zeit. Allein für die The-Field-and-Stream-Sammlung würde mir mein Antiquar in Charleston fünfzehn Dollar pro Heft hinblättern.
Wie eine Furie wühlte ich mich durch die Kartons und sortierte dreißig Jahrgänge National Geographic sowie die Kontoauszüge des Verblichenen seit Beginn der fünfziger Jahre aus, bevor ich gierig nach einem Stapel Bettwäsche aus irischem Leinen mit Hohlsaumkante griff, ein Paar leicht vergilbte Spitzengardinen zur Seite legte, einen Schuhkarton mit Modeschmuck aus Strass dazustellte und zur Krönung einige Nachthemden, Negligees und Slips aus fließender Seide barg. Als ich in einer Metalltruhe auf Mr Lowensteins Uniform aus dem Zweiten Weltkrieg stieß, wusste ich, dass ich auf einen Schatz gestoßen war. Und richtig: Sorgsam unter der Uniform versteckt, wartete eine exquisite Sammlung Kalender, Spielkarten und Zeitschriften mit Pin-up-Girls aus den vierziger und fünfziger Jahren auf ihre Wiederentdeckung. Beim Anblick des ersten Vargas-Girls zollte ich dem guten alten Arnold, der sich als Connaisseur der Aktkunst entpuppte, still Respekt. Doch wie heftig schlug erst mein Herz für ihn, als ich die erste Playboy-Ausgabe von 1953 entdeckte, mit dem berühmten Bild der bekleideten Marilyn Monroe auf dem Cover und dem skandalösen Nacktfoto auf der Innenseite!
Nach einer Stunde klebten mir Staub und Schimmel an der verschwitzten Haut, ich klopfte mir die toten Silberfische aus den Kleidern und versuchte, den penetranten Geruch von Mottenkugeln wegzufächeln, doch ich war mehr als zufrieden.
»Wie viel?«, fragte ich Greenaway, der die ganze Zeit so getan hatte, als läse er Zeitung.
Er sog die Luft zwischen den Zähnen ein, schloss die Augen, schnappte sich einen Bleistiftstummel und schrieb ein paar Zahlen an den Rand der aufgeschlagenen Zeitungsseite.
»Über den Daumen gepeilt hundertfünfundsiebzig«, sagte er, »mit Stammkundenrabatt.«
Es gab mir einen Stich. Die Sachen waren locker vierhundert Dollar wert, selbst wenn ich sie, wie hier, en gros einkaufte. Falls ich nicht völlig daneben lag und falls meine eigenen Kunden in Kauflaune waren, würde ich die Sachen für mindestens das Dreifache verscherbeln. Andererseits hatte ich genau zweihundert Dollar dabei und wollte versuchen, mich mit meinen Käufen zurückzuhalten, um noch Reserven für die anstehende Haushaltsauflösung in Beaulieu zu haben.
»Es ist mehr wert, Mr Greenaway«, wandte ich ein. »Dieses grüne Geschirr ist Jadeit, wirklich angesagt. In Atlanta bekomme ich allein für die Teller fünfunddreißig Dollar das Stück.«
Mr Greenaway schob sich die schweißfleckige Baseballkappe aus der Stirn. »Im Ernst?«, fragte er, nahm einen vom Stapel und betrachtete ihn mit ganz anderen Augen. »Meine Mama hatte solches Geschirr. Nach ihrem Tod haben wir alles der Kirche vermacht.«
Ich zog die Rolle Zwanzig-Dollar-Scheine aus der schwarzen Gürteltasche, die ich immer umgeschnallt hatte, nahm sieben heraus und drückte sie ihm in die Hand. »Diese Woche bin ich ein bisschen klamm«, sagte ich. »Wie wär’s, wenn ich alles außer dem Geschirr mitnehmen würde? Und falls Sie es bis dahin noch nicht losgeworden sind, komme ich nächste Woche wieder, wenn ich die anderen Sachen zu Geld gemacht habe.«
Mr Greenaway nahm das Bündel und steckte es in die Latztasche seines Overalls. »Ach was, nimm das Geschirr gleich mit, Eloise«, sagte er. »Auf dich ist Verlass; meinst du, das weiß ich nicht?«
Bis wir alles auf meinem Pick-up verstaut hatten, war es bereits halb zwölf. Höchste Zeit, mich auf den Weg zu meinen Eltern zu machen, unter die Dusche zu springen, mich anzuziehen und nach Beaulieu zu fahren.
Wenig später platzte ich bei meinen Eltern zur Küchentür herein und huschte an Mama vorbei, die am Spülbecken stand und für den Mittagssnack meines Vaters Tomaten schälte. Im Sommer gab es für Daddy jeden Mittag dasselbe: ein Tomatensandwich mit Weißbrot und Mayo, dazu Kartoffelchips und eine Pepsi light.
Mein Vater hielt unterdessen sein Vormittagsschläfchen. Seit seiner Pensionierung vom Postdienst hatte er einen streng geregelten Tagesablauf: frühstücken, Zeitung lesen, Coupons ausschneiden und sammeln, Nickerchen halten, zu Mittag essen. Danach standen Gartenarbeit, Nickerchen, Spielshows im Fernsehen und Abendessen auf dem Programm.
»Kann ich mal eben bei euch unter die Dusche?«, fragte ich, ohne eine Antwort abzuwarten.
»Eloise?«, rief Mama, ohne aufzusehen. »Was hast du vor?«
»Keine Zeit«, murmelte ich und schob mir im Vorbeigehen eine Handvoll Chips in den Mund.
Wenig später kam ich in meinem gelben Zelda-Kleid und mit nassen Haaren in die Küche zurück.
Mama stellte den Teller mit den Sandwiches auf den Esstisch und musterte mich mit einem skeptischen Blick.
»Willst du auf eine Kostüm-Party? Mitten im Juli?«
»Nein, liebste Mama«, sagte ich, »habe ich nicht vor. Ich will nach Beaulieu, zu Miss Anna Ruby Mullinax’ Gedenkfeier.«
Kaum war es heraus, hätte ich es gerne zurückgenommen.
»Untersteh dich, Jean Eloise Foley«, skandierte Mama und knallte ihr Glas mit Eistee auf die Arbeitsfläche. Vor Empörung blähten sich ihre blaugeäderten Nasenflügel. »Das ist ja wohl das Frevelhafteste, was mir je zu Ohren gekommen ist! Das lasse ich nicht zu, hörst du?«
Wenn Mama, wie sie es gewöhnlich das ganze Jahr zwischen ein und vier Uhr nachmittags tat, Bourbon im richtigen Mischungsverhältnis mit Wasser trank, so dass es wie Eistee aussah, fand sie alles entweder frevelhaft oder ungeheuerlich oder beides.
»In der Morning News stand, zur Trauerfeier in Beaulieu um ein Uhr seien Angehörige und Freunde willkommen«, gab ich zu bedenken. »Hinterbliebene gibt es nicht, und wer sagt denn, dass ich keine Freundin bin?«
»Bist du nicht«, klärte Mama mich auf. »Wir kennen die Leute nicht. Leute wie die Mullinaxes kennen keine Leute wie die Foleys.« Sie beugte sich vor, schnupperte an meinem Kleid und verzog das Gesicht. »Und Leute wie die Mullinaxes kennen mit Sicherheit keine Leute, die Kleider aus der Mülltonne anderer Leute tragen.«
Ich strich mir mit der Hand über die Vorderseite meines Kleides, das ich in stundenlanger, mühevoller Kleinarbeit mit der Hand gewaschen, ausgebessert und gebügelt hatte. Mit einem Mal fühlte ich mich nicht mehr wie Zelda, sondern wie Aschenputtel. Für so etwas hatte Mama wirklich ein Händchen.
»An diesem Kleid ist noch das originale Hattie-Carnegie-Label dran«, entgegnete ich leise. »Wenn ich es verkaufen wollte, brächte es bei einem meiner Kontakte für Vintagemode in New York mindestens zweihundert Dollar. Über eine E-Bay-Auktion vielleicht noch mehr.«
»Du kannst nicht einfach zum Haus dieser Frau rausfahren«, beharrte meine Mutter.
»Sie ist tot«, sagte ich, »sie hat ganz bestimmt nichts dagegen.«
Mama nippte an ihrem Bourbon-Tee. »Das ist beschämend«, sagte sie. »Was machst du, wenn einer von den Evans da aufkreuzt? Tals Eltern verkehren in diesen Kreisen. Wenn dich nun einer von ihnen da sieht?«
Ich rang mir ein gequältes Lächeln ab und mimte einen kleinen Knicks. »Dann sage ich ›Hallo, Genevieve, hallo, Big Tal. Wie schön, euch wiedersehen. Ich bin nur mal vorbeigekommen, um zu sehen, wie die bessere Gesellschaft so lebt, nachdem mir euer abgezockter Sohn alles genommen hat, was mir zusteht. Ach, richten Sie doch Little Tal von mir aus, er und seine liebste Caroline sollen in der Hölle schmoren!‹«
Statt etwas zu erwidern, eilte Mama zum Kühlschrank und füllte das hohe Glas, das bereits auf der Arbeitsplatte stand, mit weiteren Eiswürfeln auf.
»Es will mir immer noch nicht in den Kopf, wie es mit dir so weit kommen konnte«, sagte sie vorwurfsvoll. »Tal war perfekt für dich. Du hattest das beste Leben, das du dir nur wünschen konntest.« Dabei zitterte ihre schmale Oberlippe so, dass sich der feine Flaum darüber wie Weizen im Wind kräuselte. »Sieh dich doch an! Du wohnst in einer Garage. Ohne Job. Ohne Mann, ohne jede Zukunftsperspektive. Was ist das für ein Leben?«
Als Mutter mit ihrer Tirade über die Hoffnungslosigkeit meiner Existenz gerade richtig in Fahrt kam, erschien Daddy auf der Bildfläche, die Zeitungsseite mit dem Fernsehprogramm und somit seine Pläne für den Nachmittag säuberlich gefaltet in der Hand. Sein erster missbilligender Blick fiel auf Mutters Drink, der zweite auf meine Wenigkeit.
»Wenn du dir einfach einen Job suchen und ihn dann sausen lassen würdest, könnte ich den Leuten wenigstens sagen, in was für einer Branche du gerade gekündigt hast«, sagte Daddy und lachte wie immer, wenn er mit dieser Masche kam, leise über seinen eigenen Witz.
Dann holte er sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche und zog zwei Zehndollarscheine heraus. »Hier«, sagte er mit einem Augenzwinkern, »damit du über die Runden kommst.«
Ich wehrte ab. »Nicht nötig, Daddy, wirklich.«
Als sein Blick an meinem Kleid hängenblieb, packte er mich an der Hand und schloss meine Finger über den Scheinen. »Kauf dir was Hübsches. Ein neues Kleid.«
Für zwanzig Dollar! Für Daddy kostete eine Cola immer noch einen Dime. Ich steckte ihm das Geld in die Brusttasche seines kurzärmeligen Oberhemdes. »Behalte dein Geld«, sagte ich mühsam beherrscht. Immer schön freundlich, Eloise, hämmerte ich mir ein, und wenn es noch so schwerfällt. »Weißt du was, Daddy? Tipp meine Glückszahlen im Lotto. Diese Woche sind elf Millionen Dollar zu knacken. Und wenn du gewinnst, machen wir halbe-halbe.«
Ich sah, wie er ärgerlich wurde, was unweigerlich passierte, wenn ich ihm in Erinnerung rief, dass ich aus meinem ersten Teeny-BH und den rosa Prinzessinnenkleidchen, beides sorgfältig in meinem alten Kinderzimmer an der Rückseite des Hauses verstaut, herausgewachsen war.
»Behalt’s wenigstens, bis du einen Job gefunden hast und aus dieser Garage ausgezogen bist«, beharrte er und drückte mir die Scheine erneut in die Hand.
»Ich arbeite freiberuflich, ich bin nicht angestellt. Und es ist ein Kutscherhaus, keine Garage«, entgegnete ich zunehmend gereizt. »Bei meinem Kutscherhaus handelt es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude an der schönsten Straße der Altstadt.«
»Himmel Herrgott nochmal! Es ist eine Garage hinter dem Haus, in dem dein Ehemann mit seiner Freundin lebt«, platzte Daddy heraus.
»Exehemann«, stellte Mama den Sachverhalt richtig. »Vielleicht sollten wir dankbar sein, dass sie ein Dach über dem Kopf hat, Joe. Wäre dein Bruder James nicht gewesen, säße sie jetzt auf der Straße. Oder wäre wieder hier bei uns eingezogen.«
Immer hübsch freundlich, Eloise, wiederholte ich mein Mantra und biss mir auf die Lippe, während ich den Gedanken verdrängte, dass ich lieber in Schutt und Asche im finstersten Höllenloch schmoren würde, als in meinen rosa Prinzessinnenschrein im Haus meiner Eltern zurückzukehren.
Zugegeben, aus ihrer Sicht war mein Leben ein Fiasko. Ich war neunundzwanzig Jahre alt, frisch geschieden, ohne Geld, ohne Plan und Ziel, geschweige denn einen Abschluss oder Fertigkeiten, die mich für irgendeinen Job empfahlen. Als ich zehn Jahre zuvor das Community-College geschmissen hatte, um Talmadge Evans III das Jawort zu geben, war mir das alles ganz vernünftig erschienen. Ich war neunzehn, Tal vier Jahre älter. Er hatte gerade sein Architekturdiplom von der Technischen Hochschule Georgia in der Tasche, und es hatte seinen Reiz verloren, es auf dem Rücksitz des weißen Lincoln Continental seiner Mutter zu treiben.
Genevieve Evans hatte schon immer Lincolns gefahren und ihr Mann Big Tal stets einen Cadillac. Tal entstammte, mit den Worten meiner Mutter, einer »wohlsituierten« Familie.
In Savannah ist dies ein Kürzel für altes, episkopales Geld. »Steinreich« hingegen verweist auf neues Yankee-Geld und »stinkreich« auf jüdischen Wohlstand. Wenn man lange genug in Savannah lebt, kennt man diese subtilen Unterscheidungen. Eine »beliebte« Frau ist leicht zu haben, ein »musischer« Mann schwul und ein »schwieriges Kind« psychopathisch. Wie gesagt, wer hier lange genug heimisch gewesen ist, hat damit keine Probleme, und die Foleys lebten schon eine halbe Ewigkeit in Savannah. Genauer gesagt, seit Aloysius Frances Foley in den 1850er Jahren aus dem irischen County Kerry hier an Land gegangen war, um beim Bau der Southern-Railway-Bahngleise zu verlegen.
Daddy schaltete den Fernseher auf der Küchentheke ein, machte es sich am Resopaltisch in der Ecke bequem, faltete seinen Programmplan auf und stutzte. Riskant fing erst in einer halben Stunde an, und so blieb ihm nichts anderes übrig, als die Zeit mit Glücksrad zu überbrücken.
»Lumpenhändlerin«, murmelte Daddy. »Was soll das für eine Arbeit sein?«
Onkel James schärfte mir immer wieder ein, mich auf keinen Fall von ihnen unterkriegen zu lassen. Meine Eltern liebten mich von Herzen, daher die ewigen Sticheleien, so seine Theorie. Und dann fügte er stets hinzu, er an meiner Stelle würde sich lieber den Hintern rasieren oder in der Broughton Street splitternackt Überschläge rückwärts machen, als bei Joe und Marian Foley zu wohnen.
»Ich bin Picker«, erklärte ich meinem Vater zum hundertsten Mal. »Ich kaufe Antiquitäten an der Quelle, richte sie her und verkaufe sie an Antiquitätenhändler weiter. Das ist ein richtiger Beruf, mit dem man ehrliches Geld verdient.«
»Sachen aus dem Müll anderer Leute picken!«, fasste Mama in verächtlichem Ton meine Tätigkeit zusammen und schlürfte ihren Bourbon-Tee.
»Du liebe Zeit, bin ich spät dran!«, antwortete ich und wandte mich zum Gehen. »Tschüssi!«
»Was hast du es so eilig?«, wunderte sich Daddy. »Bleib zum Mittagessen. Du siehst aus, als könntest du eine Armenspeisung vertragen.« Er lachte über seinen Witz.
Ich nahm die Einladung an und schnappte mir noch eine Handvoll Kartoffelchips. »Danke!«, rief ich über die Schulter und machte einen Abgang.
3
James Aloysious Foley lehnte sich im Sessel zurück und blickte zu den Flügeln des Holzventilators auf, die an der hohen Stanzblechdecke gemächlich ihre Kreise zogen. Mit einem Seufzer wandte er sich erneut der Frau zu, die ihm auf der anderen Seite des Schreibtischs gegenübersaß und auf sein profundes Urteil wartete.
»Sehen Sie, Father James«, sagte sie, als er schwieg, und wischte sich mit einem verkrumpelten Papiertaschentuch über die Stirn. »Ich will mich nicht scheiden lassen. Scheidung ist Sünde. Das habe ich schon im Katechismusunterricht gelernt, und davon bin ich überzeugt. Ich will, dass Sie unsere Ehe kitten und dass Inky seinen Lohnscheck wieder heimbringt, wie es sich gehört.«
»Bitte, Mrs Cahoon«, sagte James, »ich bin nicht mehr Father James, schon vergessen? Ich bin kein Priester mehr, sondern Anwalt, und wenn ich Ihre Angaben gegenüber meiner Sekretärin recht verstehe, führen Sie schon lange keine richtige Ehe mehr. Akzeptieren Sie, dass es vorbei ist! Fangen Sie neu an, und lassen Sie Inky ziehen!«
Mit hochrotem Kopf sprang Denise Cahoon auf. In James’ Augen war sie mit Anfang fünfzig eine gutaussehende Frau: hübsche, schlanke Figur, das glatte, dunkle Haar aus dem Gesicht gekämmt, ausdrucksvolle graue Augen. Wieso sie sich an diesen Flegel mit Bierfahne klammerte, war ihm ein Rätsel.
»Das ist nicht wahr!«, sagte sie eine Spur zu schrill. »Das Ehegelübde ist uns heilig. Ich will kein neues Leben, ich will mein altes zurück. Rücken Sie Inky den Kopf zurecht, rufen Sie seinen Chef bei der Zeitung an und sagen Sie ihm, dass er seinen Lohn für Huren und Alkohol ausgibt. Sagen Sie ihm, er soll den Scheck mit der Post zu mir schicken, damit Inky nicht alles allein verprasst.«
Vielleicht aus alter Gewohnheit richtete James, als hoffte er auf ein Zeichen von oben, den Blick erneut zur Decke. Er hätte Stein und Bein geschworen, dass er in den Staubkörnchen, die im Luftstrom des Ventilators tanzten, zuweilen Muster ausmachen konnte – mal ein trabendes Pferd, mal eine majestätische Eiche oder, wie an diesem brütend heißen Nachmittag, das kleine Andachtskärtchen mit dem unbefleckten Herzen Mariens, in Ketten geschlagen und von einem Flammenschwert durchbohrt. Er schüttelte den Kopf und konzentrierte sich auf Denise Cahoon.
»Mrs Cahoon«, sagte er und verfiel unwillkürlich in den Tonfall des Beichtvaters. Vierundzwanzig Jahre im Dienste des Herrn schüttelte man nicht so schnell ab, auch wenn er ein Jahr vor seinem Silberjubiläum Soutane und Chorhemd geschmissen hatte. »Inky ist vor fünf Jahren ausgezogen. Wie ich hier lese, lebt er mit einer jungen Frau aus der Setzerei zusammen. Sie haben ein vierjähriges Kind, das zweite ist unterwegs. Keine guten Vorzeichen für die Wiederherstellung Ihrer Ehe.«
»Wahrscheinlich ist es gar nicht von ihm«, entgegnete Denise kampflustig. »Das Mädel schläft doch mit jedem. Mir macht das Flittchen nichts vor. Inky glaubt nur allzu gerne, das Balg wäre von ihm. Er hat sich schon immer Kinder gewünscht.«
James holte das Scheidungsantragsformular aus dem Ablagekorb auf seinem Tisch und händigte es seiner Klientin aus.
»Ist sicher zu Ihrem Besten«, bemühte er sich, Denise Cahoon in ihrer schweren Stunde ein wenig Trost zu spenden. »Es sind keine Kinder betroffen. Sie haben die ganze Zeit in diesem Haus gewohnt und es in Schuss gehalten. Sollte nicht allzu schwer sein, den Richter davon zu überzeugen, dass es Ihnen zusteht. Für die Fahrzeugkosten werden Sie dagegen selbst aufkommen müssen, und möglicherweise wird Inky auf einem Vermögensanteil aus dem Marktwert des Hauses bestehen. Sehen Sie sich diese Papiere in Ruhe an, machen Sie einen neuen Termin, und wir füllen sie zusammen aus. Wenn wir den Scheidungsantrag stellen, ist die ganze Sache in etwa sechs Wochen überstanden.«
Sie musterte James wie einen Außerirdischen, den irgendeine gottlose Macht in dieses staubige kleine Büro am Factor’s Walk gebeamt hatte, um ihr nach fünf mageren Jahren das Leben endgültig zu verleiden.
»Ist das alles? Mehr haben Sie mir nicht zu sagen? Keine Eheberatung, keine Familientherapie? Sie knallen mir diesen Wisch hin – ›Unterschreiben Sie hier, und das war’s‹? Nach zweiundzwanzig Jahren soll ich durch einen einzigen Federstrich nicht mehr Mrs Bradley R. Cahoon junior sein?«
Mit jeder Silbe war ihre Stimme ein wenig lauter, ihr Gesicht ein wenig dunkler geworden, und wie sie sich immer bedrohlicher über seinen Schreibtisch beugte, kam James der Gedanke, dass Inky vielleicht gut daran getan hatte, von Bord zu gehen, solange er noch konnte.
»Sie können Ihren Namen behalten, wenn Sie mögen«, klärte James seine Mandantin auf. »An der Scheidung allerdings geht wohl kein Weg mehr vorbei. Je länger Sie die Sache verschleppen, desto mehr Verfahrenskosten kommen auf Sie zu. Nach fünf Jahren und zwei Kindern halte ich es nicht für sehr wahrscheinlich, dass Inky es sich noch anders überlegt.«
Woraufhin Mrs Bradley R. Cahoon ihm das Formular aus der Hand riss und ihren Rechtsbeistand in einem zornigen Plädoyer in allen Punkten schuldig sprach: »Vergessen Sie’s. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil Ihre Mutter und meine Mutter Freundinnen waren. Meine Mutter war bei Ihrer Ordination dabei! Ich hatte gehofft, ein Priester könnte zwischen Recht und Unrecht unterscheiden. Ha! Bernadette Foley würde sich im Grab umdrehen, wenn sie ihren Sohn jetzt sähe, Jamie Foley. Scheidung! Sie sollten sich schämen!« Zur Bekräftigung drohte sie ihm mit dem Finger. »Schämen Sie sich!«
James wich instinktiv zurück. »Auf Wiedersehen, Mrs Cahoon«, sagte er.
Dann drehte er sich mit seinem Bürostuhl um fünfundvierzig Grad und blickte durch das verschmutzte Fenster über den lehmbraunen Savannah River, auf dem genau in diesem Moment ein langer, schwarzer Tanker vorüberglitt, vor dessen schierer Größe die Autos am Ufer wie Spielzeug erschienen. Das Schiff fuhr unter japanischer Flagge, am Bug entzifferte er den Namen Shinmoru Sunbeam.
Die Tür zu seinem Büro schlug zu. Gut. Mochte Denise Cahoon einem anderen Anwalt in den Ohren liegen.
Seit er von seiner letzten Kirche in Naples, Florida, nach Savannah zurückgekehrt war, hatte er es schon mit einigen Klienten zu tun gehabt, die der Wahrheit nicht ins Auge sehen wollten. Sie hörten nur auf das, was sie hören wollten, und mit dem Buß- und Beichtgeschäft hatte er abgeschlossen.
Als die Tür erneut aufging, wehte ihm eine Mischung aus Zigarettenrauch und Parfüm – derzeit Gardenien – entgegen.
»Gütiger Himmel und alle vierzehn Heiligen«, stöhnte Janet in melodischem Südstaatenakzent. »Wann fällt bei der Frau endlich der Groschen?«
Nur widerstrebend riss sich James von der Aussicht los. Der Fluss übte eine hypnotische Wirkung auf ihn aus. Seit er denken konnte, war das so. Wenn er von seinem Platz aus in die träge Strömung blickte, konnte er die Arbeit vergessen. Und er hatte Arbeit auf dem Tisch, Gott sei Dank.
Er blickte zur Tür. Janet brachte einen Aktenstapel herein, den sie auf den eben erst von Denise Cahoon geräumten Ohrensessel packte, bevor sie ihm eine rosa Telefonnotiz auf den Schreibtisch pappte. Als sie sich mit den Fingern durchs kurze, graue Haar strich, fiel die Zigarette, die ihr hinterm Ohr klemmte, zu Boden. Sie versuchte, sie unauffällig wegzutreten, doch zwecklos. Natürlich war sie ihm nicht entgangen. James A. Foley entging so schnell nichts.
»Ich dachte, du wolltest mit dem Rauchen aufhören«, bemerkte er und setzte eine strenge Miene auf.
»Fang nicht wieder damit an«, warnte sie.
Janet Shinholder war seine Sekretärin, älteste Freundin und Geschäftsführerin. In ihrer Jugend waren sie eine Weile zusammen gewesen, er als Kadett an der Militärschule von Savannah, sie als Schülerin am Katholischen Mädchencollege. Nachdem er Priester geworden war, hatten sie sich bis zu seiner Rückkehr aus Florida nur bei wenigen Gelegenheiten wiedergesehen.
Kurz nach seiner Heimkehr vor zwei Jahren waren sie einzweimal miteinander ausgegangen. Es war sogar zu Fummeleien auf dem Sofa in Janets Wohnung gekommen, bis ihr James widerstrebend gestand, dass sich sein Interesse an Sex in Grenzen hielt.
»Du bist schwul«, hatte Janet gekontert, als sei sie kein bisschen überrascht. »Das verstehe ich, James, kein Problem.«
Wenn er ehrlich war, hatte ihn ihre Reaktion verstimmt. Er eine Tunte? Niemals!
»Wie kommst du denn auf die Idee?«, hatte er sich empört.
»Dein ganzes Leben hast du dich in einem Priesterseminar oder einem Pfarrhaus versteckt«, entgegnete Janet, »seit deinem achtzehnten Lebensjahr. Und dann gibst du dein Priesteramt auf. Einfach so. Da dämmerte es mir endlich. Er wirft die Fesseln ab, habe ich gedacht, sondiert die Alternativen.«
»Findest du, ich benehme mich schwul?«, hatte er nachgehakt. »Glaubst du am Ende, ich interessierte mich für kleine Jungs? Ich gehörte zu der Sorte Priester?«
»Lass gut sein«, hatte Janet nur gesagt, sich die Bluse zugeknöpft und das Licht angemacht. »Tun wir einfach so, als wäre das hier nie geschehen.«
Am allermeisten verstimmte es ihn, erinnerte er sich, dass Janet richtig lag, wenn auch natürlich nicht mit der Pädophilie. Ein Jahr später lernte er jemanden kennen. Nicht etwa einen Knaben für gewisse Stunden. Jonathan war ein erfolgreicher Jurist, stellvertretender Bezirksstaatsanwalt. Sie waren sehr diskret, nur dass Janet sofort begriff, was Sache war, als Jonathan zum ersten Mal in seinem Büro auftauchte, um ihn zum Mittagessen einzuladen. Verdammt, Janet begriff schnell.
»Eloise hat angerufen«, sagte seine Sekretärin. »Wollte wissen, ob du heute Nachmittag schon was vorhast.«
James huschte ein Lächeln übers Gesicht. Seine Nichte war der eigentliche Grund dafür gewesen, nach Savannah zurückzukehren, statt woanders neu anzufangen. Sie hatten sich schon immer nahegestanden. »Du bist der Vater, den ich nie hatte«, neckte sie ihn oft, »und die Mutter.«
»Was hat sie vor?«, fragte er.
Janet zuckte die Achseln. »Sie wollte, glaube ich, zu einem Trauergottesdienst für Anna Ruby Mullinax nach Beaulieu. Sie würde sich gern dort mit dir treffen. Falls du nichts Wichtigeres vorhast.«
»Und? Hab ich das?«, gab James die Frage mit einem vielsagenden Blick auf den Sessel mit dem Aktenstapel zurück.
In den Augen seiner Nichte, die seine gesamte Büroausstattung einschließlich der beiden Sitzgelegenheiten für unglaubliche dreißig Dollar auf dem Flohmarkt erstanden hatte, war es ein großartiger Sessel. Sie hatte beide mit einem groben Leinenstoff beziehen lassen, der ihn immer an die Hängeschaukel auf der Veranda seiner Mutter in der Washington Avenue erinnerte.
»Wenn du mich fragst«, erwiderte Janet nach kurzer Überlegung, »kann es nicht schaden, dich dort blicken zu lassen. Anna Ruby Mullinax kannte hier eine Menge Leute. Einflussreiche Leute. Die vielleicht mal einen Anwalt brauchen.«
Janet nahm seinen blauen Blazer vom Messinghaken an der Innenseite der Tür und hielt ihn James mit ausgestreckten Armen hin. »Du weißt schon, Schlipszwang?«
Er schauderte bei dem Gedanken, in der üblichen Bruthitze von fünfunddreißig Grad Celsius und hundert Prozent Luftfeuchtigkeit eine Krawatte zu tragen.
»Und vergiss nicht, ein paar Visitenkarten einzustecken«, fügte sie hinzu. »Das nennt man Akquise, James.«
4
Ich drehte die Klimaanlage des Pick-ups bis zum Anschlag hoch und warf einen beschwörenden Blick auf die Temperaturanzeige. Die Nadel bewegte sich auf den Siedepunkt zu.
»Komm schon, nur noch bis Beaulieu«, redete ich dem Ding gut zu und tätschelte das Armaturenbrett, »reiß dich zusammen! Nur noch bis Beaulieu, dann kannst von mir aus wieder den Geist aufgeben.«
Vor meiner Scheidung hatte ich nie mit unbelebten Gegenständen geredet, jedenfalls nicht laut. Jetzt sprach ich mit meinem Pick-up, dem Toaster, meinen Bankauszügen, mit allem, was mir nicht widersprechen oder dummkommen konnte. Davon hatte ich mein Leben lang mehr als genug gehabt.
Jethro klopfte mit dem Schwanz auf den Vinylsitz. Eins musste man Jethro lassen: Er mochte meine Stimme. »Braver Junge«, sagte ich zu ihm. Klopf, klopf, klopf. Die Hitze im Wagen erreichte für ihn einen kritischen Punkt.
Was ich mehr als alles andere an ihm schätzte: Er grollte einem nie. Er beklagte sich nicht, schloss jeden ins Herz, er war das wohlwollendste Geschöpf auf Erden. Gefunden hatte ich ihn eines schönen Morgens auf einem meiner frühmorgendlichen Beutezüge, kurz nachdem mich Tal verlassen hatte.
Vor einem viktorianischen Stick-Style-Haus an der Habersham, das jemand gerade renovierte, hatte ein riesiger Haufen Sperrmüll nur auf mich gewartet. Nachdem ich beim Stöbern auf Teile eines Verandageländers sowie eines schmiedeeisernen Zauns und auf ein wunderschönes Buntglas-Sprossenfenster gestoßen war, hörte ich mit einem Mal ein klägliches Quieken. Wie von der Tarantel gestochen fuhr ich zurück, doch das Quieken hörte nicht auf, und selbst für die frechste Wanderratte von Savannah war es zu laut.
Ich tastete mich behutsam vor, stemmte mit dem Fuß ein Stück verrostete Regenrinne zur Seite und legte ein kleines schwarzweißes Fellknäuel frei. Es hatte ein rosa Schnäuzchen mit schwarzen Punkten und war nicht größer als eine Tüte Mehl. Zuerst sah dieses winzige Etwas tatsächlich aus, als wäre es von oben bis unten mit Mehl bestäubt, doch wie sich herausstellte, handelte es sich nur um Gipsstaub von den umliegenden Putzbrocken. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich ließ das Buntglas liegen, klemmte die Verandageländer unter den linken Arm, drückte mit der rechten Hand den kleinen Welpen an die Brust und suchte wie ein Dieb in der Nacht das Weite.
Der Tierarzt klärte mich auf, der Kleine habe Anteile von Beagle und Deutschem Schäferhund, sei aber vor allem eine Promenadenmischung. Für die Impfungen und die Entwurmungskur musste ich zweihundert Dollar hinblättern. Der Mischling war der einzige Hund, den ich je hatte. Daddy war auf dem Ohr immer taub gewesen, als Briefträger vielleicht verständlich. Ich nannte ihn Jethro, nach der Rockband Jethro Tull und nach Jethro Bodine, diesem Muskelprotz aus Beverly Hillbillies.
Als Jethro sich das erste Mal dabei erwischen ließ, wie er in Tals Hälfte des eingefriedeten Gartens an einem Kamelienstrauch das Bein hob, rief mein Ex bei seinem Anwalt und sein Anwalt bei meinem Anwalt an.
»Diese übergeschnappte Mieterin hält sich Tiere«, brüllte Tal, als James ihn in meiner Gegenwart zurückrief.
»Eloise ist keine Mieterin«, rief ihm James ins Gedächtnis. »Wirf mal einen Blick in die Vermögensvereinbarung. Eloise wurde das Kutscherhaus zugesprochen. Wenn ihr danach ist, kann sie sich Elefanten und Giraffen halten. Also, ich an deiner Stelle würde über den Hund kein weiteres Wort verlieren. Wer weiß, was sie andernfalls noch alles nach Hause schleppt.«
Wir hatten fast die Tore von Beaulieu erreicht. Höchste Zeit, denn bei einer Innentemperatur von mindestens dreißig Grad hing mir mein Kleid inzwischen wie welker Salat am Leib. Ich bog scharf nach rechts in die Einfahrt ab und hörte den Belag aus zerkleinerten Austernschalen unter den Reifen knirschen. Direkt hinter dem offenen Tor beugte ich mich über den Beifahrersitz und kurbelte die Scheibe herunter. Jethro streckte den Kopf hinaus, schnupperte und gab ein kurzes, anerkennendes Bellen von sich. Ich schwöre, der Hund hatte eine Spürnase für Antiquitäten.
Ich warf einen prüfenden Blick in den Rückspiegel. Mein kurzes, rotes Haar klebte mir am Kopf, und mein verschwitztes Gesicht glich sich meiner Haarfarbe an. Mein brauner Eyeliner verlief in den Augenwinkeln wie bei einem Bajazzo.
Ich tupfte gerade vorsichtig das verschmierte Make-up weg, als neben mir ein weißer Mercedes hielt und hupte.
James. An der Beifahrerseite glitt die Scheibe lautlos herunter, und mein Onkel rief herüber: »Das letzte Stück fährst du besser mit mir.«
»Gilt die Einladung auch für Jethro?«, rief ich zurück.
Mein Beifahrer war mir inzwischen auf den Schoß gesprungen und versuchte, den Kopf durch den Fensterspalt zu schieben, um seinem alten Kumpel James hallo zu sagen.
»Wenn er im Wagen auf uns wartet, ohne die Sitzpolster zu Hackfleisch zu machen.« Der Mercedes war ein Abschiedsgeschenk seiner Gemeinde in Florida. Ich bezeichnete ihn als Schlampenschlepper, James hielt dagegen, es sei nur recht und billig, sich – seit er nicht mehr an sein Armutsgelübde gebunden sei – für die vielen entbehrungsreichen Jahre mit einem Chevy zu entschädigen.
»Er wird sich benehmen«, versprach ich ihm.
James’ Wagen war der Inbegriff von Eleganz. Er roch nach neuem Leder und einem Hauch süßer Pfefferminze. Ich hielt meinen feuchten Kopf ins Gebläse der Klimaanlage und strich mir dabei mit den Fingern durchs Haar, um es schneller zu trocknen.
»Wusste gar nicht, dass du Anna Ruby Mullinax gekannt hast«, sagte James und zog dabei in dieser unnachahmlichen Weise halb fragend, halb amüsiert die Augenbrauen hoch.
»Wer sagt, dass ich sie gekannt habe?«, antwortete ich. »Aber das hier ist vielleicht meine einzige Chance, je in dieses Haus zu kommen. Für Mama ist mein Besuch ein Frevel.«
»Deine Mutter muss es ja wissen, da ist sie Expertin.«
»Aber du hast die alte Dame gekannt«, erwiderte ich, »sagt jedenfalls Janet.«
»Hat sie dir auch erzählt, wie wir uns kennengelernt haben?«
»Glaube nicht.«
»Ist schon lange her«, erinnerte sich James. »Es war damals, in dem Jahr, als ich in dieser kleinen neuen Kirche in Metter, Christ Our Hope, ausgeholfen habe. Müsste 1978 gewesen sein, so um den Dreh. Miss Mullinax rief bei mir an und erklärte, sie habe von einigen ›ihrer Leute‹ gehört, wir würden eine neue Kirche bauen.«
»Ich dachte, die Mullinaxes waren Episkopalisten«, warf ich ein.
»Stimmt, mit ›ihren Leuten‹ waren ehemalige schwarze Hausangestellte gemeint, die Nachfahren von Sklaven. Aber als die Bürgerrechtsbewegung salonfähig wurde, nahmen Familien wie die Mullinaxes ein Wort wie Sklaverei nicht mehr in den Mund. Eine beträchtliche Anzahl dieser Schwarzen lebte in Metter. Die meisten von ihnen waren katholisch und gehörten zu meiner neuen Gemeinde.«
»Was wollte sie von dir?«, fragte ich.
James schmunzelte. Er hatte das charakteristische Foley-Kinn, lang und kantig, und wenn er lächelte, was er häufig tat, bildeten sich unzählige kleine Fältchen um Mund und Augen.
»Sie wollte uns für die neue Kirche etwas stiften, zur Erinnerung an eine Frau namens Clydie. Clydie Jeffers. Bis zu ihrem Tod mit achtundachtzig Jahren war sie Miss Anna Rubys Haushälterin gewesen. Deshalb bin ich damals hierher nach Beaulieu rausgekommen, wir haben uns unterhalten, und am Ende hat Miss Anna Ruby das Gestühl für die Kirche gestiftet. Sie hat es aus Zypressen tischlern lassen, die hier auf dem Anwesen geschlagen wurden. Und auf einer kleinen Messingplakette stand: ›In stillem Gedenken an Clydie Jeffers‹. Die Spenderin blieb unerwähnt. Miss Anna Ruby legte größten Wert auf Anonymität.«
Der Moosbehang in den Zweigen über dem Muschelweg wogte in einer leichten Brise. Die knorrigen Lebenseichen standen in regelmäßigen Abständen zu beiden Seiten Spalier. Efeu wucherte an den Stämmen hoch, und die Kronen waren so dicht, dass sie fast gänzlich den strahlend blauen Himmel verdeckten. Ich blinzelte durch die Windschutzscheibe, und nach einer Weile kam die Silhouette des Hauses in Sicht, die bis über die Wipfel ragte. Ich reckte den Hals und wartete gespannt, bis das Haus vollständig ins Blickfeld rückte. Ich hatte lange darauf gewartet, Beaulieu aus nächster Nähe zu sehen.
»War sie nett?«, murmelte ich, während ich das Plantagenhaus anstarrte.
»Irgendwie anders«, sagte James. »Sie trug Hosen, daran erinnere ich mich genau. Ich hatte noch nie eine so alte Dame in Hosen gesehen. Und sie war barfuß. Deiner Großmama Foley wäre es im Traum nicht eingefallen, ohne Schuhwerk über die Schwelle ihres Schlafzimmers zu treten, geschweige denn, so unschicklich vor einem Fremden zu erscheinen, einem Priester obendrein. Miss Anna Ruby scherte sich nicht darum, was andere von ihr dachten, und sie ging sorgsam mit ihrem Geld um.«
Doch an diesem Punkt des Gesprächs hörte ich nur noch mit halbem Ohr zu. Wir waren da.
Dorische Säulen, drei Stockwerke hoch, zwölf an der Zahl, erstreckten sich über die gesamte Eingangsfront und waren von einer gedrechselten Balustrade sowie drei Giebeln bekrönt. Flankiert wurde der Bau von einstöckigen Seitenflügeln. Das Haus stand erhöht auf einem Fundament aus Kalkmörtel, dem Baumaterial aus Austernschalen, wie es für alte Häuser an der Küste, von South Carolina bis Georgia, typisch ist.
Eine geschwungene Doppeltreppe führte zum Portikus hinauf. Beaulieu war nicht wie die Hollywood-Version eines Plantagenhauses weiß gestrichen, sondern in einem blassen goldschimmernden Rosa, und die dunkelgrünen Klappläden an den breiten Sprossenfenstern bildeten einen reizvollen Kontrast. Es war imposant, nein, atemberaubend, mit unübersehbaren Zeichen des Verfalls.
Von den Säulen blätterte in langen Spänen die Farbe ab, die Sockel waren rissig und verfault wie die Zähne einer Stadtstreicherin. Vom Fundament aus hatte sich der Schimmel wie ein grünlicher Film über die gesamte Fassade ausgebreitet, die Holzlamellen der Fensterläden waren verrottet. Eins der Giebeldächer war eingestürzt, der Portikus in der Mitte abgesackt, und die einzigen Fenster, die nicht grau verschmiert und von Spinnweben verhangen waren, hatten keine Scheiben mehr.
»Oh«, sagte ich, als mein Staunen der Enttäuschung wich. Ich musste blinzeln. »Wie traurig.«
»Ja«, bestätigte James, »finde ich auch.«
Jethro drückte die Nase an die Scheibe, und ich schob sie sanft zur Seite.
»Damals in den Siebzigern war es noch nicht halb so verfallen«, sagte James.
Er folgte der Einfahrt bis zu einem ungepflasterten Bereich, der als Parkplatz diente, und fand eine Lücke zwischen zehn bis zwölf Fahrzeugen, die vor uns eingetroffen waren, darunter ein dottergelber Triumph Spitfire, der etwas abseits im Schatten eines Amberbaums stand.
Wie jedes Mal, wenn ich den Triumph sah, drehte sich mir der Magen um.
»Was zum Teufel hat die hier zu suchen?«, murmelte ich und packte James am Arm. »Die hat nicht den geringsten Sinn für alte Sachen.«
Obwohl die Klimaanlage noch lief, nestelte er an seiner Krawatte herum.
»Und wer ist bitte ›die‹?«
Ich zeigte auf den Triumph. Den Wagen kannte ich nur zu gut, denn er stand gewöhnlich auf meinem ehemaligen Stellplatz neben dem Kutscherhaus. Zwar hatte James für mich das kleine Haus hinter der großen Villa am Troup Square sowie die Hälfte des Gartens erstritten, doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte der Richter Tal meinen Parkplatz zugesprochen.
Und so hörte ich jeden Abend das Brummen des Triumphs, wenn er mit Vollgas den Gartenweg herunterkam und auf dem Stellplatz – meinem – zum Stehen kam, während mir nichts anderes übrigblieb, als meinen Pick-up draußen an der Charlton Street abzustellen, falls sich überhaupt eine Lücke fand.
»Caroline«, antwortete ich, »sie ist hier.«
James warf mir einen besorgten Blick zu. »Möchtest du lieber wieder fahren?«
»Nein, ich komm schon klar«, versicherte ich ihm, »solange sie nicht schon wieder irgendeine Gemeinheit ausheckt.«
James wurde ein wenig blass, ich tätschelte ihm aufmunternd die Hand, wandte mich zu Jethro um und kraulte ihn unter der Schnauze.
»Sei ein braver Hund und dass du mir Onkel James’ Zuhälterkarre nicht zerfleischst!« Dann ließ ich die Scheiben einen Spalt herunter und nahm all meinen Mut zusammen. »Auf geht’s.«
Die Eingangstür war hinter einer hässlichen Fliegengittertür im Stil der fünfziger Jahre versteckt, an der ein verwelkter Kranz aus Farn und Gänseblümchen hing und darunter eine handgeschriebene Karte mit der Aufforderung: »Bitte treten Sie ein.«
Über die verrottete Schwelle gelangten wir in eine andere Epoche. Leider nicht in den glorreichen Vorkriegssüden, sondern eher in die Jahre der Eisenhowerära.
Die großzügige Eingangsdiele war dunkel und angenehm kühl. Am Repro-Kronleuchter im Kolonialstil an der abgehängten Decke brannte noch eine einzige Birne. Die schönen alten Gipsputzwände waren blassrosa gestrichen, das aufwändige Eierstab-Stuckgesims und die Zierleisten in gedecktem Grau gehalten. An den Gartentüren waren die Jalousien heruntergelassen. Mein Blick fiel auf den Boden. Gott sei Dank. Wenn er auch unter einer dicken Schmutzschicht verschwand, waren die originalen Kiefernkernholzdielen noch erhalten.
James fasste mich sanft am Ellbogen und führte mich hinein. Zu beiden Seiten der Empfangshalle lagen identische Wohnzimmer. Der Raum zu meiner Rechten quoll von dicht zusammengerückten Möbeln über, drei lange aufgeklappte Spieltische waren so zusammengeschoben, dass darauf jede Menge Kristallglas, Porzellan, Silber und Antiquitäten Platz fand. Selbstverständlich steuerte ich dieses Zimmer an, doch James hielt mich zurück. »Die andere Seite«, flüsterte er.
Den Salon zur Linken hatte man weitgehend freigeräumt. In einem der geöffneten Fenster surrte ein billiger Kastenventilator und blies noch mehr feuchtheiße Luft in den stickig warmen Raum.
Die Gruppe, die sich hier versammelt hatte, umfasste nicht mehr als zwanzig Gäste. Die meisten Freunde von Anna Ruby Mullinax sahen mit ihrem schlohweißen Haar und den eingesackten Schultern so aus, als wären sie reif für ihren eigenen Trauergottesdienst. Die Männer wischten sich mit dem Taschentuch über das schweißnasse Gesicht, die Damen fächelten sich mit den Programmheften, die unweit der Haustür auf einem Tisch gestapelt waren, Luft zu.
Eine hochgewachsene, dünne Frau in weißem Priestergewand stand an einem hölzernen Rednerpult vor dem Kamin. Ihr schulterlanges weißes Haar bildete einen krausen Heiligenschein um ihren Kopf.
Doch ich war zu sehr damit beschäftigt, nach Caroline Ausschau zu halten, um der Geistlichen Beachtung zu schenken.
Sie sah mich zuerst und hob die Hand zum Gruß. Ich nickte höflich, während sich mir die Eingeweide zusammenkrampften und die Kopfhaut zu kribbeln begann.