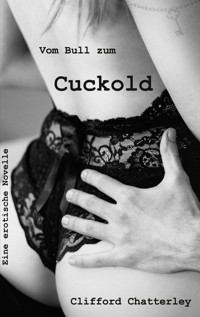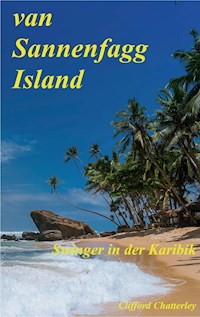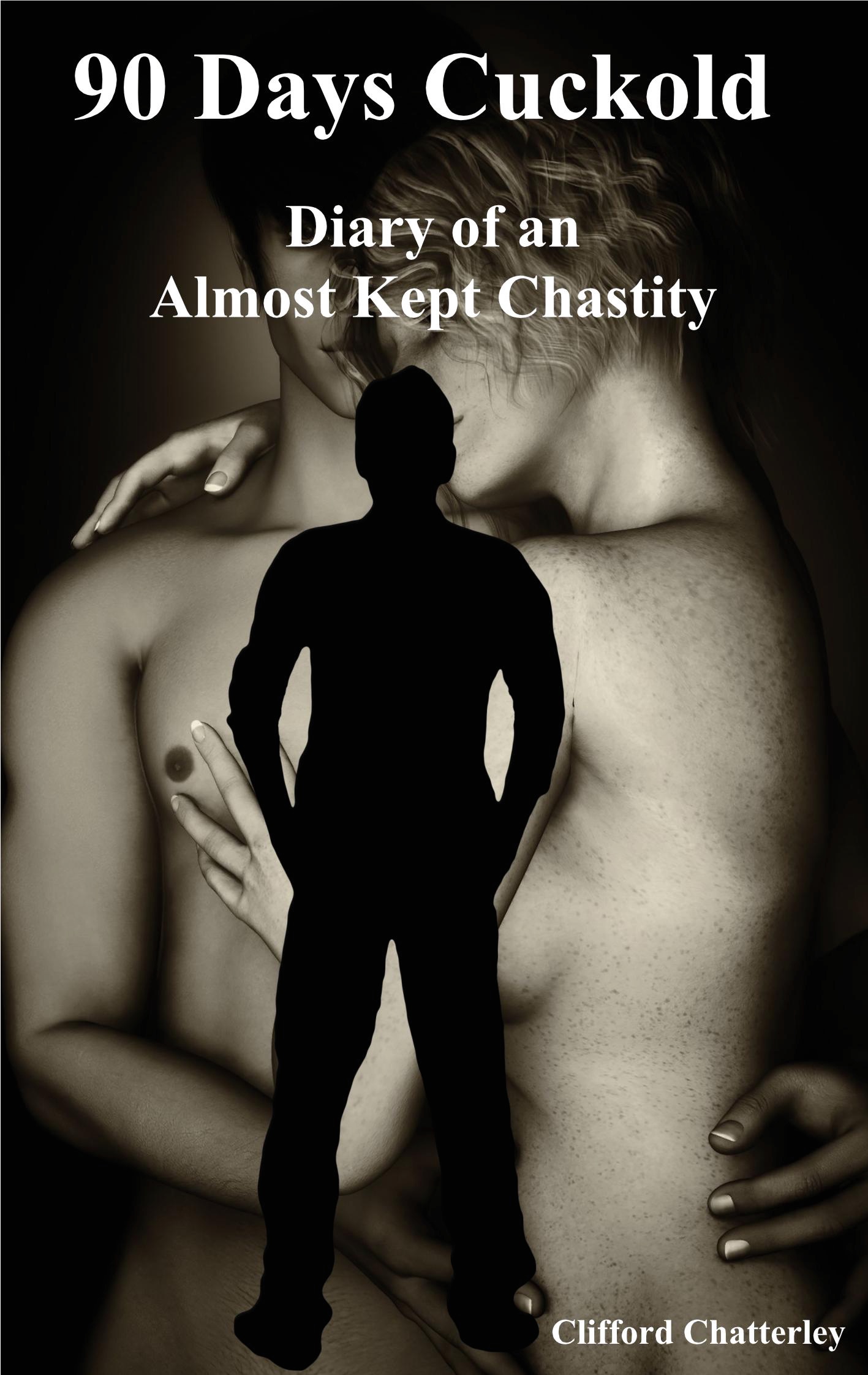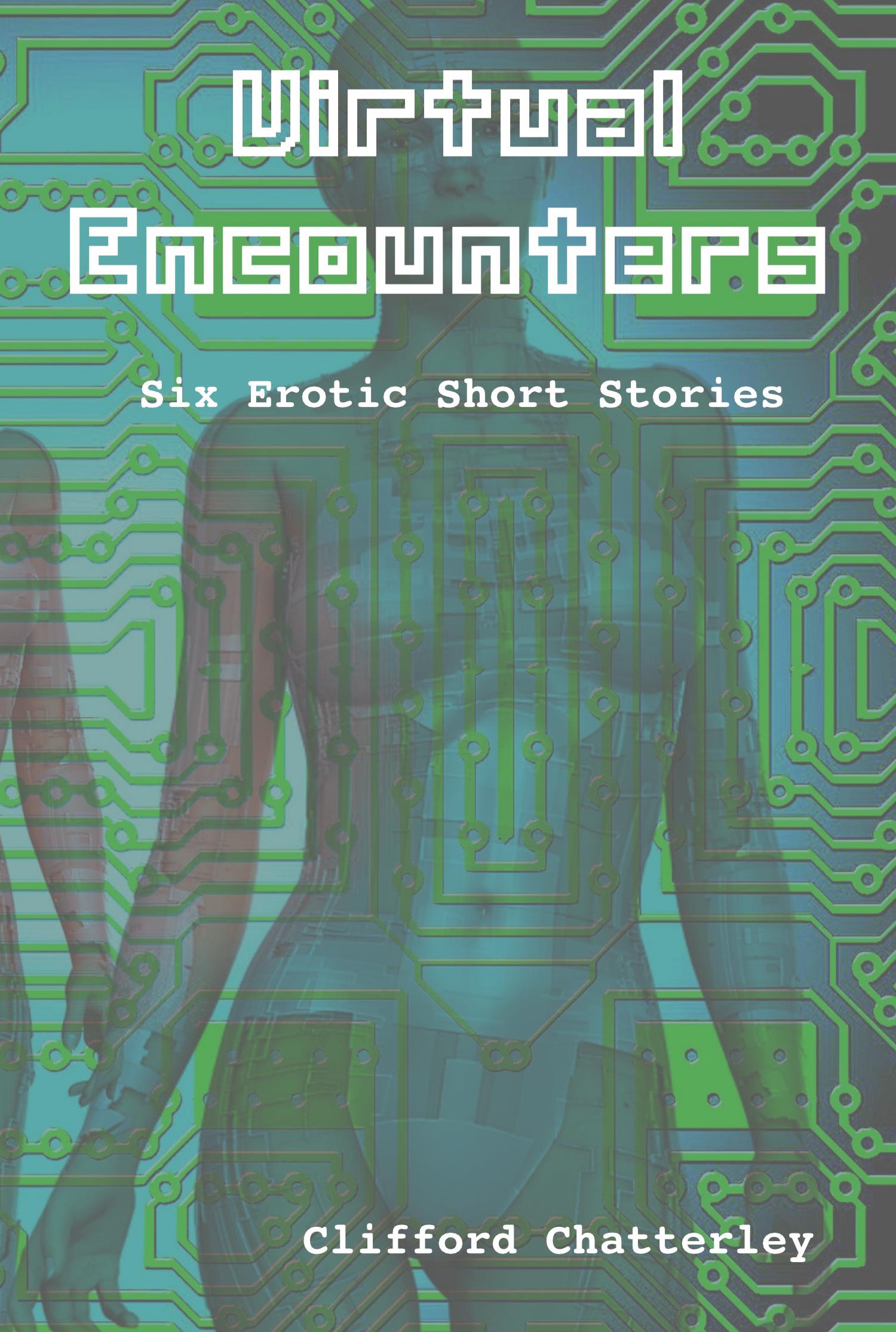Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf abgeschlossene Geschichten, fünf Zeitalter, fünf verschiedene Perspektiven auf das Thema Cuckolding: In der titelgebenden Geschichte vom gehörnten Figaro erzählt Suzanna, die Zofe der Gräfin Rosina und Geliebte des Grafen Almaviva, ihre eigene Version über ihre Hochzeit mit dem Barbier von Sevilla. Die Geschichte von Josef und Marie führt uns keineswegs in das Palästina der Zeitenwende, sondern in ein finsteres Tal zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, in dem eine Bauernfamilie immer noch das Sagen hat. In der Seeräuber-Jenny erzählt uns Markus, ein Gelegenheitsarbeiter im Hamburger Hafenviertel, wie er die Jenny in einer Kneipe kennen und lieben gelernt und mit ihr die Wirrnisse der Weltwirtschaftskrise überstanden hat. Menelaos, der König von Sparta, erzählt uns seine Version der Geschichte vom Raub seiner Gattin, der schönen Helena, durch Paris, den trojanischen Krieg und ihre Heimkehr aus Ägypten. Und mit Alma lernen wir eine Dame der Wiener Gesellschaft in den frühen Zwanziger Jahre kennen, die sich nach dem Tod ihres ersten Gatten selbst in den Mittelpunkt stellt und sich dabei nichts abgehen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fünf abgeschlossene Geschichten, fünf Zeitalter, fünf verschiedene Perspektiven auf das Thema Cuckolding:
In der titelgebenden Geschichte vom gehörnten Figaro erzählt Suzanna, die Zofe der Gräfin Rosina und Geliebte des Grafen Almaviva, ihre eigene Version über ihre Hochzeit mit dem Barbier von Sevilla.
Die Geschichte von Josef und Marie führt uns keineswegs in das Palästina der Zeitenwende, sondern in ein finsteres Tal zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, in dem eine Bauernfamilie immer noch das Sagen hat.
In der Seeräuber-Jenny erzählt uns Markus, ein Gelegenheitsarbeiter im Hamburger Hafenviertel, wie er die Jenny in einer Kneipe kennen und lieben gelernt und mit ihr die Wirrnisse der Weltwirtschaftskrise überstanden hat.
Menelaos, der König von Sparta, erzählt uns seine Version der Geschichte vom Raub seiner Gattin, der schönen Helena, durch Paris, den trojanischen Krieg und ihre Heimkehr aus Ägypten.
Und mit Alma lernen wir eine Dame der Wiener Gesellschaft in den frühen Zwanziger Jahre kennen, die sich nach dem Tod ihres ersten Gatten selbst in den Mittelpunkt stellt und sich dabei nichts abgehen lässt.
Inhalt
Josef und Marie
Der gehörnte Figaro
Die Seeräuber-Jenny
Die schöne Helena
Alma
Josef und Marie
Sie hatten es nicht eilig, die Brenners, als im Tal bekannt wurde, dass ich mit Marie ging. Nichts war eilig bei uns im Tal, die Brenners wussten, dass alles seine Ordnung haben würde, dass alles seinen Weg gehen würde. Und sie hatten Zeit und Geduld zu warten, bis ihren Schutzbefohlenen das eine oder andere ausging. Oder beides.
Aber alles schön der Reihe nach: Mein Name ist Josef. Zu der Zeit, wo die Geschichte spielt, war ich Anfang zwanzig, der einzige Sohn auf einem der Pachthöfe der Brenners. Ob man mich schön nennen hätte können, weiß ich nicht, ich selbst fühlte mich als nichts Besonderes, ich ragte einen Meter fünfundachtzig in die Höhe, von kompakter, vierschrötiger Statur, wie sie die Arbeit auf einem Bergbauernhof formt. Einzig mein krauses, fast blondes Haar war ungewöhnlich und wohl meiner Mutter geschuldet, deren rötliches Haar stets ein wenig keck unter dem Kopftuch vorlugte und ihr sommersprossiges Gesicht mit den freundlichen grünlichen Augen hübsch einrahmte. Sie war von auswärts ins Tal gekommen; zu welchen Bedingungen, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater mich immer angenommen hatte wie seinen eigenen Sohn, also war er mein Vater. Die schlichte, das Gehorchen gewohnte Psyche eines einfachen Bauernsohnes verhinderte sehr lange, dass ich mir die Frage überhaupt zu stellen wagte, die doch so offenkundig im Raum stand.
Heute ist mein Haar schon grau, unsere drei Kinder sind groß. Die Geschichte, die ich erzähle, ist so lang her, dass sich immer wieder gnädige Schleier des Vergessens über die Erinnerung zu legen versuchen. Und noch mehr über die Legenden, die erzählt werden über einen Samuel oder Sam, dem es vierzig, fünfzig Jahre davor gelungen sein sollte, Rache zu nehmen für den Tod seiner Eltern; den Brenner zu erschießen, den damaligen Herrn des Tales; seine Söhne in den Tod zu schicken, einen nach dem anderen. Und von der Luzi, der unnahbaren Schönen mit den dunklen, tiefgründigen Augen, der es gelungen sein soll, aus dem Gesetz des Tales auszubrechen, ihr erstes Kind von ihrem Mann Lukas unter dem Herzen zu tragen, ein Mädchen, Paula, die ihr einziges Kind bleiben sollte. Marie besaß ein Bild von ihr, von ihrer Großmutter, der sie glich wie ein Ei dem anderen. Äußerlich, aber wohl auch und noch viel mehr innendrin, bei allen Unterschieden des Weges, den der Herrgott ihnen auferlegte, an den sie glaubten, und der mit dem Pfarrer wenig zu schaffen hatte.
Legenden pflegen die Wirklichkeit zu verklären, die oft recht unspektakulär ist: Die Wahrheit war, dass Lukas und Luzi nicht mehr sehr lang in ihrer Heimat blieben. Der Erbhof beherrschte weiterhin das Tal, Lukas blieb ebenso Pächter der Brenners wie die restlichen Bauern. Die Erbfolge war bald geregelt, die Brenners hatte auch Sam nicht ausrotten können. Einer der verbliebenen Söhne, von denen es in jeder Bauernfamilie einen gab, saß fest im Sattel, die anderen notdürftig abgefunden, weggezogen oder tot. „Die Freiheit ist ein Geschenk, dass sich nicht jeder gern machen lässt“, soll Luzi immer wieder gesagt haben. Und dabei tiefgründig gelächelt haben. Das Dorf begann das Paar zu meiden, der damalige Brenner, der Vater des jetzigen Brenner, machte ihnen schließlich ein Angebot, das sie nicht ablehnen wollten. Genug, um in der Stadt ein neues Leben zu beginnen, wo der Ruf der Fabriken lockte, willige Arbeitskräfte immer gebraucht wurden.
Zwanzig Jahre später war Paula herangewachsen und hatte kurz vor dem Krieg einen jungen Fabrikarbeiter geheiratet. Der wurde zwei Jahre nach Maries Geburt eingezogen und fiel in einer der Isonzo-Schlachten. Ein anderer Mann kam für Paula nicht in Frage, sie musste also ihre Tochter allein aufziehen. Was bis zur Weltwirtschaftskrise gut funktionierte, dann standen die beiden plötzlich vor dem Nichts. In ihrer Not besannen sie sich wieder auf ihre Wurzeln und versuchten eine Rückkehr in das Tal von Maries Großmutter. Was Paula dafür tun hatte müssen, als Pächterin unseres Nachbarhofes aufgenommen zu werden, darüber hat sie bis zu ihrem frühen Tod nicht gesprochen. Marie hatte allerdings vor dem Pfarrer einen Eid leisten müssen, sich den Bedingungen zu unterwerfen, die im Tal unverändert herrschten. „Vor dem Pfarrer“, sagte sie stets, nicht „vor Gott“. Was sie aber nicht daran hinderte, sich an ihren Eid vor Gott gebunden zu fühlen.
*
Zu der Zeit, zu der diese Geschichte spielt, war Paula gerade ein halbes Jahr tot. Das stellte Marie neben dem unerwarteten Verlust auch vor ein gravierendes lebenspraktisches Problem: Allein konnte sie den Pachthof nicht bewirtschaften, und das war auch dem Brenner klar. Er stellte sie vor die Wahl, entweder bis zur Aussaat „jemanden“ zu finden oder das Pachtland zurückzugeben und aus dem Tal zu verschwinden.
Es war früher Februar, als Marie an unserer Türe klopfte. Ich war allein zu Hause, sie stand draußen, immer noch schwarz gekleidet, wie es die Sitte gebot, aber ohne Überkleidung. Ihr dunkles Haar schien unter dem Kopftuch nach hinten gebunden, doch einige Strähnen lugten fürwitzig hervor. „Komm erst mal rein, Marie.“ Meine Kehle war trocken. Sie streifte ihre Stiefel sorgfältig ab. „Danke, Josef“, sagte sie wie beiläufig mit ihrer dunklen, melodiösen Stimme, als sie in die Stube trat. Ich wunderte mich, dass sie „Josef“ sagte, im Tal nannte man mich nur den Sepp. „Die Eltern nicht da?“ Die Frage kam unvermittelt. „Nein, warum?“ „Ob ihr mein Vieh nehmt, wenn ich weggehe?“, fragte sie ruhig. „Eine Kuh, einen Ochsen, zwei Ziegen, eine Handvoll Hühner. Der Brenner gibt nichts dafür, es ist alles, was ich habe.“ „Weggehen?“, fragte ich. „Setz dich doch erst mal. Milch?“ Sie rutschte auf die Bank hinter dem Küchentisch, zog den heißen dampfenden Becher an sich. „Wenn ich jemanden finde, sagt der Brenner. In einem Monat müsste ich säen. Gehe ich jetzt, schulde ich wenigstens keine Pacht.“
Auch ich nahm mir einen Becher Milch, setzte mich ihr gegenüber, schwieg lang. Ihre dunklen Augen ruhten auf mir. Ein seltsames Gefühl ergriff von mir Besitz. Ich hätte gern gesagt, es war ums Herz, es war aber nicht ums Herz. Es war da, wo der Pfarrer immer sagte, dass man sich selbst nicht berühren soll. Ich nahm einen Schluck Milch. „Und du, was wirst machen?“, fragte ich. „Na was, in die Stadt. In die Fabrik, oder eine Stellung. Notfalls als Hur. Es wird schon gehen.“ Meine Kehle wurde immer trockener, trotz der Milch. Ich musste schlucken. Was eine Hur war, das wusste ich, vom Militärdienst. So selbstverständlich, wie sie das Wort aussprach, traf es mich mitten in die Magengrube „Und wenn du doch einen findest?“, fragte ich. Leise, scheu. Sie sah mich an, legte dann ohne jede Hast ihre Hand auf den Küchentisch. Ich war immer noch in diesem erregten Zustand, in dem das Denken schwer fiel. Doch hier gab es nichts misszuverstehen. Und auch nichts zu überlegen, in diesem Augenblick. Ich streckte also meine rechte aus, legte sie auf die ihre. Zitterte sie leicht? Oder war ich das? Unsere Blicke begegneten einander, die Zeit schien still zu stehen, als wir ineinander versanken, wie Ertrinkende. Es brauchte keine Worte.
„Dann ist das also entschieden“, hörte ich da eine Stimme hinter mir. Ich zuckte zusammen, ich hatte keine Ahnung, wie lang mein Elternpaar schon im Raum stand. „Das Land können wir brauchen, und du hast eine Beschäftigung, Sepp.“ Damit wandte er sich dem tabernakelartigen kleinen Wandschrank zu, in dem er seinen Schnaps aufbewahrte. Er stellte vier der kleinen Gläser auf den Tisch, schenkte sie voll, schob jedem eines zu. „Auf euch, Kinder“, sagte er, wartete nicht auf uns und leerte sein Glas. Marie schaute irritiert von einem zum anderen. Auch wenn sie wohl deswegen gekommen war: Sie schien sich gerade verschachert zu fühlen wie ein Stück Vieh. Mama schien das auch zu merken, sie ging auf Marie zu, nahm sie an beiden Händen: „Willkommen in unserer kleinen Familie, Marie“, sagte sie. Die beiden Frauen sahen einander lange in die Augen, schließlich schien alles geklärt. „Danke.“ Sie nahm ihr Glas, leerte es in einem Zug. Ich folgte ihrem Beispiel, die letzte war Mama. So kam es, dass wir miteinander gingen, Marie und ich.
„Komm, Bauer, ich zeig dir alles“, sagte Marie. Ich zögerte eine Weile, mein Erregungszustand war mittlerweile einigermaßen abgeklungen. Doch die ermunternden Blicke der Eltern waren deutlich genug. „Gern, Bäurin“, sagte ich also, stieg in meine Stiefel, nahm meine Jacke und folgte ihr. Es war nicht weit zu gehen, der Hof bot keine Überraschungen, die Pachthöfe stammten alle aus der selben Zeit, sie glichen einander wie ein Ei dem anderen. An diesem Nachmittag sah ich zum ersten Mal das Bild, Marie hatte es in der kleinen Kammer aufgehängt, die sie von Kind an bewohnte. „Bist das du?“, fragte ich ungläubig. „Nein, das ist die Luzi, meine Oma.“ Die Worte fielen beiläufig. Ich war momentan überwältigt von der Ähnlichkeit. Die Legende von der Luzi kannte ich natürlich, wie jeder im Tal, aber der Zusammenhang war mir nicht bewusst gewesen.
„Setz dich, ich erzähle es dir gern.“ Marie hielt meine Hand, als ich neben ihr saß, auf der Ofenbank in der kleinen Stube, und ich mich gefangennehmen ließ von ihrer warmen, melodiösen Stimme, mit der sie die Geschichte vortrug und kein noch so winziges Detail ausließ. Auch nicht, wie Luzi und Lukas ums Leben gekommen waren, von der Polizei erschossen auf einer Demonstration für die Rechte der Arbeiter. Mir entging die Träne nicht, die auf Maries Backe herunterfloss, als sie davon erzählte.
*
„Soso, Josef und Marie, das heilige Paar.“ Ein paar Wochen später, wir standen vor dem Brenner-Bauern in seiner guten Stube. Mich begleitete Mama, für Maries Vater, der irgendwo in Italien begraben lag, sprang halt mein Vater ein. Der Brenner war ein großer hagerer Mann, vielleicht Mitte 40, sein Haar bereits angegraut, ebenso wie der Bart, der seine Backen umrahmte. Neben ihm stand die Brennerin, sie wirkte im Vergleich zu ihm ausladend, wobei man aber nicht sagen konnte, ob das an ihrer Figur oder an der weit ausgestellten Tracht lag, die sie stets trug. Ihr Haar war noch dunkel, fast schwarz, sie wirkte deutlich jünger als der Brenner. Auch wenn sie die Aura einer Gutsherrin umgab, wirkte sie blass, der Ausdruck ihrer Augen stumpf, man hatte das Gefühl, dass sie unbeteiligt durch uns durchsah, wie wir so vor ihrem Mann standen, dem Herren des Tales. Der Brenner dachte eine Weile nach, nickte dann anerkennend. „Vier paar Hände, das langt für die beiden Höfe“, sagte er dann. „Meinen Segen habt ihr. Gibt es noch etwas?“