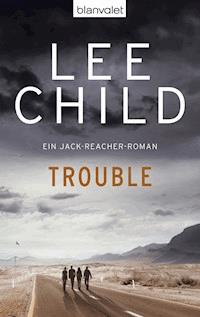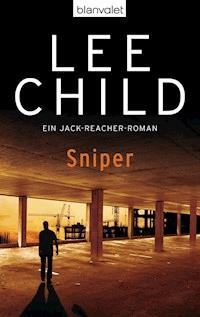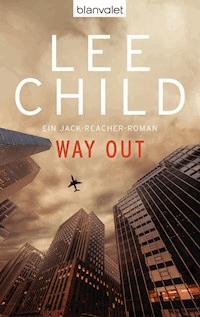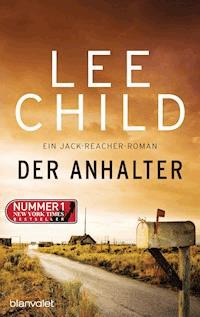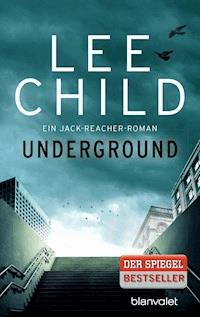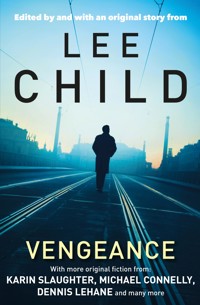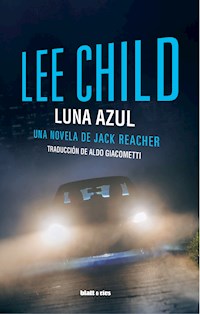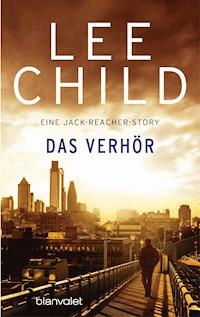Inhaltsverzeichnis
Buch
Autor
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Copyright
Buch
Vor sechs Jahren ist Jack Reacher als Spitzenermittler aus dem Militärdienst ausgeschieden. Seitdem ist er unterwegs. Ohne Familie, ohne offizielle Adresse, ohne Telefon, ohne Bankkonto. Bis er eines Abends zufällig einem Mann begegnet, der eigentlich tot sein müsste. Ein Schatten aus seiner Vergangenheit. Und Jack Reacher hasst unerledigte Geschäfte. Er will wissen, wem der Cadillac gehört, in den Quinn gestiegen ist – der Mann mit den unverwechselbaren Narben auf der Stirn. Die Anfrage bei seiner alten Dienststelle beschert ihm den Besuch zweier Agenten. Ihr Interesse gilt Zachary Beck, einem Top-Rauschgiftdealer, in dessen Haus Quinn lebt. Und schon findet sich Reacher mitten in einer hochriskanten Ermittlung wieder – als Leibwächter in Becks Haus, das einer Mafiafestung gleicht … Das Ende scheint klar. Alles scheint offensichtlich in diesem Fall – nichts ist es. Denn Lee Child ist ein Meister der unerwarteten Wendung, wenn man sie am wenigsten erwartet – bis zur letzten Seite.
Autor
Lee Child, in England geboren, studierte Jura und arbeitete dann viele Jahre als Produzent beim Fernsehen. Heute lebt er mit seiner Familie im US-Bundesstaat New York. Lee Child wurde in den USA bereits mit dem »Anthony Award«, dem renommiertesten Preis für Spannungsliteratur, ausgezeichnet. Sein Held Jack Reacher hat weltweit eine riesige Fangemeinde.
Von Lee Child außerdem lieferbar:
Tödliche Absicht. Ein Jack-Reacher-Roman (36285), Zeit der Rache. Ein Jack-Reacher-Roman (35715), Sein wahres Gesicht. Ein Jack-Reacher-Roman (35692), In letzter Sekunde. Ein Jack-Reacher-Roman (35577)
Zuletzt in gebundener Ausgabe:
Die Abschussliste. Ein Jack-Reacher-Roman (0182)
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2003 unter dem Titel »Persuader« bei Bantam Press, Transworld Publishers, The Random House Group Ltd., London.
1
Genau vier Minuten, bevor er erschossen wurde, stieg der Cop aus seinem Wagen. Er bewegte sich, als kenne er sein Schicksal bereits. Er stieß die Fahrertür gegen den Widerstand schlecht geölter Scharniere auf, rutschte auf dem abgewetzten Kunstledersitz langsam nach links und stellte beide Füße flach auf den Asphalt. Dann packte er den Türrahmen mit beiden Händen und hievte sich nach oben und aus dem Wagen. Er blieb einige Sekunden in der kalten, klaren Luft stehen, bevor er sich umdrehte und die Tür hinter sich abschloss. Verharrte noch einen Augenblick, ging nach vorn und lehnte sich in der Nähe des linken Scheinwerfers an den Kotflügel.
Der Wagen war ein sieben Jahre alter Chevy Caprice. Ein schwarzes Fahrzeug ohne Polizeikennzeichnung. Aber es verfügte über drei Antennen und hatte einfache verchromte Radkappen. Die meisten Cops, mit denen man redete, waren davon überzeugt, dass der Caprice das beste jemals gebaute Polizeifahrzeug sei. Dieser Kerl, der aussah wie ein altgedienter Kriminalbeamter, dem der gesamte Fuhrpark zur Verfügung steht, schien derselben Meinung zu sein. Ich konnte diese Art dickköpfiger Oldtimerpersönlichkeit daran erkennen, wie er sich hielt. Er war groß und massig und trug einen schlichten dunklen Anzug aus einem schweren Wollstoff. Ein alter Mann. Er bewegte den Kopf, schaute zuerst die Straße entlang und dann über die Schulter zum Collegetor. Er stand dreißig Meter von mir entfernt.
Das Collegetor selbst hatte lediglich symbolische Funktion. Zwei hohe gemauerte Klinkerpfeiler ragten einfach aus der weiten gepflegten Rasenfläche jenseits des Gehsteigs auf. Zwischen ihnen hing ein zweiflügliges Tor aus zu Fantasiegebilden gebogenen, abgewinkelten und verdrehten Eisenstangen. Das Tor glänzte schwarz, wie frisch gestrichen. Wer es nicht benutzen wollte, fuhr einfach über den Rasen. Es stand ohnehin weit offen. Hinter ihm lag eine Zufahrt mit kniehohen kleinen Eisenpollern an beiden Seiten, an denen jeweils ein Torflügel befestigt war. Die Zufahrt führte leicht abfallend zu einer etwa hundert Meter entfernten Ansammlung von Klinkergebäuden mit Moos bewachsenen Steildächern unter überhängenden Bäumen. Die Zufahrt war mit Bäumen gesäumt, ebenso der Gehsteig. Überall standen Bäume. Ihre Blätter waren noch klein, zusammengerollt und lindgrün. In einem halben Jahr würden sie groß, rot und golden sein und den Fotografen Motive für den Collegeprospekt liefern.
Zwanzig Meter jenseits des Tors parkte auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Pick-up. Er stand in fünfzig Meter Entfernung mir zugekehrt dicht am Randstein. Irgendwie passte er nicht hierher. Sein roter Lack war verblasst, und vorn hatte er einen wuchtigen Rammbügel, der aussah, als wäre er schon mehrmals verbogen und wieder ausgerichtet worden. Im Fahrerhaus saßen zwei Männer, jung, groß, blond, mit klar geschnittenen Gesichtszügen. Sie saßen völlig unbeweglich da und blickten nach vorn, ohne etwas Bestimmtes anzuvisieren.
Ich war im Süden stationiert und parkte mit einem anonymen braunen Lieferwagen vor einem Musikgeschäft – ein Laden, den man in der Nähe eines Collegetors zu finden erwartet. Draußen auf dem Gehsteig standen Tische mit gebrauchten CDs, und in den Schaufenstern dahinter hingen Poster, die für Bands warben, welche kein Mensch kannte. Ich hatte die Hecktüren des Lieferwagens geöffnet. Auf der Ladefläche waren Pappkartons gestapelt. Ich hielt einen Packen Lieferscheine in der Hand, und weil es an diesem Aprilmorgen kalt war, trug ich einen kurzen Mantel. Ich hatte auch Handschuhe an, weil an den bereits aufgerissenen Kartons im Laderaum lose Klammern hingen. Ich trug eine Waffe, weil ich das oft tat. Sie steckte hinten im Hosenbund. Die Waffe war ein Colt Anaconda: ein riesiger Revolver aus rostfreiem Stahl, der 44er-Magnum-Patronen verschoss. Er war fünfunddreißig Zentimeter lang und wog über anderthalb Kilo. Als Waffe nicht gerade meine erste Wahl. Der Colt fühlte sich hart, schwer und kalt an, und ich war mir seiner Gegenwart ständig bewusst.
Ich blieb mitten auf dem Gehsteig stehen, schaute von meinen Lieferscheinen auf und hörte den Motor des weit entfernten Pick-ups anspringen. Er fuhr jedoch nicht los, sondern blieb mit laufendem Motor stehen. Es war früh und die Straße noch menschenleer. Ich trat hinter meinen Lieferwagen und blickte die Fassade des Musikgeschäfts entlang zu den Collegegebäuden. Sah vor einem davon einen schwarzen Lincoln Town Car warten, neben dem zwei Männer standen. Sie sahen auch aus hundert Metern Entfernung nicht gerade wie Chauffeure aus. Chauffeure treten nicht paarweise auf, sind meist auch nicht jung und muskulös und wirken nicht angespannt und wachsam. Diese Kerle waren wohl eher Leibwächter.
Das Gebäude, vor dem der Lincoln parkte, schien irgendein kleines Studentenwohnheim zu sein. Über seiner massiven Holztür standen griechische Buchstaben. Während ich die Szene beobachtete, ging die schwere Tür auf, und ein hagerer Junge trat ins Freie. Er hatte langes, fettiges Haar, war mager und wie ein Obdachloser gekleidet, führte aber eine Reisetasche bei sich, deren teures Leder glänzte. Einer der Leibwächter passte auf, während der andere die Autotür aufhielt. Der Junge warf seine Reisetasche auf den Rücksitz und rutschte ebenfalls ins Wageninnere. Er schloss die Tür selbst. Der Knall, mit dem sie zufiel, kam schwach und gedämpft bei mir an. Die Leibwächter blickten sich kurz um und stiegen dann beide vorn ein. Im nächsten Augenblick fuhr der Wagen an. Dreißig Meter dahinter rollte ein Fahrzeug des College-Sicherheitsdienstes langsam hinter ihm her – nicht etwa, um eine Kolonne zu bilden, sondern nur zufällig in dieselbe Richtung unterwegs. Es war mit zwei Security-Leuten besetzt. Die beiden hockten tief in ihren Sitzen und wirkten gelangweilt.
Ich zog die Handschuhe aus, warf sie hinten in meinen Lieferwagen und trat auf die Straße hinaus, um alles besser beobachten zu können. Ich sah den Lincoln mit mäßiger Geschwindigkeit die Zufahrt entlangkommen. Er war schwarz, makellos gepflegt und verfügte über reichlich Chrom. Die Collegecops befanden sich weit dahinter. Der Wagen hielt kurz an dem mit Ornamenten geschmückten Tor, dann bog er links ab und fuhr nach Süden auf den schwarzen Caprice des Kriminalbeamten zu. Auf mich zu.
Was dann geschah, dauerte acht Sekunden, die mir jedoch nur wie ein Wimpernschlag erschienen.
Der blassrote Pick-up fuhr zwanzig Meter hinter dem Caprice an. Er beschleunigte stark, schloss zu dem Lincoln auf, zog nach links und holte ihn genau auf Höhe des schwarzen Dienstwagens ein. Dann beschleunigte er noch etwas, und sein Fahrer riss das Lenkrad so nach rechts, dass die Ecke des Rammbügels den Kotflügel des Lincoln genau in der Mitte traf. Der Fahrer des Pick-ups ließ das Lenkrad eingeschlagen und den Fuß auf dem Gaspedal und drängte den Lincoln von der Fahrbahn aufs Bankett ab. Der Lincoln wurde abrupt langsamer und knallte dann frontal an einen Baum. Metall verbog sich kreischend, Scheinwerferglas zersplitterte, und aus dem Kühler stieg eine riesige Dampfwolke auf.
Die beiden Männer stürmten aus ihrem Pick-up. Sie hatten schwarze Maschinenpistolen, mit denen sie den Lincoln unter Feuer nahmen. Ihr Hämmern war ohrenbetäubend laut, und ich sah die Messinghülsen verschossener Patronen in weitem Bogen auf den Asphalt regnen. Dann erreichten die Kerle die Türen des Lincoln. Rissen sie auf. Einer von ihnen begann den Jungen herauszuzerren. Der andere gab noch einen Feuerstoß auf die Vordersitze ab, griff anschließend mit der linken Hand in seine Tasche und holte so etwas wie eine Handgranate heraus. Warf sie in den Lincoln, knallte die Türen zu, packte seinen Kumpel und den Jungen an den Schultern, drehte sie weg und zwang sie mit sich in die Hocke. Im Wageninneren blitzte eine gleißend helle Detonation auf. Alle Fenster zersplitterten. Obwohl ich über zwanzig Meter entfernt war, nahm ich den Explosionsdruck ganz deutlich wahr. Glassplitter spritzten nach allen Seiten. Dann rappelte sich der Kerl, der die Handgranate geworfen hatte, auf und spurtete zur Beifahrertür des Pick-ups. Der andere stieß den Jungen vor sich her ins Fahrerhaus und zwängte sich hinter ihm hinein. Die Türen wurden zugeknallt, und ich sah den Jungen zwischen den Kerlen eingezwängt auf dem Mittelsitz hocken. Auf seinem Gesicht zeichnete sich Entsetzen ab. Er war vor Schock leichenblass, und trotz der schmutzigen Windschutzscheibe konnte ich erkennen, wie er den Mund zu einem stummen Schrei aufriss. Ich hörte den Motor aufheulen und die Reifen quietschen, und dann kam der Pick-up direkt auf mich zu.
Der Wagen war ein Toyota. Ich konnte das Wort TOYOTA hinter dem Rammbügel auf der Motorhaube lesen. Er war hochbeinig, und ich sah das große schwarze Differenzial in der Vorderachse. Es hatte die Größe eines Fußballs. Allradantrieb. Riesige Breitreifen. Beulen und verblasster Lack, der seit der Auslieferung nicht mehr gewaschen worden war. Er kam genau auf mich zu.
Mir blieb weniger als eine Sekunde, um mich zu entscheiden.
Ich schlug meinen Mantel zurück und zog den Colt. Zielte sehr sorgfältig und schoss ein Mal auf den Kühlergrill des Toyota. Der große Revolver blitzte und knallte. Das riesige Geschoss Kaliber 44 zerschmetterte den Kühler. Ich schoss wieder – diesmal auf den linken Vorderreifen. Ließ ihn in einer spektakulären Detonation aus schwarzen Gummiteilen hochgehen. Meterlange Gummistreifen wirbelten durch die Luft. Der Pick-up geriet ins Schleudern und kam so zum Stehen, dass die Fahrerseite mir zugewandt war. Zehn Meter entfernt. Ich verschwand hinter meinem Wagen, knallte die Hecktüren zu, tauchte auf dem Gehsteig auf und schoss diesmal auf den linken Hinterreifen. Mit demselben Ergebnis. Überall flog Gummi herum. Der Pick-up krachte auf die linken Felgen herunter und blieb stark geneigt stehen. Der Fahrer stieß die Tür auf, sprang auf die Straße und richtete sich auf einem Knie auf. Er hielt seine MP in der falschen Hand, wechselte sie rasch in die andere. Ich wartete, bis ich ziemlich sicher war, dass er damit auf mich zielen würde. Dann benutzte ich die linke Hand, um meinen rechten Unterarm mit dem schweren Colt zu stabilisieren, und zielte sorgfältig auf die Körpermitte, wie ich’s vor langer Zeit gelernt hatte, und drückte ab. Der Brustkorb des Kerls schien in einer riesigen Blutwolke zu explodieren. Der magere Junge hockte schreckensbleich im Fahrerhaus. Starrte nur entsetzt nach vorn. Doch der zweite Kerl war aus dem Pick-up gesprungen und kam um die Motorhaube herum auf mich zugehastet. Seine MP schwenkte in meine Richtung. Ich wandte mich ihm zu, wartete einen Herzschlag lang und zielte auf seine Brust. Schoss. Mit demselben Ergebnis. Er ging in einer Wolke aus aufspritzendem Blut neben dem Kotflügel zu Boden und blieb auf dem Rücken liegen.
Der magere Junge im Fahrerhaus bewegte sich jetzt. Ich rannte zu ihm und zerrte ihn direkt über die Leiche des ersten Kerls heraus. Schleppte ihn zu meinem Lieferwagen. Stieß ihn auf den Beifahrersitz, schlug die Tür zu, warf mich herum und wollte zur Fahrertür rennen. Aus dem Augenwinkel heraus bemerkte ich einen dritten Mann auf mich zukommen. Er griff in seine Jacke. Ein großer, schwerer Kerl in dunkler Kleidung. Ich schoss und sah seine Brust in einer Blutwolke zerplatzen – in genau der Zehntelsekunde, in der mir klar wurde, dass dies der alte Cop aus dem Caprice war, der in seine Jacke gegriffen hatte, um seine Plakette herauszuholen. Sie war ein goldenes Schild in einem abgewetzten Lederetui, das ihm jetzt aus der Hand flog, sich mehrmals überschlug und dicht vor meinem Wagen am Randstein landete.
Die Zeit stand still.
Ich starrte den Cop an. Er lag im Rinnstein auf dem Rücken. Seine Brust war eine einzige rote Masse. Alles war voller Blut. Aber es quoll nicht, wurde nicht herausgepumpt. Kein sichtbarer Herzschlag. Sein Oberhemd wies ein großes gezacktes Loch auf. Er lag völlig still. Sein Kopf war so zur Seite gedreht, dass eine Wange auf dem Asphalt lag. Seine Arme waren ausgebreitet, und ich konnte die Venen auf den Handrücken erkennen. Die Schwärze des Asphalts, das lebhafte Grün des Grases und das leuchtende Blau des Himmels waren mir sehr bewusst. Während das Echo der Schüsse noch in meinen Ohren dröhnte, konnte ich das Rascheln der von einer Brise bewegten jungen Blätter hören. Ich sah, wie der magere Junge durch die Windschutzscheibe meines Lieferwagens erst den niedergeschossenen Cop und dann mich anstarrte. Ich sah den Streifenwagen des College-Sicherheitsdienstes durchs Tor rollen und nach links abbiegen. Er fuhr langsamer, als er hätte fahren sollen. Hier waren unzählige Schüsse gefallen. Vielleicht machten sie sich Sorgen darüber, wo ihr Zuständigkeitsbereich begann und wo er endete. Vielleicht hatten sie einfach nur Angst. Ich sah ihre blassen Gesichter hinter der Windschutzscheibe. Ihr Wagen kam mit weniger als fünfzehn Meilen auf mich zugekrochen. Ich blickte auf die goldene Plakette im Rinnstein hinab. Das Metall war durch lebenslanges Tragen blank gewetzt. Ich blieb unbeweglich stehen. Schon vor langem hatte ich eines gelernt: dass es ganz einfach ist, einen Mann zu erschießen, aber völlig unmöglich, ihn wieder lebendig zu machen.
Ich hörte, wie der Wagen der Collegecops langsam auf mich zurollte, hörte, wie seine Reifen über Splitt knirschten. Sonst war alles still. Dann begann die Zeit wieder zu laufen, und eine Stimme in meinem Kopf kreischte Los, los, los!, und ich rannte los. Ich hechtete in den Lieferwagen, warf den Colt auf den Mittelsitz, ließ den Motor an und wendete so scharf, dass die äußeren Räder die Bodenhaftung verloren. Der magere Junge wurde dabei durchs Fahrerhaus geschleudert. Ich stellte das Lenkrad wieder gerade, gab Vollgas und raste nach Süden davon. Mein Blickfeld im Rückspiegel war beschränkt, aber ich sah, dass die Collegecops sofort ihre Blinkleuchten einschalteten und die Verfolgung aufnahmen. Der Junge neben mir gab keinen Laut von sich. Sein Mund stand offen. Er konzentrierte sich darauf, auf seinem Sitz zu bleiben. Ich konzentrierte mich darauf, noch weiter zu beschleunigen. Zum Glück herrschte nur wenig Verkehr. Dies war eine verschlafene Kleinstadt in New England – und das am frühen Morgen. Ich brachte die Geschwindigkeit auf ungefähr siebzig, umklammerte das Lenkrad, bis meine Fingerknöchel weiß hervortraten, und stierte verbissen nach vorn.
»Wie weit sind sie zurück?«, fragte ich den Jungen.
Er gab keine Antwort, lehnte nur zusammengekrümmt in seiner Ecke und starrte den schmutzig grauen Wagenhimmel an. Mit der rechten Hand stützte er sich von der Tür ab. Blasse Haut, lange Finger.
»Wie weit zurück?«, wiederholte ich. Der Motor röhrte.
»Sie haben einen Cop erschossen«, sagte er. »Dieser alte Mann war ein Cop, müssen Sie wissen.«
»Ich weiß.«
»Sie haben ihn erschossen.«
»Unfall«, sagte ich. »Wie weit sind die anderen zurück?«
»Er wollte Ihnen seine Plakette zeigen.«
»Wie weit sind die anderen zurück?«
Er raffte sich auf, drehte sich um und versuchte, durch die kleinen Fenster in den Hecktüren zu sehen.
»Dreißig Meter«, sagte er dann. Seine Stimme klang vage und ängstlich. »Verdammt nah. Der Beifahrer hängt mit einer Waffe in der Hand aus dem Fenster.«
Wie auf ein Stichwort hin hörte ich den Schussknall einer Handfeuerwaffe, der das Röhren des Motors und das Quietschen der Reifen übertönte. Ich griff nach dem Colt neben mir. Ließ ihn wieder fallen. Er war leer geschossen. Ich hatte bereits sechsmal gefeuert. Ein Autokühler, zwei Reifen, zwei Kerle. Und ein Cop.
»Handschuhfach«, sagte ich.
»Sie sollten anhalten«, sagte er. »Ihnen alles erklären. Sie haben mir geholfen. Das mit dem Cop war ein Irrtum.« Er sah mich nicht an, starrte weiter aus den Heckfenstern.
»Ich habe einen Cop erschossen«, erwiderte ich mit einer völlig neutral klingenden Stimme. »Das ist alles, was sie wissen, was sie wissen wollen. Wie oder warum ist ihnen scheißegal.«
Der Junge schwieg.
»Handschuhfach«, wiederholte ich.
Er drehte sich wieder um und öffnete die Klappe. Im Handschuhfach lag eine zweite Anaconda. Identisch. Glänzender rostfreier Stahl, voll geladen. Ich nahm dem Jungen den Colt aus der Hand und kurbelte das Fenster herunter. Kalte Luft wehte wie ein Sturmwind herein und brachte das stetige Knallen einer Handfeuerwaffe mit.
»Scheiße«, sagte ich.
Der Junge schwieg. Die Schüsse knallten weiter. Wie können sie uns nur verfehlen?
»Runter auf den Boden«, befahl ich.
Ich rutschte seitlich tiefer, bis meine linke Schulter am Türrahmen anlag, und streckte den angewinkelten rechten Arm so weit aus dem Fenster, dass der Revolver nach hinten zeigte. Als ich den ersten Schuss abgab, starrte der Junge mich entsetzt an, rutschte nach vorn und verkroch sich mit schützend über den Kopf gelegten Händen im Fußraum vor dem Beifahrersitz. Sekunden später explodierte drei Meter hinter der Stelle, an der sein Kopf sich befunden hatte, das Fenster in der Hecktür.
»Scheiße«, sagte ich wieder und lenkte nach links, um meinen Schusswinkel zu verbessern. Schoss erneut nach hinten.
»Ich brauche Sie als Aufpasser«, sagte ich. »Aber bleiben Sie so tief wie möglich unten.«
Der Junge rührte sich nicht.
»Los, kommen Sie rauf!«, sagte ich. »Sofort!«
Er stemmte sich ein wenig hoch und drehte den Oberkörper, bis er gerade so eben nach hinten blicken konnte. Ich bemerkte, wie er das zerschossene Heckfenster registrierte, und erkannte, dass sein Kopf sich in gerader Linie mit dem Fenster befunden hatte.
»Ich fahre jetzt etwas langsamer«, erklärte ich. »Und weiter rechts, damit sie zum Überholen ansetzen können.«
»Tun Sie’s nicht«, warnte mich der Junge. »Sie können diese Sache noch in Ordnung bringen.«
Ich ignorierte ihn. Verringerte mein Tempo auf ungefähr fünfzig und fuhr scharf rechts, sodass der Streifenwagen der Collegecops instinktiv nach links zog, um sich neben mich zu setzen. Ich schoss meine drei letzten Patronen auf ihn ab. Seine Windschutzscheibe zersplitterte, und er schleuderte wild über die gesamte Straßenbreite, als sei der Fahrer getroffen oder wenigstens einer der Reifen. Er geriet aufs gegenüberliegende Bankett, pflügte mit dem Kühler durch die sich dort befindliche niedrige Hecke und verschwand außer Sichtweite. Ich warf den leeren Revolver auf den Sitz neben mich, kurbelte das Fenster hoch und gab wieder Vollgas. Der Junge sagte nichts, starrte nur nach hinten in den Lieferwagen.
»Okay«, sagte ich ziemlich außer Atem. »Jetzt kann uns erst mal nichts passieren.«
Der Junge wandte sich zu mir.
»Sind Sie verrückt?«, fragte er.
»Wissen Sie, was mit Leuten geschieht, die Cops erschießen?«, fragte ich zurück.
Darauf wusste er keine Antwort. Wir fuhren etwa eine halbe Meile weit schweigend weiter, wie hypnotisiert durch die Windschutzscheibe starrend. Das Innere des Wagens stank nach Pulverdampf.
»Es war ein Unfall«, sagte ich. »Ich kann ihn nicht wieder lebendig machen. Also finden Sie sich gefälligst damit ab.«
»Wer sind Sie?«, fragte er.
»Nein, wer sind Sie?«, erwiderte ich.
Er verstummte, atmete schwer. Ich blickte in den Rückspiegel. Die Straße hinter uns war völlig leer. Auch vor uns war niemand zu sehen. Wir befanden uns weit außerhalb der Stadt. Ungefähr zehn Minuten von einem Highwaykreuz entfernt.
»Ich bin eine Zielperson«, sagte er. »Für eine Entführung.«
Eine seltsame Wortwahl.
»Die Kerle wollten mich entführen«, sagte er.
»Glauben Sie?«
Er nickte. »Das wäre nicht das erste Mal.«
»Weshalb?«
»Geld«, sagte der Junge. »Weshalb sonst?«
»Sie sind reich?«
»Mein Vater schon.«
»Wer ist er?«
»Nur irgendein Typ.«
»Aber ein reicher Typ«, sagte ich.
»Er ist Teppichimporteur.«
»Teppiche? Was, wie Auslegeware?«
»Orientteppiche.«
»Als Importeur von Orientteppichen kann man reich werden?«
»Sehr«, sagte der Junge.
»Haben Sie auch einen Namen?«
»Richard«, sagte er. »Richard Beck.«
Ich schaute wieder in den Rückspiegel. Die Straße hinter uns war immer noch leer. Ich nahm etwas Gas zurück und versuchte, wie ein normaler Mensch zu fahren.
»Also, wer waren diese Kerle?«, wollte ich wissen.
Richard Beck schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«
»Sie wussten, wo Sie sein würden. Und wann.«
»Ich wollte zum Geburtstag meiner Mutter nach Hause fahren. Er ist morgen.«
»Wer könnte das wissen?«
»Schwer zu sagen. Jeder, der meine Familie kennt. Jeder in der Teppichszene, denke ich. Wir sind ziemlich bekannt.«
»Es gibt eine Szene?«, fragte ich. »In Teppichen?«
»Wir konkurrieren alle miteinander«, antwortete er. »Dieselben Lieferanten, dieselben Märkte. Wir kennen uns alle.«
Ich schwieg eine Weile.
»Haben Sie einen Namen?«, erkundigte er sich.
»Nein«, sagte ich.
Er nickte, als verstehe er das. Cleverer Junge.
»Was haben Sie jetzt vor?«, fragte er.
»Ich setze Sie in der Nähe des Highways ab«, erwiderte ich. »Sie können per Anhalter weiterfahren oder sich ein Taxi rufen und dann vergessen, dass Sie mich jemals gesehen haben.«
Er wurde sehr still.
»Ich kann Sie nicht zur Polizei bringen«, sagte ich. »Das ist unmöglich. Das verstehen Sie doch, oder? Ich habe einen Menschen erschossen. Vielleicht sogar drei. Das haben Sie selbst gesehen.«
Er schwieg weiter. Zeit, einen Entschluss zu fassen. Noch sechs Minuten bis zum Highway.
»Sie würden mich einsperren und den Schlüssel wegwerfen«, fuhr ich fort. »Ich hab Scheiße gebaut, es war ein Unfall, aber sie würden mir nicht glauben. Das tun sie nie. Also verlangen Sie nicht, dass ich zu irgendwem gehe. Ich verschwinde, als hätte ich nie existiert. Ist das klar?«
Er schwieg.
»Und geben Sie ihnen keine Personenbeschreibung«, erklärte ich. »Erzählen Sie ihnen, Sie könnten sich nicht an mich erinnern. Erzählen Sie ihnen, dass Sie unter Schock gestanden haben. Sonst finde ich heraus, wo Sie sind, und bringe Sie um.«
Er gab keine Antwort.
»Ich setze Sie irgendwo ab«, sagte ich. »Als hätten Sie mich nie gesehen.«
Er drehte sich zu mir und sah mich an.
»Fahren Sie mich nach Hause«, sagte er. »Die ganze Strecke. Wir geben Ihnen Geld. Sind Ihnen behilflich. Verstecken Sie, wenn Sie wollen. Meine Leute werden Ihnen dankbar sein. Ich meine, ich bin Ihnen dankbar. Das müssen Sie mir glauben. Sie haben meinen Arsch gerettet. Das mit dem Cop war ein Unfall, stimmt’s? Nur ein Unfall. Sie hatten Pech, standen unter Druck. Das kann ich verstehen. Wir halten die Sache geheim.«
»Ich brauche Ihre Hilfe nicht«, entgegnete ich. »Ich möchte Sie nur loswerden.«
»Aber ich muss nach Hause«, sagte er. »Wir würden uns gegenseitig helfen.«
Noch vier Minuten bis zum Highway.
»Wo sind Sie zu Hause?«, fragte ich.
»Abbot«, antwortete er.
»Abbot was?«
»Abbot, Maine. An der Küste. Zwischen Kennebunkport und Portland.«
»Dann fahren wir in die falsche Richtung.«
»Sie können auf dem Highway nach Norden abbiegen.«
»Das müssen zweihundert Meilen sein, mindestens.«
»Wir geben Ihnen Geld. Es soll Ihr Schaden nicht sein.«
»Ich könnte Sie bei Boston absetzen«, schlug ich vor. »Es muss einen Bus nach Portland geben.«
Er schüttelte heftig, fast panisch den Kopf.
»Ausgeschlossen«, sagte er. »Ich kann keinen Bus nehmen. Ich darf nicht allein sein. Nicht jetzt. Ich brauche Schutz. Diese Kerle können noch irgendwo lauern.«
»Diese Kerle sind tot«, entgegnete ich. »Wie dieser verdammte Cop.«
»Sie können Komplizen haben.«
Wieder so ein seltsamer Ausdruck. Er sah klein, dünn und ängstlich aus. Er nahm beide Hände, um sein Haar zusammenzufassen, und drehte den Kopf so, dass ich sein linkes Ohr sehen konnte. Es war nicht da. An seiner Stelle befand sich ein Klumpen hartes Narbengewebe, das wie ungekochte Pasta aussah.
»Sie haben’s abgeschnitten und mit der Post geschickt«, erklärte er. »Beim ersten Mal.«
»Wann?«
»Ich war fünfzehn.«
»Ihr Dad hat nicht gezahlt?«
»Nicht schnell genug.«
Ich sagte nichts. Richard Beck saß einfach nur da, zeigte mir seine Narbe, war ängstlich und schnaufte wie eine Dampfmaschine.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, erkundigte ich mich.
»Bringen Sie mich nach Hause«, bat er eindringlich.
»Ich will jetzt nicht allein sein.«
Noch zwei Minuten bis zum Highway.
»Bitte«, sagte er. »Helfen Sie mir.«
»Scheiße«, sagte ich.
»Bitte. Wir können einander helfen. Sie müssen sich verstecken.«
»Diese Kiste können wir nicht behalten«, sagte ich. »Wir müssen damit rechnen, dass ihre Beschreibung im ganzen Staat über Funk verbreitet wird.«
Er starrte mich voller Hoffnung an. Bis zum Highway war es noch eine Minute.
»Wir müssen uns einen anderen Wagen beschaffen«, sagte ich.
»Wo?«
»Irgendwo. Autos stehen überall herum.«
Südwestlich des Highwaykreuzes befand sich ein großes Einkaufszentrum auf der grünen Wiese. Ich konnte es bereits sehen. Es bestand aus riesigen beigefarbenen Gebäuden – ohne Fenster, aber mit hellen Leuchtreklamen. Dazu gehörten riesige Parkplätze, die ungefähr zur Hälfte besetzt waren. Ich bog ab und drehte langsam eine Runde. Das Einkaufszentrum hatte die Größe einer Kleinstadt. Überall liefen Leute herum. Sie machten mich nervös. Ich bog erneut ab und fuhr an einer Reihe von Müllcontainern vorbei zur Rückseite eines großen Kaufhauses.
»Wohin wollen wir?«, fragte Richard.
»Personalparkplatz«, antwortete ich. »Kunden kommen und gehen den ganzen Tag. Unberechenbar. Aber das Personal ist bis Ladenschluss drinnen. Sicherer.«
Er starrte mich an, als kapierte er das nicht. Ich hielt auf eine Reihe von acht oder neun Wagen zu, die an einer kahlen Mauer eingeparkt standen. Neben einem zirka drei Jahre alten Nissan Maxima in glanzlosem Blau war eine Parklücke frei. Der Nissan würde genügen. Er schien mir ein ziemlich anonymes Fahrzeug zu sein. Der Parkplatz war abgelegen, still und einsam. Ich stieß rückwärts in die Parklücke, bis die Hecktüren fast die Mauer berührten.
»Müssen das kaputte Fenster verstecken«, erklärte ich.
Der Junge sagte nichts. Ich schob die beiden leeren Colts in meine Manteltaschen und stieg aus. Rüttelte an den Türen des Maximas.
»Suchen Sie mir einen Draht«, sagte ich. »Ein Stück starkes Elektrokabel oder einen Kleiderbügel.«
»Sie wollen diesen Wagen stehlen?«
Ich nickte.
»Ist das clever?«
»Wenn Sie versehentlich einen Cop erschossen hätten, würden Sie’s jedenfalls clever finden.«
Der Junge sah mich einen Augenblick verständnislos an, dann raffte er sich auf und begann herumzusuchen. Ich entlud die Anacondas und warf die zwölf leeren Patronenhülsen in einen Müllbehälter. Der Junge kam mit einem fast einen Meter langen Stück Elektrokabel von einem kleinen Haufen Bauschutt zurück. Ich entfernte die Isolierung mit den Zähnen, bog den Draht vorn zu einem kleinen Haken zusammen und schob ihn durch den Fenstergummi der Fahrertür des Maximas.
»Sie stehen Schmiere«, sagte ich.
Er entfernte sich ein paar Schritte, um den Parkplatz besser überblicken zu können. Ich schob das Drahtende mit dem Haken tiefer und fummelte damit herum, bis die Tür entriegelt war und sich öffnen ließ. Dann warf ich den Draht wieder auf den Haufen, bückte mich unter die Lenksäule und zog die Plastikverkleidung ab. Sortierte die Drähte, bis ich die zwei gefunden hatte, die ich brauchte, und verdrillte sie. Der Anlasser surrte, und der Motor sprang an. Der Junge schien beeindruckt zu sein.
»Vergeudete Jugend«, sagte ich.
»Ist das clever?«, fragte er nochmal.
Ich nickte. »Das Cleverste, was wir tun können. Er wird nicht vor sechs, vielleicht erst um acht Uhr abends vermisst. Wann immer dieser Laden schließt. Bis dahin sind Sie längst zu Hause.«
Er blieb mit einer Hand an der Beifahrertür stehen, dann gab er sich einen Ruck und stieg ein. Ich schob den Fahrersitz zurück, verstellte den Innenspiegel und stieß rückwärts aus der Parklücke. Lenkte den Wagen gemächlich über das Areal des Einkaufszentrums. Ungefähr hundert Meter vor uns sah ich einen Streifenwagen. Ich fuhr in die erste Parklücke, die ich fand, und blieb mit laufendem Motor in dem Nissan sitzen, bis der Streifenwagen außer Sicht war. Zwei Minuten später rollten wir mit sechzig Meilen in der Stunde auf einem breiten Highway nach Norden. In dem Wagen roch es penetrant nach Parfüm, und auf der Mittelkonsole standen gleich zwei Boxen Kosmetiktücher. An den hinteren Seitenfenstern waren als Sonnenschutz Pandabären angebracht, die statt Pfoten Saugnäpfe aus durchsichtigem Plastikmaterial besaßen. Auf dem Rücksitz lag ein Baseballhandschuh aus der Little League, und im Kofferraum klapperte ein Aluminiumschläger herum.
»Mamas Taxi«, bemerkte ich.
Der Junge äußerte sich nicht dazu.
»Keine Sorge«, sagte ich. »Sie ist wahrscheinlich versichert. Bestimmt eine angesehene Bürgerin.«
»Fühlen Sie sich nicht schlecht?«, fragte er. »Wegen des Cops?«
Ich schaute zu ihm hinüber. Er war blass und saß so weit wie irgend möglich von mir abgerückt. Seine rechte Hand lag auf dem Fensterrahmen. Die langen Finger sahen aus wie die eines Musikers. Ich hatte das Gefühl, als bemühte er sich, mich zu mögen.
»Scheiße passiert eben«, erwiderte ich. »Unnötig, sich darüber groß aufzuregen.«
»Was ist das für eine Antwort, verdammt noch mal?«
»Die einzig richtige. Das war ein minimaler Kollateralschaden. Unwichtig, wenn er sich später nicht als belastend erweist. Fazit: Wir können nichts daran ändern, also blicken wir nach vorn.«
Er schwieg.
»Außerdem war Ihr Dad daran schuld«, sagte ich.
»Weil er reich ist und einen Sohn hat?«
»Weil er miserable Leibwächter angeheuert hat.«
Er sah weg. Sagte nichts.
»Sie waren Leibwächter, stimmt’s?«
Er nickte.
»Also fühlen Sie sich nicht miserabel?«, fragte ich. »Ihretwegen?«
»Ein bisschen«, antwortete er. »Wahrscheinlich. Ich hab sie nicht gut gekannt.«
»Sie waren nichts wert«, sagte ich.
»Alles ist so schnell gegangen.«
»Die Kidnapper haben Ihnen dort aufgelauert«, erklärte ich. »Ein klappriger alter Pick-up wie ihrer, der einfach so in einer spießigen kleinen Collegestadt rumhängt? Welchem Leibwächter fällt so was nicht auf? Die haben wohl nie was von Gefahreneinschätzung gehört?«
»Soll das heißen, dass er Ihnen aufgefallen ist?«
Ich nickte. »Ja, das ist er.«
»Nicht schlecht für einen Lieferwagenfahrer.«
»Ich war in der Army. Militärpolizist. Ich weiß, was Leibwächter zu tun haben. Und ich kenne mich mit Kollateralschäden aus.«
Der Junge nickte unsicher.
»Haben Sie auch einen Namen?«, erkundigte er sich.
»Kommt darauf an«, entgegnete ich. »Ich muss erst wissen, wie Sie die Sache sehen. Ich könnte in allerhand Schwierigkeiten geraten. Zumindest ein Cop ist tot, und ich habe gerade ein Auto geklaut.«
Er schwieg. Ich ließ ihm Zeit zum Nachdenken. Wir waren schon fast aus Massachusetts heraus.
»Meine Familie schätzt Loyalität«, sagte er schließlich. »Sie haben ihrem Sohn einen Dienst erwiesen. Und Sie haben ihr einen Dienst erwiesen. Ihr zumindest Geld gespart. Sie wird Ihnen ihre Dankbarkeit beweisen und verpfeift Sie auf keinen Fall, da bin ich mir ganz sicher.«
»Müssen Sie sie verständigen?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie erwartet mich. Solange ich aufkreuze, brauche ich sie nicht zu verständigen.«
»Die Cops werden sie anrufen. Sie glauben, ich hätte Sie entführt.«
»Sie kennen die Nummer nicht. Die kennt niemand.«
»Das College muss Ihre Adresse haben. Dann lässt sich die Telefonnummer rauskriegen.«
Er schüttelte wieder den Kopf. »Das College weiß unsere Adresse nicht. Die weiß niemand. Mit solchen Dingen sind wir sehr vorsichtig.«
Ich zuckte mit den Schultern und schwieg eine Weile.
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte ich dann. »Werden Sie mich verpfeifen?«
Ich sah, wie er sein rechtes Ohr berührte. Das eine, das noch da war – eine völlig unbewusste Bewegung.
»Sie haben meinen Arsch gerettet«, antwortete er. »Ich werde Sie nicht verpfeifen.«
»Okay«, sagte ich. »Mein Name ist Reacher.«
Wir verbrachten ein paar Minuten damit, einen winzigen Zipfel Vermonts zu durchqueren, um dann durch New Hampshire nach Nordosten zu fahren. Richteten uns auf die lange Fahrt ein. Das Adrenalin baute sich langsam ab, und der Junge überwand seinen Schock. Erschöpfung und Müdigkeit überkamen uns. Ich öffnete das Fenster einen Spalt weit, um etwas frische Luft hereinzulassen. Das hielt mich wach. Richard Beck erzählte mir, er sei zwanzig und im vorletzten Studienjahr. Sein Hauptfach im College war irgendeine Art zeitgenössischer Kunstausdruck, der mich sehr an Malerei mit Fingerfarben erinnerte. Er war ein Einzelkind und hatte Schwierigkeiten, Beziehungen aufzubauen. Seine Familie – ein anscheinend sehr eng miteinander verwobener Clan – sah er äußerst ambivalent. Ein Teil von ihm wollte dort raus, während der andere nur im Familienverband überleben konnte. Seine frühere Entführung schien ein schweres Trauma hinterlassen zu haben. Ich frage mich unwillkürlich, ob ihm außer der Sache mit dem Ohr noch etwas anderes widerfahren war. Vielleicht etwas viel Schlimmeres.
Ich erzählte ihm von der Army. Meine Qualifikationen als Leibwächter strich ich dabei heraus. Ich wollte ihm das Gefühl geben, zumindest vorläufig in guten Händen zu sein. Ich fuhr schnell und sicher. Der Maxima war voll getankt, sodass wir unterwegs nicht zu tanken brauchten. Ich hielt einmal an, um auf die Toilette zu gehen. Dann fuhren wir auf dem Highway weiter, passierten Concord in New Hampshire und nahmen Kurs auf Portland in Maine. Die Zeit verging. Je näher wir unserem Ziel kamen, desto entspannter, aber auch schweigsamer wurde er.
Wir überquerten die Staatsgrenze. Ungefähr zwanzig Meilen vor Portland betrachtete er aufmerksam die Umgebung und forderte mich dann auf, die nächste Ausfahrt zu nehmen. Wir bogen in eine schmale Straße ein, die genau nach Osten in Richtung Atlantik verlief. Sie führte unter der I-95 hindurch und mehr als fünfzehn Meilen weit über eine Landzunge bis ans Meer. Die Landschaft hätte im Sommer großartig ausgesehen, doch um diese Jahreszeit wirkte sie rau und abweisend. Hier gab es in der salzhaltigen Luft verkümmerte Bäume und nackte Felsen, von denen Wind und Sturmfluten den letzten Humus gefegt hatten. Die Straße wand und schlängelte sich, und manchmal war der bleigraue Atlantik zu sehen. Die Straße verlief zwischen zahllosen Buchten, die hin und wieder kleine Strände mit grobkörnigem Sand aufwiesen. Dann führte sie nach einer engen Links-Rechts-Kurve auf eine Landspitze hinaus. Sie war wie eine Handfläche geformt und verengte sich abrupt zu einem direkt ins Meer hinausragenden einzelnen Finger. Er bildete eine schätzungsweise hundert Meter breite und achtzig Meter lange felsige Halbinsel. Ich konnte spüren, wie der Wind den Nissan durchrüttelte. Ich fuhr auf die Halbinsel hinaus. Eine Reihe krummer immergrüner Bäume versuchte, eine hohe Granitmauer zu tarnen, was aber nicht gelang, weil sie dafür weder groß noch breit genug waren. Die Krone der gut zweieinhalb Meter hohen Mauer war mit großen Rollen Bandstacheldraht gesichert. Außerdem hatte man in regelmäßigen Abständen Sicherheitsscheinwerfer angebracht. Sie verlief quer über den mehr als hundert Meter breiten Felsfinger. Die scharf abgewinkelten Mauerenden führten bis zum Meer hinunter, wo sie von massiven Steinfundamenten voller Seetang getragen wurden. Genau in der Mauermitte befand sich ein Eisentor. Es war geschlossen.
»Wir sind da«, sagte Richard Beck. »Hier wohne ich.«
Die Straße führte direkt auf das Tor zu. Dahinter verwandelte sie sich in eine schnurgerade lange Zufahrt, an deren Ende sich ein graues Steinhaus erhob, das teilweise über das Wasser hinausragte. Gleich neben dem Tor stand ein ebenerdiges Wachhäuschen – im selben Stil und aus demselben Stein wie das Haupthaus, aber viel kleiner und niedriger. Es wuchs aus der Mauer heraus. Ich fuhr langsamer und hielt vor dem Tor.
»Einfach hupen«, sagte Richard Beck.
Ich tat ihm den Gefallen und sah, wie die auf einem Torpfosten installierte Überwachungskamera herumschwenkte und sich in unsere Richtung neigte. Nach einer längeren Pause ging die Tür des Wachhäuschens auf. Ein Mann – ein Riese – in dunklem Anzug trat ins Freie. Er ging dicht ans Tor und starrte nach draußen, brauchte eine Weile, mich zu inspizieren, und nur einen Augenblick, den Jungen anzusehen. Dann öffnete er das Tor.
»Fahren Sie gleich zum Haus weiter«, befahl Richard. »Hier nicht halten. Ich mag diesen Kerl nicht.«
Ich passierte das Tor, fuhr langsam weiter und schaute mich um. Begibt man sich auf unbekanntes Terrain, sieht man sich als Erstes nach einem Notausgang um. Die Mauer führte auf beiden Seiten bis zur schäumenden Brandung hinab. Sie war zu hoch, um im Sprung überwunden werden zu können, und der Bandstacheldraht auf der Krone verhinderte ein Überklettern. Gleich dahinter verlief ein etwa dreißig Meter breiter gerodeter Streifen. Wie ein Niemandsland. Die Sicherheitsscheinwerfer leuchteten diesen Streifen aus. Der einzige Ausgang schien das Tor zu sein, das der Riese jetzt hinter uns schloss. Ich konnte ihn dabei im Rückspiegel beobachten.
Die Zufahrt zum Haus zog sich hin. Graues Meer auf drei Seiten. Das Haus war ein großes altes Steingebäude. Vielleicht der Ruhesitz eines Kapitäns aus der Zeit, als mit dem Walfang noch lukrative Geschäfte zu machen waren. Es wies Erker, Gesimse, Zinnen und Nischen auf. Alle nach Norden zeigenden Flächen waren mit grauen Flechten überwuchert. Den Rest bedeckten Flecken von grünem Moos. Es war zweistöckig und besaß ein Dutzend Kamine. Außerdem gab es zahlreiche Gauben mit kurzen Regenrinnen und Dutzenden von dicken Gussrohren, die das Regenwasser ableiteten. Die aus Eiche gefertigte Haustür war mit Eisenbändern verstärkt und mit Nägeln beschlagen. Die Zufahrt endete in einer kreisrunden Auffahrt. Ich folgte ihr im Uhrzeigersinn und hielt genau vor der schweren Tür. Sie ging auf, und ein anderer Mann in einem dunklen Anzug trat ins Freie. Er hatte ungefähr meine Größe, war also viel kleiner als der Kerl im Wachhäuschen. Doch er gefiel mir auch nicht besser. Sein Gesicht wirkte wie versteinert, sein Blick ausdruckslos. Er öffnete die Beifahrertür des Nissan, als hätte er uns erwartet, was vermutlich stimmte, weil der Riese am Tor uns angekündigt haben musste.
»Warten Sie bitte hier?«, fragte Richard mich.
Er stieg aus und verschwand im Haus. Der Typ im Anzug schloss die Eichentür von außen und postierte sich genau davor. Er würdigte mich keines Blicks, aber ich wusste, dass ich mich irgendwo am Rand seines Blickfelds befand. Ich trennte die Drahtverbindung unter der Lenksäule, stellte so den Motor ab und wartete.
Ich musste ziemlich lange warten, fast vierzig Minuten. Es wurde kühl im Wagen. Ich starrte durch die Windschutzscheibe nach Nordosten und konnte in der klaren Meerluft die Küste ausmachen. In ungefähr zwanzig Meilen Entfernung hingen bräunliche Nebel am Horizont, vermutlich aus Portland aufsteigender Smog. Die Stadt selbst lag hinter einem Vorgebirge und war deshalb unsichtbar.
Dann öffnete sich die Haustür wieder, und der Aufpasser trat rasch einen Schritt zur Seite. Eine Frau kam heraus. Unverkennbar Richard Becks Mutter. Sie besaß den gleichen schmächtigen Körperbau und das gleiche blasse Gesicht. Die gleichen langen Finger. Sie war ungefähr fünfzig, hatte windzerzaustes Haar und trug Jeans sowie einen schweren Wollpullover. Sie sah müde und angespannt aus und blieb ungefähr zwei Meter vor dem Wagen stehen, so als wollte sie mir zu verstehen geben, dass es höflicher wäre, wenn ich ausstiege und ihr auf halbem Weg entgegenkäme. Also tat ich ihr den Gefallen. Sie gab mir ihre Hand, die sich eiskalt anfühlte und nur aus Sehnen und Knochen zu bestehen schien.
»Mein Sohn hat mir erzählt, was passiert ist«, begann sie. Ihre Stimme war leise und klang etwas heiser. »Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie ihm geholfen haben.«
»Alles in Ordnung mit ihm?«, erkundigte ich mich.
Sie verzog das Gesicht, als wüsste sie das nicht so genau. »Er hat sich ein bisschen hingelegt.«
Ich nickte. Ließ die Hand los. Danach folgte verlegenes Schweigen.
»Ich bin Elizabeth Beck«, sagte sie.
»Jack Reacher«, erwiderte ich.
»Mein Sohn hat mir Ihr Dilemma geschildert«, sagte sie.
Das war ein nettes neutrales Wort. Wog man Dankbarkeit gegen Abscheu ab, gelangte man vermutlich zu diesem neutralen Ausdruck. Ich sagte nichts.
»Mein Mann kommt am Abend nach Hause«, fuhr sie fort. »Er wird wissen, was zu tun ist.«
Ich nickte. Wieder trat eine verlegene Pause ein. Ich wartete.
»Wollen Sie nicht hereinkommen?«, erkundigte sie sich.
Sie wandte sich um und eilte in die Eingangshalle zurück. Ich folgte ihr. Als ich durch die Tür ging, piepste etwas. Ich sah auf und stellte fest, dass am inneren Türrahmen ein Metalldetektor angebracht war.
»Wären Sie so freundlich?«, fragte Elizabeth Beck. Sie machte eine verlegene Handbewegung, die mich und den hässlichen Kerl im Anzug einbezog. Er schickte sich an, mich nach Waffen zu durchsuchen.
»Zwei Revolver«, sagte ich. »Ungeladen. In meinen Manteltaschen.«
Er zog sie mit geübten Bewegungen heraus und legte sie auf einen Beistelltisch. Dann ging er in die Hocke, ließ die Hände über meine Beine gleiten, stand wieder auf und tastete Arme, Hüften, Brust und Rücken ab. Er arbeitete sehr gründlich und nicht gerade sanft.
»Tut mir Leid«, sagte Elizabeth Beck.
Der Kerl in dem Anzug ging auf Abstand. Eine weitere verlegene Pause entstand.
»Brauchen Sie irgendetwas?«, fragte Elizabeth Beck.
Es gab viele Dinge, die ich hätte brauchen können. Aber ich schüttelte den Kopf.
»Ich bin ein bisschen müde«, entgegenete ich. »Langer Tag. Am liebsten würde ich ein Nickerchen machen.«
Sie lächelte flüchtig, als wäre sie darüber erleichtert, als befreite sie die Tatsache, dass ich irgendwo schlief, von gesellschaftlichen Zwängen.
»Natürlich«, sagte sie. »Duke zeigt Ihnen das Zimmer.«
Sie ließ ihren Blick noch einen Moment länger auf mir ruhen. Dachte man sich den Stress und die Blässe weg, war sie eine sehr attraktive Frau. Sie hatte ein fein geschnittenes Gesicht und einen makellosen Teint. Sie drehte sich um und verschwand irgendwo im Haus. Ich wandte mich dem Kerl im Anzug zu, da ich annahm, dass er Duke sei.
»Wann kriege ich die Revolver wieder?«, wollte ich wissen.
Er gab keine Antwort, zeigte nur auf die Treppe und folgte mir. Deutete auf die nächste Treppe, über die wir in den zweiten Stock gelangten. Er führte mich zu einer Tür und öffnete sie. Ich trat ein und befand mich in einem schlichten quadratischen Zimmer mit schweren, antiken Möbeln und Eichenpaneelen an den Wänden. Auf dem Fußboden lag ein abgetretener Orientteppich – vielleicht ein wertvolles altes Stück. Duke ging an mir vorbei, durchquerte den Raum und zeigte mir, wo sich das Bad befand. Er benahm sich wie ein Hotelpage.
»Abendessen um acht«, sagte er, ging hinaus und schloss die Tür hinter sich. Als ich sie kontrollierte, war sie von außen zugesperrt. Innen besaß sie kein Schlüsselloch. Ich trat ans Fenster und schaute hinaus. Das Zimmer lag auf der Rückseite des Hauses, sodass ich nur den Atlantik sehen konnte. Ich blickte genau nach Osten. Fünfzehn Meter unter mir lagen Felsen, an denen sich die Brandung brach. Die Flut schien eben hereinzukommen.
Ich ging wieder zur Tür, hielt ein Ohr daran und horchte angestrengt. Hörte nichts. Ich suchte die Decke, die Randleisten der Paneele und die Möbelstücke sehr sorgfältig ab. Nichts. Keine Kameras. Mikrofone waren mir egal. Ich hatte nicht vor, Geräusche zu machen. Ich setzte mich aufs Bett, zog den rechten Schuh aus, drehte ihn um und benützte die Fingernägel, um einen Stift aus dem Absatz zu ziehen. Schwenkte den Gummiabsatz wie eine kleine Tür, drehte den Schuh wieder um und schüttelte ihn. Ein rechteckiges Kästchen aus schwarzem Kunststoff fiel aufs Bett, ein E-Mail-Sender. Nichts Ausgefallenes. Ein handelsübliches Gerät, das jedoch so umprogrammiert war, dass es nur an eine Adresse sendete. Es hatte in etwa die Größe eines Piepsers und eine Minitastatur. Ich schaltete es ein und tippte eine Kurznachricht. Dann drückte ich auf jetzt senden.
Die Nachricht lautete: Ich bin drin.
2
Tatsächlich war ich zu diesem Zeitpunkt schon elf volle Tage drin, seit einem feucht glänzenden Samstagabend in Boston, an dem ich bemerkte, wie ein toter Mann den Gehsteig überquerte und in eine Limousine stieg. Und dies war keine Illusion, keine optische Täuschung. Es handelte sich nicht um ein Double, einen Zwillingsbruder, einen Bruder oder einen Cousin. Ich sah einen Mann, der vor einem Jahrzehnt gestorben war. Ganz ohne Zweifel. Er war die entsprechende Anzahl von Jahren gealtert und wies die Narben der Wunden auf, die ihn getötet hatten.
Ich war spätabends auf der Huntington Avenue unterwegs zu einer Bar, von der ich gehört hatte. Aus der Symphony Hall strömte Konzertpublikum. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge. Auf der Fahrbahn parkten Autos und Taxis in zwei Reihen. Ihre Motoren liefen. Ich entdeckte den Mann, als er links von mir aus der Tür des Foyers trat. Er trug einen Kaschmirmantel, hielt Handschuhe und einen Schal in der Hand und war barhäuptig. Er war ungefähr fünfzig. Wir waren beinahe zusammengestoßen. Ich blieb stehen. Er blieb stehen, sah mir ins Gesicht. Im ersten Moment dachte ich, er erkenne mich nicht wieder. Dann huschte ein Schatten über sein Gesicht, bevor er an mir vorbeiging und im Fond eines am Randstein wartenden schwarzen Cadillacs verschwand. Ich stand da und beobachtete, wie der Chauffeur sich in den Verkehrsstrom einordnete und davonfuhr.
Ich merkte mir das Kennzeichen. Ich geriet nicht in Panik, stellte nichts in Frage. Glaubte, was ich mit eigenen Augen gesehen hatte. Zehn Jahre Geschichte wurden in einer einzigen Sekunde über den Haufen geworfen. Der Kerl lebt noch. Was mich vor ein riesiges Problem stellte.
Das war der erste Tag. Ich verschwendete keinen Gedanken mehr an die Bar, ging geradewegs in mein Hotel zurück und begann, alte Nummern aus meiner Zeit bei der Militärpolizei anzurufen. Ich brauchte jemanden, den ich kannte und dem ich vertrauen konnte. Aber ich war schon sechs Jahre draußen, und da es zudem Samstagabend war, standen meine Chancen schlecht. Zuletzt begnügte ich mich mit jemandem, der behauptete, er habe schon mal von mir gehört. Er war Fachdienstoffizier und hieß Powell.
»Sie müssen für mich herausfinden, wem ein bestimmtes Autokennzeichen gehört«, erklärte ich ihm. »Als persönlichen Gefallen.«
Da er wusste, wer ich war, konnte er mir meine Bitte nicht abschlagen. Ich gab ihm das Kennzeichen, sagte, es gehöre ziemlich sicher zu einem Privatwagen, nicht zu einem Mietauto mit Chauffeur. Er ließ sich meine Nummer geben und versprach, mich am nächsten Morgen zurückzurufen. Das würde dann der zweite Tag sein.
Er rief mich nicht zurück. Stattdessen verriet er mich. Unter diesen Umständen hätte das jeder getan, denke ich. Der zweite Tag war ein Sonntag. Ich stand früh auf, ließ mir vom Zimmerservice ein Frühstück bringen und wartete auf den Anruf. Kurz nach zehn klopfte jemand an meine Tür. Ich spähte durch den Spion und sah zwei Personen – einen Mann und eine Frau. Dunkle Jacketts. Keine Mäntel. Der Mann trug einen Aktenkoffer. Beide hielten eine Art Dienstausweis hoch.
»Federal Agents«, sagte der Mann gerade so laut, dass ich ihn durch die Tür hindurch verstehen konnte.
In einer solchen Situation kann man nicht einfach so tun, als sei man nicht da. Ich hatte früher oft genug zu den Typen auf dem Flur gehört. Einer bleibt vor der Tür stehen, während der andere nach unten geht, um den Portier mit dem Generalschlüssel zu holen. Deshalb öffnete ich einfach die Tür, trat zur Seite und ließ sie ein.
Anfangs waren sie argwöhnisch. Als sie jedoch erkannten, dass ich unbewaffnet war und nicht wie ein Verrückter aussah, entspannten sie sich. Sie reichten mir ihre Dienstausweise und warteten höflich, während ich sie studierte. Oben stand: United States Department of Justice. Unten las ich: Drug Enforcement Administration. In der Mitte befanden sich alle möglichen Siegel, Unterschriften und Wasserzeichen. Auch Passfotos und maschinengeschriebene Namen. Der Mann war als Steven Eliot eingetragen – mit einem l wie der alte Dichter. April ist der grausamste Monat. Das stimmte genau. Das Foto war ziemlich gut getroffen. Er schien zwischen dreißig und vierzig zu sein, war stämmig, hatte schwarze Haare und ein nettes Lächeln. Die Frau hieß Susan Duffy, war blass und schlank, etwas jünger und größer als Eliot und hatte jetzt eine andere Frisur als auf dem Foto.
»Nur zu«, sagte ich. »Durchsucht das Zimmer. Es ist lange her, dass ich was besaß, das ich vor euch hätte verbergen wollen.«
Ich gab ihnen die Dienstausweise zurück. Als sie sie in die Innentaschen ihrer Jacketts steckten, taten sie es so, dass ich ihre Waffen sah. Sie trugen sie in adretten Schulterhalftern. Unter Eliots Achsel erkannte ich den geriffelten Griff einer Glock 17. Duffy hatte eine 19, die weitgehend identisch, aber etwas kleiner war. Die Glock lag eng an ihrer rechten Brust. Sie musste Linkshänderin sein.
»Wir haben nicht vor, Ihr Zimmer zu durchsuchen«, sagte sie.
»Wir wollen über ein Autokennzeichen reden«, sagte Eliot.
»Ich habe kein Auto«, sagte ich.
Wir standen alle noch unmittelbar hinter der Tür. Eliot hielt seinen Aktenkoffer in der Hand. Ich versuchte herauszufinden, wer von den beiden der Boss war. Vielleicht hatten sie aber auch den gleichen Dienstgrad. Wahrscheinlich einen ziemlich hohen. Sie waren gut gekleidet, wirkten aber etwas müde.
»Können wir uns setzen?«, fragte Duffy.
»Klar«, antwortete ich. Aber in einem billigen Hotelzimmer war das nicht so einfach. Es gab nur einen Stuhl. Er war unter einen kleinen Schreibtisch zwischen Wand und Fernsehschrank geschoben. Duffy zog ihn heraus und drehte ihn mit der Sitzfläche zum Bett um. Ich setzte mich aufs Bett, oben bei den Kissen. Eliot hockte sich ans Fußende und legte dort auch seinen Aktenkoffer ab. Er lächelte mich weiter freundlich an. Duffy machte sich gut auf dem Stuhl. Der Rock ihres Kostüms war ziemlich kurz, und sie trug dunkle Nylonstrümpfe, die heller wirkten, wo sie sich über ihren Knien spannten.
»Sie sind Reacher, stimmt’s?«, erkundigte sich Eliot.
Ich wandte den Blick von Duffys Beinen ab und nickte.
»Dieses Zimmer ist an einen gewissen Calhoun vermietet«, sagte er. »Bar bezahlt, nur für eine Nacht.«
»Gewohnheit«, erwiderte ich.
»Sie reisen heute ab?«
»Ich nehme’s jeweils für eine Nacht.«
»Wer ist Calhoun?«
»John Quincy Adams’ Vizepräsident«, sagte ich. »Ist mir zu dieser Stadt passend erschienen. Die Präsidenten habe ich längst aufgebraucht. Jetzt nehme ich Vizepräsidenten. Calhoun war ungewöhnlich. Er ist zurückgetreten, um für den Senat zu kandidieren.«
»Ist er reingekommen?«
»Keine Ahnung.«
»Wozu der falsche Name?«
»Gewohnheit«, sagte ich wieder.
Susan Duffy sah mir direkt ins Gesicht. Nicht so, als ob ich verrückt wäre, sondern als ob sie sich für mich interessierte. Wahrscheinlich hatte sie die Erfahrung gemacht, dass das eine brauchbare Vernehmungstaktik war.
»Wir haben mit einem Militärpolizisten namens Powell gesprochen«, sagte sie. »Sie haben ihn gebeten, einen Fahrzeughalter für Sie ausfindig zu machen.«
Ihre Stimme klang tief und warm und ein wenig heiser. Ich sagte nichts.
»Dieses Kennzeichen löst in unseren Computern Alarmsignale aus«, fuhr sie fort. »Gleich nachdem er seine Anfrage eingegeben hat, erfuhren wir davon. Wir haben ihn angerufen und nach dem Grund seines Interesses gefragt. Er hat uns erzählt, Sie hätten sich danach erkundigt.«
ENDE DER LESEPROBE
Umwelthinweis:Alle bedruckten Materialien dieses Taschenbuches sind chlorfrei und umweltschonend.
4. Auflage Taschenbuchausgabe Januar 2007 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © by Lee Child 2003 Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2005
by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Published by arrangement with Lee Child Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen. Umschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagmotiv: www.buerosued.de Redaktion: Irmi Perkounigg VB · Herstellung: H. Nawrot
eISBN : 978-3-641-03816-8
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de