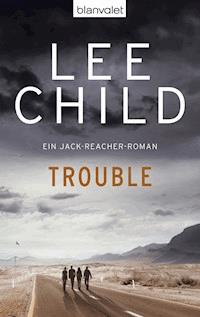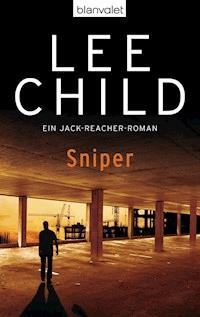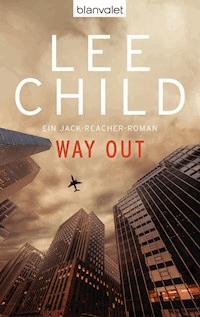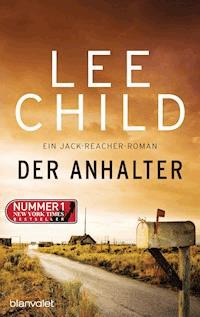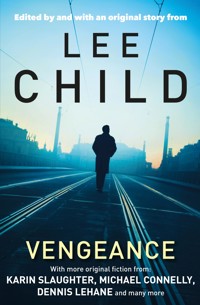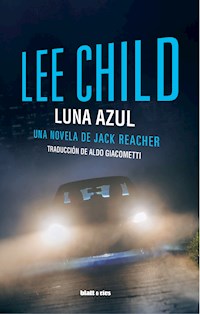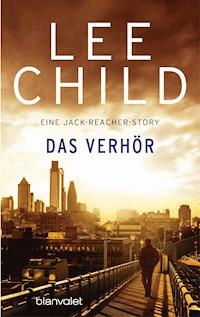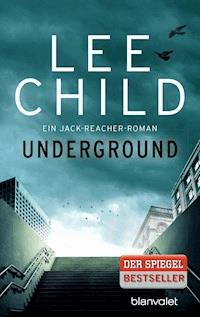
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die-Jack-Reacher-Romane
- Sprache: Deutsch
Niemand verletzt tödlicher als einstige Freunde …
New York City, zwei Uhr nachts. Jack Reacher sitzt in der U-Bahn. Neben ihm befinden sich noch fünf weitere Personen im Abteil. Vier davon sind harmlos. Die fünfte erregt Reachers Aufmerksamkeit. Minutenlang beobachtet er sie genau – und ist sich sicher, eine Selbstmordattentäterin vor sich zu haben. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes, und ausgerechnet Reacher selbst gerät ins Kreuzfeuer …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Lee Child
Underground
Ein Jack-Reacher-Roman
Aus dem Englischen von Wulf Bergner
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel »Gone Tomorrow« bei Bantam Press, a division of Transworld Publishers,The Random House Group Ltd., London.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Lee Child
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012by Blanvalet Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Published by Arrangement with Lee Child
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-06115-9
www.blanvalet.de
Für meine Schwägerinnen Leslie und Sally,zwei selten charmante und begabte Frauen.
1
Selbstmordattentäter sind leicht zu entdecken. Sie senden alle möglichen verräterischen Signale aus. Hauptsächlich aus Nervosität. Logischerweise sind sie alle Anfänger.
Das defensive Drehbuch schrieb die israelische Spionageabwehr. Sie sagte uns, wonach wir Ausschau halten mussten. Sie benutzte pragmatische Beobachtungen und psychologische Erkenntnisse, um eine Liste mit Verhaltensindikatoren zu erstellen. Vor zwanzig Jahren erhielt ich diese Liste von einem Hauptmann der israelischen Armee. Er schwor darauf. Deshalb schwor auch ich darauf, denn ich war damals für drei Wochen abkommandiert und tat die meiste Zeit Schulter an Schulter mit ihm Dienst: in Israel selbst, in Jerusalem, im Westjordanland, im Libanon, manchmal in Syrien, manchmal in Jordanien, in Bussen, in Geschäften, auf belebten Gehsteigen. Ich ließ den Blick wandern und hakte in Gedanken einen Punkt der Liste nach dem anderen ab.
Zwanzig Jahre später habe ich die Liste noch immer im Kopf. Und meine Augen bewegen sich noch immer. Reine Gewohnheit. Von einem anderen Haufen habe ich ein weiteres Mantra gelernt: Hinsehen statt sehen, zuhören statt hören. Je mehr man sich engagiert, desto länger lebt man.
Die Liste ist zwölf Punkte lang, wenn man einen verdächtigen Mann betrachtet, und elf, wenn man eine Frau vor sich hat. Der Unterschied ist die frische Rasur. Selbstmordattentäter nehmen ihren Bart ab. Das macht sie weniger auffällig, weniger verdächtig. Das Ergebnis ist eine hellere untere Gesichtshälfte.
Aber mich interessierten keine Rasuren.
Ich arbeitete die Elfpunkteliste ab.
Ich hatte eine Frau im Blick.
Ich fuhr mit der New Yorker U-Bahn, war mit dem 6 Train, dem Lokalzug zur Lexington Avenue, stadtauswärts unterwegs, um zwei Uhr morgens. Ich war in der Bleecker Street am Südende des Bahnsteigs in einen Wagen eingestiegen, in dem nur fünf Fahrgäste saßen. U-Bahnwagen kommen einem klein und intim vor, wenn sie voll sind. Sind sie leer, wirken sie riesig und höhlenartig und einsam. Nachts kommt einem ihre Beleuchtung wärmer und heller vor, obwohl es dieselbe wie tagsüber ist. Es gibt nur diese eine Beleuchtung. Ich hatte es mir auf der den Bahnsteigen abgekehrten Seite des Wagens auf dem Zweiersitz nördlich der Endtür bequem gemacht. Die übrigen Fahrgäste saßen südlich von mir auf den langen Sitzbänken: seitlich im Profil zu sehen, weit voneinander entfernt, ausdruckslos quer durch den Wagen starrend, drei links und zwei rechts.
Der Wagen hatte die Nummer 7622. Ich war im 6 Train einmal acht Haltestellen weit neben einem verrückten Kerl sitzend gefahren, der über den Wagen, in dem wir saßen, mit der gleichen Begeisterung sprach, mit der andere Männer über Sport oder Frauen reden. Deshalb wusste ich, dass Wagen 7622 zur neuesten Modellreihe R142A des New Yorker U-Bahn-Systems gehörte – bei Kawasaki im japanischen Kobe gebaut, nach New York verschifft, zum Rangierbahnhof 207th Street transportiert, mit einem Kran aufs Gleis gesetzt, zur 180th Street geschleppt und dort getestet. Ich wusste, dass er zweihunderttausend Meilen ohne größere Wartung zurücklegen konnte. Ich wusste, dass sein automatisches Ansagesystem für Anweisungen eine Männerstimme und für Informationen eine Frauenstimme benutzte, was angeblich ein Zufall war, aber in Wirklichkeit daher kam, dass die zuständigen Manager diese Arbeitsteilung für psychologisch schlüssig hielten. Ich erkannte die Stimmen, hatte sie in Bloomberg TV gehört – aber schon vor Jahren, bevor Mike Oberbürgermeister wurde. Ich wusste, dass in New York sechshundert Wagen der Baureihe R142A verkehrten und dass jeder etwas über fünfzehn Meter siebzig lang und etwas über zwei Meter vierzig breit war. Ich wusste, dass es in einem Wagen ohne Fahrerstand, in dem ich auch heute wieder saß, vierzig Sitzplätze und maximal hundertachtundvierzig Stehplätze gab. Alle diese Angaben hatte der Verrückte nur so hervorgesprudelt. Selbst sehen konnte ich, dass die Sitze des Wagens aus blauem Kunststoff im gleichen Farbton wie ein Spätherbsthimmel oder eine britische RAF-Uniform waren. Ich konnte sehen, dass seine Wandverkleidung aus einem Glasfasermaterial bestand, das gegen Graffiti resistent war. Ich konnte auch die in zwei langen Streifen angeordnete Werbung am Übergang zwischen Seitenwänden und Dach sehen. Ich konnte all die bunten kleinen Plakate sehen, die für Fernsehshows und Sprachunterricht und mühelose Studienabschlüsse und glänzende Verdienstmöglichkeiten warben.
Und ich konnte eine Mahnung der Polizei sehen, die mich aufforderte: Wenn Sie etwas sehen, melden Sie es.
Mir am nächsten befand sich eine Hispanierin. Sie saß auf der anderen Seite des Wagens, links von mir, vor der ersten Doppeltür, ganz allein auf einer Bank für acht Fahrgäste, deutlich außerhalb der Mitte. Sie war klein, irgendwo zwischen vierzig und fünfzig und wirkte erhitzt und übermüdet. Sie hatte die abgewetzte Tragetasche eines Supermarkts über ihr linkes Handgelenk geschlungen und starrte den leeren Platz gegenüber an.
Danach kam ein Mann auf der anderen Seite, ungefähr eineinviertel Meter weiter den Wagen entlang. Auch er saß allein auf einer Achtpersonenbank. Er hätte vom Balkan oder der Schwarzmeerküste stammen können. Dunkles Haar, runzliges Gesicht. Er war sehnig, von Arbeit im Freien verbraucht. Seine Füße standen fest auf dem Boden. Er hatte die Ellbogen auf die Knie gestützt und beugte sich nach vorn. Nicht schlafend, aber in einer Art Halbschlaf. Scheintot, auf der Stelle tretend, im Takt mit den Bewegungen des Zuges schwankend. Er war ungefähr fünfzig und trug Sachen, die viel zu jugendlich für ihn waren: sackartige Jeans, die ihm nur bis zu den Waden reichten, und ein übergroßes NBA-Trikot mit dem Namen eines Spielers, den ich nicht kannte.
An dritter Stelle kam eine Frau, die vermutlich aus Westafrika stammte. Sie saß links, etwas südlich der mittleren Doppeltür. Erschöpft, träge. Ihre schwarze Haut sah durch die Beleuchtung staubig grau aus. Sie trug ein farbenfrohes Batikkleid mit einem dazu passenden bunten Kopftuch. Ihre Augen waren geschlossen. Ich kenne New York einigermaßen gut. Ich bezeichne mich als Weltbürger und New York als die Hauptstadt der Welt, sodass ich diese Stadt so gut verstehe, wie ein Engländer London und ein Franzose Paris kennt. Ihre Gewohnheiten sind mir bekannt, aber nicht vertraut. Trotzdem war leicht zu erraten, dass drei Leute wie diese, die schon südlich der Bleecker Street im 6 Train nach Norden gesessen hatten, Raumpfleger waren, die von der Spätschicht in der Umgebung der City Hall heimfuhren oder in Restaurants in Chinatown oder Little Italy als Küchenhelfer arbeiteten.
Die Fahrgäste vier und fünf waren anders.
Bei der Nummer fünf handelte es sich um einen Mann ungefähr in meinem Alter. Er lümmelte diagonal gegenüber und durch die gesamte Wagenlänge von mir getrennt schräg auf einer Zweiersitzbank. Er war lässig, aber nicht billig gekleidet. Chinos und ein Golfhemd. Er stierte auf einen Punkt irgendwo vor ihm, kniff die Augen dabei zusammen oder veränderte ihren Fokus, als wäre er hellwach und überlegte. Sie erinnerten mich an die Augen eines Baseballspielers. In seinem Blick lag eine gewisse listige, berechnende Schlauheit.
Aber es war die Nummer vier, die ich unauffällig im Auge behielt.
Wenn Sie etwas sehen, melden Sie es.
Sie saß auf der rechten Wagenseite, ebenfalls allein auf einer Achtpersonenbank, gegenüber und ungefähr in der Mitte zwischen der erschöpften Westafrikanerin und dem Kerl mit dem Blick eines Baseballspielers. Sie war eine unscheinbare weiße Frau, die ich auf Anfang vierzig schätzte. Sie hatte schwarzes Haar, das ordentlich, aber nicht modisch geschnitten und zu gleichmäßig dunkel wirkte, um nicht gefärbt zu sein. Sie war ganz in Schwarz gekleidet. Ich konnte sie verhältnismäßig gut beobachten. Der rechts von mir zwischen uns sitzende Kerl hockte weiterhin nach vorn gebeugt da, und die V-förmige Lücke zwischen seinem Rücken und der Seitenwand des Wagens verschaffte mir freie Sicht, die nur durch die vielen Haltestangen aus rostfreiem Stahl leicht beeinträchtigt wurde.
Keine ideale Sicht, aber doch gut genug, um bei jedem einzelnen Punkt der Elfpunkteliste sämtliche Alarmglocken schrillen zu lassen. Sie blinkten rot wie die Kirschen im Display eines Spielautomaten in Vegas.
Wollte ich der israelischen Spionageabwehr glauben, sah ich eine Selbstmordattentäterin.
2
Diesen Gedanken verwarf ich sofort wieder. Nicht aus ethnischen Erwägungen. Weiße Frauen sind zu ebensolchen Verrücktheiten imstande wie jeder andere. Ich verwarf ihn, weil er taktisch nicht plausibel war. Der Zeitpunkt war ganz falsch. Die New Yorker U-Bahn wäre ein gutes Ziel für einen Selbstmordanschlag gewesen. Der 6 Train wäre so gut wie jeder andere und besser als die meisten gewesen. Er hält unter dem Grand Central Terminal. Acht Uhr morgens, achtzehn Uhr abends, ein voll besetzter Wagen, vierzig Sitzplätze, hundertachtundvierzig Stehplätze. Abwarten, bis die Türen sich zum überfüllten Bahnsteig hin öffnen, dann auf den Knopf drücken. Hundert Tote, mehrere hundert Schwerverletzte, Panik, Bauschäden, vielleicht ein Brand, eine wichtige Verkehrsdrehscheibe tage- oder wochenlang lahmgelegt und vielleicht für alle Zeiten misstrauisch beäugt. Für Menschen, deren Denkweise wir nicht ganz verstehen, sicher ein bedeutender Erfolg.
Aber nicht um zwei Uhr morgens.
Nicht in einem Wagen, in dem nur sechs Fahrgäste saßen. Nicht wenn auf den U-Bahnsteigen unter dem Grand Central nur herumliegender Müll, leere Kaffeebecher und ein paar Obdachlose auf den Bänken anzutreffen waren.
Die U-Bahn hielt am Astor Place. Die Türen öffneten sich zischend. Niemand stieg aus. Niemand stieg zu. Die Türen schlossen sich polternd, die Motoren heulten auf, und der Zug fuhr weiter.
Die elf wichtigen Punkte blinkten weiter rot.
Auf den ersten konnte jeder kommen: unpassende Kleidung. Sprengstoffgürtel waren inzwischen so perfektioniert wie Baseballhandschuhe. Man nimmt ein dreißig mal neunzig Zentimeter großes Stück Segeltuch, legt es der Länge nach einmal zusammen und erhält so eine dreißig Zentimeter hohe Tasche. Diese Tasche legt man dem Attentäter um und näht sie hinten zusammen. Schnallen oder Reißverschlüsse können dazu führen, dass jemand sich die Sache anders überlegt. Dann steckt man eine Palisade aus Dynamitstangen in die Tasche, verdrahtet sie, füllt die Zwischenräume mit Nägeln oder Kugellagerkugeln aus, näht die Tasche oben zu und ergänzt sie durch einfache Schulterträger, um die Last besser zu verteilen. Insgesamt wirkungsvoll, aber recht sperrig. Die einzig brauchbare Tarnung ist ein übergroßes Kleidungsstück wie ein gefütterter Winterparka. Im Nahen Osten gänzlich ungeeignet, in New York nur etwa drei Monate im Jahr passend.
Aber wir hatten September, es war so heiß wie im Sommer und im Untergrund mindestens fünf Grad heißer. Ich trug ein T-Shirt. Die Nummer vier trug eine Daunenjacke von North Face: schwarz, bauschig, etwas zu groß und mit bis unters Kinn zugezogenem Reißverschluss.
Wenn Sie etwas sehen, melden Sie es.
Den zweiten der elf Punkte ließ ich vorerst unberücksichtigt. Er war nicht gleich überprüfbar. Der zweite Punkt ist: roboterhafter Gang. Bedeutsam an einer Kontrollstelle oder auf einem belebten Platz, aber bei einer sitzenden Verdächtigen im öffentlichen Nahverkehr nicht relevant. Selbstmordattentäter gehen nicht roboterhaft, weil sie wegen ihres unmittelbar bevorstehenden Märtyrertums in Ekstase sind, sondern weil sie zwanzig Kilo ungewohntes Extragewicht mit sich herumschleppen und betäubt sind. Märtyrertum ist nur bis zu einem gewissen Grad reizvoll. Die meisten Selbstmordattentäter sind unter Druck gesetzte Einfaltspinsel, die einen Priem aus Rohopiumpaste in der Backe haben. Das wissen wir, weil Dynamitgürtel mit einer typischen Druckwelle in Doughnutform detonieren, die sich in Bruchteilen einer Nanosekunde durch den Oberkörper fortpflanzt und den Kopf von den Schultern sprengt. Der menschliche Kopf ist nicht angeschraubt. Er hält sich durch Schwerkraft und ist durch Haut, Muskeln, Sehnen und Bänder fixiert. Aber diese schwachen biologischen Anker richten nicht viel gegen eine starke chemische Detonation aus. Von meinem israelischen Mentor weiß ich, wie sich leicht feststellen lässt, ob eine Detonation unter freiem Himmel durch eine Autobombe, einen Selbstmordattentäter oder eine Kofferbombe ausgelöst worden ist: Man sucht einen Radius von fünfundzwanzig bis dreißig Meter nach einem abgetrennten menschlichen Kopf ab, der meist seltsam intakt und unbeschädigt ist – bis hin zu dem Opiumpriem in der Backe.
Der Zug hielt am Union Square. Die Türen gingen auf. Niemand stieg aus. Niemand stieg zu. Vom Bahnsteig wehte heiße Luft herein und kämpfte gegen die Klimaanlage des Wagens an. Dann schlossen die Türen sich wieder, und der Zug fuhr weiter.
Die Punkte drei bis sechs sind Variationen eines subjektiven Themas: Reizbarkeit, Schwitzen, Tics und auffällige Nervosität. Meiner Ansicht nach kommt das Schwitzen ebenso häufig von körperlicher Erhitzung wie von schwachen Nerven, von unpassender Kleidung und dem Dynamit. Dynamit besteht aus Sägemehl, das mit Nitroglyzerin getränkt und zu Stangen gepresst wird. Sägemehl isoliert gut. Deshalb gehört das Schwitzen mit dazu. Aber die Reizbarkeit, die Tics und die Nervosität sind wertvolle Indikatoren. Diese Leute befinden sich in den letzten verrückten Augenblicken ihres Lebens, sorgenvoll, mit Angst vor Schmerzen, von Betäubungsmitteln benommen. Sie sind erklärtermaßen irrational. Sie glauben oder glauben nur halb oder eigentlich nicht an das Paradies, in dem Milch und Honig fließen, an grünes Land und Jungfrauen, stehen unter ideologischem Druck oder werden von den Erwartungen ihrer Gefährten und Familien angetrieben und stecken plötzlich zu tief drin, um sich noch befreien zu können. Tapfere Reden bei Geheimtreffen sind eine Sache, tapferes Handeln eine andere. Daher die unterdrückte Panik mit all ihren sichtbaren Anzeichen.
Die Nummer vier ließ sie alle erkennen. Sie sah genau wie eine Frau aus, die zum Ende ihres Lebens unterwegs ist – so zuverlässig und sicher, wie der Zug zur Endstation dieser Strecke unterwegs war.
Deshalb Punkt sieben: Atmung.
Sie hechelte leise und kontrolliert: ein, aus, ein, aus. Wie eine Atemtechnik, um Wehenschmerzen zu ertragen, wie als Folge eines Schocks oder wie als letzte verzweifelte Barriere davor, vor Angst, Schrecken und Entsetzen laut zu kreischen.
Ein, aus, ein, aus.
Punkt acht: Selbstmordattentäter, die kurz davor stehen, in Aktion zu treten, starren angestrengt geradeaus. Niemand weiß, weshalb, aber Videoaufnahmen und die Aussagen überlebender Augenzeugen haben das bestätigt. Selbstmordattentäter starren geradeaus vor sich hin. Vielleicht haben sie ihre Entschlossenheit ausgereizt und fürchten, aufgehalten zu werden. Vielleicht glauben sie wie Kinder und Hunde, dass keiner sie sieht, wenn sie niemanden ansehen. Vielleicht bewirkt ein letzter Rest Anstand, dass sie die Leute, die sie vernichten werden, nicht ansehen können. Keiner weiß, weshalb sie’s tun, aber sie tun es.
Die Nummer vier tat es auch. Das stand fest. Sie starrte das leere Fenster gegenüber so durchdringend an, dass ihr Blick fast ein Loch ins Glas brannte.
Die Punkte eins bis acht trafen also zu. Ich verlagerte mein Gewicht auf meinem Sitz etwas nach vorn.
Dann hielt ich inne. Die Idee war taktisch absurd. Dies war der falsche Zeitpunkt.
Dann sah ich noch einmal hin. Und bewegte mich erneut. Weil auch die Punkte neun, zehn und elf vorhanden waren und zutrafen – und weil sie die wichtigsten Punkte von allen waren.
3
Punkt neun: gemurmelte Gebete. Alle bisher bekannten Attentate sind durch Religion, fast ausschließlich durch den islamischen Glauben, angestiftet oder motiviert, gerechtfertigt oder überwacht worden, und Muslime waren es gewöhnt, in der Öffentlichkeit zu beten. Überlebende berichten von langen formelhaften Beschwörungen, die mehr oder weniger hörbar, aber stets mit sichtbar bewegten Lippen wiederholt werden. Die Nummer vier war wirklich eifrig dabei. Ihre Lippen bewegten sich unter ihrem starren Blick in einer langen, keuchenden, ritualistischen Beschwörung, die sich etwa alle zwanzig Sekunden zu wiederholen schien. Vielleicht stellte sie sich bereits der Gottheit vor, der sie jenseits der Linie zu begegnen hoffte. Oder vielleicht versuchte sie sich selbst davon zu überzeugen, dass es wirklich eine Gottheit und eine Linie gab.
Der Zug hielt in der 23rd Street. Die Türen gingen auf. Niemand stieg aus. Niemand stieg zu. Über dem Bahnsteig sah ich die roten Hinweisschilder zu den Ausgängen: 22nd and Park, Nordostecke, oder 23rd and Park, Südostecke. Unauffällige, aber plötzlich attraktive Gehsteigabschnitte in Manhattan.
Ich blieb auf meinem Platz. Die Türen schlossen sich. Der Zug fuhr weiter.
Punkt zehn: eine große Umhängetasche.
Dynamit ist ein stabiler Sprengstoff, solange es frisch ist. Es geht nicht von selbst hoch, sondern muss durch Zündhütchen gezündet werden. Zündhütchen sind durch ein Zündkabel mit einem Unterbrecher und einer Stromquelle verbunden. Die großen Zündmaschinen in alten Westernfilmen waren beides. Wurde ihr Hebel nach unten gedrückt, betrieb er einen Dynamo, und im letzten Teil wurde ein Schalter betätigt. Für tragbare Ladungen nicht geeignet. Für die benötigt man eine Batterie, und für einen laufenden Meter Dynamit braucht man etwas Spannung und Stromstärke. Kleine AA-Batterien liefern kümmerliche anderthalb Volt – nach allgemeinen Faustregeln nicht genug. Ein Neunvoltblock ist besser, aber für eine sichere Zündung will man eine kantige Blockbatterie von der Größe einer Suppendose, wie sie für Handscheinwerfer verkauft werden. Zu groß und zu schwer für eine Jackentasche, daher die Umhängetasche. Die Batterie liegt darin, und das Zündkabel läuft von ihr zu einem Schalter, bevor es durch einen unauffälligen Schlitz hinten aus der Tasche hinausführt und unter dem Saum des unpassenden Kleidungsstücks nach oben verschwindet.
Die Nummer vier trug eine Kuriertasche im urbanen Stil aus schwarzem Segeltuch so umgehängt, dass der Gurt vor ihrem Körper verlief und die Tasche selbst auf ihrem Schoß lag. Die Art, wie das steife Gewebe sich beulte und doch wieder Falten bildete, ließ darauf schließen, dass die Tasche bis auf einen einzigen schweren Gegenstand leer war.
Der Zug hielt in der 28th Street. Die Türen gingen auf. Niemand stieg aus. Niemand stieg zu. Die Türen schlossen sich, und der Zug fuhr weiter.
Punkt elf: Hände in der Tasche.
Vor zwanzig Jahren war Punkt elf noch eine kürzlich hinzugefügte Neuerung gewesen. Davor hatte die Liste mit Punkt zehn geendet. Aber die Entwicklung ging weiter. Aktion, dann Reaktion. Die israelischen Sicherheitsdienste und ein paar tapfere Bürger hatten eine neue Taktik erfunden. Wurde man misstrauisch, lief man nicht weg. Das war eigentlich sinnlos. Schneller als ein Schrapnell kann niemand rennen. Stattdessen umschlangen sie den Verdächtigen mit verzweifelter Kraft, hielten seine Arme fest und hinderten ihn so daran, den Schalter zu erreichen. Auf diese Weise wurden mehrere Anschläge vereitelt und viele Menschenleben gerettet. Aber die Attentäter lernten dazu. Jetzt brachte man ihnen bei, ihren Daumen ständig auf dem Zündknopf zu lassen, um die Umarmungstaktik wirkungslos zu machen. Der Schalter befindet sich neben der Batterie in der Tasche. Deshalb die Hände in der Tasche.
Die Nummer vier hatte beide Hände in der Kuriertasche, deren Klappe zwischen ihren Handgelenken faltig zusammengedrückt war.
Der Zug hielt in der 33rd Street. Die Türen gingen auf. Niemand stieg aus. Die einzelne Person auf dem Bahnsteig zögerte, wandte sich dann nach rechts und stieg in den nächsten Wagen. Ich drehte mich um, schaute durch das kleine Fenster hinter meinem Kopf und beobachtete, wie sie sich für einen Sitzplatz in meiner Nähe entschied. Zwei Querwände aus rostfreiem Stahl und der schmale Luftraum über der Kupplung. Ich hätte ihr am liebsten bedeutet, nach hinten zu gehen. Am anderen Ende des Wagens hätte sie vielleicht eine Überlebenschance. Aber ich rührte mich nicht. Wir hatten keinen Blickkontakt, und sie hätte mich ohnehin ignoriert. Ich kenne New York. Auf irre Gesten in spätnächtlichen U-Bahnen reagierte man nicht.
Die Türen blieben einen Herzschlag länger offen als normal. Eine verrückte Sekunde lang überlegte ich, ob ich versuchen solle, alle dazu zu bringen, den Wagen zu verlassen. Aber ich tat es nicht. Das wäre eine Komödie gewesen. Überraschung, Verständnislosigkeit, vielleicht Sprachbarrieren. Ich wusste nicht einmal, ob ich das spanische Wort für »Bombe« kannte. Vielleicht bomba. Oder war das die Glühbirne? Einen verrückten Kerl, der etwas von Glühbirnen schwafelte, würde niemand ernst nehmen.
Nein, Glühbirne hieß bombilla, glaubte ich.
Vielleicht.
Möglicherweise.
Aber ich beherrschte sicher keine Balkansprache. Und erst recht keine westafrikanischen Dialekte. Obwohl die Frau in dem Batikkleid vielleicht Französisch sprach. Teile Westafrikas sind frankophon. Und ich spreche Französisch. Une bombe! La femme là-bas a une bombe sous sa doudoune. Die Frau da drüben hat eine Bombe unter ihrer Daunenjacke. Die Westafrikanerin würde mich vielleicht verstehen. Oder sie würde irgendwie begreifen, dass Gefahr drohte, und uns einfach hinausfolgen.
Falls sie rechtzeitig aufwachte. Falls sie die Augen öffnete.
Zuletzt blieb ich einfach sitzen.
Die Türen schlossen sich.
Der Zug fuhr weiter.
Ich starrte die Nummer vier an. Stellte mir ihren schlanken blassen Daumen auf dem versteckten Zündknopf vor. Der Druckschalter stammte vermutlich aus dem Radio Shack. Ein harmloses Bauteil – für Hobbyzwecke. Hatte vermutlich anderthalb Bucks gekostet. Ich stellte mir ein Gewirr aus Drähten vor, rot und schwarz, mit Klebeband zusammengehalten, die Enden zurechtgebogen und mit Kabelschuhen versehen. Ein dickes Zündkabel, das aus der Tasche kam und sich unter ihrer Jacke nach oben schlängelte, um dann zwölf bis zwanzig Zündhütchen in einer langen tödlichen Reihe miteinander zu verbinden. Elektrizität fließt fast mit Lichtgeschwindigkeit. Dynamit besitzt ungeheure Sprengkraft. In einem geschlossenen Raum wie einem U-Bahn-Wagen würde allein die Druckwelle Mus aus uns machen. Die Nägel und Kugellagerkugeln würden eine überflüssige Dreingabe sein. Wie Kugeln gegen Eiscreme. Von uns würde nur sehr wenig übrig bleiben. Vielleicht Knochensplitter von Grapefruitkerngröße. Am ehesten würden Amboss und Steigbügel aus dem Innenohr intakt bleiben. Als kleinste Knochen des menschlichen Körpers hatten sie statistisch gesehen die größte Chance, von der Splitterwolke verfehlt zu werden.
Ich starrte die Frau an. Erreichen konnte ich sie unmöglich. Ich war zehn Meter von ihr entfernt. Ihr Daumen lag bereits auf dem Zündschalter. Billige Messingkontakte hatten ungefähr drei Millimeter Abstand, und diese winzige Lücke wurde jetzt vielleicht rhythmisch um Bruchteile größer oder kleiner, während ihr Herz schlug und ihr Arm zitterte.
Sie war bereit, und ich war es nicht.
Der Zug fuhr leicht schwankend weiter. Das Heulen des Fahrtwinds im Tunnel, das Rattern der Radkränze auf den Schienenstößen, das Scharren des Stromabnehmers über die Stromschiene, das Heulen der Motoren und das sich nach hinten fortpflanzende Quietschen der Spurkränze, wenn ein Wagen nach dem anderen eine Kurve durchfuhr.
Wohin wollte sie? Worunter fuhr der 6 Train hindurch? Ließ sich ein Gebäude durch einen Selbstmordattentäter zum Einsturz bringen? Vermutlich nicht. Wo gab es also nach zwei Uhr morgens noch größere Menschenansammlungen? Nur an wenigen Orten. Vielleicht in Nachtklubs, aber die meisten lagen schon hinter uns, und sie wäre ohnehin an keinem Türsteher vorbeigekommen.
Ich starrte sie an.
Zu intensiv.
Sie spürte es.
Sie drehte den Kopf zur Seite: langsam, ruhig, wie mit einer programmierten Bewegung.
Sie starrte mich ihrerseits an.
Unsere Blicke begegneten sich.
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich.
Sie wusste, dass ich es wusste.
4
Wir starrten uns fast zehn Sekunden lang unverwandt an. Dann stand ich auf. Blieb leicht schwankend auf den Beinen und machte einen Schritt. Aus zehn Metern Entfernung hatte ich keine Überlebenschance, das war klar. Verringerte ich diesen Abstand, konnte ich auch nicht toter sein. Ich ging an der Hispanierin links von mir vorbei. An dem Kerl mit dem NBA-Trikot rechts von mir. An der Westafrikanerin in dem Batikkleid links von mir. Ihre Augen waren noch immer geschlossen. Ich hangelte mich von einem Haltegriff zum nächsten weiter, links, rechts, links, schwankend. Die Nummer vier beobachtete mich unverwandt: ängstlich, hechelnd, murmelnd. Ihre Hände blieben in der Umhängetasche.
Ich blieb zwei Meter von ihr entfernt stehen.
Ich sagte: »Mir wär’s wirklich lieber, wenn ich mich in dieser Sache geirrt hätte.«
Sie gab keine Antwort. Ihre Lippen bewegten sich. Ihre Hände bewegten sich unter dem dicken schwarzen Segeltuch. Der große Gegenstand in ihrer Umhängetasche veränderte seine Position leicht.
Ich sagte: »Ich muss Ihre Hände sehen.«
Sie gab keine Antwort.
»Ich bin ein Cop«, log ich. »Ich kann Ihnen helfen.«
Sie gab keine Antwort.
Ich sagte: »Wir können darüber reden.«
Sie gab keine Antwort.
Ich nahm die Hände von den Handgriffen und ließ sie seitlich herabsinken. Das machte mich kleiner. Weniger bedrohlich. Bloß irgendein Kerl. Ich stand so still, wie der fahrende, schwankende Zug es zuließ. Ich tat nichts. Mir blieb nichts anderes übrig. Sie würde nur Bruchteile einer Sekunde brauchen. Ich würde länger brauchen. Und ich konnte absolut nichts tun. Ich hätte versuchen können, ihre Tasche zu ergreifen und sie ihr wegzureißen. Aber der um ihren Körper geschlungene Trageriemen war ein breites gewebtes Baumwollband. Die gleiche Webart wie bei Feuerwehrschläuchen. Das Band war vorgewaschen, künstlich gealtert und abgewetzt, wie neues Zeug heutzutage ist, aber es würde trotzdem noch sehr reißfest sein. Mein Versuch hätte damit geendet, dass ich sie vom Sitz hochriss und zu Boden fallen ließ.
Bloß wäre ich gar nicht erst in ihre Nähe gekommen. Sie hätte den Knopf gedrückt, bevor meine Hand die halbe Entfernung zurückgelegt hatte.
Ich hätte versuchen können, die Tasche hochzureißen und mit der anderen Hand über ihre Rückseite zu fahren, um das Zündkabel von den Batteriepolen zu reißen. Nur würde das Kabel reichlich lang sein, damit sie sich frei bewegen konnte, sodass ich in weitem Bogen einen halben Meter Kabel hätte herausziehen müssen, bevor irgendein Widerstand zu spüren gewesen wäre. Bis dahin hätte sie den Knopf gedrückt, vielleicht nur unwillkürlich aus Schock.
Oder ich hätte ihre Daunenjacke packen und versuchen können, einige der anderen Drähte loszureißen. Aber zwischen mir und diesen Drähten befanden sich dicke Taschen mit Gänsedaunen. Und rutschig glattes Nylongewebe. Kein Griff, kein Gefühl.
Keine Hoffnung.
Ich hätte versuchen können, sie außer Gefecht zu setzen. Ihr eins über den Schädel zu ziehen, sie k.o. zu schlagen, mit einer Geraden, augenblicklich. Aber obwohl ich schnell war, hätte ein wirksamer Schlag aus zwei Metern Entfernung ungefähr eine halbe Sekunde gedauert. Und sie brauchte ihren Daumen nur drei Millimeter weit zu bewegen.
Sie wäre schneller gewesen.
Ich fragte: »Darf ich mich hinsetzen? Neben Sie?«
Sie sagte: »Nein, bleiben Sie von mir weg.«
Eine neutrale, tonlose Stimme. Kein hörbarer Akzent. Amerikanisch klingend, aber sie hätte von überall her sein können. Aus der Nähe machte sie keinen wirklich gefährlichen oder geistesgestörten Eindruck. Eher einen resignierten, ernsten, verängstigten und erschöpften. Sie sah mit derselben Intensität zu mir auf, mit der sie vorhin das Fenster gegenüber angestarrt hatte. Sie wirkte völlig wach und zurechnungsfähig. Ich kam mir regelrecht durchleuchtet vor, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht sprechen.
»Es ist spät«, sagte ich dann. »Sie sollten die Hauptverkehrszeit abwarten.«
Sie gab keine Antwort.
»Noch sechs Stunden«, sagte ich. »Dann ist sie viel wirksamer.«
Ihre Hände in der Tasche bewegten sich.
Ich sagte: »Nicht jetzt.«
Sie schwieg.
»Nur eine«, sagte ich. »Zeigen Sie mir eine Hand. Sie brauchen nicht beide dort drinzuhaben.«
Der Zug bremste scharf. Ich hatte Mühe, auf den Beinen zu bleiben, griff wieder nach oben und bekam einen Haltegriff zu fassen. Meine Hand war feucht. Der Metallgriff fühlte sich heiß an. Grand Central, dachte ich. Aber dort waren wir nicht. Ich schaute aus dem Fenster, weil ich Licht und weiße Kacheln erwartete, und hatte nur das schwache Leuchten einer blauen Lampe vor mir. Wir hatten im Tunnel gehalten. Bauarbeiten oder ein Signal.
Ich drehte mich zu ihr um.
»Zeigen Sie mir eine Hand«, forderte ich sie noch mal auf.
Die Frau gab keine Antwort. Sie starrte meinen Bauch an. Weil ich mit erhobenen Händen dastand, war mein T-Shirt hochgerutscht und ließ über dem Hosenbund die Narbe an meinem Unterleib sehen. Weißes Narbengewebe, hart und aufgeworfen. Große primitive Stiche wie in einem Cartoon. Von Splittern einer vor vielen Jahren in Beirut hochgegangenen Lastwagenbombe. Ich war hundert Meter vom Nullpunkt entfernt gewesen.
Der Frau auf der Sitzbank war ich achtundneunzig Meter näher.
Sie starrte mich weiter an. Die meisten Leute fragen, woher ich die Narbe habe. Ich wollte nicht, dass sie das auch tat. Ich wollte nicht über Bomben reden. Nicht mit ihr.
Ich sagte: »Zeigen Sie mir eine Hand.«
Sie fragte: »Wieso?«
»Sie brauchen nicht beide dort drin.«
»Was hätten Sie davon?«
»Weiß ich nicht«, antwortete ich. Ich hatte keine rechte Vorstellung davon, was ich tat. Ich habe keine Erfahrung in Verhandlungen mit Geiselnehmern. Ich redete um des Redens willen, was sehr untypisch für mich war. Normalerweise bin ich eher schweigsam. Statistisch gesehen wäre es äußerst unwahrscheinlich, dass ich mitten im Satz sterben würde.
Vielleicht redete ich deshalb.
Die Frau bewegte ihre Hände. Ich sah, dass sie mit der Rechten etwas in der Tasche festhielt, bevor sie langsam die linke Hand herauszog, schmal, blass, kaum sichtbar mit Sehnen und Adern überzogen. Nicht mehr junge Haut. Unlackierte Fingernägel, kurz geschnitten. Keine Ringe. Nicht verheiratet, nicht verlobt. Sie drehte die Hand, um mir die andere Seite zu zeigen. Die leere Handfläche war gerötet, weil ihr heiß war.
»Danke«, sagte ich.
Sie legte die Linke mit der Handfläche nach unten auf den benachbarten Sitz und ließ sie dort liegen, als hätte sie nichts mit dem Rest ihres Körpers zu tun. Was in diesem Augenblick fast zutraf. Der Zug stand weiter im Dunkel. Ich ließ die Hände sinken. Der Saum meines T-Shirts rutschte wieder nach unten und verdeckte die Narbe.
Ich sagte: »Zeigen Sie mir jetzt, was Sie in der Tasche haben.«
»Wozu?«
»Ich möchte es nur sehen. Was immer es ist.«
Sie gab keine Antwort.
Sie bewegte sich nicht.
Ich sagte: »Ich werde nicht versuchen, es Ihnen wegzunehmen. Ehrenwort! Ich möchte es nur sehen. Das verstehen Sie bestimmt.«
Der Zug fuhr wieder an. Wenig Beschleunigung, kein Ruckeln, niedriges Tempo. Ein sanftes Gleiten in die Station. Ein langsames Rollen. Noch ungefähr zweihundert Meter, dachte ich.
Ich sagte: »Ich habe ein Recht darauf, es wenigstens zu sehen, denke ich. Würden Sie mir nicht zustimmen?«
Sie machte ein Gesicht, als verstünde sie das nicht.
Sie sagte: »Ich sehe nicht ein, wieso das Ihr Recht sein soll.«
»Das tun Sie nicht?«
»Nein.«
»Weil dieses Ding auch mich etwas angeht. Und vielleicht kann ich kontrollieren, ob es richtig verdrahtet ist. Für später. Denn Sie müssen es später einsetzen. Nicht jetzt.«
»Sie haben gesagt, dass Sie ein Cop sind.«
»Wir können eine Lösung finden«, sagte ich. »Ich kann Ihnen helfen.« Ich warf einen Blick über die Schulter. Der Zug kroch weiter. Vor uns weißes Licht im Tunnel. Ich schaute wieder nach vorn. Die rechte Hand der Frau bewegte sich. Sie bemühte sich um einen festeren Griff, befreite den Gegenstand zugleich vom Stoff der Umhängetasche.
Ich beobachtete sie. Der Taschenrand verfing sich an ihrem Handgelenk, und sie benützte die Linke, um es zu befreien. Dann zog sie die rechte Hand heraus.
Keine Batterie. Keine Drähte. Kein Knopf, kein Schalter, keine Zündmaschine.
Etwas ganz anderes.
5
Die Frau hielt eine Schusswaffe in der Hand. Sie zielte damit auf mich. Eher tief, unterhalb der Rumpfmitte, auf der Linie zwischen Leistengegend und Nabel. Dort befinden sich alle möglichen lebenswichtigen Dinge: Organe, Rückgrat, Eingeweide, verschiedene Venen und Arterien. Die Waffe war eine Ruger Speed-Six. Ein großer alter Revolver Kaliber .357 Magnum mit zehn Zentimeter langem Lauf, der imstande war, mich so zu durchlöchern, dass Tageslicht durchscheinen konnte.
Insgesamt war ich jedoch heiterer als noch vor einer Sekunde. Aus vielerlei Gründen. Bomben bringen viele Leute plötzlich um, Schusswaffen töten sie einzeln. Mit Bomben braucht man nicht zu zielen, mit Schusswaffen schon. Der Speed-Six wiegt geladen fast ein Kilo. Das ist viel Masse, die ein schmales Handgelenk beherrschen soll. Und Magnumpatronen erzeugen grelles Mündungsfeuer und starken Rückstoß. Hatte sie schon mit dieser Waffe geschossen, würde sie das wissen. Und sie würde sich das bei Schützen bekannte »Magnum-Zucken« angewöhnt haben: eine Zehntelsekunde vor dem Abdrücken den Arm verkrampfen, die Augen schließen und den Kopf wegdrehen. Sie hatte gute Chancen, mich zu verfehlen – selbst aus zwei Meter Entfernung. Die meisten Schüsse aus Handfeuerwaffen gehen daneben. Vielleicht nicht auf dem Schießstand, nicht mit Ohrenschützern und Schießbrille, ohne Zeitdruck und ohne dass etwas auf dem Spiel steht. Aber im richtigen Leben, mit Panik und Stress, zitternden Händen und jagendem Herzen haben Handfeuerwaffen mehr mit Glück oder Pech zu tun. Mit ihrem oder meinem.
Verfehlte sie mich, würde sie keine zweite Chance bekommen.
Ich sagte: »Immer mit der Ruhe.« Nur um irgendetwas zu reden. Ihr Zeigefinger am Abzug war kalkweiß, aber sie hatte ihn noch nicht bewegt. Der Speed-Six ist ein Revolver mit doppelt wirkendem Abzug, bei dem die erste Hälfte der Abzugbewegung den Hammer zurückzieht und die Trommel dreht. Die zweite Hälfte lässt den gespannten Hammer nach vorn schlagen und löst den Schuss aus. Ein komplizierter Mechanismus, der Zeit braucht. Nicht viel, aber doch etwas. Ich starrte ihren Finger an. Spürte auch, dass der Kerl mit dem Blick eines Baseballspielers uns beobachtete. Für alle anderen blockierte mein Rücken vermutlich die Szene.
Ich sagte: »Sie haben keinen Streit mit mir, Lady. Sie kennen mich nicht mal. Stecken Sie das Ding weg, damit wir miteinander reden können.«
Sie gab keine Antwort. Vielleicht drückte ihre Miene etwas aus, aber ich achtete nicht darauf. Ich fixierte ihren Zeigefinger. Das war der einzige Teil von ihr, der mich interessierte. Und ich konzentrierte mich auf die durch den Wagenboden zu spürenden Vibrationen. Wartete darauf, dass der Wagen anhielt. Mein verrückter Mitfahrer hatte mir erzählt, dass jeder R142A fünfunddreißig Tonnen wiegt. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt hundert Stundenkilometer. Deshalb hat er sehr starke Bremsen. Zu stark, um bei langsamer Fahrt fein dosiert zu werden. Sie rucken, knirschen und blockieren sogar. Die letzten Meter vor dem Anhalten rutschen die Züge oft mit blockierten Bremsen. Daher das typische Jaulen, wenn sie zum Stehen kommen.
Ich rechnete mir aus, dass das selbst nach unserem Kriechen der Fall sein würde. Der Revolver war im Prinzip das Gewicht am Ende eines Pendels. Ein langer dünner Arm, dann ein Kilo Stahl. Wenn die Bremsen griffen, würde sich der Speed-Six durch seine Bewegungsenergie in derselben Richtung wie bisher weiterbewegen. Stadtauswärts. Newtons Bewegungsgesetze. Ich hielt mich bereit, gegen die eigene Bewegungsenergie anzukämpfen und einen Sprung in Gegenrichtung zu machen. Stadteinwärts. Ruckte die Revolvermündung nur zehn Zentimeter nach Norden, während ich mich zehn Zentimeter nach Süden bewegte, konnte mir nichts passieren.
Vielleicht genügten auch acht Zentimeter.
Oder neun, um ein kleines Sicherheitspolster zu haben.
Die Frau fragte: »Wo haben Sie die Narbe her?«
Ich gab keine Antwort.
»War das ein Bauchschuss?«
»Bombe«, sagte ich.
Sie bewegte die Mündung etwas, von ihr aus gesehen nach links, aus meiner Sicht nach rechts. Nun zielte sie auf die unter meinem T-Shirt unsichtbare Narbe.
Der Zug rollte weiter. In die Station. Unendlich langsam. Kaum im Fußgängertempo. Die Bahnsteige im Grand Central Terminal sind lang. Der Steuerwagen befand sich ganz am vorderen Ende. Ich wartete darauf, dass die Bremsen greifen würden. Rechnete damit, dass es einen netten kleinen Ruck gäbe.
Dazu kam es nie.
Die Revolvermündung bewegte sich zurück zu meiner Körpermitte. Dann zeigte sie senkrecht in die Höhe. Eine Zehntelsekunde lang glaubte ich, die Frau wolle sich ergeben. Aber die Mündung bewegte sich weiter. Mit einer stolzen, trotzigen Geste hob die Frau das Kinn und drückte die Mündung in das weiche Fleisch darunter. Betätigte den Abzug halb. Die Trommel drehte sich, und der Hammer scharrte über den Nylonstoff ihrer Daunenjacke.
Dann zog sie den Abzug ganz durch und schoss sich selbst den Kopf weg.
6
Die Türen gingen lange nicht auf. Vielleicht hatte jemand die Sprechanlage für Notrufe benutzt, oder der U-Bahnfahrer hatte den Schuss gehört. Jedenfalls entschied das System sich erst mal für eine Vollsperrung. Die hatte das Personal zweifellos geübt. Und eigentlich war dieses Verfahren vernünftig. Es war besser, einen bewaffneten Verrückten in einem Wagen einzusperren, als ihn in der ganzen Stadt herumlaufen zu lassen.
Aber das Warten war nicht angenehm. Das Kaliber .357 Magnum wurde 1935 erfunden. Magnum heißt im Lateinischen groß. Schwereres Geschoss und weit mehr Treibladung. In Wirklichkeit detoniert die Treibladung nicht, sondern brennt schnell ab. Dabei entsteht eine riesige Blase aus heißem Gas, die das Geschoss aus dem Rohr treibt. Normalerweise tritt das Gas nach dem Geschoss aus und entzündet den Sauerstoff der Umgebungsluft. Daher das Mündungsfeuer. Aber bei einem aufgesetzten Schuss, für den die Nummer vier sich entschieden hatte, durchlöchert die Kugel die Haut, und das Gas dringt sofort nach ihr ein. Unter der Haut dehnt es sich gewaltsam aus und reißt eine riesige sternförmige Austrittswunde oder bläst alles Fleisch, alle Haut vom Schädel, der so kahl zurückbleibt, als hätte man eine Banane geschält.
Das war in diesem Fall passiert. Das Gesicht der Frau bestand nur noch aus blutigen Fleischfetzen, die an zertrümmerten Knochen hingen. Das Geschoss war senkrecht durch ihren Mund gegangen und hatte mit seiner gewaltigen kinetischen Energie die Schädeldecke durchschlagen. Der jähe Überdruck hatte ein Ventil gesucht und dort gefunden, wo ihre Gehirnschale im Säuglingsalter zugewachsen war. Die Fontanellen waren wieder aufgeplatzt, und der Druck hatte über und hinter ihr mehrere große Knochensplitter verteilt, die an der Seitenwand klebten. Ihr Kopf war praktisch nicht mehr da. Aber die gegen Graffiti resistente Glasfaserwand erfüllte ihre Aufgabe. Weiße Knochensplitter, dunkles Blut und graue Gehirnmasse liefen über die glatte Fläche nach unten, klebten nicht fest, hinterließen dünne Kriechspuren. Die Tote war auf der Bank zusammengesackt. Ihr rechter Zeigefinger steckte noch im Abzugsbügel. Der Revolver war vom rechten Oberschenkel abgeprallt und lag jetzt auf dem Sitz neben ihr.
Der Schussknall hallte noch immer in meinen Ohren nach. Hinter mir hörte ich gedämpfte Geräusche. Ich roch das Blut der Frau. Ich trat vor und kontrollierte ihre Tasche. Leer. Ich öffnete den Reißverschluss ihrer Daunenjacke und zog sie vorn auseinander. Wieder nichts. Nur eine weiße Baumwollbluse und der Gestank von Kot und Urin.
Ich fand die Notrufanlage und sprach selbst mit dem Fahrer. Ich sagte: »Selbstmord durch Erschießen. Im vorletzten Wagen. Die Sache ist gelaufen. Wir sind in Sicherheit. Uns droht keine weitere Gefahr.« Ich wollte nicht warten müssen, bis die New Yorker Polizei SWAT-Teams zusammenzog, die sich in Kevlarwesten und mit Sturmgewehren anpirschen würden. Das konnte verdammt lange dauern.
Von dem U-Bahnfahrer erhielt ich keine Antwort. Aber eine Minute später kam seine Stimme aus den Deckenlautsprechern. Er sagte: »Achtung, eine Durchsage an alle Fahrgäste. Wegen eines noch nicht geklärten Vorfalls bleiben die Türen einige Minuten geschlossen.« Er sprach langsam. Vermutlich las er den Text von einem Kärtchen ab. Seine Stimme klang zittrig. Ganz anders als der professionelle Tonfall der Nachrichtensprecher von Bloomberg TV.
Ich sah mich ein letztes Mal in dem Wagen um, setzte mich dann einen Meter von der kopflosen Leiche entfernt hin und wartete.
Ganze Episoden von Fernsehkrimis hätten laufen können, bevor die richtigen Cops auch nur auftauchten. DNA-Spuren hätten gesichert und untersucht, Übereinstimmungen festgestellt, Täter gejagt und gefasst und vor Gericht gestellt und verurteilt werden können. Irgendwann kamen jedoch sechs Uniformierte die Treppe herunter. Sie trugen Mützen und Kevlarwesten und hatten ihre Waffen gezogen. NYPD-Streifenpolizisten der Nachtschicht, vermutlich vom 14. Revier in der West 35th Street, dem berühmten Bezirk Midtown South. Sie rannten den Bahnsteig entlang und fingen an, den Zug von vorn zu kontrollieren. Ich stand wieder auf und schaute durch die Fenster über den Kupplungen den ganzen Zug entlang, als blickte ich in einen langen beleuchteten Tunnel aus rostfreiem Stahl. Mit zunehmender Entfernung wurde das Bild trüber, weil die Scheiben grünlich und nicht ganz sauber waren. Aber ich konnte verfolgen, wie die Cops nacheinander alle Wagentüren öffneten, die Fahrgäste überprüften, auf den Bahnsteig schoben und nach oben auf die Straße schickten. Dieser Nachtzug war nur schwach besetzt, deshalb brauchten sie nicht lange, um uns zu erreichen. Sie sahen durch die Fenster, entdeckten die Leiche mitsamt dem Revolver und wurden sichtlich nervös. Als die Türen sich zischend öffneten, stürmten sie paarweise durch die Doppeltüren herein. Wir hoben alle reflexartig die Hände.
Jeweils ein Cop blockierte die Türen, und die anderen drei bewegten sich sofort auf die Tote zu. Sie machten knapp zwei Meter vor ihr halt. Tasteten nicht nach ihrem Puls oder sonstigen Lebenszeichen. Hielten ihr keinen Spiegel unter die Nase, um festzustellen, ob sie noch atmete. Teils weil klar war, dass sie nicht atmete, teils weil sie keine Nase mehr hatte. Die Knorpelteile waren weggefetzt, sodass zwischen den durch inneren Überdruck herausgedrückten Augäpfeln nur gezackte Knochensplitter übrig waren.
Ein großer Cop mit den Ärmelstreifen eines Sergeanten drehte sich um. Er war etwas blass um die Kiemen, spielte die Rolle des Veteranen, den nichts mehr erschüttern kann, aber ziemlich gut. Er fragte: »Wer hat gesehen, was hier passiert ist?«
Im vorderen Teil des Wagens herrschte Schweigen. Die Hispanierin, der Mann in dem NBA-Trikot, die Westafrikanerin – sie alle saßen unbeweglich da und sagten nichts. Punkt acht: angestrengt geradeaus starren. Das taten sie alle. Kann ich dich nicht sehen, kannst du mich nicht sehen. Auch der Mann in dem Golfhemd schwieg. Also sagte ich: »Sie hat die Waffe aus ihrer Tasche gezogen und sich erschossen.«
»Einfach so?«
»Mehr oder weniger.«
»Warum?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Wo und wann?«
»Kurz vor der Einfahrt in diese Station. Wann immer das war.«
Der Kerl verarbeitete die Informationen. Selbstmord durch Erschießen. Für die U-Bahn war das NYPD zuständig. Die Langsamfahrstelle zwischen 41st und 42nd Street gehörte zum Bereich des 14. Reviers. Sein Fall. Keine Frage. Er nickte, dann sagte er: »Okay, steigen Sie bitte alle aus, und warten Sie auf dem Bahnsteig. Wir brauchen Namen, Adressen und Zeugenaussagen von Ihnen.«
Dann schaltete er sein Kragenmikrofon ein und bekam als Antwort laut knatternde atmosphärische Störungen. Auf die antwortete er seinerseits mit einer langen Kette von Codewörtern und -zahlen. Ich vermutete, dass er Sanitäter und einen Krankenwagen anforderte. Danach würde Bahnpersonal dafür sorgen müssen, dass der Wagen abgekoppelt und gereinigt wurde und die Züge auf dieser Linie wieder normal verkehrten. Keine Schwierigkeit, dachte ich. Bis zur morgendlichen Hauptverkehrszeit blieben noch ein paar Stunden.
Als wir ausstiegen, hatte sich auf dem Bahnsteig bereits eine große Menschenmenge versammelt. U-Bahn-Polizei, dazukommende gewöhnliche Cops, Bahnarbeiter, die von allen Seiten zusammenströmten, U-Bahn-Personal aus den oberen Etagen des Terminals. Fünf Minuten später polterte ein Rettungsteam des FDNY mit einer Tragbahre die Treppe herunter. Als die Feuerwehrleute durch die Sperre und in den Zug kamen, stiegen die zuerst erschienenen Cops aus. Wie es weiterging, sah ich nicht mehr, denn diese Cops streiften durch die Menge, schauten sich um und suchten jeweils einen Fahrgast, um ihn mitzunehmen und zu befragen. Der große Sergeant kam zu mir. Ich hatte seine Fragen im Zug beantwortet. Deshalb hatte er es gleich auf mich abgesehen. Er führte mich tief in die Station hinein und in einen heißen, spärlich möblierten, weiß gekachelten Raum, der vermutlich zum Revier der U-Bahn-Polizei gehörte, ließ mich auf einem Holzstuhl Platz nehmen und fragte mich nach meinem Namen.
»Jack Reacher«, antwortete ich.
Er schrieb ihn auf und sagte sonst nichts mehr. Lungerte nur an der Tür herum und beobachtete mich. Und wartete. Auf die Ankunft eines Kriminalbeamten, vermutete ich.
7
Der Kriminalbeamte, der dann aufkreuzte, war eine Frau, und sie kam allein. Sie trug Hosen und dazu eine kurzärmelige graue Bluse. Vielleicht Seide, vielleicht Kunstseide. Jedenfalls glänzend. Sie war nicht in die Hose gesteckt, und ich vermutete, dass sie die Dienstwaffe, die Handschellen, und was sie sonst noch bei sich hatte, verdeckte. Die Frau war klein und schlank, hatte schwarze, zu einem Nackenknoten zusammengefasste Haare und ein schmales, ovales Gesicht. Kein Schmuck. Nicht mal ein Ehering. Sie war Ende dreißig, vielleicht vierzig. Eine attraktive Frau. Ich mochte sie sofort. Sie wirkte entspannt und freundlich, wies ihre goldene Plakette vor und gab mir ihre Visitenkarte. Darauf standen ihre dienstliche Telefonnummer, eine Handynummer und ihre E-Mail-Adresse beim NYPD, ebenso wie ihr Name, den sie auch laut sagte: Theresa Lee. Aber sie war keine Asiatin. Vielleicht stammte »Lee« aus einer früheren Ehe oder war die Ellis-Island-Version von Leigh oder einem anderen längeren oder komplizierteren Namen. Oder vielleicht stammte sie von Robert E. Lee ab.
Sie sagte: »Können Sie mir schildern, was genau passiert ist?«
Sie sprach leise, mit hochgezogenen Augenbrauen und sanfter, fürsorglicher und rücksichtsvoller Stimme, als wäre ihre größte Sorge mein persönlicher posttraumatischer Stress. Können Sie es mir schildern? Können Sie das? Wie in: Können Sie es ertragen, alles noch einmal zu durchleben? Ich musste kurz lächeln. In Midtown South gab es pro Jahr kein halbes Dutzend Morde, und selbst wenn sie seit ihrem ersten Tag im Dienst zu allen gerufen worden war, hatte ich trotzdem mehr Leichen gesehen als sie. Um ein Vielfaches mehr. Die Frau in der U-Bahn war nicht der angenehmste Fall gewesen, aber es hatte weit schlimmere gegeben.
Also erzählte ich ihr genau, was passiert war: mein Einsteigen in der Bleecker Street, die abgehakte Elfpunkteliste, meine zögernde Annäherung, das stockende Gespräch, der Revolver, der Selbstmord.
Theresa Lee wollte über die Liste reden.
»Wir haben ein Exemplar«, sagte sie. »Es ist als vertraulich eingestuft.«
»Sie ist seit zwanzig Jahren bekannt«, entgegnete ich. »Jeder hat ein Exemplar. Von vertraulich kann keine Rede sein.«
»Wo haben Sie sie gesehen?«
»In Israel«, antwortete ich. »Kurz nachdem sie aufgestellt worden war.«
»Wieso?«
Ich erzählte ihr meinen Lebenslauf. Die Kurzfassung. Die US Army, dreizehn Jahre als Militärpolizist, die Eliteeinheit 110th Investigative Unit, dienstliche Verwendung in aller Welt, dazu Abkommandierungen nach Bedarf. Dann der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Friedensdividende, der zusammengestrichene Verteidigungshaushalt, die überraschende Freistellung.
»Offizier oder Mannschaftsdienstgrad?«, fragte sie.
»Zuletzt war ich Major«, sagte ich.
»Und jetzt?«
»Ich bin pensioniert.«
»Dafür sind Sie noch recht jung.«
»Ich wollte das Leben genießen, solange ich kann.«
»Und tun Sie’s?«
»Mehr als jemals zuvor.«
»Was haben Sie heute Abend gemacht? Drunten im Village?«
»Musik«, sagte ich. »In den Blues Clubs in der Bleecker Street.«
»Und wohin waren Sie mit dem 6 Train unterwegs?«
»Ich wollte mir irgendwo ein Zimmer nehmen oder zur Port Authority fahren, um einen Bus zu nehmen.«
»Wohin?«
»Irgendwohin.«
»Kurzbesuch?«
»Die beste Art.«
»Wo wohnen Sie?«
»Nirgends. Mein Jahr besteht aus einem Kurzbesuch nach dem anderen.«
»Wo ist Ihr Gepäck?«
»Ich habe keines.«
Danach stellen die meisten Leute weiterführende Fragen, aber Theresa Lee tat das nicht. Stattdessen betrachtete sie mich nachdenklich und sagte: »Ich bin nicht glücklich darüber, dass die Liste falsch war. Ich dachte, sie sollte endgültig sein.« Ihr Tonfall schloss mich ein, von Cop zu Cop, als machte mein früherer Job einen Unterschied für sie.
»Sie war nur halb falsch«, erklärte ich. »Der Teil mit dem Selbstmord war richtig.«
»Das stimmt wohl«, sagte sie. »Die Anzeichen wären die gleichen, nehme ich an. Trotzdem war das ein falsches positives Signal.«
»Besser als ein falsches negatives.«
»Das stimmt wohl«, sagte sie wieder.
Ich fragte: »Wissen wir schon, wer sie war?«
»Noch nicht. Aber das steht bald fest. Wie ich höre, sind am Tatort Schlüssel und eine Geldbörse gefunden worden. Damit dürfte eine Identifizierung möglich sein. Aber was war mit der Daunenjacke?«
Ich sagte: »Keine Ahnung.«
Sie verstummte, als wäre sie zutiefst enttäuscht. Ich sagte: »Solche Dinge sind immer im Fluss. Persönlich glaube ich, dass wir die Liste um einen zwölften Punkt ergänzen sollten. Nimmt eine Selbstmordattentäterin ihr Kopftuch ab, ist fehlende Sonnenbräune ebenso verräterisch wie bei einem Mann.«
»Gutes Argument«, meinte sie.
»Und ich habe in einem Buch gelesen, dass die Sache mit den Jungfrauen eine Falschübersetzung ist. Das Wort ist mehrdeutig. Es steht in einem Abschnitt, in dem von essbaren Dingen die Rede ist. Milch und Honig. Wahrscheinlich bedeutet es Rosinen. Dick und vermutlich kandiert oder gezuckert.«
»Sie verüben Selbstmord wegen Rosinen?«
»Ich würde gern ihre Gesichter sehen.«
»Sind Sie Linguist?«
»Ich spreche Englisch«, sagte ich. »Und Französisch. Und wozu sollte eine Selbstmordattentäterin überhaupt Jungfrauen wollen? Viele religiöse Schriften sind falsch übersetzt. Vor allem wenn’s um Jungfrauen geht. Wahrscheinlich sogar das Neue Testament. Manche Leute sagen, Maria sei eine Erstgebärende gewesen, sonst nichts. Nach dem hebräischen Wort dafür. Keine Jungfrau. Die ursprünglichen Autoren würden lachen, wenn sie lesen könnten, was wir alles daraus gemacht haben.«
Theresa Lee äußerte sich nicht dazu. Stattdessen fragte sie: »Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Ich dachte, sie erkundige sich, ob ich durcheinander sei. Ob sie mir psychologische Betreuung anbieten solle. Vielleicht weil sie mich für einen schweigsamen Mann hielt, der zu viel redete. Aber ich hatte mich getäuscht. Als ich antwortete: »Mir geht’s gut«, wirkte sie leicht überrascht und sagte: »Mir an Ihrer Stelle täte es leid, sie angesprochen zu haben. In der U-Bahn. Ich glaube, Sie haben sie in den Abgrund gestoßen. Noch ein paar Stationen, dann wäre sie vielleicht darüber hinweggekommen, was immer ihr zugesetzt hat.«
Danach saßen wir eine Minute lang schweigend da, bis der große Sergeant den Kopf zur Tür hereinstreckte und Lee zunickte, einen Augenblick herauszukommen. Ich hörte ein kurzes, flüsternd geführtes Gespräch, dann betrat Lee wieder den Raum und forderte mich auf, ihr in die West 35th Street zu folgen – aufs Polizeirevier.
Ich fragte: »Warum?«
Sie zögerte.
»Formalität«, erklärte sie. »Um Ihre Aussage zu Protokoll zu nehmen, um die Akte zu schließen.«
»Kann ich’s mir aussuchen, ob ich mitkommen will?«
»Fangen Sie nicht damit an«, sagte sie. »Hier geht’s auch um die israelische Liste. Wir könnten alles zu einer Frage der nationalen Sicherheit erklären. Sie sind ein wichtiger Zeuge, und wir könnten Sie einsperren, bis Sie alt und grau sind. Spielen Sie lieber mit wie ein anständiger Bürger.«
Also zuckte ich mit den Schultern und ging mit ihr durch das Labyrinth des Grand Central Terminal zur Vanderbilt Avenue, wo ihr Wagen parkte – ein neutraler Ford Crown Victoria, verbeult und nicht gewaschen, aber fahrtauglich. Er brachte uns problemlos in die West 35th Street. Wir betraten das Dienstgebäude durch das prächtige alte Portal. Sie führte mich in einen Vernehmungsraum im ersten Stock, trat beiseite und wartete auf dem Flur, um mir den Vortritt zu lassen. Dann schloss sie die Tür hinter mir und sperrte sie von außen ab.
8
Zwanzig Minuten später tauchte Theresa Lee mit einer frisch angelegten Fallakte und einem Kollegen wieder auf. Sie warf die Akte auf den Tisch und stellte den Mann als ihren Partner vor. Sie sagte, er heiße Docherty, und ihm seien eine Menge Fragen eingefallen, die vielleicht zu Anfang hätten gestellt und beantwortet werden sollen.
»Welche Fragen?«, wollte ich wissen.
Als Erstes bot sie mir Kaffee und einen Gang auf die Toilette an. Ich sagte zu beidem ja. Docherty begleitete mich den Flur entlang, und als wir zurückkamen, standen neben der Akte drei Styroporbecher auf dem Tisch. Zweimal Kaffee, einmal Tee. Ich nahm mir einen Kaffee und kostete ihn. Er war in Ordnung. Lee nahm den Tee, Docherty den zweiten Kaffee. Er sagte: »Erzählen Sie alles noch mal von vorn.«
Das tat ich also, knapp und präzise, aufs Nötigste beschränkt, und Docherty regte sich, genau wie zuvor Lee, ein bisschen darüber auf, dass die israelische Liste sich als falsch positiv erwiesen hatte. Ich erklärte erneut, falsch positiv sei besser als falsch negativ, und aus der Sicht einer Selbstmörderin mache es in Bezug auf persönliche Symptome vielleicht keinen Unterschied, ob sie allein abtreten oder eine Menge Leute mit in den Tod reißen wolle. Fünf Minuten lang herrschte eine Seminaratmosphäre, in der drei vernünftige Leute über ein interessantes Phänomen diskutierten.
Dann änderte sich der Tonfall.
Docherty fragte: »Wie war Ihnen zumute?«
Ich fragte: »Wann?«
»Als sie sich umgebracht hat.«
»Ich war froh, dass sie nicht mich erschossen hat.«
Docherty sagte: »Wir gehören zur Mordkommission. Wir müssen uns alle gewaltsamen Tode ansehen. Das verstehen Sie doch, nicht? Für alle Fälle.«
Ich sagte: »Für welchen Fall?«
»Falls hinter dieser Sache mehr steckt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist.«
»Das tut’s nicht. Sie hat sich erschossen.«
»Das sagen Sie.«
»Niemand kann etwas anderes behaupten. Weil es genau so passiert ist.«
Docherty sagte: »Es gibt immer alternative Szenarien.«
»Glauben Sie?«
»Vielleicht haben Sie sie erschossen.«
Theresa Lee bedachte mich mit einem mitfühlenden Blick.
Ich sagte: »Das habe ich nicht.«
Docherty sagte: »Vielleicht war das Ihr Revolver.«
Ich sagte: »Das war er nicht. Das Ding wiegt zwei Pfund. Ich habe keine Tragetasche.«
»Sie sind ein großer Mann. Große Hose. Große Taschen.«
Theresa Lee bedachte mich mit einem weiteren mitfühlenden Blick. Als wollte sie sagen: Tut mir leid.
Ich fragte: »Was wird hier gespielt? Guter Cop, doofer Cop?«
Docherty sagte: »Halten Sie mich für doof?«
»Sie haben’s gerade bewiesen. Hätte ich sie mit einer .357 Magnum erschossen, hätte ich bis zum Ellbogen Schmauchspuren am Arm. Aber Sie haben draußen vor der Toilette gewartet, als ich mir die Hände gewaschen habe. Sie reden lauter Scheiß. Sie haben mir keine Fingerabdrücke abgenommen und mich nicht über meine Rechte belehrt. Sie werfen nur Nebelkerzen.«
»Wir sind verpflichtet, uns Gewissheit zu verschaffen.«
»Was sagt der Gerichtsmediziner?«
»Das wissen wir noch nicht.«
»Es gibt weitere Zeugen.«
Lee schüttelte den Kopf. »Zwecklos. Die haben nichts gesehen.«
»Sie müssen etwas gesehen haben.«
»Ihr Rücken hat ihnen die Sicht genommen. Außerdem haben sie nicht hingesehen, haben halb geschlafen und sprechen kaum Englisch. Sie hatten nichts zu bieten. Im Prinzip wollten sie weiter, denke ich, bevor wir anfangen konnten, Green Cards zu kontrollieren.«
»Was ist mit dem anderen Kerl? Er hat vor mir gesessen und war hellwach. Und er hat wie ein Bürger ausgesehen, der gut Englisch spricht.«
»Welcher andere Kerl?«
»Der fünfte Fahrgast. Chinos und ein Golfhemd.«
Lee schlug die Akte auf. Schüttelte den Kopf. »Außer der Frau waren nur vier Fahrgäste in dem Wagen.«
9
Lee nahm ein Blatt Papier aus dem Schnellhefter, drehte es um und schob es halb über den Tisch. Es war eine handgeschriebene Zeugenliste. Vier Namen. Meiner, dazu ein Rodriguez, ein Frluijow und eine Mbele.
»Vier Fahrgäste«, wiederholte sie.
Ich sagte: »Ich war im Wagen. Ich kann zählen. Ich weiß, wie viele Fahrgäste es waren.« Dann stellte ich mir die Szene noch einmal vor. Aus der U-Bahn aussteigen, im Durcheinander auf dem Bahnsteig warten. Die Ankunft der Rettungssanitäter. Die Cops, die jetzt einzeln ausstiegen, sich durch die Menge schoben, Zeugen identifizierten und sie einzeln zu Vernehmungsräumen führten. Mich hatte der große Sergeant als Ersten geschnappt. Ich konnte unmöglich sagen, ob uns drei Cops gefolgt waren oder vier.
Ich sagte: »Er muss sich heimlich verdrückt haben.«
Docherty fragte: »Wer war er?«
»Nur irgendein Kerl. Hellwach, aber nicht weiter auffällig. In meinem Alter, nicht arm.«
»Hat er irgendwie Kontakt mit der Frau gehabt?«
»Meines Wissens nicht.«
»Hat er sie erschossen?«
»Sie hat sich selbst erschossen.«
Docherty zuckte mit den Schultern. »Also ist er nur ein widerwilliger Zeuge. Will nicht, dass die Vernehmung zeigt, dass er um zwei Uhr morgens unterwegs war. Wahrscheinlich hat er seine Frau betrogen. So was passiert dauernd.«
»Er ist abgehauen. Aber Sie stellen ihm einen Freibrief aus und befragen stattdessen mich?«
»Sie haben gerade ausgesagt, dass er nichts mit der Sache zu tun gehabt hat.«
»Ich auch nicht.«
»Das behaupten Sie.«
»Sie glauben, was ich über den anderen Typen sage, aber nicht, was ich über mich selbst sage?«
»Wieso sollten Sie in Bezug auf den anderen Typen lügen?«
Ich sagte: »Das ist alles Zeitverschwendung.« Und zwar so extreme, plumpe Zeitverschwendung, dass ich plötzlich erkannte, dass sie nicht echt war. Sie war nur Theater. Ich merkte, dass Lee und Docherty mir auf ihre spezielle Weise einen kleinen Gefallen erwiesen.