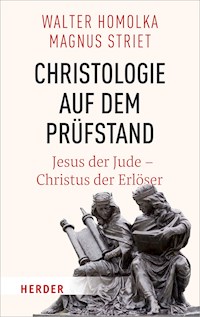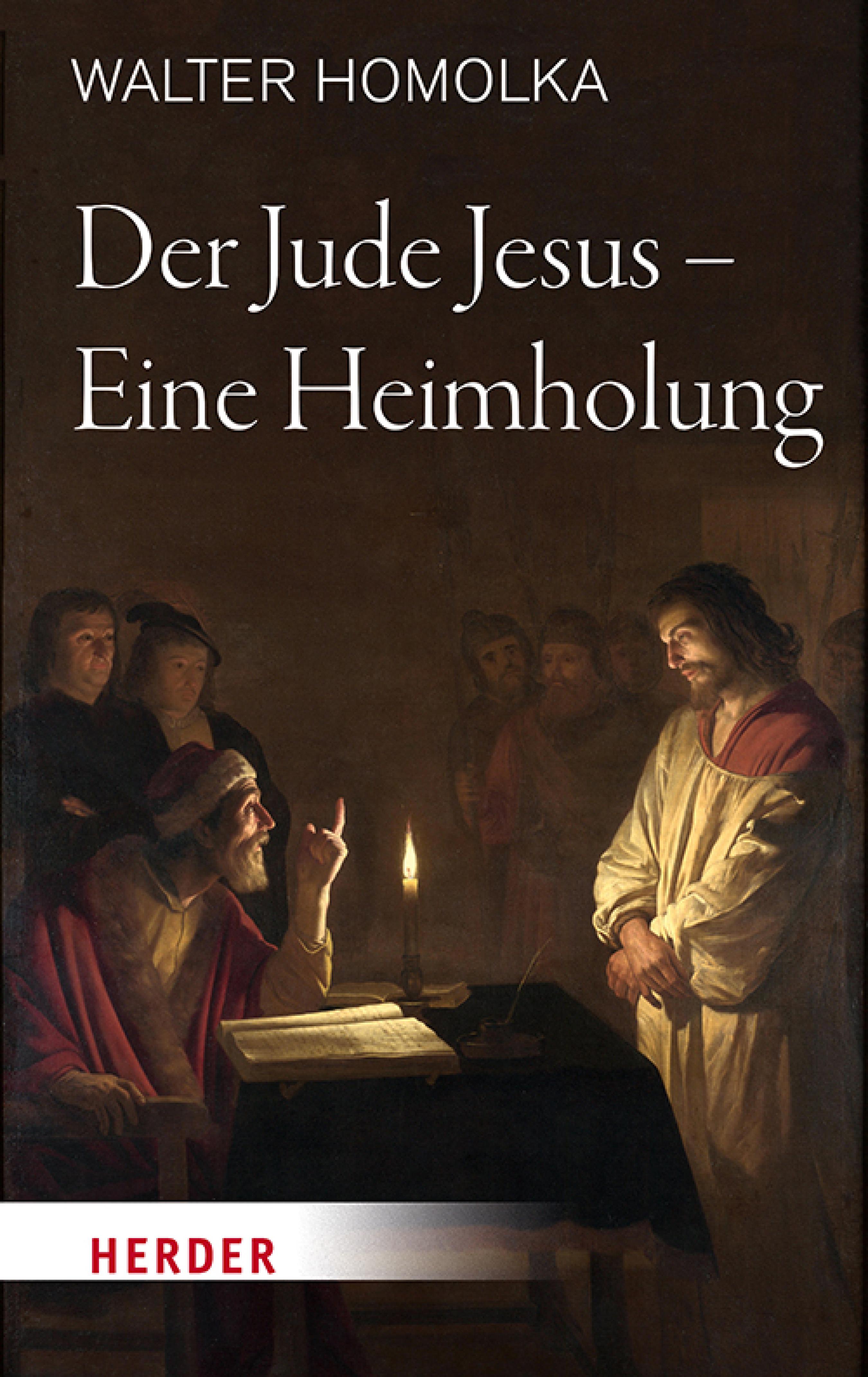
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Rabbiner Walter Homolka beschreibt in seinem Buch die wichtigsten jüdischen Perspektiven auf Jesus. Trotz der christlichen Unterdrückung, die Juden im Namen Jesu jahrhundertelang erfuhren, setzten sie sich seit jeher mit Jesus auseinander. Homolka diskutiert das wachsende jüdische Interesse am Nazarener seit der Aufklärung und wie Juden Jesus heute sehen, im religiösen sowie kulturellen Kontext. Das Buch zeigt: Im Zentrum der Beschäftigung mit dem Juden Jesus steht das Ringen des Judentums um Authentizität und Augenhöhe. Jesu Verankerung im Judentum bietet eine Herausforderung für Christen heute und die Chance auf fruchtbaren jüdisch-christlichen Dialog.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Homolka
Der Jude Jesus – Eine Heimholung
Mit einem Geleitwort von Jan-Heiner Tück
Danksagung
Das vorliegende Buch fußt auf meiner englischen Veröffentlichung „Jesus Reclaimed – Jewish Perspectives on the Nazarene“ (New York/Oxford 2015) und der polnischen Ausgabe „Upominanie siy o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej“ (Poznan 2019), die aktualisiert und erweitert wurden.
ßeßDie deutsche Fassung gäbe es nicht ohne die kollegiale Mithilfe von Frau Prof. Dr. Kathy Ehrensperger (Potsdam). Frau Dr. Juni Hoppe, Herr Hartmut Bomhoff M.A. und Herr Dr. David Heywood Jones haben wesentlich am Zustandekommen des Buches mitgewirkt. Frau Susanne Naumann M.A. von Sunside-Übersetzung Reutlingen hat Teile des Werkes in die deutsche Sprache übersetzt. Dr. Stephan Weber hat das Buch als Lektor grandios betreut. Ihnen allen gilt mein ganzer Dank!
ßeßDie 5. Auflage des Buchs seit dem Erscheinen im Juli 2020 wurde korrigiert und aktualisiert.
ßo1ßRabbiner Professor Walter Homolka Potsdam, April 2021
5. erneut durchgesehene Auflage 2021© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2020Alle Rechte vorbehaltenwww.herder.deUmschlaggestaltung: Verlag HerderUmschlagmotiv: van Honthorst, Gerrit: Jesus vor dem Hohenpriester, ca. 1617, Öl auf Leinwand, The National Gallery, London.Satz : SatzWeise, Bad WünnenbergHerstellung: CPI books GmbH, LeckPrinted in GermanyISBN Print 978-3-451-38356-4ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83356-4ISBN E-Book (E-PUB) 978-3-451-83623-7
Für Christian Stücklund die Oberammergauer PassionsspieleTräger des Abraham-Geiger-Preises 2020
Efrat Natan, Roof Work – Golgotha, 1979, picture from installation, gelatin silver print, The Israel Museum, Jerusalem. ‘ Yehudit Itach.
Inhaltsverzeichnis
Titel
Danksagung
Impressum
Widmung
Vorwort
Anmerkungen
Die Heimholung Jesu als Anstoß für die christliche Theologie Zum Geleit
Von gegenseitiger Verketzerung zu wechselseitiger Annäherung
‚Heimholung Jesu‘ ins Judentum – ein Anstoß für die christliche Theologie
Abbau des Dogmas? Die Koalition von historisch- kritischer Exegese und jüdischer Jesus-Forschung
Inhabitation – Inkarnation: eine Annäherung bei bleibender Unterschiedenheit
Anmerkungen
Kapitel 1 Jesusbilder von der Antike bis zur frühen Neuzeit: Ein Faktencheck
1.a. Das Leben Jesu nach den Quellen
Die frühen Jahre
Öffentliches Auftreten
Jesu Botschaft
Verhaftung, Prozess und Tod
1.b. Jesusbilder im Judentum
Jesus in Mischna und Talmud
Die „Toldot Jeschu“
Rabbinische Polemik gegen Jesus
Christliche Talmudkritik und Zensur
Verdunkelter Monotheismus, aber kein Götzendienst
Anmerkungen
Kapitel 2 Jüdische und christliche Leben-Jesu-Forschung: Der historische Jesus
2.a. Jesus und die jüdische Aufklärung
2.b. Die christliche Leben-Jesu-Forschung – Eine Abkehr vom Dogma5
2.c. Die jüdische Leben-Jesu-Forschung als Heimholung Jesu ins Judentum
2.d. Das entwürdigte Judentum: Der Berliner Antisemitismusstreit
2.e. Leo Baeck und Adolf von Harnack – Die Kontroverse zwischen jüdischer und christlicher Jesusforschung
Anmerkungen
Kapitel 3 Jüdische Ansätze zur Leben-Jesu-Forschung in der Moderne
3.a. Jüdische Leben-Jesu-Forschung im 20. Jahrhundert
Joseph Klausner (1874–1958)
Eduard Strauss (1876–1952)
Martin Buber (1878–1965)
Schalom Ben-Chorin (1913–1999)
Pinchas Lapide (1922–1997)
Samuel Sandmel (1911–1979)
Ernst Ludwig Ehrlich (1921–2007)
Hans-Joachim Schoeps (1909–1980)
David Flusser (1917–2000)
Géza Vermes (1924–2013)
3.b. Jüdische Leben-Jesu-Forschung im 21. Jahrhundert
Michael J. Cook und Jonathan Brumberg-Kraus
The Jewish Annotated New Testament
Zev Garber und Bruce Chilton
Amy-Jill Levine
Paula Fredriksen
Adele Reinhartz
Daniel Boyarin
Jacob Neusner
Irving Greenberg
Michael Wyschogrod
3.c. Der Beitrag der Archäologie zur Leben-Jesu-Forschung
Anmerkungen
Kapitel 4 Der jüdische Jesus in der Moderne: Eine diverse Wirkungsgeschichte
4.a. Wichtige rezeptionsgeschichtliche Stimmen in der Theologie
Matthew Hoffman
Susannah Heschel
Christian Wiese
George L. Berlin
Donald A. Hagner
David R. Catchpole
Daniel F. Moore
4.b. Exkurs: Der jüdische Jesus in der Literatur
Anmerkungen
Kapitel 5 Joseph Ratzinger und der jüdische Jesus: Ein theologischer Rückfall
5.a. Dass Jesus Jude war – ein kultureller Zufall?
5.b. Der „Rabbi Jesus“ – den Christen nur als Christus wichtig?
5.c. „Die ganze Bibel von Christus her lesen“ – Joseph Ratzingers Hermeneutik
5.d. Christlicher Glaube und „historische Vernunft“
5.e „Gnade und Berufung ohne Reue“
Anmerkungen
Kapitel 6 Der jüdische Jesus – eine Herausforderung für die christliche Theologie
Anmerkungen
Bibliographie
Register
Vorwort
Für die Juden in Europa war Jesus als der dogmatisierte Christus lange nichts weiter als ein Symbol christlicher Unterdrückung. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kämpften Juden in Europa um gleiche Rechte und gesellschaftliche Anerkennung. Dies zwang viele, ihre jüdische Identität im Licht der neuen Bedingungen neu zu bewerten. Juden wollten nicht nur nach dem Gesetz, sondern auch de facto gleichberechtigte Bürger sein. Da sie diesen Identitätsfindungsprozess in einer christlich geprägten Gesellschaft durchlebten, stand die Beschäftigung mit Jesus bald auf dem Plan. Einer der prominentesten jüdischen Denker seiner Zeit, Moses Mendelssohn (1729–1786), äußerte sich in seiner einflussreichen Abhandlung über die philosophischen Gründe für eine Trennung von Kirche und Staat im Jahr 1783 zu Jesus: Jesus habe nie gesagt, er sei gekommen, um die Tora aufzuheben, sondern er habe im Gegenteil nicht nur die schriftliche Tora, sondern auch die Verordnungen der Rabbiner befolgt. Wenn das so ist, dann kann er auch für Juden neu entdeckt werden.1
Besonders aufregend war dieser Prozess der Annäherung an Jesus den Juden in einer Ausstellung des Israel-Museums Jerusalem 2018 zu sehen: „Jesus in Israeli Art“ zeigt eindrücklich, wie bildende Künstler im 19. Jahrhundert begannen, aus jüdischer Perspektive auf Jesus zu blicken.2 Moritz Oppenheim, Maurycy Gottlieb, Mark Antokolsky oder auch Max Liebermann beschäftigten sich in ihrem Ringen um Anerkennung in der europäischen Kunst mit jener Gestalt, die kontrovers zwischen Judentum und Christentum steht und zugleich das Bindeglied zwischen beiden ist: Jesus von Nazareth.
Wie problembeladen diese Auseinandersetzung anfangs gewesen ist, zeigt die Erfahrung des deutschen Impressionisten Max Liebermann (1847–1935). Mit seinem Gemälde „Der zwölfjährige Jesus im Tempel“ löste er im August 1879, noch vor den antisemitischen Hetzparolen eines Adolf Stoecker oder Heinrich von Treitschke, einen Skandal aus. Denn er zeigte den Jesusknaben in naturalistischer Weise als jungen Juden und verletzte, noch dazu als ein jüdischer Künstler, die Regeln hergebrachter christlicher Ikonographie.3
Max Liebermann: Der zwölfjährige Jesus im Tempel 1879 (Kunsthalle Hamburg), © Alamy Stock
Liebermann vermittelte ein jüdisches Jesus-Bild, wie es zuvor Rabbiner Abraham Geiger oder auch der jüdische Historiker Heinrich Graetz vorgezeichnet hatten. Die öffentliche, von antijüdischen Ressentiments genährte Empörung war so groß, dass sich sogar der Bayerische Landtag mit dem Bild beschäftigte. Deutsches Empfinden, hieß es in der Kritik, sei durch dieses blasphemische Gemälde beleidigt worden. Der Berliner Hofprediger Adolf von Stoecker entrüstete sich so:
Bedenken Sie meine Herren von Israel, dass uns Christus gerade so heilig ist, wie Ihnen Jehova, und Sie müssen unseren Zorn, anstatt zu verdammen, ehren und anerkennen. Wie aber die Berliner Witzblätter, lauter jüdisches Geschmeiß, die christlichen Dinge verhöhnen und verspotten, oft in einer einzigen Nummer vier Mal, weiß jeder, der die verderblichen Blätter liest.4
In Folge des Sturms der öffentlichen Entrüstung übermalte Liebermann sein Bild, bevor es 1884 noch einmal in einer Pariser Ausstellung zu sehen war. Dank einer erhaltenen Skizze weiß man aber, dass Liebermann ursprünglich einen barfüßigen Knaben mit kurzem, ungekämmtem schwarzem Haar und einem stereotypisch jüdischen Profil dargestellt hatte. In der Skizze spricht der Junge selbstbewusst und mit großer Geste. Das überarbeitete Gemälde wurde dann bis zur Berliner Sezessions-Ausstellung von 1907 nicht mehr gezeigt.
Dieser Vorfall um Max Liebermann, immerhin ab 1920 Präsident der Akademie der Künste Berlin, macht die Schwere der Aufgabe deutlich. Der Dominanz des Christentums und seines triumphalen Anspruchs auf den Besitz der universalen Wahrheit wollten Künstler wie er ein selbstbewusstes Judentum entgegenstellen. Ein Judentum, das sich gegen Antisemitismus behaupten kann und stolz ist auf seine Einzigartigkeit. Ein Judentum, das deshalb Jesus ganz als Teil des Judentums begreifen kann – als jemand, der die Werte des Judentums für die ganze Menschheit zugänglich gemacht hat.
Und dieser Prozess ist nicht auf die Diaspora begrenzt. Maler wie Reuven Rubin (1893–1974) und zeitgenössische israelische Künstler wie Moshe Hoffman (1938–1983), Efrat Natan (* 1947) und der Fotograf Adi Nes (* 1966) mit seinem „Last Supper“ haben diesen Trend erstaunlicherweise fortgesetzt, sich im Kontext des Staates Israel an das Tabu Jesus gewagt und ihn als jüdischen Bruder zu begreifen versucht.
Reuven Rubin, The Encounter, 1922, Oil on canvas, Collection Phoenix Insurance, Tel Aviv. ‘ Avraham Hay.
„Die Begegnung (Jesus und der Jude)“ wurde 1922 von Reuven Rubin gemalt. Der Künstler stand im Begriff, von Rumänien nach Palästina auszuwandern, als er den Ahasver gleichenden wandernden Juden mit Jesus auf einer Bank sitzend darstellte. Kein triumphierender Jesus, beide sind gezeichnet von ihrem Leiden. Das Thema des Bildes scheint inspiriert vom neoromantischen jiddischen Dichter Itzig Manger (1901– 1969) und seiner „Ballade vom Verlausten und Gekreuzigten.“ Da hadert ein Landstreicher mit Jesus: „Wer hat dir gesagt, o Jesus, sag/deine Krone sei heiliger als meine Plag?“ Und Jesus antwortet mit der Anerkenntnis, auch des Landstreichers Schmutz sei heilig, umso mehr noch seine Trauer, sein Leiden.5 Jesus selbst durchbricht die Art und Weise, mit der sein Leid jahrhundertelang durch die christliche Umwelt zum Leid des jüdischen Volkes umgemünzt wurde. Im gemeinsamen Leid entsteht eine Solidarität gegen Verfolgung und Antisemitismus. Amitai Mendelsohn geht in seiner Auslegung so weit, zwischen Jesu Auferstehung und der Erneuerung des Jüdischen Volkes im eigenen Staat einen symbolischen Parallelismus zu sehen. Jesus würde zum „regenerated Jew destined to take his place and thereby heal the suffering of the Diaspora!“6
Moshe Hoffman wurde 1938 in eine orthodoxe Familie geboren, überlebte den Zweiten Weltkrieg in Budapest und emigrierte nach Israel. 1967 entstand seine Serie „6.000.001“ mit zehn Holzschnitten. Im ausgewählten Beispiel wird Jesus durch einen Schergen vom Kreuz abgenommen und der Deportation ins Konzentrationslager zugeführt. Er wird buchstäblich zum Opfer schlechthin, und wie bei Reuven Rubin entsteht eine solidarische Linie vom Leiden Jesu zum Leid des jüdischen Volkes. Im Kreuzestod Jesu zeigt sich für Hoffman der Tod des Göttlichen, aber auch das Vertrauen in die Berufung des Menschen zur schöpferischen Gestaltung der Welt.7 Der Gegensatz zwischen Juden und Christen löst sich auf, die Darstellung macht aber deutlich, dass Jesus zuallererst Jude sei. Damit deckt Hoffman eindrücklich das Versagen der Menschen auf, die sich auf Jesu Lehren beziehen und doch das Volk Jesu stets missachtet und verfolgt haben. Hoffman macht deutlich: Jesu Schicksal ist zutiefst mit dem seines Volkes verbunden. Diese Beziehung ist letztlich inniger als die der Christen zu ihrem vermeintlichen Religionsgründer.
Moshe Hoffman, Woodcut from 6,000,001-series, 1967, (courtesy:) Yad Vashem Museum, Jerusalem.
Efrat Natan ist eine Künstlerin, die bereits im Staat Israel geboren wurde, im Kibbutz Kfar Ruppin. Ihre Installation „Roof Work: Golgotha“ (1979) auf Seite 6 dieses Buches schließt an Reuven Rubins Deutung Jesu als Pionier und Sohn Eretz Israels an. Das Unterhemd in ihrer Kreuzesgruppe verweist als billiges Kleidungsstück des Alltags auf das sozialistische Ethos physischer Aufbauarbeit unter großer Entbehrung. Jesus und seine Jünger werden in ihrem einfachen Lebenswandel und ihrer Kritik am Materialismus des israelitischen Establishments zur Zeit des Zweiten Tempels quasi zu Vorbildern für die frühen Zionisten, die der Dekadenz Europas den Rücken zukehren, um in Mühsal und Schweiß den jüdischen Staat aufzubauen. Efrat Natan liest die Askese der zionistischen Pioniere und ihr Streben nach Reinheit und Aufrichtigkeit spirituell. Sie untermauert das durch ein Gedankenspiel, in dem sie das hebräische gufiyah (Unterhemd) als guf-yah (Gottes Leib) auffasst. So entsteht eine Verbindung zwischen dem inkarnierten Gott und dem Unterhemd in ihrer Kreuzigungsgruppe.8
Der Fotograf Adi Nes knüpft an solche Anleihen christlicher Ikonografie an und beschreitet dennoch neue Wege. Sein bekanntestes Werk „Das letzte Abendmahl“ (1999) lehnt sich offensichtlich an Leonardo da Vincis „Abendmahl“ in Mailand an.
Adi Nes, Untitled, 1999, Chromogen print, The Israel Museum, Jerusalem
Nes verwendet das Thema und moduliert seine Aussage. In seinem Werk zieht die zentrale Figur eines Soldaten mit Zigarette in der Linken nicht alle Aufmerksamkeit auf sich, wie im Bild Leonardos. Keiner der anderen Soldaten schaut ihn auch nur an. Das Werk entstand 1999, vier Jahre nach der Ermordung Yitzhak Rabins, drei Jahre nach der Wahl Benjamin Netanjahus zum Ministerpräsidenten und ein Jahr vor dem Ausbruch der Zweiten Intifada. Adi Nes greift den Moment vor fatalem Verrat in der Abendmahlsszene auf und deutet damit das Lebensgefühl einer Generation junger israelischer Soldaten, die ihr letztes Mahl einnehmen, bevor sie von ihrer Regierung in den Kampf geschickt werden. Der Soldat im Zentrum sei deshalb isoliert dargestellt, so die in Berlin lebende israelische Kunsthistorikerin Doreet LeVitte-Harten, weil sein Schicksal bereits besiegelt sei: der Tod. Die ihn Umgebenden haben ihn bereits aus ihrem Gedächtnis gelöscht.9 Diese israelischen Soldaten, der Stolz der Nation, wirken orientierungslos und verloren.
Adi Nes, Untitled, 1995, Chromogen print, Israel Museum, Jerusalem.
Der gefallene Soldat im Schoß seines trauernden Kameraden (1995) hat gar nichts Heroisches, die Pietá-Szene konzentriert sich ganz auf die Realität des Sterbens in einer politisch verfahrenen Situation.
Diese sind nur einige Beispiele einer ganzen Reihe von Belegen, wie sich jüdische und israelische Künstler fast schockierend freimütig christlicher Motive bedienen. Jesus ist hier schon längst der jüdische Bruder geworden, der nicht wie Jahrhunderte zuvor gegen sein Volk gerichtet wird, sondern in einem Akt der künstlerischen Heimholung als Projektionsfläche jüdischer Identitätsbewältigung dienen kann.
Auch ganz aktuell in Deutschland kann man die künstlerische Auseinandersetzung mit Jesus aus jüdischer Perspektive finden. Die deutsch-jüdische Künstlerin Ilana Lewitan (* 1961) stellt mit ihrem Werk „Adam, wo bist Du?“ 2020 die Frage: „Stellen Sie sich vor, Jesus hätte im Dritten Reich gelebt. Was wäre mit ihm geschehen?“ Für sie ist das Kreuz nicht zuerst christliches Symbol, sondern das, was es ursprünglich gewesen ist: ein Tötungswerkzeug der Römer. Ähnlich den Gaskammern der Nazis im 20. Jahrhundert. Damit löst sich ihr Jesus aus der gewohnten Rezeption. Sie macht sich gar kein Bild von ihm, sondern deutet ihn nur körperlich an in der Hülle der Häftlingskleidung mit dem gelben Stern, die er als Jude getragen hätte auf dem Weg in den Tod. Sie verknüpft auf diese Weise zwei Zeitstränge miteinander: den Beginn seines Wirkens und die Folge christlichen Antisemitismus. Ilana Lewitans Darstellung spitzt zu: Jesus kann man gar nicht ohne sein Judesein verstehen. Ihr Jesus richtet seine Arme klagend auf. Ihr Jesus fragt nicht: „Wo ist Gott?“ Sondern er fragt ganz jüdisch: „Gott, wo ist der Mensch?“ Damit deckt sie das Versagen der Menschen auf, die sich auf Jesu Lehren beziehen, z. B. das Liebesgebot, und doch das Volk Jesu missachten und verfolgen. Sie macht deutlich: Jesu Schicksal ist zutiefst mit dem seines Volkes verbunden.
Abb. 7: Ilana Lewitan, Adam, wo bist Du? (2020); Stahl, Foliendruck auf Acryl, gehärtetes Leinen, 4,60 m x 2,50 m x 1,50 m; Fotograf: Wolf-Dieter Böttcher
Auch jüdische und israelische Schriftsteller haben in ihren Werken die Person Jesu reflektiert und auf ihre eigene Identität projiziert.10 Man denke nur an Samuel Yosef Agnon (1888– 1970), Yona Wallach (1944–1985) oder Haim Be’er (* 1945). Zu den eindrucksvollsten Beispielen jüdischer Jesus-Rezeption in neuerer Zeit gehört Amos Oz’ Roman „Judas.“11 Sein „Jesus und Judas – ein Zwischenruf“12 macht deutlich, wie emotional die Entdeckung eines lang verloren geglaubten Familienmitglieds sein kann und welche Fragen dies für die christliche Gefolgschaft Jesu aufwirft.
Wie wir in seinem Berliner Zwischenruf über „Jesus und Judas“ erkennen, sieht der bekannte israelische Schriftsteller, Journalist und Intellektuelle keine Schwierigkeiten darin, sich positiv auf Jesus zu beziehen und sich kritisch mit seiner neutestamentlichen Wirkungsgeschichte auseinanderzusetzen: „Ich verliebte mich in Jesus, in seine Vision, seine Zärtlichkeit, seinen herrlichen Sinn für Humor, seine Direktheit, in die Tatsache, dass seine Lehren so voller Überraschungen stecken und so voller Poesie sind.“13 Bei seiner Beschäftigung mit dem Jesus des Neuen Testaments gerät Oz allerdings durch die Geschichte vom Verrat des Judas ins Stocken:
Nach den christlichen Quellen war Judas nicht etwa ein armer Fischer vom See Genezareth, wie die anderen Apostel, sondern ein reicher Großgrundbesitzer aus Judäa, ein Mann, der Sklaven und Sklavinnen besaß. Warum um alles in der Welt sollte er seinen Lehrer, seinen Rabbi, seinen Gott verkaufen? Für sechshundert Euro? Und wenn er tatsächlich dermaßen gemein und habgierig war, dass er seinen Herrn und Gott für sechshundert Euro verkaufte – warum ging er unmittelbar danach hin und erhängte sich? Das ergab einfach keinen Sinn. Vor allem aber verstand ich nicht, warum irgendjemand, irgendein Mensch auf Erden, Judas auch nur fünfzig Cent oder einen Euro dafür geben sollte, dass er Jesus nach dem Letzten Abendmahl küsste und ihn damit an die Schergen verriet, die die Priester ausgeschickt hatten, ihn zu verhaften. Schließlich war Jesus in ganz Jerusalem wohlbekannt.14
Oz resümiert: „In meinen Augen ist die Geschichte von Judas in den Evangelien gleichsam das Tschernobyl des christlichen Antisemitismus der vergangenen zweitausend Jahre. Diese Geschichte verseucht das Verhältnis zwischen Juden und Christen seit Jahrtausenden, indem sie die Juden zu Opfern und die Christen zu Tätern macht.“15
Amos Oz ist der Großneffe Joseph Klausners (1874–1958), eines der Pioniere der modernen jüdischen Jesus-Forschung.16 Die Hauptfigur in Oz’ Roman „Judas,“ Schmuel Asch, kann im Jerusalem des Jahres 1959 seine Magisterarbeit über das Thema „Jesus aus jüdischer Sicht“ nicht zum Abschluss bringen. Oz arbeitet in seinem Roman die jüdischen Fragen nach dem historischen Jesus heraus. Amos Oz berichtet, wie er dabei von Klausner inspiriert worden ist:
Als kleiner Junge besuchte ich eine äußerst traditionelle orthodoxe jüdische Schule in Jerusalem. Wir wurden angewiesen, jedes Mal, wenn wir an einer Kirche oder einem Kreuz vorübergingen, unsere Augen abzuwenden und in die entgegengesetzte Richtung zu schauen. Als Begründung hieß es: ‚Wir Juden haben seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, wegen dieses Menschen gelitten.‘ Orthodoxe Juden nennen Jesus häufig nicht bei seinem Namen, sondern bezeichnen ihn abfällig als ‚diesen Menschen‘. Onkel Joseph aber sagte, das dürfe ich niemals tun: ‚Wann immer du eine Kirche oder ein Kreuz siehst, sieh ganz genau hin, denn Jesus war einer von uns, einer unserer großen Lehrer, einer unserer bedeutendsten Moralisten, einer unserer größten Visionäre.‘ Ich war schockiert.17
Mal theologisch, mal literarisch: Oz baut eine Brücke zwischen der jüdischen Jesus-Rezeption des 19. und des 21. Jahrhunderts. Sein Eingehen auf Jesus und Judas macht deutlich: Für die jüdische Seite ist die Beschäftigung mit dem Juden Jesus Ausdruck einer neuen Freiheit und eines neuen Selbstbewusstseins.
Damit kommen wir zum Anliegen dieses Buchs. Im 19. Jahrhundert hatten jüdische Wissenschaftler die neue historisch-kritische Methode entdeckt und begonnen, von Joseph Salvador (1779–1873) bis hin zu Abraham Geiger (1810–1874), Samuel Hirsch (1815–1889) und Joseph Klausner (1874–1958), intensiver zur Gestalt Jesu zu forschen. Symptomatisch dabei ist, dass dieser historische Jesus einerseits kontrovers zwischen Judentum und Christentum steht und andererseits das Bindeglied zwischen beiden darstellen kann. Der vorliegende Band ist diesem Befund von Historikern, Religionsphilosophen und Theologen gewidmet. Wir werden sehen, wie sehr sich die Auffassungen und Ansichten zu Jesus aus jüdischer Sicht durch die Jahrhunderte unterscheiden: drei grundlegende Aussagen über Jesus aus jüdischer Sicht kann man aber treffen, wenn man das 19. und 20. Jahrhundert zusammenfassen möchte:
1. Jesus war nicht nur von seiner Herkunft her Jude, er war auch fest in der jüdischen Umwelt seiner Zeit verwurzelt.
2. Das Christentum ist aus dem Judentum hervorgegangen; es hat sich in einem vielschichtigen kulturellen Milieu herausgebildet und allmählich zu einer eigenen Religion entwickelt, dabei jedoch einen jüdischen Charakter bewahrt.
3. Jesus von Nazareth ist nicht der Messias, der in der hebräischen heiligen Schrift verheißen ist.
Erkenntnisleitend war für die jüdische Forschung ebenso wie schon in der Kunst und Literatur, der Dominanz des Christentums und seines triumphalen Anspruchs auf den Besitz der universalen Wahrheit ein selbstbewusstes Judentum entgegenzustellen. Die Jüdische Leben-Jesu-Forschung diente vielen Vertretern der Wissenschaft des Judentums in Deutschland somit als Mittel der jüdischen Selbstbehauptung. Für Joseph Klausner und andere europäische Pioniere eines jüdischen Nationalstaats Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Jesus dagegen zu einem zionistischen Propheten, wie er auch in den Werken von Reuven Rubin oder Efrat Natan interpretiert worden ist.
Für die jüdische Seite ist damit eine Situation entstanden, sich als eigenständige Stimme Gehör zu verschaffen und aus einer untergeordneten Position in die Rolle eines gleichwertigen Gesprächspartners hineinzuwachsen. Erst in der Folge der Schoa kam es in der westlichen Welt zu einer wesentlichen Voraussetzung dafür: der Anerkennung des Judentums als gleichwertiger Religion. Dies machte den Weg für einen konstruktiven theologischen Dialog zwischen Juden und Christen frei, wie er sich seit siebzig Jahren nicht nur in Europa und den USA entfaltet.18
Von besonderer Bedeutung war dabei die Anerkennung der Religionsfreiheit durch die katholische Kirche im Zweiten Vatikanischen Konzil und mit ihr das Eingeständnis, dass auch andere Religionen im Besitz gültiger Wahrheiten sein können.
Werden Christen und ihre Kirchen in der Lage sein, diese Verortung Jesu und seine Heimholung in die jüdische Schicksalsgemeinschaft zu respektieren und in ihre Rede von Jesus, in ihre Christologien einzubeziehen? Die Rede christlicher Theologie über Jesus, gemeinhin „Christologie“ genannt, steht heute vor der Herausforderung, so über Jesus zu sprechen, dass seine Verankerung im Judentum nicht verdeckt wird durch den universalen Heilsanspruch des Christus der Kirchen.
Anmerkungen
1 Siehe Walter Homolka/Magnus Striet, Christologie auf dem Prüfstand. Jesus der Jude – Christus der Erlöser, Freiburg i. Br. 2019, S. 14.
2 Zur gesamten Rezeption Jesu in der darstellenden Kunst siehe Amitai Mendelsohn, Behold the Man – Jesus in Israeli Art, Jerusalem 2017, S. 37–61.
3 Siehe Walter Homolka, Jesus von Nazareth im Spiegel jüdischer Forschung, Berlin 2010, S. 68–69; so auch Verena Lenzen, Jüdische Jesus-Forschung und israelische Kunst als Inspiration des jüdisch- christlichen Dialogs, in: Christologie zwischen Christentum und Judentum. Jesus, der Jude aus Galiläa und der christliche Erlöser, hg. v. Christian Danz, Kathy Ehrensperger, Walter Homolka, Tübingen 2020. Mendelsohn, Behold the Man, S. 52–54.
4 Zitiert nach Martin Faass/Henrike Mund, Sturm der Entrüstung. Kunstkritik, Presse und öffentliche Diskussion, in: Der Jesus-Skandal. Ein Liebermann-Bild im Kreuzfeuer der Kritik, hg. v. Martin Faass, Berlin 2009, S. 59–78, hier: S. 70.
5 Tania Oldenhage, Neutestamentliche Passionsgeschichten nach der Shoah: Exegese als Teil der Erinnerungskultur, Stuttgart 2014, Kap. 2.2.2.
6 Mendelsohn, Behold the Man, S. 105.
7 Ebd., S. 152.
8 Ebd., S. 245–253.
9 Ebd., S. 270.
10 Siehe auch Kapitel 4b: Der jüdische Jesus in der Literatur, S. 189 ff.
11 Amos Oz, Judas, Berlin 2015.
12 Amos Oz, Jesus und Judas – ein Zwischenruf, Ostfildern 2018.
13 A. a. O., S. 16.
14 A. a. O., S. 18–19.
15 A. a. O., S. 25–26.
16 Joseph Klausner, Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre. Übersetzt aus dem Hebräischen von Walter Fischel, Berlin 1930.
17 Oz, Jesus und Judas, S. 11–12.
18 Siehe Homolka/Striet, Christologie auf dem Prüfstand, S. 14–16.
Die Heimholung Jesu als Anstoß für die christliche TheologieZum Geleit
Jan-Heiner Tück, Wien
„Das Wort wurde – nicht ‚Fleisch‘, Mensch, erniedrigter und leidender Mensch in irgendeiner Allgemeinheit, sondern jüdisches Fleisch.“ Karl Barth1
Das Verhältnis zwischen Juden und Christen ist jahrhundertelang schwer belastet gewesen. Das hat sich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts geändert. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962–65) gab es vereinzelte Stimmen, die an die Israeltheologie des Römerbriefs erinnerten und es als tragisches Versäumnis beklagten, dass christliche Theologie jahrhundertelang nichts vom lebendigen Judentum erwartet habe. Überlegenheitsattitüden und eine Theologie der Verachtung hätten verhindert, dass man eine theologische Sensibilität, geschweige denn Lernbereitschaft gegenüber dem Judentum ausgebildet habe.2 Nach der überraschenden Ankündigung eines Konzils am 25. Januar 1959 durch den betagten Reformpapst Johannes XXIII. (1958–63) gab es auf der Ebene der Bischöfe zunächst kein Bewusstsein für die Dringlichkeit, das Verhältnis zum Judentum neu auszurichten und die antijudaistischen Hypotheken in der eigenen Tradition aufzuarbeiten. Ein sprechendes Indiz dafür sind die knapp 3.000 Voten des Weltepiskopats, die im Vorfeld des Konzils von Rom erbeten wurden. Was das Thema Judentum anlangt, Fehlanzeige! Als wolle man den dunklen Mantel des Schweigens über die Schrecken der Shoah legen und die partielle Verstrickung von Theologie und Kirche ausklammern.
Dass das Thema dann doch auf die Agenda des Konzils kam, verdankt sich dem mutigen Vorstoß des französischen Historikers Jules Isaac (1877–1963), der seine Frau und seine Tochter in der Shoah verloren hatte. In einer Privataudienz am 13. Juni 1960 legte er dem Roncalli-Papst drei Bitten vor: (1) alle ungerechten Aussagen über Israel in der christlichen Lehre einer kritischen Revision zu unterziehen; (2) die zählebige Legende richtigzustellen, dass die Zerstreuung der Juden unter die Völker als Strafe Gottes für die Kreuzigung Jesu zu betrachten sei; sowie (3) die Aussage aus dem Trienter Katechismus in Erinnerung zu rufen, welche die Schuld am Tod Jesu nicht dem jüdischen Volk, sondern ‚unseren Sünden‘ zuspricht. Der Papst sorgte über Kardinal Augustin Bea, den Präsidenten des Sekretariats für die Einheit der Christen, dafür, dass diese Anliegen von Jules Isaac in die Konzilsarbeiten einflossen3 – und die Erklärung Nostra Aetate (Nr. 4) hat nach einem dramatischen Ringen um die Endgestalt des Textes diese Bitten dann auch tatsächlich eingelöst. Damit aber hat sie ein neues Kapitel im Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum aufgeschlagen. Diese Impulse sind durch die Nachkonzilspäpste, besonders durch die Ansprachen und symbolischen Gesten von Johannes Paul II. (1978–2005), der als erster Papst eine Synagoge besucht und an der Westmauer des Tempels in Jerusalem gebetet hat, aufgenommen worden. Auch die akademische Theologie hat sie inzwischen weithin rezipiert.
Diese veränderte Haltung der katholischen Kirche, die in der Einrichtung der Kommission für die besonderen Beziehungen zum Judentum im päpstlichen Einheitsrat auch institutionellen Ausdruck gefunden hat, ist in den letzten Jahren erfreulicherweise auch von jüdischer Seite registriert und positiv gewürdigt worden. Die von einer Reihe namhafter jüdischer Gelehrter publizierte Stellungnahme Dabru emet – Redet Wahrheit von 2000 ist hier ebenso zu nennen wie das Dokument der Orthodoxen Rabbiner Zwischen Rom und Jerusalem, das 2017 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläum der Konzilserklärung Nostra Aetate veröffentlicht wurde. Die römische Kommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum hatte bereits 2015 in ihrem Dokument Denn unwiderruflich sind Gnade und Berufung, die Gott gewährt (Röm 11,29) eine „prinzipielle Ablehnung institutionalisierter Judenmission“ (Art. 44) formuliert und die veränderte Gesprächslage in die Worte gefasst, dass das ehemalige Nebeneinander und teilweise Gegeneinander von Juden und Christen durch die Dialogbemühungen seit dem Konzil in ein „tragfähiges und fruchtbares Miteinander“ (Art. 10) überführt werden konnte. Diese veränderte Gesprächslage bildet den Rahmen, in dem sich der Austausch zwischen katholischer und jüdischer Theologie heute bewegt. Er bildet auch den Hintergrund der vorliegenden Studie von Walter Homolka, die der Heimholung Jesu ins Judentum gewidmet ist und seine bisherigen Überlegungen weiterführt.4
Von gegenseitiger Verketzerung zu wechselseitiger Annäherung
Lange ist das christliche Bekenntnis zu Jesus Christus von antijüdischen Motiven durchsetzt gewesen. Die theologische Semantik, in der die Christologie und Kreuzestheologie ausbuchstabiert wurde, war von Antijudaismen toxisch durchzogen. Seit der Pascha-Homilie des Melito von Sardes hat der Topos von den Juden als „Gottesmördern“ eine verhängnisvolle Resonanz in der Geschichte des Christentums gefunden5, die bis heute in traditionalistischen Milieus6 widerhallt. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels sowie die Zerstreuung der Juden unter die Völker wurden als Gottes Fluch gegen sein abtrünnig gewordenes Volk gedeutet.7 Tertullian schreibt den ersten Adversus-Iudaeos-Traktat und der hl. Johannes Chrysostomos bietet in seinen Predigten das ganze Inventar polemischer Topoi gegen die Juden auf. Als biblischer locus classicus zur Begründung einer judenfeindlichen Sicht wurde der Ruf des „ganzen Volkes“ vor dem römischen Prokurator Pontius Pilatus angeführt: „Ans Kreuz mit ihm! … Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“ (Mt 27,23.25).8 Das semantische Dynamit des Antijudaismus blieb nicht auf die Sphäre des Denkens beschränkt, es entlud sich in gewaltsamen Ausschreitungen und Pogromen. Im Mittelalter wurden Juden stigmatisiert, verfolgt und vertrieben. Talmudausgaben wurden konfisziert und verbrannt. Mit der Intensivierung der Eucharistie- Frömmigkeit kamen ab dem 13. Jahrhundert Hostienfrevel- und Ritualmordlegenden auf, die sich trotz päpstlicher Einsprüche als zählebig erwiesen. Der junge Martin Luther verfasste zwar 1523 eine Schrift Daß Jesus Christus ein geborener Jude sei, die er dem ehemaligen Rabbiner und Konvertiten Jakob Gipher widmete – in der Hoffnung, dass sich weitere Juden zum reformatorischen Christentum bekehren würden. Als sich diese Hoffnung nicht erfüllte, radikalisierte Luther in seinen Spätschriften Gegen die Juden und ihre Lügen (1543) und Vermahnung wider die Juden (1546) antijudaistische Denkweisen und rechtfertigte sogar die gewaltsame Vertreibung von Juden aus evangelischen Gebieten. Diese Einstellung des Reformators blieb nicht ohne Folgen. Der theologische Antijudaismus der Kirchen ging häufig eine Verbindung mit sozialen und politisch-ökonomischen Vorurteilen ein. Er konnte vom rassischen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts aufgenommen und ideologisch verschärft werden. Zwischen der kirchlichen Polemik gegen die Synagoge und dem modernen Antisemitismus ist allerdings zu unterscheiden. Machte die Kirche der Synagoge das Erbe streitig, so wies der moderne Antisemitismus dieses Erbe zurück. „Die Christen warfen den Juden vor, den Glauben Israels und seine göttliche anerkannte Tradition verraten zu haben; die Nazis hingegen hassten unterschiedslos Volk, Glaube und Tradition der Juden.“9 Die Konstruktion eines „arischen Jesus“ in der Zeit des Nationalsozialismus ist der finstere Höhepunkt dieser Entwicklung.10
Umgekehrt gibt es, wie Walter Homolka in einem instruktiven Überblick zeigt, auch im rabbinischen Judentum polemische Verzeichnungen Jesu von Nazareth. An den wenigen Stellen, an denen im Babylonischen Talmud von Jesus die Rede ist, wird er als illegitimer Sprössling einer unehelichen Verbindung Marias mit einem römischen Soldaten hingestellt und „Sohn der Pantera“ genannt. Am Abend des Pessachfestes sei Jesus als Zauberer und Betrüger gesteinigt und erhängt (nicht aber gekreuzigt!) worden. Durch den Hinweis auf die uneheliche Herkunft wird der Anspruch, Jesus sei Nachkomme aus dem Haus Davids, delegitimiert, zugleich wird das neutestamentliche Zeugnis von der Geburt Jesu aus der Jungfrau Maria durch Verweis auf die Affäre mit einem noch dazu heidnischen Legionär konterkariert.11 Abweichend von den neutestamentlichen Passionserzählungen wird aus der römischen Kreuzigung eine dem jüdischen Recht entsprechende Steinigung und Erhängung gemacht, was zeigt, dass die Lehre Jesu als höchst anstößig und als jüdische Häresie eingestuft wurde. Das setzt sich fort, wenn im Babylonischen Talmud die Geschichte von Jesu Abstieg in die Hölle und seiner Bestrafung in „kochendem Kot“ erzählt wird (b Git 56b–57a) – ein Kontrapunkt zum neutestamentlichen Zeugnis der Himmelfahrt des Auferstandenen (vgl. Mk 16,19; Apg 1,9–11).12 Es ist offensichtlich, dass diese Umschreibungen „Gegenerzählungen“ zu den Evangelien schaffen sollten. Der Luzerner Judaist Clemens Thoma hat dazu trocken notiert: „Es gibt nicht nur christliche Adversus- Iudaeos-Literatur, sondern auch eine jüdische Adversus-Christianos-Literatur.“13 Man muss allerdings sofort ergänzen, dass die Asymmetrie der politischen Machtverhältnisse, die mit der Christianisierung des römischen Imperiums im 4. Jahrhundert einsetzte, für die Juden verheerende Folgen hatte. Als literarischer Reflex auf die Repressalien kann der Traktat Toledot Jeschu gelesen werden, der im Mittelalter eine Fortschreibung der polemischen Jesus-Satire bietet. Martin Luther hat in seiner Schrift Vom Schem Hamphoras (1546) die lateinische Version der Toledot Jeschu ins Deutsche übertragen, um sie als Vorlage für eine wüste Beschimpfung der Juden als „Teufel“ zu nutzen. Im gleichen Jahr legitimiert er auch Pogrome. Walter Homolka zitiert in diesem Zusammenhang das denkwürdige Diktum von Heinrich Graetz: „Die Christen vergossen unser Blut, wir vergossen nur Tinte.“
Diese polemischen Abgrenzungsdiskurse sind heute weithin Geschichte. Der Schrecken der Shoah hat die christliche Theologie seit den 1970er Jahren zu einer Gewissenserforschung veranlasst. Sie hat im Sinne des Konzils antijudaistische Spuren in Liturgie, Katechese und Theologie selbstkritisch aufzuarbeiten begonnen, gleichzeitig ringt sie um eine Theologie, welche die bleibende Dignität des Judentums als „Gottes Augapfel“ achtet, ohne deshalb das christliche Bekenntnis zu Jesus Christus abzuschwächen oder gar preiszugeben.14 Das Nein der meisten Juden zu Jesus als dem Christus darf nie wieder in eine christliche Verneinung des Judentums umschlagen, vielmehr muss anerkannt und gewürdigt werden, dass dieses Nein, wie etwa Jacob Neusner in seinem Buch Ein Rabbi spricht mit Jesus deutlich gemacht hat, durchaus aus Treue zur Tora und zur rabbinischen Überlieferung gesprochen sein kann. Auch darf das Ja der Christen zu Jesus Christus nicht zu einer Verneinung der Tora führen, die Jesus als Richtschnur anerkannt und in Leben und Lehre autoritativ ausgelegt hat. Markionitische Versuchungen, die bei Adolf von Harnack und den deutschen Christen neu aufgeflackert sind und die sich auch in der populären Jesus-Literatur unserer Tage immer wieder finden, gilt es mit Argumenten zu widerlegen.15 Nur so können neue Formen der Abwertung des Judentums zu einer heilsgeschichtlich überholten Größe vermieden werden. Wie aber christliche Theologie nach der Shoah für das jüdische Erbe neu sensibel geworden ist, so haben umgekehrt jüdische Gelehrte ein neues Interesse für Jesus ausgebildet und dabei innovative Deutungen entwickelt.
‚Heimholung Jesu‘ ins Judentum – ein Anstoß für die christliche Theologie
Diese noch zu wenig bekannte, facettenreiche Geschichte der „Heimholung Jesu“ ins Judentum16 zeichnet Walter Homolka in der vorliegenden Studie eindrücklich nach. Er bietet ein faszinierendes Panorama von Deutungen, die im späten 19. Jahrhundert bei deutsch-jüdischen Gelehrten wie Abraham Geiger einsetzen und bis in die Gegenwart reichen. Mit großer Wertschätzung holen sie Jesus in jüdische Deutungshorizonte zurück. Das ist bemerkenswert, denn Jahrhunderte lang war der jüdische Zugang zu Jesus auch durch das Anti- Zeugnis der Christen verstellt, die Juden theoretisch und praktisch verachtet und verfolgt haben. Das hat sich geändert. Jüdische Gelehrte, so kann Homolka zeigen, können sich mit der Person Jesu sehr wohl identifizieren, ja sie machen teilweise geltend, dass sie ihn besser verstehen als Christen, die Jesus zwar in die Mitte ihrer Religion gestellt, ihn aber zugleich vom Mutterboden des Judentums abgerückt haben. So begreift Leo Baeck in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Harnacks Wesen des Christentums Jesus als „echt jüdische Persönlichkeit“, die den ethischen Monotheismus der Propheten weiterführt. Joseph Klausner würdigt den Nazarener als „Lehrer hoher Sittlichkeit und Gleichnisredner ersten Ranges“, Martin Buber schätzt ihn als „großen Bruder“, dem ein „großer Platz in der Glaubensgeschichte Israels“ zukomme, und Schalom Ben- Chorin hält ihn für einen „Erz-Märtyrer, der das jüdische Leidensschicksal verkörpert“ – eine Sicht, die Marc Chagall in einigen seiner Gemälde bestätigt, die den Gekreuzigten als Inbild des leidenden Juden zeigen. Pinchas Lapide hingegen sieht in Jesus einen jüdischen Freiheitskämpfer, der das römische Joch abschütteln will, während Géza Vermes ihn eher als charismatischen Wanderprediger aus Galiläa zeichnet. Bei manchen Arbeiten der jüdischen Jesus-Forschung fällt eine Spannung ins Auge: sie betonen die historische Unverlässlichkeit der Evangelien als Glaubenszeugnisse, treffen dann aber doch recht zuverlässige Aussagen über Jesus den Juden. Das Kriterium der Differenz, das nach Ernst Käsemann die neue Frage oder das Problem des historischen Jesus bestimmt, lässt nur das als genuin jesuanisch gelten, was sich vom damaligen Judentum ebenso abhebt wie von der urchristlichen Gemeinde.17 Diese methodische Weichenstellung wird abgelehnt, weil sie Jesus aus dem Kontext herausnimmt, in dem er gelebt und gewirkt hat. In dieser Ablehnung trifft sich die jüngere jüdische Jesus-Forschung mit der third quest in der christlichen Exegese, die das Judesein Jesu als unhintergehbare Grundlage ins Zentrum rückt. Zugleich wird aber von einzelnen jüdischen Forschern auch der ungeheuerliche Anspruch Jesu registriert, so wenn Jacob Neusner Jesus die Gefolgschaft versagt, weil dieser die Familie relativiert und beansprucht, der Herr über den Sabbat zu sein, als könne er sich über die Tora stellen.18 Auch Daniel Boyarin sieht in der Selbstidentifikation Jesu mit dem Menschensohn der Daniel-Apokalypse den provozierenden Vollmachtsanspruch verbunden, Sünden vergeben zu können.19 Alles in allem zeigt Walter Homolkas Überblick, dass die jüdischen Ansätze zur modernen Leben-Jesu-Forschung vital, eigenständig und vielstimmig sind. Was aber kann die Polyphonie dieser Stimmen im Resonanzraum christlicher Theologie heute bedeuten?
Abbau des Dogmas? Die Koalition von historisch- kritischer Exegese und jüdischer Jesus-Forschung
Homolka erinnert daran, dass die historisch-kritische Methode zu einer Krise der dogmatischen Christologie geführt hat. Schon Reimarus und Lessing konstatieren einen Graben zwischen dem Jesus der Geschichte und dem Christus des Glaubens. David Friedrich Strauß verfeinert die Literar- und Quellenkritik und lehnt ein übernatürliches Verständnis der Gestalt Jesu ab, den Christus-Mythos schreibt er der Ideenproduktion der nachösterlichen Gemeinde zu. Zugleich wirbt er für eine mythische Transformation der Jesusüberlieferung und bezieht die Idee des Gottmenschen nicht auf den Einzelnen, nicht auf die christlichen Kirchen, sondern auf die menschliche Gattung. Der Zusammenfall von Menschwerdung und Gottwerdung des Menschen solle den Fluchtpunkt der menschlichen Gattungsgeschichte bilden. Im 20. Jahrhundert führt Rudolf Bultmann das Projekt einer Entmythologisierung des Neuen Testamentes weiter. Aufgrund der prekären Quellenlage hält er eine zuverlässige historische Rekonstruktion des Lebens Jesu für unmöglich. Für das Kerygma der Kirche reiche das bloße Faktum des Gekommenseins Jesu. Diese „Christologie ohne Jesus“20 hat den Einspruch seines Schülers Ernst Käsemann provoziert, der, wie bereits erwähnt, eine „neue Rückfrage“ nach dem historischen Jesus gefordert hat. Das Kriterium der Differenz sollte freilegen, was genuin jesuanisch ist und was nicht. Dadurch aber wurde Jesus schon vom methodischen Ansatz her seiner jüdischen Herkunft entkleidet. Die Forschung des third quest setzt dagegen einen heilsamen Kontrapunkt und versucht Jesus genauer im Kontext des galiläischen Judentums der Zeitenwende zu verankern.
Die jüdische Jesusforschung hat in Teilen ebenfalls das Interesse, die dogmatische Christologie als spekulative Überhöhung zu desavouieren. Fast durchgängig ist eine Reserve gegenüber der altkirchlichen Konzilienchristologie zu beobachten. „Jesus ist mein älterer Bruder, aber der Christus der Kirche ist ein Koloß auf tönernen Füßen“21, urteilt schon Martin Buber. Schalom Ben-Chorin warnt davor, Jesus „durch eine christlich-dogmatische Überhöhung zu spiritualisieren“, und spricht markant von der „Gefahr eines Christus-Gespenstes“22. Pinchas Lapide sekundiert: „1800 Jahre lang hat die Kirche drei Dinge gemacht: Sie hat ihn entjudet, sie hat ihn hellenisiert und sie hat ihn sehr wirksam uns allen verekelt: durch Zwangspredigten, durch Zwangstaufen, durch Kinderraub.“23 Ähnliche Stimmen ließen sich bis in die Gegenwart fortsetzen.
Eine Koalition von liberaler Exegese und jüdischer Leben- Jesus-Forschung scheint demnach nahezuliegen – und Walter Homolka deutet seine Sympathien für einen solchen Schulterschluss mehrfach an. Dennoch zögere ich als systematischer Theologe einzuwilligen, wenn diese Koalition auf eine Relativierung dogmatischer Christologie hinauslaufen soll. Gewiss trifft es zu, dass eine Depotenzierung der Christologie durch christliche Exegeten, welche das Judesein Jesu herausstellen und zugleich das kirchliche Christusbekenntnis als nachösterliche Konstruktion verabschieden, das Gespräch mit dem Judentum auf den ersten Blick erleichtern würde. Der Stein des Anstoßes wäre weggerollt. Eine solche Depotenzierung käme der ‚Heimholung Jesu ins Judentum‘ durch jüdische Gelehrte entgegen, welche den Glauben Jesu anerkennen, den Glauben an Jesus und damit eine christologische Deutung seines Wirkens und seiner Person aber strikt ablehnen. Einer solchen Koalition haftete allerdings das Manko an, dass sie am Selbstverständnis gläubiger Christinnen und Christen vorbeigeht, die sich auch heute zu Jesus als dem Christus und Sohn Gottes bekennen – in Gebet, Liturgie und dem Dogma der Kirche, das für sie eine Orientierungsmarke bleibt, die immer neu auszulegen und zu aktualisieren ist.
Dennoch wird christliche Theologie, die bereit ist, sich selbst mit den Augen der anderen zu sehen, auf die Ergebnisse der jüdischen Jesus-Forschung nicht vorschnell mit Antireflexen reagieren, sondern dankbar zur Kenntnis nehmen und selbstkritisch fragen, was sie aus diesen Einsprüchen lernen kann. Sie wird zugestehen, dass mit der Ausbuchstabierung der Christologie auch Verluste verbunden gewesen sind. Zweifelsohne ist ja mit der Inkulturation des christlichen Glaubens in den hellenistischen Denkhorizont24 eine begrifflich-spekulative Durchdringung angestoßen worden, die nicht nur die geschichtliche Dimension, sondern auch das galiläische Kolorit der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu in den Hintergrund gedrängt hat. Gleichwohl wird man nicht sagen können, dass die altkirchliche Konzilienchristologie das unbegreifliche Geheimnis des Nahekommens des Logos Gottes in Jesus Christus begrifflich fixiert und sich im Sinne einer usurpatorischen Theologie Gottes bemächtigt hätte. Gegenüber dem Verdacht, dogmatische Definitionen seien begriffliche Idole, die sich an der Unbegreiflichkeit Gottes vergreifen, lässt sich nicht nur der Hinweis anbringen, dass der unbegreifliche Gott sich selbst begreiflich machen wollte, wie Leo der Große in seinem Brief an Flavian prägnant notiert hat: incomprehensibilis voluit comprehendi (DH 294).25 Auch lassen sich in den dogmatischen Entscheidungen der Alten Kirche sprachliche Alteritätssignale aufweisen, die den Raum für das Geheimnis offenhalten und im Sinne einer privativen Theologie gelesen werden können, die im Zugleich von Präsenz und Entzug den eigentlichen Grundzug biblischer Offenbarung erblickt.26
So richtet sich die Rede von Jesus Christus als dem gleichwesentlichen Sohn des Vaters auf dem Konzil von Nizäa 325 gegen den Subordinatianismus des Arius, der in seiner Thalia gelehrt hatte, dass der Sohn dem Vater „wesensfremd“ sei, und allein der Monas Gottes Ewigkeit zugesprochen hatte. Im Sinne der mittelplatonischen Kosmologie identifiziert Arius den Sohn mit dem Schöpfungsmittler und Demiurgen, den er auch als erstes Geschöpf vor aller Schöpfung bezeichnet. Das Konzil widersetzt sich dieser Identifikation und lehrt die Gleichwesentlichkeit zwischen Vater und Sohn, ohne positiv anzugeben, wie die ontologische Gleichrangigkeit von Vater und Sohn näher verstanden werden soll. Klar wird der Subordinatianismus zurückgewiesen, der Gott nach einem Wort Erik Petersons auf die Rolle eines konstitutionellen Monarchen reduziert, der den Gläubigen allenfalls in seinen Ministern nahekommt; klar wird auch der Monarchianismus zurückgewiesen, der die Offenbarungsgestalten, in denen Gott zunächst als Schöpfer, dann als Sohn und Erlöser und schließlich als Heiliger Geist nahekommt, als Masken Gottes betrachtet. Diese Wege werden als Sackgassen, die Gott begrifflich durchschauen wollen, abgewiesen, um den Raum für das Geheimnis offenzuhalten. In Treue zu den neutestamentlichen Aussagen wird lediglich gesagt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, wie dieses Bekenntnis aber mit dem Monotheismus Israels zu vereinbaren ist, den auch das Konzil selbstverständlich fortzuschreiben gedenkt, bleibt ungesagt. Diesen Hof des Ungesagten im Gesagten gilt es wahrzunehmen. Das Konzil übersetzt die neutestamentlichen Bekenntnisaussagen zu Jesus als dem präexistenten Logos und Sohn Gottes in eine hellenistische Sprachgestalt – mit dem Nebeneffekt, dass im Horizont griechischen Denken erstmals gedacht wird, was bislang undenkbar war, dass nämlich das göttliche Eine nicht als beziehungslose Entität, sondern als Wirklichkeit in Beziehung anzusehen ist. Anders als Arius, der jede Zweiheit aus der Monas Gottes ausgeschlossen hatte, wird eine Differenzierung in den Gottesbegriff eingetragen. Darin kann man eine Revolution im Gottesbegriff erblicken. Der nichtbiblische Begriff ὁμοούσιος macht deutlich, dass die Relation zwischen Vater und Sohn das Gottsein Gottes bestimmt, er entspricht damit den biblischen Aussagen, dass Gott Leben, dass Gott Liebe ist.27 Die Liebe Gottes aber erweist sich darin, dass der Sohn Gottes „um unseres Heiles willen herabgestiegen und Fleisch und Mensch geworden ist“ (DH 125). Die soteriologische Bedeutung der Menschwerdung würde aus Sicht des Konzils ausgehöhlt, wenn in Jesus Christus nicht Gott selbst, sondern nur ein besonders gottbegabter Mensch nahegekommen wäre. Dann wäre, wie Athanasius von Alexandrien deutlich macht, Gott nach wie vor der radikal Transzendente, und die Kluft zwischen ihm und der Schöpfung bliebe unüberbrückt bestehen. Auch wäre die Lehre von der Vergöttlichung des Menschen (θέωσις), die auf der Menschwerdung des Wortes Gottes aufruht, ohne Fundament.28 Wie sich allerdings die Selbstmitteilung Gottes im menschgewordenen Wort zu den Offenbarungsgestalten des Alten Testaments verhält, bleibt offen.
Mit der Lehre von der Gleichwesentlichkeit von Vater und Sohn ist allerdings verbunden, dass Maria, die Mutter Jesu, nicht nur „Christusgebärerin“, wie Nestorius vorgeschlagen hat, sondern auch „Gottesgebärerin“ (θεοτόκος) genannt werden kann (DH 251). Dieser in der hymnischen Gebetssprache schon sehr früh nachweisbare und in der Theologie des Alexander von Alexandrien gebrauchte Titel29