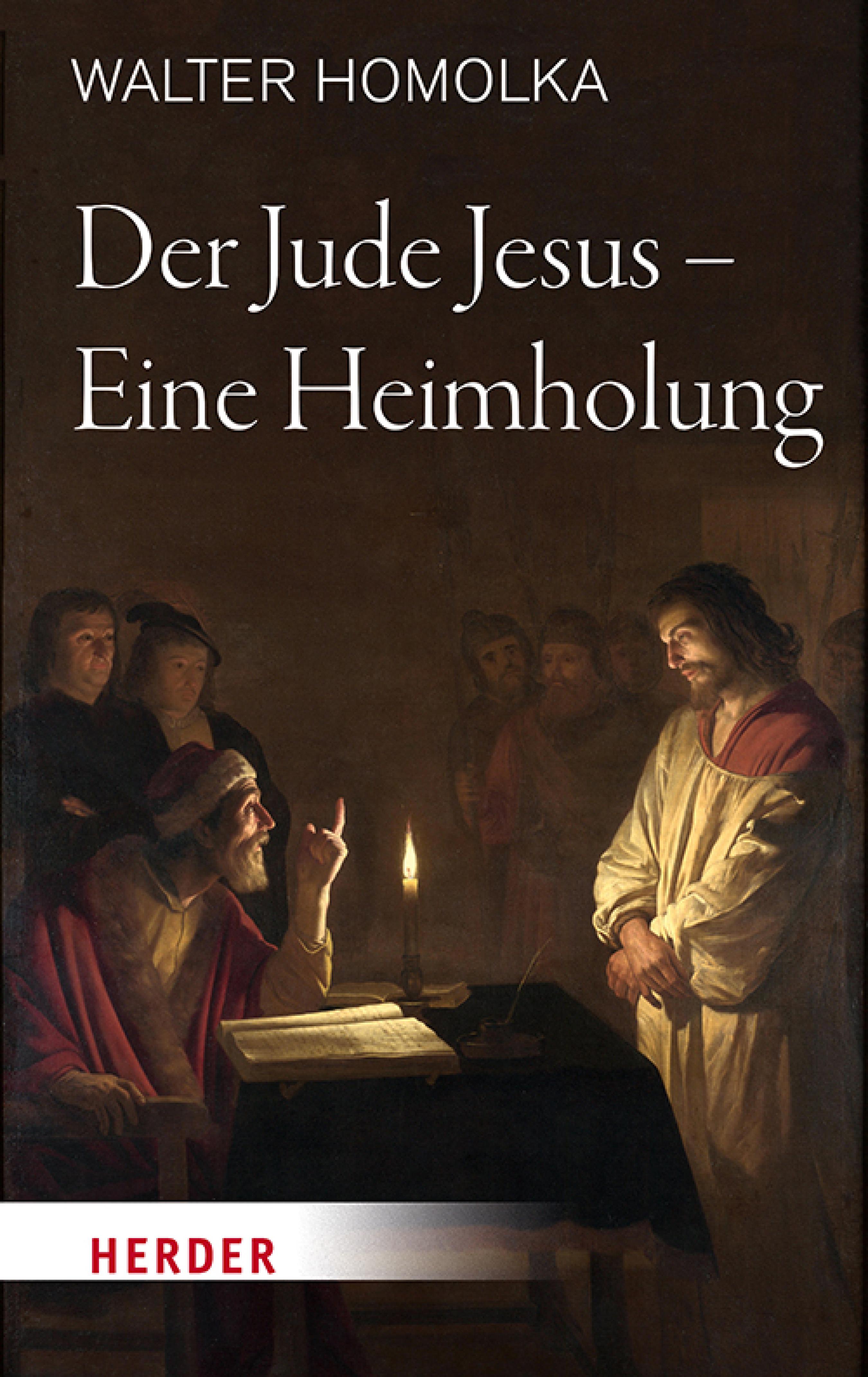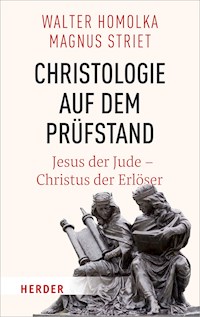Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Walter Homolka ist einer der profiliertesten Vertreter des zeitgenössischen Judentums in Deutschland, Gründungsrektor des ersten deutschen Rabbinerseminars nach der Schoa. In diesem Buch kommentiert er Begebenheiten der Gegenwart aus jüdischer Sicht: Konkrete Ereignisse werden zu Anlässen, um ethische Fragestellungen, religiöse Hintergründe, politische Positionen offenzulegen und mit einem jüdischen Blick auf die Welt einzuordnen-unterhaltsam und oft überraschend. Der Band erscheint zum zwanzigjähren Ordinationsjubiläum des Rabbiners im Juni 2017.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Walter Homolka
Übergänge
Beobachtungen eines Rabbiners
Patmos Verlag
Inhalt
Übergänge gestalten
Vorwort von Margot Käßmann
Statt Einleitung: Zehn Fragen an den Autor
Plurales Judentum
Heute Jude sein
Warum bin ich Jude?
Wahrheit
Sinn und Glück
Was glücklich macht
Frei durch das Gesetz
Ethik und Erwählung
Ethik und Ritual
Wessen Werke sind schöner?
Unrast und Besinnung
Gott der Vater
Gottesleugnung
Religionskritik
Kein Personenkult
Messias
Beten
Reform
Einer von uns
Zeugen
Religion und Moderne
Das Judentum in der Moderne
Bibelkritik und Aufklärung
Erfolgskonzept Toleranz
Jüdische Theologie
Theologie an der Universität
Universitätsstudium für Geistliche
Vernunft und Geschichte
Öffentliche Religion
Stammzellforschung
Homosexualität
Frauen im Amt
»Mischehen«
Kompetenz und Verantwortung
Juden – Christen – Muslime
Veränderungen würdigen – den Dialog suchen: Im Gespräch mit Katholiken
Einander begegnen und Unterschiede aushalten: Im Gespräch mit Protestanten
Gemeinsamkeiten betonen – Unterschiede respektieren: Im Gespräch mit Muslimen
Verbindendes und Trennendes
Keine Judenmission
Unter Freunden
Jesus – Brücke oder Hindernis?
Ein Muslim mit Chuzpe
Paulus
Pessach und Ostern
Karfreitagsfürbitte
Was treibt uns an?
Benedikt XVI.
Beten für einen Freund
Ein Ketzer als Brücke
Martin Luther
Adolf von Harnack
Logik und Mystik
Wertegemeinschaften
Proselyten
Seitenwechsel unter Brüdern
Vermächtnis
Land und Staat Israel
Israel und die Diaspora
Heimat in der Fremde
»Nächstes Jahr in Jerusalem«
Niemand sonst
Siebzig Jahre
Gerechtigkeit und Frieden
Gewissen im Judentum
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit
Dem Frieden nachjagen
Wahrheit und Frieden
Gleichheit und Menschenrechte
Ökonomie und Ethik
Finanzmarktkrise
Umweltschutz
Heimat
Deutsche Einheit
Über den Autor
Über die Autorin des Vorworts
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Übergänge gestaltenVorwort von Margot Käßmann
Zum ersten Mal habe ich Walter Homolka intensiv erlebt, als wir beide an Lebensübergängen standen: Wenige Wochen nach meinem Amtsantritt als Landesbischöfin 1999 kam er mit seinem Vorgänger, Rabbiner Henry G. Brandt, zu mir in die Bischofskanzlei in Hannover, um sich als neuer Landesrabbiner von Niedersachsen vorzustellen. Wir hatten damals ein spannendes Gespräch über das Abraham Geiger Kolleg, dessen Mitbegründer und Rektor Rabbiner Homolka ist. Das Rabbinerseminar war eben erst ins Leben gerufen worden, hatte den Lehrbetrieb aber noch nicht aufgenommen. Ich war damals schon begeistert von der Initiative, in Deutschland Rabbiner auszubilden. In der Folgezeit habe ich mit hohem Respekt verfolgen können, wie durch den enormen Einsatz von Rabbiner Homolka und seiner Mitstreiter das Kolleg seine Arbeit aufnahm. Dass in Deutschland nach dem Holocaust wieder jüdisches Leben existiert, Gemeinden gegründet und ihre Rabbiner in diesem Land ausgebildet werden, ist für mich als Christin bewegend und ich bin Rabbiner Homolka dankbar für seinen unermüdlichen Einsatz.
In den kommenden Jahren wurde er für mich zum wichtigen Gesprächspartner, wann immer ich Fragen zum Judentum in Deutschland heute, zur jüdischen Theologie oder auch zur jüdischen Praxis habe. Besonders intensiv wurde unser Austausch, nachdem er mich eingeladen hatte, am 13. November 2013 die Festrede zur Eröffnung der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam zu halten, deren geschäftsführender Direktor er ist. Zum allerersten Mal wurde damit an einer deutschen Universität der Studiengang »Jüdische Theologie« im Fakultätsrang eingerichtet. Meine Anwesenheit sollte auch ein Zeichen sein, waren es doch nicht zuletzt angesehene protestantische Theologen, die im 19. Jahrhundert jüdischer Theologie an deutschen Universitäten ablehnend gegenüberstanden.
Natürlich wurden auch im 19. Jahrhundert und bis zum Beginn der Schoa Rabbiner in Deutschland ausgebildet. Doch diese Ausbildung konnte sich nicht an öffentlichen Universitäten etablieren, sondern fand in eigenen Seminaren statt: eins in Breslau, zwei in Berlin. Auch gab es an evangelisch-theologischen Fakultäten Nischen für Judentumskunde. Besonderes Gewicht hatte der Lehrstuhl von Hermann Leberecht-Strack in Berlin, der mit seinem Institutum Iudaicum hoch angesehen war. Seine »Einleitung in Talmud und Midrasch« war ein Klassiker, er arbeitete mit dem orthodoxen Rabbinerseminar zusammen. Anders als andere protestantische Theologen hatte er sich gegen jedweden Antisemitismus positioniert. In Leipzig gab es zudem das Institut am Lehrstuhl von Franz Delitzsch, nach 1945 wurde es nach Münster verlegt. Aber es waren christliche Lehrstühle, nicht jüdische, und das Berliner Institut hatte zudem den Untertitel »Institut zur Förderung der Judenmission«. Judaistik, jüdische Wissenschaft war ein Appendix. Es gab hier und da jüdische Lehrstuhlmitarbeiter – freie Forschung und Lehre des Judentums war das nicht.
Mit der School of Jewish Theology der Universität Potsdam stehen wir am Übergang in eine Zukunft, in der jüdische Theologie als eigenständiges Fach an einer deutschen Universität betrieben wird. Das ist etwas Neues, und ich bin überzeugt: Das wird der Ausgangspunkt sein für eine Begegnung auf Augenhöhe. Uns allen ist bewusst, dass wir einen Dialog der Religionen brauchen. Und genau diesen Dialog kann und soll gerade die Theologie möglich machen. Sie gibt den menschlichen Begegnungen, die ebenso unerlässlich sind, die notwendige Substanz für das Gespräch.
Das Ringen um Gott und die Welt, der wissenschaftliche Zugang zu den heiligen Schriften, die systematische und praktisch-theologische ebenso wie die historische Durchdringung der Religion sind eine Herausforderung im Zeitalter der Aufklärung. Sie gehört an die Universität, um diskursfähig zu sein in der säkularen Welt und sich eben nicht in privat-religiöse Nischen zurückzuziehen. Theologie braucht universitäre Fakultäten – jüdische ebenso wie christliche und islamische.
Das zwanzigjährige Ordinationsjubiläum von Rabbiner Homolka fällt in das Jahr 2017, in dem die Evangelische Kirche Deutschlands das fünfhundertjährige Reformationsjubiläum feiert. Es kann gerade nach der Realität des Holocaust kein Reformationsjubiläum geben, das bei aller Freude über die Errungenschaften der Reformation ihre Schattenseiten nicht benennt. Und gerade die bedrückende Geschichte der christlichen Judenfeindschaft hat in Martin Luther einen furchtbaren Zeugen, so sehr vieles an ihm hochzuschätzen ist. Der Antijudaismus Martin Luthers hat der protestantischen Kirche ein fatales Erbe hinterlassen. Dabei finden sich in seiner 1523 veröffentlichten Schrift »Dass Jesus Christus ein geborener Jude sei« für die damalige Zeit bemerkenswerte Ansichten: Stereotype Vorwürfe gegen die Juden, darunter den des Wucherzinses, weist der Reformator entschieden zurück. Durch jene Schrift Luthers entstand in jüdischen Kreisen die Hoffnung, es könne zu einem Neuanfang im Verhältnis zwischen Juden und Christen kommen. Doch zwanzig Jahre später, 1543, erscheint ein im Duktus völlig anderer Text Luthers. Schon der Titel »Von den Juden und ihren Lügen« verrät, dass es sich um eine Schmähschrift handelt. Luther schlägt darin der Obrigkeit vor, dass sie Synagogen und jüdische Schulen »mit Feuer anstecken«, ihre Häuser »zerbrechen« und die Juden »wie die Zigeuner in einen Stall tun« soll. Diese so unfassbaren Äußerungen werfen auf ihn und die Reformation insgesamt einen Schatten und sollten die Kirche, die sich nach ihm benannte, auf einen entsetzlichen Irrweg führen.
Bis auf wenige Einzelne versagte die Evangelische Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus, weil sie Juden und Jüdinnen nicht schützte, sich dem Holocaust nicht vehement entgegenstellte. Erst nach 1945 begann sie – langsam –, den verhängnisvollen Weg des Antijudaismus zu verlassen, eine Lerngeschichte setzte ein. Der jüdisch-christliche Dialog hat neu entdecken lassen, was der Apostel Paulus über das Verhältnis von Christen und Juden schreibt: »Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich« (Römer 11,18). Das war für die Evangelische Kirche ein Prozess, der Erschrecken über eigene Irrwege zutage treten ließ und Befangenheit auslöste. Mein Eindruck aber ist, dass immer öfter freie Begegnung möglich wird, die um das Vergangene, um Schuld ebenso wie um Opfererfahrung weiß, aber nicht dort verhaftet bleibt, sondern Übergänge eröffnet in die Zukunft eines Dialogs auf Augenhöhe.
Für solche vertrauensvollen Dialoge, die auch Spannungsvolles nicht ausklammern, stellt sich Rabbiner Walter Homolka gern zur Verfügung. Er ist dabei ein kundiger Gesprächspartner, hat er doch in Vorbereitung seines Rabbinatsstudiums als Jude selbst zunächst protestantische Theologie studiert, drei Jahre bis zum Baccalaureat 1986 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, und danach 1992 am Kings’ College in London über Rabbiner Leo Baeck und den deutschen Protestantismus promoviert. Er ist 2017 bei der Weltausstellung Reformation an der Vorbereitung des Themenbereiches »Dialog der Religionen« beteiligt. Mit dabei sind neben Juden und Christen auch Muslime, und dieser Trialog macht die Kommunikationsfähigkeit von Walter Homolka noch einmal besonders wahrnehmbar.
Ich habe von ihm viel gelernt über die jüdische Luther-Rezeption, die vor dem Nationalsozialismus offenbar bemerkenswert wohlgesonnen Luthers Stellung zu den Juden betrachtete. Es war ein Rabbiner, nämlich Reinhold Lewin, der 1911 die erste wissenschaftliche Monografie zu diesem Thema veröffentlichte. Luther sei deswegen für das Judentum interessant, weil er den nach Gott suchenden Menschen in den Mittelpunkt stellt, so der Rabbiner. Das Judentum habe von der Reformation profitiert, sagt Homolka. Er kennt sich aus in der Geisteswelt des 19. Jahrhunderts, als Luther im Zuge der jüdischen Aufklärung zum Symbol und Ausgangspunkt geistiger Freiheit stilisiert wurde. Er ist auch ein großer Kenner der Theologie Leo Baecks, dessen Klage ich teile: »Es ist ein geistiges und moralisches Unglück Deutschlands, dass man aus dem Deutschtum eine Religion gemacht hat.« Die Reformation habe die Religion an den Staat ausgeliefert, meinte Baeck – eine diskussionswürdige These, die Rabbiner Homolka wieder ins Gespräch bringt. Dabei sind »Verstaatlichung« und »Privatisierung« zwei Entwicklungen, die beide zu vermeiden sind. Ich teile seine Bedenken, dass sich Religion ins Private verflüchtigen könnte. Homolka sieht Parallelen zwischen liberalem Judentum und liberalem Christentum: Beide müssen immer wieder erklären, auf welche Weise sie ihrer Tradition treu sind.
Wir leben in einer Zeit der Übergänge, auch was die Gestalten und Erscheinungsformen der Religionen betrifft. Dabei hat Walter Homolka nach zwanzig Jahren im Rabbinat eine große Weitsicht und Geduld. Er wünscht sich Veränderungen und Entwicklung des Judentums wie der Kirchen – aber weiß auch, dass es immer wieder längere Durststrecken gibt. Das muss nicht beunruhigen, sondern kann mit Zuversicht ertragen werden.
Immer wieder meldet sich Walter Homolka zu Wort; einige dieser Wortmeldungen sind in diesem Buch versammelt. Ich freue mich auf das Buch, in dem sowohl programmatische Beiträge als auch Notizen und Beobachtungen aus den vergangenen Jahren zusammengestellt sind, und ich bin gespannt auf seine Anregungen, was er zur Pluralität des Judentums, zu Religion und Moderne, zum Dialog der Religionen, zu Land und Staat Israel sowie zu Gerechtigkeit und Frieden zu sagen hat. Ein Ringen, durchaus auch Streiten um diese Themen ist hilfreich in einer Zeit, in der Fundamentalismus um sich greift. Eigenes Denken und Fragen, ja Streit um die Wahrheit sind notwendig gegen jede Form von Fundamentalismus. Frei denken zu können, Religions-, Meinungs- und Redefreiheit sind ein hohes Gut. Ohne gemeinsames Denken und Ringen landen wir in isolierten Sackgassen.
Walter Homolka und ich sind uns immer wieder an Lebensübergängen begegnet. Am allermeisten schätze ich seinen Humor, mit dem er auch schwierige Gespräche entspannen kann. Solch eine Haltung, mit der ein Mensch auch einmal über sich selbst lachen kann, wünschte ich mir in manch anderem Gespräch. Seit zwanzig Jahren wirkt er als Rabbiner in Deutschland. Darüber freue ich mich und bin dankbar. Sein Wirken kann für alle zum Segen werden, und diesen Segen wünsche ich ihm persönlich als christliche Theologin von Herzen.
Statt Einleitung: Zehn Fragen an den Autor
Herr Homolka, Sie stammen aus einer kleinen Stadt in Niederbayern. Heute leben Sie in Berlin. Hatten Sie einen guten Start ins Leben?
Ich bin in Landau relativ behütet aufwachsen und habe mich auf die Schule konzentrieren können. Mein Lebensweg ist ein Beispiel dafür, dass bis in die 1980er Jahre jemand aus einer Kleinstadt mit einem normalen Gymnasialabschluss etwas erreichen kann. Nachhaltige Erfolge sind meistens keine Wunder, sondern das Ergebnis konsequenten und beharrlichen Arbeitens. Die Frage ist doch, ob man bereit ist, Herausforderungen anzunehmen und sie erfolgreich zu bewältigen. Ich arbeite heute in der Auswahl für die Stipendiaten der Studienstiftung des Deutschen Volkes und des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks mit. Dort sehe ich, dass es Großstadtkinder oft schwerer haben bei all den Ablenkungen. Ich habe es jedenfalls nie als Nachteil angesehen, dass ich aus einem kleinen Städtchen komme.
Was haben Ihnen Ihre Eltern mitgegeben?
Die Beharrlichkeit, die sie bei Projekten an den Tag gelegt haben, aber auch das konziliante Herangehen und das Organisationstalent. Ich verdanke aber auch meinen Lehrern einiges und bin ihnen dankbar, weil sie Persönlichkeiten gewesen sind, die wiederum Persönlichkeiten formen konnten.
Wie kam es, dass die jüdische Religion zu Ihrem Lebensmittelpunkt wurde?
Ich komme aus einem religiös wenig gebundenen Elternhaus. Mein Vater lernte meine Mutter bei einer Rede Kurt Schumachers vor Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern in der Passauer Nibelungenhalle kennen. An unserer Schule gab es aber einen faszinierenden Religionslehrer, den Prälaten Helmuth Schuler. Wir nannten ihn nur den »Guru«. Er hat uns ermuntert, den Fragen des Lebens nachzuspüren: warum wir hier sind, was unsere Aufgabe im Leben ist, wohin wir gehen. Und er hat uns zu Aufgeschlossenheit und Neugier ermuntert. Dafür bin ich ihm noch heute dankbar. Dadurch hatte ich die geistige Freiheit, mich mit etwa zwölf Jahren in der Israelitischen Kultusgemeinde von Straubing zu engagieren. Als ich religiös mündig geworden war, bin ich bald darauf formal eingetreten.
Wie sind Sie nach Ihrem Studium zunächst zum Investment Banking gekommen?
Ich bin nach einem Studium der Theologie, Philosophie und Judaistik eher zufällig ins Bankenwesen hineingerutscht: durch ein Praktikum bei der BayerischenHypotheken- und Wechsel-Bank, das mir »Student und Arbeitsmarkt« für Geisteswissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München vermitteln konnte.
Eigentlich hätte ich in der Personalabteilung anfangen sollen. Irgendwie kam ich aber ins Wertpapiergeschäft. Als der Irrtum bemerkt wurde, war ich schon so integriert, dass mich meine Kollegen nicht mehr hergeben wollten. Ich war positiv aufgefallen durch mein ehrliches Interesse an allen Aufgaben in der Abteilung, und wenn sie noch so unbedeutend schienen. Ein Kollege formulierte das so: »Es ist erfreulich, mal einen Praktikanten zu haben, der nicht schon alles weiß, sondern offen und neugierig ankommt, um zu lernen und die Praxis durch Praktiker kennenzulernen.«
Ende der 1980er Jahre wurde ein Thema wichtig: Möglichkeiten des ethisch verantwortlichen Investments. Ein Theologe wie ich konnte da Investmentfondsmanager bei der Portfolioauswahl unterstützen. Es ging darum, Firmen auszuwählen, die versuchen, ihre Renditeziele zu erreichen, und dabei soziale und ökologische Standards einhalten. Die Kriterien für solche »Gerechtigkeit im wirtschaftlichen Handeln« waren erst mühsam zu definieren. Ich hatte es mir zur Aufgabe gestellt nachzuweisen, dass sich wertorientiertes Verhalten in der Wirtschaft auszahlt und nicht durch Renditeeinbußen »bezahlt« werden muss. Daraus entstand der erste ethische Investmentfonds Deutschlands, der »H.C.M. Umweltfonds«.
Aus dem Investment Banking hat es Sie dann in die Welt der Medien verschlagen. War das nicht ein ziemlicher Kontrast?
Meine Funktion als Vorstandsassistent bei Bertelsmann erforderte den Willen zur Exzellenz, aber auch die Bereitschaft, sich durchzusetzen. Die Zeit dort hat mich vor allem mit vielen spannenden Menschen zusammengebracht. In der Buchbranche geht es um Autoren und Inhalte. Und wie man ein öffentliches Forum für beide findet. Das war schon eine enorm stimulierende Zeit, für die ich sehr dankbar bin.
Ich habe in der Industrie aber auch gelernt: Nicht jedes rational vorgetragene Sachargument dient dem Wahren, Guten und Schönen und soll die Unternehmenskultur fördern. Man muss erkennen können, dass eine vermeintliche Effizienzinitiative des Leiters der Nachbarabteilung beim Vorstand letztlich darauf abzielt, sich meine Mitarbeiter unter den Nagel zu reißen.
Dieses Umdenken, Doppelbödigkeit des Handelns zu entlarven und geeignete Gegenmaßnahmen parat zu haben, fällt gerade Religionswissenschaftlern nicht leicht. Wer darauf ausgerichtet ist, sich allein durch gute Leistungen für Höheres zu empfehlen, wird schnell feststellen, dass seine fachliche Kompetenz und Unverzichtbarkeit geradezu als Hindernis für den Aufstieg im Unternehmen wirken können. Gefragt sind ein gewisses politisches Geschick und hohe Flexibilität. Schnelle Auffassungsgabe ist ebenso hilfreich wie sensible Beobachtung der Situation.
Das klingt nach Kompetenzen, die auch für die Begleitung von Menschen als Rabbiner nützlich sind. Welche Erkenntnisse aus Ihrem Berufsweg sind Ihnen auch als Rabbiner besonders wichtig?
Dass man, um etwas bewirken zu können, auch ein bisschen »reizen« können muss wie beim Kartenspielen. Erfolgversprechende Allianzen sind dabei von Vorteil. Wenn man tragfähige, verlässliche Koalitionen schmieden kann, versetzt das Berge. Ich habe gemerkt, dass man im Team trotz der schlechtesten Ausgangsvoraussetzungen gewinnen kann.
In meiner Zeit als Geschäftsführer bei Greenpeace Deutschland habe ich vor allem gelernt, dass es sich lohnt, sich für das einzusetzen, was man richtig findet. Dabei muss man den Mut haben, auch neue Wege zu gehen und Trends zu setzen. Ich nehme als Beispiel die Suffragetten, die Anfang des 20. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Damals war das hoch umstritten und gesellschaftlich geächtet, heute führt Angela Merkel unser Land als Bundeskanzlerin. Wenn man für eine Vision kämpft, kann man also nicht immer nur den Ist-Zustand betrachten. Vor allem aber braucht man einen langen Atem. Im Judentum geht es um »Gerechtigkeit«, um den Weg, durch »gerechtes Handeln« Gottes Schöpfung zu bewahren und zu ihrem Ziel zu bringen.
Liegt darin für Sie die besondere Anziehungskraft des Judentums?
Am Judentum hat mich fasziniert, dass es hinter die Ursprünge des Christentums zurückgeht. Seine strenge Orientierung auf den einen, unfassbaren Gott zog mich an. Gott bleibt für den Menschen vollkommen unverfügbar, gleichzeitig gibt er uns Menschen durch die Offenbarung seiner Gebote den Schlüssel zur Bewährung in dieser Welt in die Hand. Damit liegt eine große Verantwortung auf dem einzelnen Menschen, diese Welt zu verbessern, gerechter zu machen und so quasi am Schöpfungswerk Gottes teilzuhaben. Zusätzlich haben mich persönliche Begegnungen sehr beeindruckt, die bis heute prägend sind: Mit dem Religionsphilosophen Schalom Ben-Chorin blieb ich von meiner Jugend an bis zu seinem Tod 1999 befreundet; der aus Augsburg stammende frühere Präsident der amerikanischen Rabbinerkonferenz Walter Jacob hat mich schon als Teenager in Landau gefördert, mich 1997 zum Rabbiner ordiniert und ist heute der geistige Vater des Abraham Geiger Kollegs.
Seit 2002 sind Sie Rektor des Abraham Geiger Kollegs an der Universität Potsdam. Worin liegt für Sie persönlich die besondere Bedeutung des Kollegs?
Das Abraham Geiger Kolleg ist das erste Rabbinerseminar in Deutschland seit der Schoa. 1997 gab es die ersten Überlegungen, dass endlich vor Ort dringend benötigte Rabbiner ausgebildet werden müssten. Zwei Jahre später wurde das Seminar gegründet, 2001 hat der erste Jahrgang sein Studium an der Universität Potsdam aufgenommen, 2006 gab es in der Neuen Synagoge von Dresden die erste Ordination seit 1942, als die Nazis die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in Berlin zerstört hatten. Bei der Errichtung des Rabbinerseminars haben wir einen präzisen Masterplan verfolgt, wie ich ihn aus meiner Arbeit in der Wirtschaft kenne. Viele Partner und großes Wohlwollen haben die Gründung mitgetragen. Gerade die politische Unterstützung aller im Bundestag vertretenen Parteien hat uns dabei unendlich geholfen. In unserer Arbeit bemühen wir uns um eine internationale Ausrichtung. Wir bilden für ganz Kontinentaleuropa aus und sogar darüber hinaus. Durch das deutsche Hochschulsystem können wir das ohne Studiengebühren anbieten. Damit sind wir weltweit einzigartig und vor allem hilfreich für die Studierenden osteuropäischer Staaten, die die im angloamerikanischen Raum üblichen Studienkosten niemals aufbringen könnten.
Alles was ich an Erfahrungen im Leben vorher machen konnte, habe ich für die Errichtung des Abraham Geiger Kollegs und für die Stärkung des liberalen Judentums weltweit gut brauchen können. Hier schließt sich ein Kreis. 2006 fand in Dresden die erste Ordination von Rabbinern in Deutschland nach der Schoa statt. Das war ein sehr emotionaler Moment. Ich war beeindruckt, dass weite Teile der Öffentlichkeit davon Notiz genommen haben. Es war ein wirkliches Freudenfest des Neuanfangs. Wenn ich mich an meine Anfänge in der jüdischen Gemeinde in Straubing erinnere vor vierzig Jahren: Da war die Stimmung, dass wir bald zusperren müssen. Mittlerweile herrscht unter den Juden in Deutschland eine gewisse Aufbruchsstimmung. Natürlich auch bedingt durch die große Zuwanderung von Juden aus der früheren Sowjetunion.
Reicht denn die bloße Tatsache der Zuwanderung aus, um den jüdischen Gemeinden in Deutschland eine Zukunft zu geben?
Vor allem ist es wichtig, diese Menschen inhaltlich an das religiöse Gemeindeleben zu binden. Wenn sie nicht die Chance haben, zu lernen, ihre Erfahrungen religiös zu durchleuchten, dann wird die Zuwanderung von 200 000 Kontingentflüchtlingen nur ein kurzes Strohfeuer sein. Gerade deshalb ist die Ausbildung neuer Rabbiner so wichtig. Weil der Rabbinermangel so riesig ist, bilden wir seit 2007 auch Kantoren als Vorbeter und Religionslehrer in Potsdam aus. Dieser Studiengang hat sich ebenfalls gut entwickelt.
Mit der Eröffnung der School of Jewish Theology an der Universität Potsdam am 19. November 2013 hat sich schließlich nach fast zweihundert Jahren die Forderung nach der Gleichberechtigung der jüdischen Theologie mit den christlichen Theologien und den Islam-Studien erfüllt. Seitdem bilden wir auch konservative Rabbiner und Rabbinerinnen aus, am Zacharias Frankel College der Universität Potsdam. Ganz wichtig ist auch die Arbeit mit jungen Menschen. Deshalb haben wir das Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk (ELES) als eines von dreizehn Begabtenförderwerken gegründet, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) unterstützt werden. ELES fördert besonders begabte jüdische Studierende und Promovierende. Diese Förderung setzt auf Engagement und Selbstentfaltungsmöglichkeiten. Neben der finanziellen Absicherung hat ELES auch das Ziel, durch Maßnahmen ideeller Förderung jüdische Identität, Verantwortungsbewusstsein und Dialogfähigkeit seiner Stipendiaten zu stärken.
Sie selbst sind sehr aktiv im interreligiösen Dialog, auch Ihr Lehrstuhl an der Universität Potsdam hat einen Schwerpunkt Interreligiöse Beziehungen. Wie erfahren Sie Ihre Gesprächspartner?
Ich bin aktiv im Gesprächskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der Gesprächskreis hat gerade ein Buch herausgegeben, an dem jüdische und christliche Wissenschaftler gemeinsam mitgewirkt haben, um eine Reihe christlicher Irrtümer über das Judentum aufzuklären (Von Abba bis Zorn Gottes. Irrtümer aufklären – das Judentum verstehen, Ostfildern 2017). Irritation hat für mich vor allem die Neufassung der Karfreitagsfürbitte durch Papst Benedikt XVI. 2007 ausgelöst. Es ist für uns Juden sehr problematisch, wenn in der katholischen Kirche wieder dafür gebetet wird, dass Gott die Juden erleuchten möge. Zwar soll diese Fürbitte nur im sogenannten »außerordentlichen Ritus« verwendet werden, aber sie wurde durch den damaligen Papst eigenhändig verfasst. Das gibt dem Text und seiner theologischen Aussage besonderes Gewicht. Deshalb kam weltweite Kritik, besonders aus Italien, Deutschland und Österreich. Wir bleiben bei unserer Wahrnehmung, dass diese Version der Fürbitte ein Hindernis im Miteinander von Juden und Katholiken darstellt. Die Fürbitte Benedikts XVI. hat dazu geführt, dass konservative Kreise öffentlich die Judenmission propagierten. Wir Juden gehen davon aus: Der Bund Gottes mit seinem Volk ist ungekündigt. Wir hatten eigentlich angenommen, dass die neue Verhältnisbestimmung von Juden und Christen, die das Zweite Vatikanische Konzil und die Erklärung Nostra aetate für die katholische Kirche definiert hat, nicht mehr infrage gestellt würde. Papst Franziskus hat deutlich gemacht, dass es mit ihm keine Wende in den freundschaftlichen Beziehungen zwischen Juden und Christen geben werde. Diese Standortbestimmung wird sich im Alltag bewähren müssen.
Vor diesem Hintergrund sind mir die enormen Bemühungen der Evangelischen Kirche in Deutschland wichtig, im Kontext des Reformationsjubiläums 2017 eine gründliche Aufarbeitung des Verhältnisses mit dem Judentum zu leisten. Hier erwähne ich besonders die Erklärung der Magdeburger Synode zur Judenmission vom 9. November 2016, die »Erklärung zu Christen und Juden als Zeugen der Treue Gottes«.
In meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich mit beiden Kirchen und trage gerne dazu bei, dass sich das Verhältnis immer weiter verbessert. Die Herausforderung des Dialogs ist heute, dieses Einvernehmen auch mit dem Islam zu suchen und zu pflegen. Mir war der respektvolle Umgang aller Religionen miteinander immer sehr wichtig, deshalb spielt die interreligiöse Erfahrung bei der Ausbildung unserer Rabbiner eine große Rolle. Ich werde mich auch weiterhin für ein gedeihliches Miteinander auf gleicher Augenhöhe einsetzen.