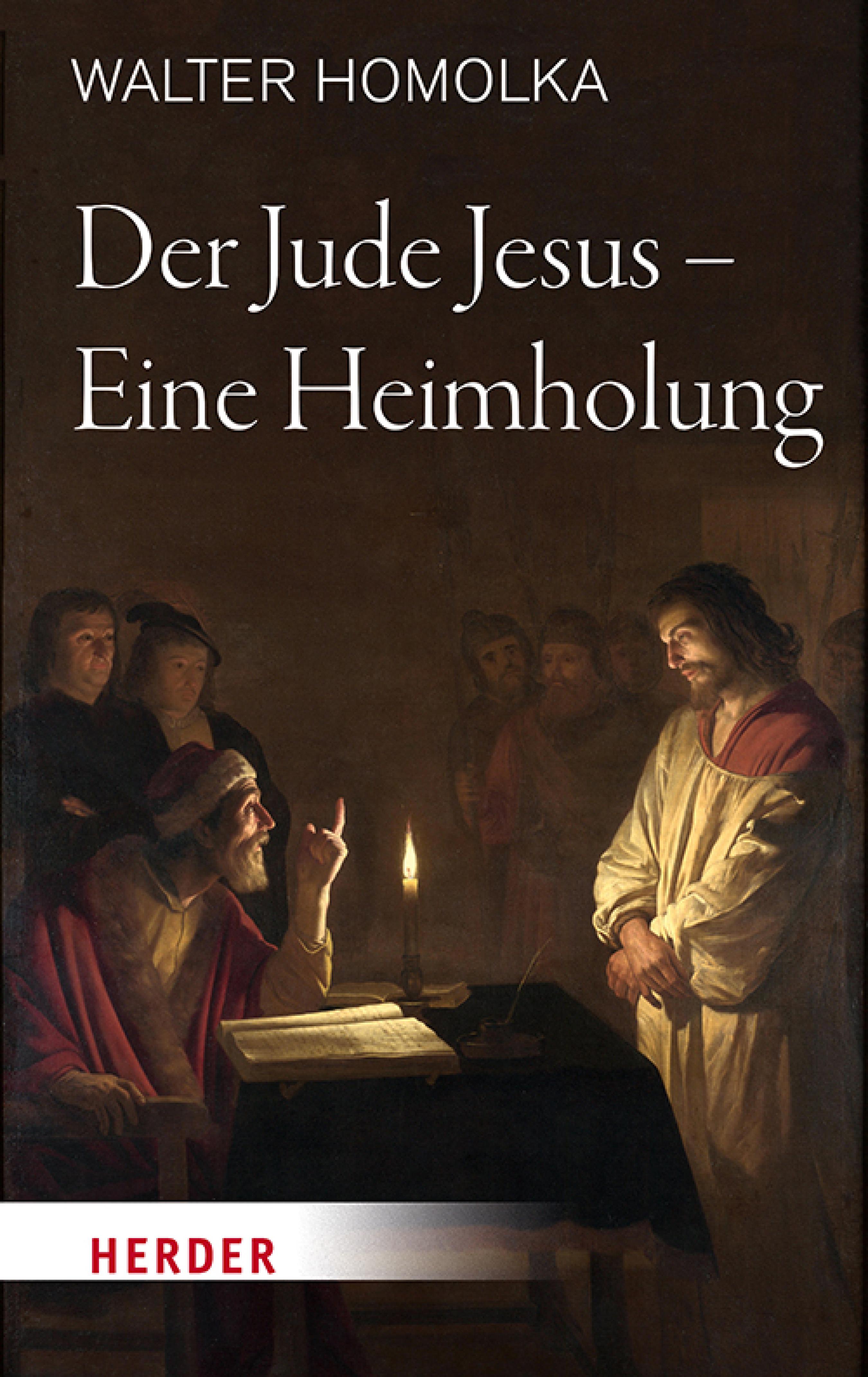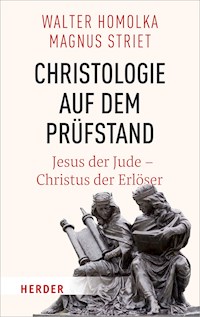Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Judentum und Islam – zwei verfeindete Religionen? Hat nicht bereits der Koran zur Gewalt gegen Juden aufgerufen und damit das Fundament zu einem Jahrhunderte währenden Konflikt gelegt, der noch unsere Gegenwart bestimmt? Und auch im deutschsprachigen Raum wirkt das Verhältnis beider Religionen von starken Gegensätzen geprägt. Wird heute von Antisemitismus gesprochen, dann ist in vielen Fällen muslimischer Antisemitismus gemeint. Doch die beiden Religionen stehen sich näher, als viele vermuten. Judentum und Islam sind eng miteinander verwandt und einander deutlich näher als dem Christentum. Dass ist ein Faktum, das von der Mehrheit unserer Gesellschaft weithin noch übersehen wird. Der jüdische Religionsphilosoph Rabbiner Walter Homolka und der islamische Theologe Mouhanad Khorchide stellen in ihrem ebenso provokanten wie diskussionsfreudigen Buch gängige Klischees infrage und kommen zu einem überraschenden Ergebnis: Die Geschwisterreligionen Judentum und Islam haben innovatives Potenzial für die Gesamtgesellschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mouhanad Khorchide und Walter Homolka
Umdenken!
Wie Islam und Judentum unsereGesellschaft besser machen
Besonderer Dank an Herrn Dr. German Neundorfer, Frau Hildegard Mangels-Heine und Frau Dr. Juni Hoppe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book Konvertierung: ZeroSoft, Timisoara
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © Lars Berg / KNA; © Harald Oppitz / KNA
ISBN E-Book (ePub) 978-3-451-81137-1
ISBN E-Book (E-PDF) 978-3-451-81636-9
ISBN Print 978-3-451-37625-2
Inhalt
Vom „christlichen Abendland“ zur pluralistischen Gesellschaft Eine Hinführung
1. Geschwister im Glauben – Umdenken in den Religionen
Juden, Muslime und Christen – Grundlagen eines Gesprächs
In der Wahrheit leben
Verbunden in der Gefahr
Judentum und Islam – die verschwisterten Religionen
Der Koran und die Juden
Der Koran und die Wissenschaft des Judentums
Das Judentum – Grundlage für den Islam?
Juden im Koran – ein ambivalentes Verhältnis
Umdenken: Der Koran und die Einheit in der Vielfalt
Die Notwendigkeit einer historisch-kritischen Betrachtung der Prophetenbiografie
2. Warum über Gott sprechen? – Umdenken in der Theologie
Säkularisierung versus Pluralisierung
Jüdische Theologie als Tochter der Wissenschaft des Judentums
Die Verortung an der staatlichen Universität
Die Aufgabe der Jüdischen Theologie im „christlichen Staat“
Die Aufgabe der Jüdischen Theologie im weltanschaulich neutralen Staat
Die islamische Theologie an deutschen Universitäten
Öffentliche und private Religion
Imam-Ausbildung und Moscheegemeinden
3. Wahrheit in der Vielfalt – Umdenken in der Gesellschaft
Vielfalt braucht einen Rahmen
Renaissance und Aufklärung
Von der einen Kirche zum Nebeneinander der Bekenntnisse
Vom Nebeneinander zum Miteinander
Schleiermacher und das Judentum in Deutschland im 19. Jahrhundert
Der „christliche Staat“ als Verteidigungslinie der homogenen Gesellschaft
Vielfalt der Glaubensweisen und Autonomie der Überzeugung
Der Staat und die Diversität der Weltanschauungen
Fundamentalismus und Populismus als Rekonstruktionsversuche des Verlorenen
Der Staat: Garant des neutralen Raums für ein pluralistisches Miteinander
Gehört Deutschland zum Islam?
Individualität oder Kollektivität – ein konstruiertes Dilemma
Wie pluralitätsfähig sind auch Muslime?
Frauen im Islam und die Problematik identitärer Zugänge
Machtdiskurse der Opfer-Täter-Rhetorik
Die identitäre Konstruktion von Tätern und Opfern
Identitäre Islamisten und ihre Unterstützer
Exkurs: Politischer Islam
Eine intellektuelle Krise oder endlose Naivität?
Warum es notwendig ist, gekränkte Identitäten zu überwinden
Dankbarkeit als Schlüssel innerer Erfülltheit
Ein flehender Appell: Bitte gönnen Sie auch dem Islam seine Aufklärung!
Die Bejahung der Vielfalt bedeutet die Bejahung des Selbst Schlusswort
Anmerkungen
Vita
Vom „christlichen Abendland“ zur pluralistischen Gesellschaft Eine Hinführung
Walter Homolka
Wenn ich mit Wiener Freunden auf dem Balkon ihres Hauses in der Krapfenwaldgasse von Grinzing sitze, schaue ich direkt auf den Kahlenberg. Da, wo heute liebliche Weinberge liegen, ereignete sich am 16. September 1683 die Schlacht am Kahlenberg und beendete die Zweite Wiener Türkenbelagerung. Ein deutsch-polnisches Entsatzheer unter der Führung des polnischen Königs Johann III. Sobieski schlug die osmanische Armee unter Kara Mustafa. Vom nicht abgesicherten Höhenzug zwischen Kahlenberg und Leopoldsberg stießen die verbündeten polnisch-deutschen Fußtruppen so in den Rücken der Osmanen, die die Stadt einzunehmen versuchten. Die osmanischen Kriegsherren konnten sich über die Taktik in dieser Schlacht mit zwei Fronten nicht einigen. Herzog Karl V. von Lothringen zerschlug den schwachen rechten Flügel der Osmanen. Am späten Nachmittag wurde die Schlacht entschieden, als die Kavallerie, insbesondere die durch König Johann III. Sobieski geführte polnische Elitetruppe der Husaren, die Elitetruppen der Sipahi und Janitscharen bezwingen und ins feindliche Lager eindringen konnte. Wien war gerettet, die Osmanen flohen in wildem Durcheinander.
Die Niederlage bedeutete den Anfang vom Ende der türkischen Hegemonialpolitik. 1683 wurden der Stern und die Mondsichel am Stephansdom abgenommen, die seit 1519 dort die Spitze als Wetterfahne zierte und missverständlich als Halbmond gedeutet werden konnte. Man ersetzte sie durch das eindeutige Kreuz. Das christliche Europa hatte – so schien es den Zeitgenossen – ein für alle Mal den muslimischen Einfluss eindämmen können.
So traumatisch war diese Erfahrung, dass die Schlacht am Kahlenberg noch 350 Jahre später als Sinnbild für die Rettung des christlichen Abendlandes betrachtet wird. Und der Ausruf „Die Türken stehen vor Wien“ drückt heute noch die Dramatik der Situation aus, wie nah doch der Islam an die christlichen Mächte Europas herangerückt war. Hier sei mir der Hinweis gestattet, dass die jüdisch-sefardische Gemeinde in Wien seit 1736 eine gewisse Mittlerfunktion zwischen Österreich und dem Osmanischen Reich innehatte. Der „Türkische Tempel“ in der heutigen Zirkusgasse 22, zwischen 1885 und 1887 von Hugo von Wiedenfeld nach dem Vorbild der Alhambra im maurischen Stil erbaut, wurde in der Reichspogromnacht 1938 zerstört.
Aus Ungarn zogen sich die Türken erst 1720 zurück; der Sieg Polens über die Osmanen 1621 bei Chocim hatte Begeisterungsstürme in Europa ausgelöst, Papst Gregor XV. verfügte ein mehrtägiges Dankfest. Wacław Potocki (1621–1696) idealisierte den Sieg in seinem zehnteiligen Heldengedicht Wojna chocimska (Der Krieg von Chocim), das um 1670 entstand. In ihm idealisierte er den Großhetman von Litauen Jan Karol Chodkiewicz, in dem er „ein letztes Mal das Ideal des christlichen Ritters aufleuchten“ sah. Erst der Friede von Karlowitz 1699 beendete die osmanisch-polnischen Fehden. Noch im 20. Jahrhundert setzte sich der polnische Historienmaler Józef Brandt (gest. 1915) mit dem ersten Osmanisch-Polnischen Krieg auseinander: Für ihn war dieser Krieg ein Beweis dafür, dass sein Vaterland, auch wenn es in der Zeit der Teilung 1795 bis 1918 keinen souveränen Staat bilden durfte, den Teilungsmächten seiner Zeit, Königreich Preußen, Österreich und dem Russischen Zarenreich, mindestens gleichwertig, wenn nicht überlegen war, da es sie vor dem weiteren Vordringen der Türken gerettet hatte.
Heute stehen die Türken mitten auf der Mariahilfer Straße, und eine Studie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften von 2014 prognostiziert für 2046 einen Bevölkerungsanteil der Muslime in Wien von 21 Prozent. Dann würden nurmehr ein Drittel der Wiener katholisch sein. Und in Deutschland? Laut einer Schätzung von 2019 leben in Deutschland ca. fünf Millionen Musliminnen und Muslime, auch wenn man sie schwer zählen kann. Denn ihr Organisationsgrad ist gering, was auch erklärt, warum sie bisher keinen vollen Anteil am öffentlichen Leben erreichen konnten. Jede zweite Person besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, und Berlin gilt als die größte türkische Stadt außerhalb der Türkei. Aber wir sprechen bisher nur von Türken. Die Länder mit den meisten Muslimen waren 2010 Indonesien (209,1 Mio.), Indien (176,2 Mio.), Pakistan (167,4 Mio.), Bangladesch (134,4 Mio.) und Nigeria (77,3 Mio.). Die große Mehrheit der muslimischen Bevölkerung lebt in Vorderasien, Afrika, Südasien, Zentralasien und Südostasien. Mit über 1,8 Milliarden Mitgliedern ist der Islam nach dem Christentum (ca. 2,2 Milliarden Mitglieder) heute die Weltreligion mit der zweitgrößten Mitgliederzahl.
Heute wie damals stehen sich also zwei Religionen auf Augenhöhe gegenüber. Und im Zeitalter der Globalisierung kommen sie sich nicht nur näher, sondern leben auch miteinander, Tür an Tür.
Einem Juden im Alltag zu begegnen ist da schon schwerer. Weltweit gibt es nur 15 Millionen Jüdinnen und Juden, 0,2 Prozent der Weltbevölkerung. In Deutschland gibt es ca. 100 000 Jüdinnen und Juden, die in ca. 120 Gemeinden organisiert sind. In Österreich sind es ca. 10 000 Juden, die zu 87 Prozent in Wien wohnen. Unsere Berührungspunkte mit der christlichen Umgebung waren zeitweise von ähnlicher Abneigung und hysterischer Feindseligkeit geprägt, wie Muslime sie erfahren haben. Aber Juden hatten keine Heere, die das „christliche Abendland“ je hätten gefährden können. Sie lebten in einem Paralleluniversum inmitten einer christlichen Umgebung und trugen das Schandmal der Christusmörder. Papst Benedikt hat es in seinem Essay „Gnade und Berufung ohne Reue“ eindrücklich für das 21. Jahrhundert formuliert: „Die Umstiftung des Sinai-Bundes in den neuen Bund im Blute Jesu […] gibt dem Bund eine neue und für immer gültige Gestalt. Jesus antwortet damit im voraus auf die zwei geschichtlichen Ereignisse, die kurz danach in der Tat die Situation Israels und die konkrete Form des Sinai-Bundes grundlegend geändert haben: die Zerstörung des Tempels, die sich immer mehr als unwiderruflich erwies, und die Zerstreuung Israels in einer weltweiten Diaspora.“[1] Durch ihre endgültige Zerstreuung in der Welt hätten die Juden zwar die Tür zu Gott geöffnet, im jüdischen Leid und Exil sei die Umwandlung des Sinai-Bundes in den Jesus-Bund aber sinnfällig. Ein wahrlich asymmetrisches Verhältnis hat das Zusammenleben von Juden und Christen viele Jahrhunderte lang verhindert.
Die Aufklärung Anfang des 19. Jahrhunderts hat hier Wandel möglich gemacht. Auf einmal ging es um ein Miteinander anstelle eines unverbundenen Nebeneinanders. Das bedeutete Stress für beide Seiten. Denn Wandel erzeugt immer auch Druck. Christlicherseits musste man Abschied nehmen vom Mythos des „christlichen Staats“, das Judentum wiederum musste sich der Neuzeit stellen und damit der Frage, wie jüdisches Leben im Geist der Aufklärung aussehen soll. Daraus entstanden die jüdischen Geistesrichtungen, die es heute noch gibt. Für beide dauerte der Prozess der Annäherung und gleichberechtigten Teilhabe weit über hundert Jahre. Und nach unbestreitbaren Erfolgen kam mit der Schoa eine Zäsur, die alles einriss, was das 19. Jahrhundert an Entwicklung ermöglicht hatte.
Noch heute beschäftigt uns das jüdisch-christliche Verhältnis enorm und die aktuelle Situation der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland wird immer noch stark von der Schoa geprägt.
Immerhin boten die Weimarer Republik und die Republik Deutschösterreich ab 1918 den Einstieg in eine religionspluralistische Gesellschaft. Aber viele Probleme sind auch hundert Jahre danach noch bestimmend für unseren gesellschaftlichen Diskurs. Mouhanad Khorchide und ich widmen dieser Tatsache unser gemeinsames Buch.
1. Geschwister im Glauben – Umdenken in den Religionen
Juden, Muslime und Christen – Grundlagen eines Gesprächs
Walter Homolka
Einer der großen Denker des deutschen Judentums im 19. Jahrhundert, Abraham Geiger, nahm 1832 die Haltung ein, die Beschäftigung mit dem Islam sei ihm liebevolle Neigung, die Auseinandersetzung mit der christlichen Theologie aber nur lästige und apologetische Pflicht. Geiger, der auch einer der Begründer der modernen Koranforschung war, kam zu dieser Aussage, weil er damals mit einer protestantischen Vorstellung des „christlichen Staates“ konfrontiert war, die Juden die Teilhabe an der Gesamtgesellschaft vorenthalten wollte. Es dauerte mehr als hundert Jahre, bis Juden und Christen zu einem neuen Verhältnis gefunden haben: Zunächst musste sich die Verbindung von „Thron und Altar“ lösen, darauf aufbauend konnte eine plurale Gleichstellung der Religionen in der Weimarer Reichsverfassung erreicht werden. Letztlich hat erst das Trauma des Holocaust den nötigen Bruch in den Kirchen herbeigeführt. Aus der Bankrotterklärung christlicher Ethik im Dritten Reich und aus dem Versagen der Kirchen vor der Aufgabe, die jüdischen Brüder und Schwestern wirksam vor der Ermordung zu schützen, ergab sich nach dem Zweiten Weltkrieg schrittweise ein Ansatz für ein neues Miteinander von Christen und Juden. In Abraham Geigers Nachfolge bedeutet das den Mut zu schonungsloser Analyse, die aber Mut zum Handeln gibt. Und in der Tat: Die Alternativen zum Dialog sind wenig verlockend. Die drängende Frage aber ist: Was müssen wir tun?
Der Hinweis auf den Holocaust macht eine Einsicht besonders eindringlich: Die Wahrnehmung des Anderen im Judentum basiert nicht auf der Frage nach dem rechten Glauben, sondern einzig auf der Frage nach dem richtigen ethischen Verhalten. Die Grundlage davon ist die Vorstellung von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Weil der Mensch im Angesicht Gottes geschaffen ist, hat er die Verantwortung und auch die Möglichkeit, die Vernunft als Mittel zur ethischen Vollendung zu verwenden. Dabei verweisen Juden auf Noah und seine sieben Gebote an die Menschheit: die sechs Verbote des Götzendienstes, des Mordes, des Diebstahls, der sexuellen Promiskuität, der Gotteslästerung, der Tierquälerei und das Gebot einer gerechten Gesellschaft mit gerechten Gesetzen. Jeder Nichtjude, der diese Ge- und Verbote einhält, ist ein Gerechter unter den Völkern, und von dem wird gesagt, er habe die gleiche geistige und moralische Stufe erreicht wie selbst der Hohepriester im Tempel (Talmud, Bava Kamma 38a).
Für mich ist dieses gegenseitige Eintreten gar nicht neu. Seit 1972 fand jedes Jahr in Bendorf am Rhein eine Begegnungswoche von Juden, Christen und Muslimen statt. Das Londoner Rabbinerseminar, das Leo Baeck College, war Mitorganisator, und wir Studenten nahmen daran regelmäßig teil. Es gehörte zu unserer Ausbildung, sich diesem Erlebnis des gemeinsamen Studierens, Essens und Betens auszusetzen – und ich bin froh um diese Erfahrung, mit dem Anderen zu leben und mich auch in seinen religiösen Alltag hineinzufühlen. Warum aber ist ein solches Zusammenleben für Juden und Muslime so bedeutsam? Das Judentum und der Islam sind sich einander näher, als man gemeinhin glaubt. Das hat religiöse und historische Bezüge.
In der Wahrheit leben
Lassen Sie mich einen Blick in die Hebräische Bibel werfen. Dort finden wir den Grund, warum Juden und Muslime eben viel gemeinsam haben, so sehr sie auch manches unterscheidet.
Die Geschichte von Isaak und Ismael
Alles begann mit der Geschichte von Isaak und Ismael im 1. Buch Mose Kap. 21. Ismael war Abrahams Sohn von Hagar, einer Sklavin der Sara. Da das Paar Abraham und Sara kinderlos zu bleiben scheint, schläft Abraham auf Bitten seiner Frau mit der ägyptischen Sklavin Hagar. Hagar wird schwanger, und Ismael wird geboren. Ein von Hagar geborenes Kind gilt nach damaliger Sitte als Sprössling der unfruchtbaren Herrin. Dann aber geschieht das Wunder: Abrahams Frau Sara bekommt selbst noch einen Sohn: Isaak. Da wird Hagar von ihr buchstäblich in die Wüste geschickt und es erscheint ein Engel. Er zeigt Hagar und Ismael den rettenden Brunnen.
Die Rettung der beiden ist tröstlich, aber diese Geschichte ist auch voller Neid, Eifersucht und Furcht. Das Verhältnis von Sara und Hagar ist davon ebenso geprägt wie die Beziehung zwischen dem Erstgeborenen Ismael, der scheinbar durch Isaak um sein Recht gebracht wird, der Erste zu sein. So war es vorher schon Kain und Abel ergangen, so wird es wenig später in der Geschichte auch Esau und Jakob ergehen. Am Ende unserer biblischen Geschichte gehen Ismael und Isaak getrennte Wege. Als aber Abraham stirbt, im 25. Kapitel, da begegnen sie einander, um ihn gemeinsam zu begraben, vielleicht auch ihre Eifersucht vor dem Herrn. „Und Ismael lebte im Angesicht all seiner Brüder“, sagt Vers 18 schließlich. Das Ende ist versöhnlich, man arrangiert sich, ein Nebeneinanderleben scheint möglich. Denn beide haben doch denselben Vater. Die Geschichte von Ismael und Isaak mahnt uns: Als Brüder sollen wir uns erkennen. Vielleicht, um auch einmal im Angesicht des Bruders nebeneinander zu wohnen.
Theologische Berührungspunkte
Judentum und Islam wissen sich einig in ihrem Gottesbild, ihrer Vorstellung von Offenbarung und Gottes Geboten. Gott ist für Juden wie Muslime ein rettender, beschützender, ein barmherziger Gott, der den Menschen ewige Treue und Liebe entgegenbringt. Muslime haben immer schon gewusst, dass hier derselbe Gott angesprochen wurde und wird.
Wir glauben an das, was zu uns herabgesandt und zu euch herabgesandt wurde. Unser Gott und euer Gott ist einer. Und wir sind ihm ergeben. (Sure 29 –Al-Ankabut, 46)
Im Islam wie im Judentum offenbart Gott seinen Willen in seinem Wort an die Menschen.
„Wir haben die Tora hinabgesandt, in der Rechtleitung und Licht enthalten sind, damit die Propheten, die gottergeben waren, für die, die Juden sind, danach urteilen, und so auch die Rabbinen und Gelehrten, aufgrund dessen, was ihnen vom Buche Gottes anvertraut wurde und worüber sie Zeugen waren. […] Und wir ließen nach ihnen Jesus, den Sohn Marias, folgen, damit er bestätige, was von der Tora vor ihm vorhanden war. Und wir ließen ihm das Evangelium zukommen, das Rechtleitung und Licht enthält und das bestätigt, was von der Tora vor ihm vorhanden war, und als Rechtleitung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. […] Und wir haben zu dir [Mohammad] das Buch mit der Wahrheit hinabgesandt, damit es bestätige, was vom Buch vor ihm vorhanden war, und alles, was darin steht, fest in der Hand habe.“ (Sure 5 – Al-Maida, 44–48)
Nach Vorstellung des rabbinischen Judentums führt der Weg zu Gott nur über seine Offenbarung. Sie befindet sich aber nicht „im Himmel“, sondern wurde den Menschen als einzige Quelle ihrer Auslegung und ihres Weltverstehens gegeben. Diese Offenbarung schreitet voran durch die menschliche Auslegung, für Juden in der „mündlichen Tora“, für Christen und Muslime im Neuen Testament und Koran.
Judentum wie Islam suchen die Wege von Gottes Gerechtigkeit im religiösen Recht (jüdisch die Halacha, wörtlich „die zu gehende Wegrichtung“). Die Halacha markiert hierbei nicht das Ziel, sondern einen Weg. Sie verlangt Handeln, die „Selbstheiligung“ durch Gebotserfüllung, und nicht Glauben. Im Judentum wie im Islam ist der Mensch vor Gott für sein Tun verantwortlich, er hat den freien Willen, sich für das Gute zu entscheiden.
„Wer der Rechtleitung folgt, folgt ihr zu seinem eigenen Vorteil. Und wer irregeht, der geht irre zu seinem eigenen Schaden. Und keine lasttragende Seele trägt die Last einer anderen.“ (Sure 17 – Al-Isra, 15)
Im Vordergrund stehen bei Judentum wie Islam das Leben mit Gott, das Studium seiner Schrift und die Einhaltung der Gebote Gottes.
„Zivilisatorisches“ Wertesystem
Auch heute noch hören wir immer wieder unbestimmte Hinweise auf Kulturen im Kontext von Religion – auf eine jüdische, christliche oder islamische Kultur, wobei unterstellt wird, dass zwischen ihnen irgendeine Art von Widerspruch bestünde –, dass diese sich gegenseitig ausschlössen und somit auch notwendigerweise unvereinbar miteinander seien oder einander sogar feindlich gegenüberstünden. Der Historiker William Dalrymple macht uns darauf aufmerksam, dass „das geistige Erwachen, das die Renaissance verkörperte, fast ebenso sehr dem Zusammenspiel von Orient und Okzident wie einem auf griechischen und römischen Wurzeln aufbauenden Prozess der Selbstfindung geschuldet war“.[2]
Demnach verkörpert jede der drei Glaubensweisen in ihrer ureigenen Form die potenziell zivilisatorische Kraft des Glaubens. Als jeweils universelle Religion lässt sich keine von ihnen zeitlich oder räumlich abgrenzen. Sie verkörpern unterschiedliche Ausdrucksformen der gleichen „zivilisatorischen“ Werte; verschiedene Interpretationen des ewigen Bundes. Somit können sie ohne ein Risiko von Gegensätzen in ein und derselben Gesellschaft präsent sein – und in ein und derselben Welt, ohne dass dadurch zwangsläufig Konfrontationen ausgelöst werden. Im Kern geht es hier um eine Frage der Identität. In diesem Bereich können Menschen mit gemeinsamer Erfahrung als religiöse Gemeinschaften einander behilflich sein, sich ohne Assimilation auf metaphysischer Ebene bzw. ohne jede Aufgabe ihrer Loyalität gegenüber Gott in vollem Umfang als loyale Mitglieder der Zivilgesellschaft einbringen. Der Koran gemahnt uns, dass Verschiedenheit und Vielfalt als Bereicherung begrüßt werden sollten und voll und ganz unter die göttliche Vorsehung fallen.
Wir sollen uns nicht einbilden, wir seien Gott und könnten in einer Wahnvorstellung der eigenen Allmacht unseren Willen zum Gesetz erheben, obwohl wir das oft genug tun. Aber wir haben den Auftrag, Gottes Wahrheit durch unser Handeln in die Welt zu bringen, also in der Wahrheit zu leben. Das bedeutet auch: sich unangenehme Wahrheiten sagen zu können. Was aber bedeutet vor dem Hintergrund der Aufklärung „in der Wahrheit leben“?
Tradition und Moderne
Juden und Christen sind heute einander so nahe, weil beiden die Erfahrung der Aufklärung mit ihrem Primat von Rationalismus und Vernunft gemeinsam ist. Alle Religionen, auch das Christentum, hatten an den Herausforderungen der Moderne zu kauen, manches ist bis heute unverdaut. Die Vereinbarkeit von Religion und Moderne entscheidet sich besonders an hermeneutischen Grundfragen: Im Schrift- und Traditionsverständnis werden die Weichen gestellt für die Dialog- und Reformfähigkeit von Religion. So mussten sich Judentum wie Christentum fragen, ob sie eine historisch-kritische Betrachtung von heiligen Schriften und Tradition zulassen. Das europäische Judentum hat durch die Aufklärung eine Chance erhalten: die Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs, die kulturelle wie rechtliche Emanzipation und die Ausformung einer widerstandsfähigen Identität. Dies bedingte die Neubewertung unserer jüdischen Traditionen und Lehren. Die Teilhabe an einer sich pluralisierenden Gesellschaft lässt eben keinen unverändert. Und hier setzt meine Hoffnung an, dass auf der Basis gegenseitiger Anerkenntnis die muslimische Seite auch einen brüderlichen Rat entgegenzunehmen bereit ist. Vielleicht können wir Juden dem Islam mit unseren Erfahrungen auf brüderliche Weise Wege aufzeigen, wie man der Tradition gerecht wird und dennoch mit den Erträgen der Aufklärung zurechtkommt. Denn ein historisch-kritisches Hinterfragen der eigenen Tradition ist ein wichtiger Schritt hin zur Integration von Muslimen in die westliche Gesellschaft.
Diese Wahrheit müssen wir – jeder für sich – in der Auseinandersetzung von Tradition und Moderne immer wieder finden. Das erfordert Disziplin. Und: Wir müssen uns um diese Wahrheit mit unserem freien Willen und unserer Einsichtsfähigkeit bemühen, und wir müssen damit fertig werden, dass es die eine Wahrheit nicht geben kann. In der Demut, die dieser Einsicht folgt, können Juden, Christen und Muslime zu einem gleichberechtigten Verhältnis finden. Ein solches Nebeneinander unter Brüdern setzt die Bereitschaft voraus, den anderen, wenn nötig, zu verteidigen, auf der Basis solcher Anerkennung als Bruder aber auch kritisieren zu dürfen. Um es mit den Worten von Imam Abu Ishaq al-Shatibi (gest. 1388) zu sagen: „Nu’adhem al-jawaame’ wa nahtarem al-furooq“ – Wir betonen die Gemeinsamkeiten und respektieren gleichzeitig die Unterschiede.
Nun hören wir Juden von christlicher Seite immer wieder, der jüdisch-christliche Dialog sei mit der Beziehung zu den Muslimen gar nicht zu vergleichen. Juden und Christen teilten sich die gleiche Heilige Schrift und hätten das gleiche Gottesbild. Als Jude macht mich das stutzig. Denn über viele Jahrhunderte hinweg wurden Juden von Christen auf das Grausamste verfolgt, ausgegrenzt, verhöhnt und ermordet. Die Scham über das große Versagen beider Kirchen während des Dritten Reichs war die Grundlage mehrerer Jahrzehnte der intensiven Annäherung des Christentums an das Judentum, mit teilweise grotesken Phasen des Philosemitismus. Kann das aber Jahrhunderte der guten Nachbarschaft zwischen Juden und Muslimen aufwiegen? Nein.
Verbunden in der Gefahr
Spätestens seit dem 11. September 2001 ist die christliche Seite wieder von Furcht geplagt. Groß ist ihre Furcht, das „christliche Abendland“ sei in Gefahr. Einst die Türken vor Wien, heute der Islamismus – und mit der Türkei klopfe er direkt an unsere Haustüre.
Ein Blick auf die jüdisch-muslimische Beziehungsgeschichte ist lohnenswert, wenn man beurteilen will, ob die Rede von den jüdisch-christlichen Wurzeln Europas wirklich trägt. Dabei werden dann ganz spannende Befunde deutlich. Die Hohe Pforte am Bosporus gewährte den Juden Freiheiten und Rechte, die für sie im christlichen Europa keineswegs selbstverständlich gewesen waren. Rabbiner Isaak Zarfati lud 1454 die schikanierten deutschsprachigen jüdischen Gemeinden ein, sich im Osmanischen Reich anzusiedeln. 1492 schickte Sultan Bayezid II. sogar Schiffe und nahm viele Juden aus Spanien auf, die vor der Kirche fliehen mussten.
Und diese Offenheit und Hilfsbereitschaft setzte sich bis in die jüngere Vergangenheit fort. So ehrte die nationale Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel den türkischen Botschafter Selahattin Ülkümen (1914–2003) als „Gerechten unter den Völkern“, weil er Juden auf Rhodos unter Lebensgefahr zur Flucht verholfen hatte. Kemal Atatürk ermöglichte es durch eine freizügige Einreisepolitik vielen jüdischen Professoren aus Nazideutschland, sich zu retten und an türkischen Universitäten weiterzuarbeiten. Unter den Diplomaten der Türkei fanden sich mehr als siebzehn „Raoul Wallenbergs“, die in Europas dunkelster Zeit Mut zur Menschlichkeit bewiesen. So der Botschafter in Marseille, Behiç Erkin. Er verlieh 18 000 Juden die türkische Staatsbürgerschaft und rettete sie vor der Vernichtung.
Man kann also sagen: In Schlüsselsituationen der europäischen Geschichte wusste die Türkei als islamisches Land – regiert vom Kalifen – moralische Werte zu verteidigen, von denen Europa heute träumt. Ein Europa, in dem das Osmanische Reich über Jahrhunderte eine bedeutende Rolle gespielt hat: als Handelspartner, geistiges Zentrum und islamische Großmacht. Diese Wahrheit haben Christen lange nicht sehen wollen. Aber für uns Juden blieb diese Verbundenheit unvergesslich.
Judentum und Islam – die verschwisterten Religionen
In seiner auf Latein eingereichten und 1833 auf Deutsch veröffentlichten Dissertation „Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?“ ging Rabbiner Abraham Geiger der Frage nach, inwieweit sich Christentum und Islam vom Judentum, aus dem ja beide hervorgegangen seien, unterschieden. Aus seiner Sicht war dabei entscheidend, in welchem Ausmaß hellenistische Einflüsse zur Abweichung vom Monotheismus jüdischer Prägung führten. Für Geiger hatte Paulus das Christentum seinem jüdischen Ursprung und seiner Stiftergestalt Jesus entfremdet. Mohammed dagegen sei dem jüdischen Monotheismus treu geblieben und dem Rechtsdiskurs als religiöser Ausdrucksform. Während das Christentum die Synagoge und ihre Gebotsobservanz für von Gott verworfen hielt, habe der Islam den Respekt gegenüber der fortdauernden Gültigkeit des Judentums nie völlig verloren. Mit dieser Arbeit und seinen weiteren Forschungen über den Koran wurde Abraham Geiger auch zum Wegbereiter einer modernen Islamwissenschaft.
Christen müssen sich vergegenwärtigen, dass ihre Trinitätslehre dem Judentum ferner liegt als die Lehre des Islams und dass Juden und Muslime lange Phasen gemeinsamer Erfahrungen verbinden, etwa die der Kreuzzüge oder der Reconquista. Juden müssen sich daran erinnern, dass die vorherrschende jüdische Philosophie im Mittelalter im islamischen Raum und in arabischer Sprache entstanden ist und dass die Festschreibung unserer Glaubensgrundsätze durch den mittelalterlichen Rechtsgelehrten und Religionsphilosophen Maimonides im 12. Jahrhundert dem Beispiel Mohammeds folgt. „Gott ist einer und einzig, und Moses ist sein Prophet“ entspricht der Formel, die jeder Muslim als Glaubensbekenntnis kennt: „Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Gesandter.“ Gott, unverfügbar, Schöpfer, Richter, Offenbarer.
Besonders die kirchlichen Akademien haben sich seit den späten Neunzigerjahren als Orte der Begegnung von Christen, Muslimen und Juden verdient gemacht. Was damals Normalität war, steht heute jedoch unter christlich-lehramtlicher Kritik. Mit Vehemenz treten die Kirchen von Aussagen zurück, die für Christen und Juden eine gemeinsame Gottesvorstellung festgestellt hatten. So formulierte die katholische Seite im Zweiten Vatikanischen Konzil 1964 in Lumen gentium, Absatz 16: „Der Heilswille (Gottes) umfaßt aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einzigen Gott anbeten, den barmherzigen, der die Menschen am Jüngsten Tag richten wird.“ Im Schlussdokument von Cartigny zog 1969 der Weltrat der Kirchen nach: „Judentum, Christentum und Islam gehören nicht nur historisch zusammen, sie sprechen von demselben Gott, Schöpfer, Offenbarer und Richter.“
Als Muslime, Juden und Christen unterliegen wir alle dem gemeinsamen Erbe des spirituellen Dienstes unter ein und demselben Gott. Leider teilen wir auch die Sünde der Abweichung. Ironischerweise untergraben viele Personen in dem Bemühen, die Traditionen und Sitten unserer gemeinsamen Zivilisation zu bewahren, die Grundfesten, auf denen sie aufgebaut wurde. Seit den tragischen Ereignissen vom 11. September 2001 und den nachfolgenden Schrecken ist die Welt für Muslime ein sehr viel weniger einladender Platz geworden. Die bloße Verurteilung eines solchen verabscheuungswürdigen und unislamischen Verhaltens reicht nicht aus. Vielmehr liegt es an den Muslimen, wie Großmufti Mustafa Cerić in seiner bemerkenswert weitsichtigen und sachbezogenen Erklärung der europäischen Muslime[3] deutlich gemacht hat, und ich zitiere:
[…] der ganzen Welt den nicht gewalttätigen Charakter ihres Glaubens vor Augen zu führen und ihre Kinder zu lehren, dass der richtige Weg zum Erfolg in dieser Welt und zur Errettung im Jenseits nicht das Argument der Gewalt, sondern die Gewalt der friedlichen Argumentation ist.
An uns allen ist es, zu erkennen, wie die Liebe für Gott und den Nächsten eine starke Klammer um Juden, Christen und Muslime bilden kann. Mein Lehrer und Kollege am Leo Baeck College London, Rabbiner Jonathan Magonet, hat mich gelehrt: Wir müssen unsere Engstirnigkeit ablegen, die alle Menschen in einen Topf wirft, die deren Einzigartigkeit und Menschlichkeit in Abrede stellt und diese auf ein Typenschild oder eine Parole reduzieren will. Gefangen in unserer eigenen Engstirnigkeit schauen wir auf Gott und rufen ihn an. Und er antwortet uns mit einer viel weiteren Sicht der Dinge. Denn Gottes Liebe ist „l’olam“: für die ganze Welt!
Der Koran und die Juden
Mouhanad Khorchide
Der Koran und die Wissenschaft des Judentums
Es mag erstaunen: Die ersten historisch-kritischen Annäherungen an den Koran sind ausgerechnet jüdischen Koranforschern zu verdanken. „Die Wissenschaft des Judentums als Gründungsdisziplin kritischer Koranforschung“, so lautet ein Unterkapitel in Angelika Neuwirths beachtlichem Werk „Der Koran als Text der Spätantike“.[4] Darin liefert sie einen historischen Abriss der Leistungen jüdischer Koranforscher und deren Einfluss auf die westliche Koranforschung. Ab dem 19. Jahrhundert zeigte sich innerhalb der westlichen Koranforschung eine Wende im Umgang mit dem Koran, die maßgeblich mit der Durchsetzung eines neuen Geschichtsverständnisses und mit der Etablierung des historisch-kritischen Zugangs zu den Heiligen Schriften durch die Wissenschaft des Judentums eingeläutet wurde. Dabei handelt es sich um eine deutsch-jüdische Intellektuellenbewegung, die sich seit Leopold Zunz (gest. 1886) der Historisierung ihrer eigenen kanonischen Texte verschrieben hatte.[5] Was im 19. Jahrhundert in der christlichen Theologie revolutionär neu praktiziert worden war, nämlich die Bibel nicht als religiösen, sondern als historischen Text zu lesen, sollte auch auf ihren hebräischen Kanon angewandt werden, sodass es angebracht erschien, von zwei gleichzeitigen Re-Lektüren der Bibel zu sprechen, durch welche Schrifttexte aus ihrer jahrhundertealten Deutungstradition in Synagoge und Kirche – d. h. Judentum und Christentum als Schwesterreligionen – in die säkulare Disziplin der Geschichte überführt wurden.
Für eine Vielzahl von jüdischen Gelehrten der „Wissenschaft des Judentums“ ist die arabisch-islamische Vergangenheit, d. h. die Zeit der jüdisch-islamischen kulturellen Symbiose in al-Andalus, die für das damalige Europa – zumal seit den osmanischen Eroberungen – eher im Dunkeln liegt, das goldene Zeitalter. Ein ganz anderes kulturelles Selbstverständnis, eine „Selbstorientalisierung“,[6] war Auslöser einer neuen Forschungsrichtung, die dazu angetreten ist, den Koran und den Islam endlich mit den Maßstäben der bereits etablierten Wissenschaft zu erforschen. Gilt weithin Ignaz Goldziher (gest. 1921)[7] als Begründer der Islamwissenschaft, der mit seinen bis heute unerreichten Studien zur islamischen Traditionsliteratur neue Standards setzte,[8] so ist kaum bekannt, dass bereits ein halbes Jahrhundert zuvor Abraham Geiger (gest. 1874) mit der Beantwortung einer Preisfrage (Inquiratur in fontes Alcorani seu legis Mohammedicae eas qui ex Judaismo derivandi sunt)[9] die Koranforschung auf eine neue Basis stellte oder, besser gesagt: eine Koranforschung überhaupt erst aus der Taufe hob. Sein 1833, also ein Jahr nach Veröffentlichung der in Lateinisch angefertigten Preisschrift, auf Deutsch erschienenes Erstlingswerk „Was hat Mohammed aus dem Judenthume aufgenommen?“ erkennt im Koran vielfältige Echos der jüdischen Traditionsliteratur.[10] Für Geiger ist der Koran damit – strukturanalog zum Christentum – im Mutterschoß des Judentums geboren. Der Koran repräsentierte für ihn nicht das Fremde, sondern wurde als Teil einer gemeinsamen Geschichte wahrgenommen, in der der Koran Zeugnis ungetrübter jüdischer Vitalität ist.