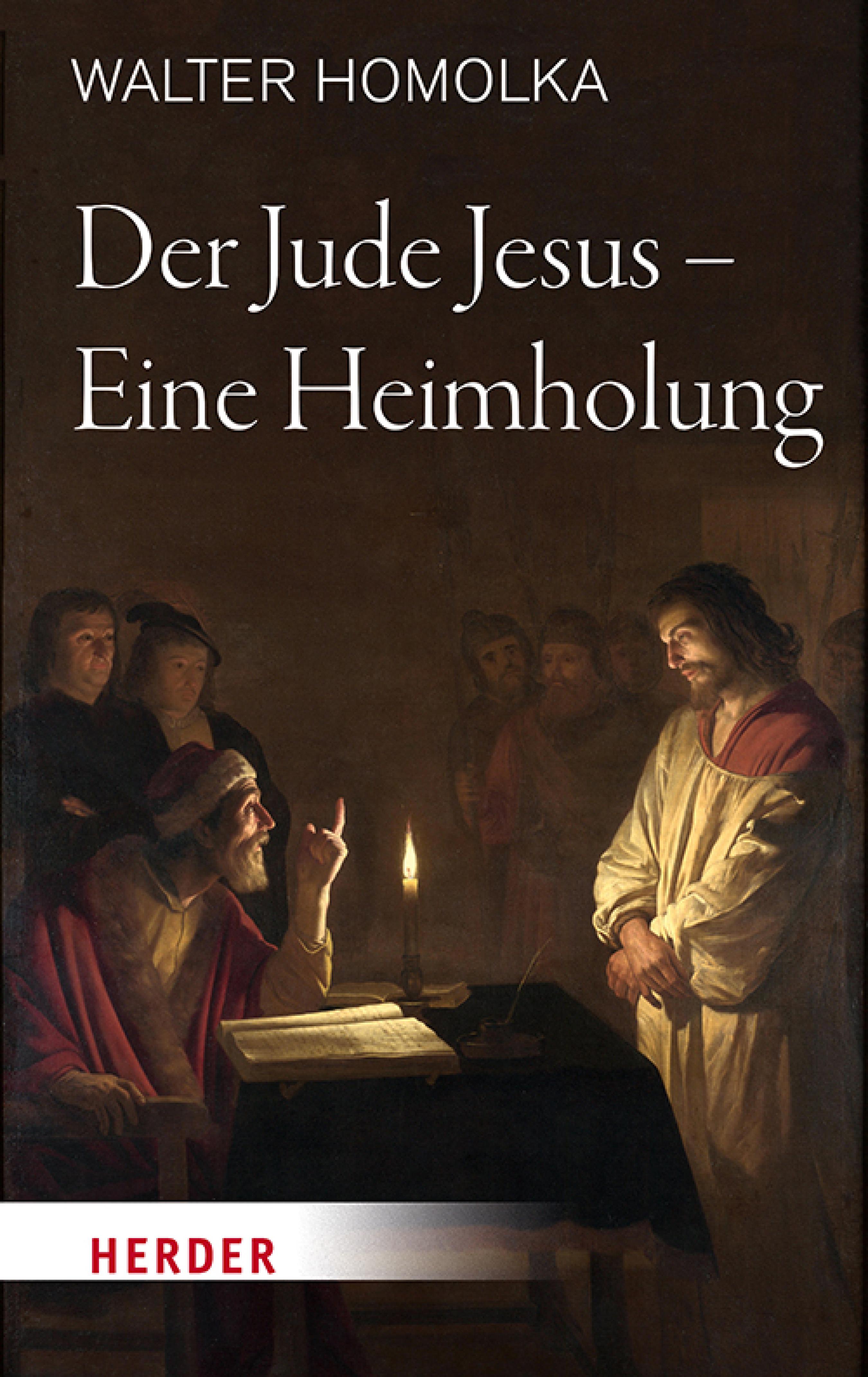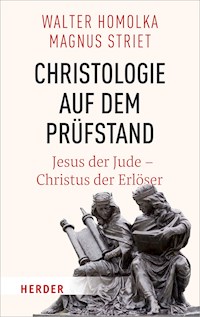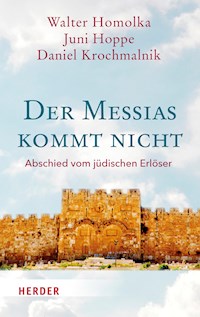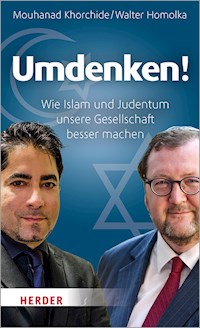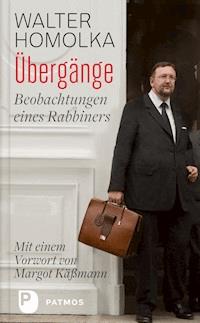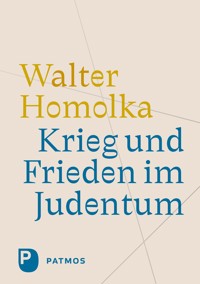
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach der Schoa und mit der Staatsgründung Israels ist die Frage von Krieg und Frieden für Jüdinnen und Juden zu einem realen Dilemma geworden. Das Massaker der palästinensischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 hat zu einer kollektiven (Re-)Traumatisierung der jüdischen Gesellschaft in Israel und der ganzen Welt geführt. Langzeitkonsequenzen sind nicht abzusehen, aber schon deutlich spürbar. Vor diesem Hintergrund zeichnet Rabbiner Walter Homolka das jüdische Ringen um Krieg und Frieden nach: von der Hebräischen Bibel über die rabbinische Literatur und jüdische Religionsphilosophie bis hin zur aktuellen Situation im Staat Israel. Er zeigt, dass die Frage nach dem gerechten Krieg der Herausforderung gewichen ist, einen gerechten Frieden zu erreichen. »Obwohl in der Tora über Kriege geschrieben wird, wird über sie um des Friedens willen geschrieben.« Midrasch Tanchuma
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Walter Homolka
Krieg und Frieden im Judentum
Patmos Verlag
Inhalt
Zur Einstimmung
Kriegsdienst: ein Ehrendienst?
Gibt es einen gerechten Krieg?Deuteronomium 20 und seine Wirkungsgeschichte im jüdischen Denken
Krieg und Frieden in der Tora
Exkurs: Der Tierfrieden
Krieg und Frieden bei den Propheten
Der biblische Ursprung der Messiasidee
Die jüdisch-hellenistische Symbiose
Über individuelle Friedfertigkeit und eine Zukunft ohne Krieg: Die ›sefarim chizonim‹
Krieg und Frieden bei Philo und Josephus
Krieg und Frieden in der rabbinischen Literatur
Exkurs: Der Frieden im Gebet
Gewalt und Gewaltlosigkeit in der mittelalterlichen Religionsphilosophie
Der messianische Frieden
Die Friedfertigkeit im Alltag
Der Frieden als abstrakter Begriff
Der kosmische Frieden der jüdischen Mystik
Der Chassidismus
Der Friedensbegriff der jüdischen Aufklärung und Emanzipation
Die ›Wissenschaft des Judentums‹
Hermann Cohen
Neo-Orthodoxie und LiberalesJudentum
Samson Raphael Hirsch
Leo Baeck
Der Staat Israel: Vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden?
»Frieden ist die einzige Option«
Bibliografie
Anmerkungen
ÜBER DEN AUTOR
ÜBER DAS BUCH
EDITORISCHE HINWEISE
IMPRESSUM
Für Esther Scheiner
Zur Einstimmung
»Vom Bösen lass ab und tue Gutes, such Frieden und jag ihm nach«, heißt es im Buch der Psalmen (34,15). Das Friedensideal des Judentums blieb in den beinahe zweitausend Jahren, in denen kein souveräner jüdischer Staat bestand, eine Sehnsucht. Ebenso blieben die rabbinischen Diskussionen über den gerechten Krieg in Zeiten, in denen es keine jüdischen Kriegsparteien gab, ohne praktische Relevanz. Wenn es etwa in talmudischer Zeit in den ›Sprüchen der Soferim‹ heißt: »Der Krieg ist in den Augen jener gerechtfertigt, die durch ihn ihre Ziele erreichen«, so war das gleichsam ein Blick von außen.
Mit der Staatsgründung Israels 1948 hat sich die Situation radikal verändert: Die israelische Armee ist seit dem Angriffskrieg der arabischen Nachbarstaaten 1948 Garant für die Sicherheit, ja für die Existenz des jüdischen Staates geworden, damit aber auch zur Konfliktpartei. Wie lässt sich dieser Konflikt, der bis heute andauert und auf beiden Seiten Menschenleben fordert, vor dem Hintergrund der jüdischen Überlieferung zu Krieg und Frieden einordnen?
Die historische Verortung des jüdischen Friedensdenkens sowie die gesellschaftliche und politische Situierung in diesem Band sollen zeigen, mit wie viel Idealismus, Engagement, Freude und auch Schmerz jüdische Denker bis in die Gegenwart um dieses Friedenspostulat gerungen haben und dies heute noch tun. Nicht immer waren ihre Mahnungen im Judentum mehrheitsfähig.
Die Darstellung von ›schalom‹ in der Tradition des Judentums bis in unsere Tage kann jedoch die zentrale Bedeutung des Friedens für das jüdische Denken belegen. Ein differenziertes Bild macht die aktuellen Kontroversen zwischen einem prophetisch geprägten Pazifismus und der Sehnsucht nach Geborgenheit vor allen Feinden verständlich. Aus dieser Geschichte ergeben sich Kriterien und Bezugspunkte für aktuelle und künftige Debatten.
Walter Homolka
Kriegsdienst: ein Ehrendienst?
Es gab vom Jahr 63 v. d. Z. bis hin zur Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel 1948 mit Ausnahme der Kämpfer im gescheiterten Bar-Kochba-Aufstand von 132 bis 135/36 keine jüdische Kriegspartei, und so gibt es auch keine systematische jüdische Lehre vom gerechten Krieg, anders als in der Kirche, in der sie – ausgehend von Überlegungen bei Cicero und in der griechischen Stoa – zuerst Aurelius Augustinus (354–430) formulierte. Thomas von Aquin (1225–1274) systematisierte sie in seiner ›Summa Theologica‹ zu einer klaren Drei-Kriterien-Lehre. Das Ziel der Kriegsführung muss dabei die Wiederherstellung des Friedens sein.1 Diese christlichen Lehren vom gerechten Krieg gingen in der Neuzeit schließlich in die politische Philosophie über, beispielsweise in ›Vom Recht des Krieges und des Friedens‹ von Hugo Grotius (1625).
Welche Regeln gelten für Juden als Soldaten im Krieg? In Europa stellte sich die Frage erst im Zuge des Emanzipationsprozesses, als die Diskussion aufkam, ob und unter welchen Umständen Juden zum Kriegsdienst zugelassen werden sollten. Als in Europa im 18. und 19. Jh. der Nationalgedanke erstarkte, galt die Bereitschaft zur Landesverteidigung als Staatsbürgerpflicht; Juden dagegen wurde zumeist abgesprochen, dass sie willens und fähig seien, im Kriegsfall ihr Leben für ihr jeweiliges Vaterland einzusetzen. In Preußen befand etwa Christian Wilhelm Dohm, ein Befürworter der rechtlichen Emanzipation der Juden, 1781: »Der erheblichste Grund, aus dem man die Unfähigkeit der Juden zu völlig gleichen Rechten mit den übrigen Bürgern des Staats folgern könnte, ist wohl dieser, dass man glaubt, die Juden würden durch ihre Religion abgehalten, Kriegsdienst zu tun.«2So forderte der Göttinger Theologe Johann David Michaelis 1783, Juden nicht die vollen staatsbürgerlichen Rechte zuzugestehen, da ihre Religion sie unter anderem unfähig mache, Soldaten zu werden. Der jüdische Berliner Philosoph Moses Mendelssohn (1729–1786) erklärte in seiner Replik, dass keine Religion, auch nicht das Christentum, die Aufgabe habe, Männer zu Soldaten zu machen, und dass die Juden in ihrem staatsbürgerlichen Verhalten keineswegs hinter den anderen zurückstünden und der Verteidigung des Vaterlandes ebenso verpflichtet seien wie alle anderen auch.3Die Frage, ob es halachische Bedenken gebe, dass Juden zur Armee gehen, wurde im 19. Jahrhundert jüdischerseits mitBezugauf den talmudischen Leitsatzdina de-malchuta dina, »Das Gesetz des Landes ist Gesetz«, ausgeräumt.4
In den Befreiungskriegen war der Wunsch nach Ableistung von Kriegsdienst Zeichen bürgerlicher Gleichstellung; Major Meno Burg (1789‒1853) blieb jedoch der erste und einzige jüdische Major im Preußen des 19. Jahrhunderts.5
Während Armeedienst für Juden zum Inbegriff von Patriotismus und Zugehörigkeit wurde, wurde ihre Loyalität jedoch immer wieder angezweifelt. Die französische Dreyfus-Affäre von 1894 ist ein dramatisches Beispiel dafür. In den deutschen Ländern waren Juden zwar als Freiwillige in den Befreiungskriegen 1813–1815 gegen Napoleon willkommen, wurden aber bis zum Ende des Kaiserreichs nicht in höhere Ränge befördert. Juden wurden nicht zur Offiziersprüfung zugelassen oder von den Offizieren ihres Regiments nicht kooptiert. In Preußen gelang zwischen 1885 und 1914 keinem einzigen jüdischen Anwärter der Aufstieg zum Reserveoffizier: eine Demütigung. Der deutsche Reichsaußenminister Walther Rathenau (1867–1922) hat aus seiner vergeblichen Kandidatur als Reserveoffizier noch in der Weimarer Republik den Schluss gezogen, man bleibe als Jude eben Staatsbürger zweiter Klasse. In Kriegszeiten haben Juden ihre Pflicht oft übererfüllt, die Anerkennung blieb ihnen aber versagt.6 Anders war die Situation in Österreich, wo das Toleranzpatent Josephs II. von 1782 die Akkulturation der jüdischen Gemeinschaft beschleunigte. Die in der Habsburger-Monarchie 1788 auch für Juden eingeführte Militärpflicht wurde von den jüdischen Gemeinden zumeist positiv aufgenommen; sie verstanden sie als wesentlichen Schritt auf dem Weg zur bürgerlichen Gleichberechtigung. Von 1882 an wurden übrigens auch muslimische Bosniaken zum Militärdienst herangezogen. Im Ersten Weltkrieg begriff sich das Heer der österreich-ungarischen Doppelmonarchie als offene Institution im Zeichen ethnischer, nationaler und religiöser Diversität, und auch wenn Juden gemeinhin nicht in die höchsten militärischen Ränge aufstiegen, so waren sie doch unter den Reserveoffizieren und im Offizierskorps der Armee stark vertreten.7
Nach dem Ersten Weltkrieg war es auch im polnischen Militär, einer wesentlichen Instanz für die Nationalisierung, umstritten, ob und in welchem Maße Staatsbürger, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehörten, Zugang zu den Streitkräften erhalten sollten. Auch wenn Juden nun Zugang zu den höchsten militärischen Rängen hatten, blieb ein Spannungsverhältnis von Inkorporation und Ablehnung als Ausdruck der polnischen Minderheitenpolitik der Zwischenkriegszeit bestehen.8
Das deutsche und das polnische Beispiel machen deutlich, dass eine originär jüdische Diskussion eines gerechtfertigten, ja gerechten Krieges nicht zeitgemäß war, solange Militärdienst ein staatsbürgerliches Bekenntnis zum jeweiligen Vaterland war und keineigenständigesjüdisches Staatswesen bestand, wie es einst Basis für die Regeln in Deuteronomium 20 gewesen war.
Schauen wir uns also diese zentrale Textstelle in der Hebräischen Bibel an.
Gibt es einen gerechten Krieg?Deuteronomium 20 und seine Wirkungsgeschichte im jüdischen Denken
Das Streben nach Frieden ist eng verbunden mit der Frage nach einem gerechten Krieg. Als der amerikanische Moral- und Sozialphilosoph Michael Walzer (geb. 1935) 1977 sein inzwischen zum Klassiker gewordenes Buch ›Just and Unjust Wars‹ veröffentlichte, rückte er unter dem Eindruck des Vietnam-Kriegs einer breiten Leserschaft ins Bewusstsein, dass sich bereits in der Hebräischen Bibel im Buch Deuteronomium Regeln für eine adäquate Kriegsführung finden. Walzer geht es bei der Lehre vom gerechten Krieg um die Einschränkung möglicher Kriegsgründe, -zwecke und -mittel, also eher um eine Einhegung anstatt einer kategorischen Vermeidung des Krieges. Die Theologin Ruth Ebach bemerkt zu diesen Regeln in Deuteronomium 20: »Wie alle Texte des deuteronomischen Gesetzes sind auch die Regelungen zum Krieg keine bi- oder multilateralen Verträge mit anderen Staaten oder Völkern, sondern haben die Israeliten selbst als Adressaten. Sie sind also keine Kompromisse internationaler Aushandlungsprozesse, in denen sich verschiedene Interessen widerspiegelten, sondern bilden ein Ideal ab, das sich Israel für eine gerechte Kriegsführung imaginiert.«9 Die Epochen, in denen die Israeliten eine souveräne Nation darstellten, waren der Zeitraum zwischen ca. 1250 und 586 v. u. Z., also die Eroberung Kanaans und die Zeit des Ersten Tempels, sowie die Jahre zwischen 165 und 63 v. u. Z., die Makkabäerzeit und die Zeit der Hasmonäer.
Die Anweisungen zum Krieg gegen Städte in Deuteronomium 20 lauten folgendermaßen:
»So du einer Stadt nahest, sie zu bekriegen, sollst du ihr Frieden entbieten. Und es soll sein, wenn sie dir Frieden erwidert und dir öffnet, soll das ganze Volk, das darinnen sich findet, dir fronpflichtig sein und dir dienen. Wenn sie aber nicht Frieden mit dir macht und krieget mit dir und du sie belagerst, und der Ewige, dein Gott, gibt sie in deine Hand: So sollst du erschlagen alles, was in ihr männlich ist, mit des Schwertes Schärfe. Nur die Frauen und die Kinder und das Vieh und alles, was in der Stadt sein wird, all ihre Beute plündere für dich und verzehre die Beute deiner Feinde, die der Ewige, dein Gott, dir dann gegeben. So tue allen Städten, die sehr fern von dir sind, die nicht von den Städten dieser Völker sind. Aber von den Städten dieser Völker, welche der Ewige, dein Gott, dir zum Besitze gibt, sollst du keine Seele leben lassen, sondern bannen sollst du den Chitti und den Emori, den Kena‛ani und den Perisi, den Chivvi und den Jewusi, so, wie der Ewige, dein Gott, dir gebot, damit sie euch nicht lehren, wie all ihre Gräuel zu tun, die sie ihren Göttern tun, und ihr euch verschuldet wider den Ewigen, euren Gott« (Deuteronomium 20,10–18).
Zur Schonung des Baumbestandes im Kriegsfall heißt es daran anschließend, dass im Zuge der Belagerung keine Frucht tragenden Bäume gefällt werden dürfen:
»So du eine Stadt umlagerst lange Zeit, sie zu bekriegen, sie einzunehmen, sollst du nicht ihre Bäume verderben, die Axt daran zu legen, da du davon issest, haue ihn nicht um, denn des Menschen ist der Baum des Feldes, als dass er kommen sollte von dir zum Belagerungswerk. Nur den Baum, von dem du weißt, dass er kein Fruchtbaum ist: ihn kannst du vernichten und umhauen und Belagerungswerke wider die Stadt bauen, die mit dir Krieg führt, bis sie gefallen« (Deuteronomium 20, 19f).
Mit Blick auf die Mobilmachung ist bemerkenswert, wer in biblischer Zeit alles vom Kriegsdienst befreit werden sollte:
»Und die Vorsteher sollen zum Volke reden und sprechen: Wer ist da, der ein neues Haus gebaut und es nicht eingeweiht? Er gehe und kehre zurück zu seinem Hause, dass er nicht sterbe im Kriege und ein andrer Mann es einweihe. Und wer, der einen Weinberg gepflanzt und ihn nicht gelöset? Er gehe und kehre zurück zu seinem Hause, dass er nicht sterbe im Krieg und ein andrer Mann [den Weinberg] löse. Und wer, der sich mit einer Frau verlobet und sie nicht heimgeführt? Er gehe und kehre zurück zu seinem Hause, dass er nicht sterbe im Kriege und ein andrer Mann [die Frau] heimführe. Dann sollen fortfahren die Vorsteher, zum Volke zu reden und zu sprechen: Wer ist da, der furchtsam ist und vergehet vor Angst? Er gehe und kehre zurück zu seinem Hause, dass nicht feige werde das Herz seiner Brüder wie sein Herz« (Deuteronomium 20,5–9).
Die Gesetze in Deuteronomium 20 regeln die Freistellung vom Militärdienst, Tributleistungen und die Kriegsbeute und deren Verteilung sowie die Behandlung der Kriegsgefangenen und verbieten eine Entwaldung vor den Toren belagerter Städte. Die genannten Maßnahmen, etwa die Hinrichtung aller Männer auf gegnerischer Seite durch das Schwert und die Versklavung von Frauen und Kindern, sind im Kontext altorientalischer Kulturen zu lesen. Es geht um ein Ideal kultisch legitimierter Kriegsführung, das mit heutigen Vorstellungen von Humanität wenig gemein hat.
Deuteronomium 20 gilt zwar als locus classicus für die altisraelitische Perspektive auf eine legitime Kriegsführung, kann aber keinesfalls als die zusammenfassende Darstellung eines jüdischen Kriegsgesetzes verstanden werden. Doch obwohl dieser Basistext rudimentär bleibt und nur während der nationalen Unabhängigkeit der Israeliten gültig war, ist er zum Ausgangspunkt für ausgiebige Diskussionen über ethische Fragen geworden. Ein frühes Beispiel dafür findet sich beim Philosophen Philo, dem wichtigsten Repräsentanten des alexandrinischen Judentums, der überzeugt ist, dass »das Gesetz niemals beabsichtigt haben könnte, Eroberungskriege zu billigen« (De specialibus legibus 4,219–223); die Gesetze zur Befreiung vom Kriegsdienst legt Philo allegorisch so aus, dass es ihnen nicht nur um den Erwerb, sondern auch um den Genuss der vollen Seligkeit der Tugend gehe (De agricultura 146–168).10
In der Mischna (Sota 8) wird der Begriff Krieg einer Differenzierung unterzogen: Pflichtkrieg, erlaubter Krieg und Selbstverteidigung. Außerdem werden die Bedingungen für die Befreiung vom Kriegsdienst thematisiert, wobei die Mischna zu dem Schluss kommt, dass in einem gebotenen Kriege ein jeder geht, sogar ein Bräutigam aus seinem Zimmer und eine Braut von ihrem Hochzeitsbaldachin (Sota 8,7). Für Dienstbefreite mit Ausnahme eines Bräutigams wird zudem eine Art Zivildienst als Alternative formuliert (Sota 8,2). Die Erörterungen umfassen somit gar nicht alle Fragen, die der biblische Text aufwirft.
Im Talmud (Sota 44b) wird – lange nach dem Ende der nationalen Eigenständigkeit Israels – mit Bezug auf Deuteronomium 20 die Mischna mit den drei Arten von Krieg aufgegriffen, nämlich dem von Gott gebotenen Pflichtkrieg (milchemet chowa oder milchemet mizwa), dem erlaubten Krieg oder Ermessenskrieg (milchemet reschut) und einer Mischform, dem Präventivkrieg, der der Selbstverteidigung gilt. Es wird also nicht zwischen gerechtem und ungerechtem Krieg unterschieden, sondern zwischen gebotenem und erlaubtem; die Kategorie »verbotener Krieg« fehlt. Die Wiedergabe und Auslegung der Bibelverse zum Kriegsrecht erfolgt dabei eher unsystematisch.
Die gebotenen Kriege beziehen sich gemäß Deuteronomium 20,17 auf Kriege gegen die Völker, die ursprünglich Kanaan bewohnten (Hetiter, Amoriter, Kaananiter, Perisiter, Hiwiter, Jebusiter), und gegen das Volk Amalek, das die Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten angegriffen hatte (Exodus 17,8–16). Gebotene Kriege müssen von Gott selbst, vom König oder vom Sanhedrin erklärt werden; als Beispiel für gebotene Kriege werden die von Joschua genannt.11Erlaubte Kriege sind Expansionskriege, die von jüdischen Königen unternommen wurden, um ihre Grenzen zu sichern oder ihren Ruhm zu vergrößern; als Beispiel für erlaubte Kriege aus Ermessensgründen wird auf die Kriege König Davids verwiesen. Die Kriege Joschuas sind historisch nicht belegt, werden in der Hebräischen Bibel aber als Vernichtungskriege dargestellt, die gewissermaßen auch präventiv waren: »… damit sie euch nicht lehren, wie all ihre Gräuel zu tun, die sie ihren Göttern tun« (Deuteronomium 20,18).
Die Entscheidung, in einen Ermessenskrieg einzutreten, erfordert die Zustimmung mehrerer Instanzen, neben der Exekutive und der Legislative auch die des Hohen Rates von 71 Priestern, des Sanhedrins, als Judikative (Sanhedrin 1,5; Hilchot Melachim 5,2). Der Sanhedrin kann keinen Krieg initiieren; die Initiative muss vom König ausgehen, der dann die Zustimmung des Gerichts einholen muss (Tosefot Jom Tow zu Sanhedrin 1,5).
Der Angriff auf einen Feind in Erwartung dessen Angriffs (Präventivkrieg) ist umstrittener. Der Talmud befindet für diesen Fall mit den Worten von Raba: »Sie streiten nur über die [Kriege] gegen die Nichtjuden, damit sie sie nicht überfallen; einer nennt sie gebotene und einer nennt sie freiwillige« (Sota 44b).
Die realen historischen Voraussetzungen für beide Varianten sind seit dem Ende des israelitischen Königtums und des Sanhedrins nicht mehr gegeben; der gebotene und der erlaubte Krieg waren also zur Zeit der rabbinischen Diskurse schon längst keine praktisch und politisch relevanten Kategorien mehr. Die rabbinischen Erörterungen bezogen sich stets auf den spärlichen biblischen Basistext, nicht aber auf aktuelle Gegebenheiten. Rabbiner Daniel F. Polish (geb. 1942) fragt, ob diese rabbinischen Erörterungen überhaupt nützlich sind, um heute eine jüdische Perspektive zum gerechten Krieg zu formulieren, und befindet, dass sie eine wichtige Gemeinsamkeit mit allgemeineren Theorien des gerechten Krieges haben: Sie versuchen, Unterscheidungen zu treffen zwischen verschiedenen Arten von Krieg.12
Zeitlos ist das Recht auf Verteidigung aus Notwehr: »Kommt jemand dich zu töten, komm ihm zuvor« (Sanhedrin 72a). Für viele heutige Gelehrte, etwa für Rabbiner Judah David Bleich (geb. 1936), ist dieser Satz als Begründung für eine gemeinschaftliche Selbstverteidigung jedoch problematisch, auch deswegen, weil individuelle Selbstverteidigung nicht gerechtfertigt ist, wenn sie unschuldige Unbeteiligte in Gefahr bringt, was im Krieg unweigerlich geschieht.13
In Deuteronomium 20,4 heißt es: »Denn der Ewige, euer Gott, ist’s, der mit euch zieht, für euch zu streiten mit euren Feinden, euch zu helfen!« Gott zieht also zusammen mit den Kindern Israels in den Krieg; für den Tora-Kommentator Rabbiner W. Gunther Plaut (1912–2012) ist dies auch ein Hinweis darauf, dass die Bundeslade mit in den Kampf genommen wurde.14 Dieser Gotteskrieg unterscheidet sich jedoch vom islamischen Djihad und vom Heiligen Krieg der Christen darin, dass er gewisse Ideale einfordert, um ein ›heiliger Krieg‹ (milchemet kodesch) zu sein. Freilich: In der gesamten Hebräischen Bibel kommt der Begriff »heiliger Krieg« nicht vor. Der deutsche Religionsphilosoph Rabbiner Daniel Krochmalnik (geb. 1956) verweist darauf, dass sich in der christlichen Rezeptionsgeschichte, etwa bei Gerhard von Rad, die Rede von »kriegerischem Geist und programmatischer Unversöhnlichkeit« mit »stark humaner Tendenz« verbindet.15
Der Gelehrte und Bibelexeget Raschi (Rabbi Schlomo Jitzchaki, 1040–1105) resümierte in seinem Kommentar zu Deuteronomium 20,1 zu der Frage, warum die Vorschriften über den Krieg auf die Regeln über die Gerechtigkeit im vorherigen Kapitel folgen: »Um dir zu sagen, wenn du gerechtes Urteil vollzogen hast, kannst du sicher sein, dass, wenn du in den Krieg ziehst, du siegst; und so sagt auch David (Psalm 119, 121): Habe ich Recht und Gerechtigkeit geübt, wirst du mich nicht meinen Bedrückern überlassen.«16
Moses Maimonides (1135‒1204) hat die rabbinische Kasuistik vom Krieg in ›Mischne Tora: Hilchot Melachim U‘Milchamitehem‹ (»Wiederholung der Tora. Gesetze der Könige und ihrer Kriege«, kurz Hilchot Melachim) kodifiziert.17 Krochmalnik konstatiert: »Maimonides kodifiziert ferner das rabbinische Ius in bello, welches das Ius ad bellum gelegentlich soweit einschränkt, dass es wenigstens in einigen Punkten gar keinen praktischen Unterschied mehr zwischen gebotenem, erlaubtem und verbotenem Krieg gibt: So darf beispielsweise der Belagerungsring um eine Stadt nicht dicht gemacht werden, ein Fluchtweg muss offenbleiben (Hilchot Melachim 6,7). Diese Halacha beurteilt die Lage vom Standpunkt der nichtisraelitischen Belagerten und nicht vom Standpunkt der israelitischen Belagerer … Die Rabbinen sind zwar keine Pazifisten, aber sie grenzen die Gewalt ein.«18
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: