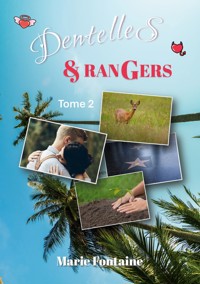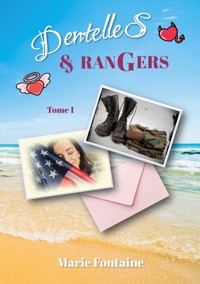4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein Ort voll Wärme, Duft und Farben: Der zauberhafte Liebesroman »Der kleine Blumenladen des großen Glücks« von Marie Fontaine als eBook bei dotbooks. Es ist sein täglicher Lichtblick: Jeden Abend kommt der Hotelmanager Nicholas Matin nach der Arbeit an einem kleinen Blumenladen mit wunderschönen Arrangements im Schaufenster vorbei. Eines Tages traut er sich hinein – und trifft auf eine Floristin mit dem siebten Sinn für die Wünsche ihrer Kunden, die ihn auf den ersten Blick verzaubert. Aber die junge Fleur Danton ist noch viel mehr: eine einfühlsame Zuhörerin und eine strahlende Persönlichkeit, die ein jedes Herz erwärmt. Schon bald kann er sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen – doch solange Nicholas und Fleur einander nicht ihre Geheimnisse gestehen, ist der Traum von einer gemeinsamen Zukunft nur ein Luftschloss ... Können sie lernen, einander zu vertrauen und gemeinsam das große Glück finden? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der berührende Liebesroman »Der kleine Blumenladen des großen Glücks« von Marie Fontaine wird Fans von Julie Caplin und Sarah Morgan begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es ist sein täglicher Lichtblick: Jeden Abend kommt der Hotelmanager Nicholas Matin nach der Arbeit an einem kleinen Blumenladen mit wunderschönen Arrangements im Schaufenster vorbei. Eines Tages traut er sich hinein – und trifft auf eine Floristin mit dem siebten Sinn für die Wünsche ihrer Kunden, die ihn auf den ersten Blick verzaubert. Aber die junge Fleur Danton ist noch viel mehr: eine einfühlsame Zuhörerin und eine strahlende Persönlichkeit, die ein jedes Herz erwärmt. Schon bald kann er sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen – doch solange Nicholas und Fleur einander nicht ihre Geheimnisse gestehen, ist der Traum von einer gemeinsamen Zukunft nur ein Luftschloss ... Können sie lernen, einander zu vertrauen und gemeinsam das große Glück finden?
Über die Autorin:
Marie Fontaine wurde in Paris geboren und hat lange in einer kleinen Buchhandlung gearbeitet, bevor sie sich als PR-Beraterin selbstständig machte. Sie verbringt ihre Freizeit am liebsten in den kleinen Läden und Cafés ihres Viertels und denkt sich dabei immer neue Geschichten aus, in denen die Menschen vorkommen, die ihr dabei begegnen. Die Idee zu »Der kleine Blumenladen des großen Glücks« kam ihr, als sie die Rosensträucher in ihrem winzigen Garten gegen den Frost einpackte. Sie lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Stadthaus und blickt von ihrem Schreibtisch auf eine große, alte Linde, die sie im Frühling mit ihren hellgrünen Trieben bezaubert und ihr in der Herbstsonne goldenes Licht am Arbeitsplatz schenkt.
***
eBook-Neuausgabe November 2023
Dieses Buch erschien bereits 2018 unter dem Titel »Ein Winter voller Blumen« bei Rowohlt.
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Marie Fontaine und Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-871-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Der kleine Blumenladen des großen Glücks«an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Marie Fontaine
Der kleine Blumenladen des großen Glücks
Ein Paris-Roman
dotbooks.
Ein Garten im Winter ist schlafende Schönheit
Nachdenken über Pflanzen heißt Nachdenken über das Leben
Es war an einem nasskalten Novembertag, die Straßenlaternen brannten schon, da öffnete sich mit leisem Klingeln die Tür zu Mademoiselle Fleurs Blumenladen, und ein Mann im Mantel trat ein, den die junge Frau noch nie gesehen hatte. »Bonjour, Monsieur!«, grüßte sie freundlich. »Kann ich Ihnen helfen?«
Ein unverbindliches Lächeln, ein Zögern. Er räusperte sich. »Danke. Ich sehe mich nur ein wenig um.«
Mademoiselle Fleur kannte das. Wenn das Wetter schlecht war, flüchtete sich oft jemand in den Laden. Wenn sie Glück hatte, würde dieser Herr aus purer Verlegenheit ein winziges Sträußchen oder einen Zwergkaktus kaufen. Irgendetwas, das wenig kostete und … »Haben Sie Bougainvilleen?«, fragte der Kunde, der plötzlich wieder hinter den Zimmerpflanzen hervortrat.
Die Blumenhändlerin schüttelte den Kopf. »Leider«, sagte sie. »Da müssten Sie vielleicht im Gartencenter fragen. Aber ob die um diese Jahreszeit …«
»Ich dachte nur.« Der Mann nahm seine Brille ab und putzte sie umständlich mit seinem Schal, was wenig nützte. Dann setzte er sie wieder auf und nahm den Hut ab. Er war viel jünger, als sie zunächst gedacht hatte. Mitte dreißig, Anfang vierzig vielleicht. Sein Haar war voll und dunkel, die Augen hell und lebhaft. Und er war gut gekleidet. Vielleicht arbeitete er bei einer Bank oder Galerie. »Wissen Sie, ich liebe Bougainvilleen. Es gab sie bei uns im Garten. Ich meine, als ich ein Kind war … Pardon …«Er schüttelte den Kopf, als käme er sich selbst ganz lächerlich vor, und ließ den Blick über die kleinen Topfpflanzen streifen, die neben der Kasse standen. »Und was wäre das hier?« Er zeigte auf eine zartviolette Blume, die Mademoiselle Fleur in ein geflochtenes Körbchen platziert hatte.
»Diese hier heißt Silberrand«, erklärte die Floristin. »Und das ist eine Campanula.«
»Schön«, sagte der Mann nur und schien mehr auf ihre Hände zu blicken als auf die zierlichen Stöckchen. »Davon nehme ich eine mit.«
»Vom Silberrand oder von der Campanula?«
Abermals räusperte er sich. »Von beiden bitte.«
Mademoiselle Fleur nickte. »Gerne, Monsieur. Haben Sie es weit nach Hause?«
»Bitte?«
»Dann sollten wir sie gut einpacken.« Sie warf einen vielsagenden Blick nach draußen, wo der Wind die letzten Blätter von den Bäumen riss und durch die Straße fegte. »Sie haben recht«, erwiderte der Mann, ohne ihrem Blick zu folgen. Vielmehr sah er sie gedankenverloren an und fühlte sich offenbar ertappt, als sie sein Lächeln bemerkte. »Aber ich habe es nicht weit. Gott sei Dank«, erklärte er und klopfte mit den Fingerspitzen leicht auf die Ladentheke.
»Bon. Dann können wir uns das Zeitungspapier sparen, und ich wickle sie ganz normal ein. Möchten Sie sich nicht so lange setzen?« Sie deutete auf ein kleines, etwas schiefes Tischchen, das neben dem Eingang stand und von zwei noch schieferen Stühlen umrahmt war, von denen der weiße Lack abblätterte. Der Herr nickte und ging hinüber, ohne sich jedoch zu setzen. Vielmehr blieb er an einer prächtigen, weiß blühenden Pflanze stehen und beugte sich vor, um daran zu riechen.
»Ein Arabischer Jasmin, Monsieur«, rief Mademoiselle Fleur.
»Wundervoll.«
»Ja, das finde ich auch. Soll ich Ihnen eine Schleife daranbinden?«
Er schüttelte den Kopf. »Nicht nötig, Mademoiselle …«Er trat wieder zur Ladentheke und betrachtete die beiden Päckchen, die in roséfarbenes Papier eingeschlagen waren, auf dem in eleganten Lettern die Worte Fleurs de Fleur geschrieben standen.
»Fleur, Monsieur. Fleur Danton.«
»Wie der Revolutionär!«
»Wie der Revolutionär, ja. Aber nicht mit ihm verwandt. Eine Papiertüte vielleicht?«
»Das wäre sehr freundlich.«
Die Blumenhändlerin stellte die beiden eingepackten Stöcke in eine Tüte und reichte sie ihrem Kunden.
»Merci.«
»Merci, Monsieur.«
Er setzte seinen Hut wieder auf und wandte sich zur Tür, da hörte er hinter sich: »Das macht sechzehn fünfzig.« Mit hochrotem Kopf drehte er sich um und stammelte: »Pardon, Mademoiselle. Das hatte ich … Es tut mir schrecklich leid … Ich …« Verlegen und umständlich tastete er seine Taschen nach der Geldbörse ab, nahm die Tüte von der rechten in die linke Hand und wieder in die rechte. »Natürlich. Hier.« Er zog das Portemonnaie heraus und legte zwei Zehner auf die Theke. »Es stimmt so, Mademoiselle. Bitte entschuldigen Sie vielmals. Das ist mir noch nie passiert. Es war keine böse Absicht.«
Er sah so verzweifelt aus, dass Fleur laut lachen musste. »Ich bitte Sie!«, rief sie. »Das kann doch passieren. Seien Sie unbesorgt. Ich halte Sie wirklich nicht für einen Dieb oder Betrüger.«
»Natürlich nicht«, murmelte der Herr und wusste offenbar nicht, wohin er schauen sollte. »Trotzdem. Wie gesagt, es tut mir sehr leid.«
Einen Moment später fiel die Tür hinter ihm zu, und der Wind zerrte an seinem Mantel. Und während er den Mantelkragen hochschlug und die Rue du Cherche-Midi hinabging, folgte ihm der Blick der jungen Floristin, die an die Tür getreten war und von ihrem kleinen Paradies aus die kalte dunkle Stadt und ihre hoffnungsvollen Lichter betrachtete.
***
Paris, die Schöne, ist die Stadt der Freude und der Lebenslust. Kein anderer Ort der Welt inspiriert die Menschen so zur Liebe, kein anderer weckt mehr Sehnsüchte als Paris. Doch kalte und düstere Novembertage gibt es auch hier, und es fällt schwer, sich das Leuchten der Stadt vorzustellen, wenn man sich gegen den schneidenden Herbstwind stemmt und die Feuchtigkeit durch die Kleidung dringt. Gleichwohl ging Nicholas Matin beschwingt den Weg hinab nach St. Germain-des-Prés und ans Ufer der Seine, wo sich seit vielen Jahrzehnten die prachtvolle Fassade des Hotels Louis XV erhob, in dem er seit kurzem arbeitete.
Seit dem Spätsommer genauer gesagt. Die Saison hatte gerade wieder begonnen, wobei ein Haus wie das Louis XV immer Saison hat. Die Pariser waren aus ihren Ferien zurückgekehrt, eine milde Brise hatte die Hitze weggeweht, die den August über wie eine Glocke über der Stadt gelegen hatte. Es war die Zeit der Ernte ‒ für Nicholas Matin eine Zeit des Anfangs.
Er hatte sich eine Wohnung im Montparnasse genommen, klein und trotzdem beinahe unbezahlbar. Aber nach den Jahren, die er in La Defense zugebracht hatte, dem futuristischen Geschäftsviertel im Westen der Stadt, war diese Veränderung für ihn wie eine Wiedergeburt. Täglich bewunderte er die klassizistischen Bauwerke, die opulenten Dekorationen, die prächtigen Schaufenster und ließ gern zu, dass das alles ein Teil seines Lebens wurde.
Auch ein Lokal hatte er entdeckt, das ihm schnell ans Herz wuchs, das Café du Midi. Die Inhaberin, Madame Goncourt, stammte aus dem Süden des Landes und sprach mitunter in einem Akzent, über den Nicholas manchmal lachen musste. Er selbst stammte schließlich vom Land und hatte in seiner Kindheit alles andere als klassisches Französisch gesprochen.
In der warmen Spätsommersonne hatte das Café du Midi Tische und Stühle vor dem Lokal aufgestellt, und Nicholas hatte es genossen, dort zu sitzen, einen Kaffee zu trinken oder nach Feierabend ein Glas Burgunder, die Menschen zu beobachten, die die Straße entlangkamen und in alle Richtungen eilten, als fände das Leben dort und nur dort statt, wo sie gerade hinwollten. Madame Goncourts Café lag in einer kleinen Nebenstraße der Rue de Rennes, und während dort der Verkehr tobte und die Menschen sich auf den schmalen Gehsteigen gegenseitig anrempelten, herrschte hier trotz aller Lebhaftigkeit eine friedliche Stimmung. Es war nicht die überwältigende Atmosphäre des Boulevard Haussmann, nicht der Luxus der Place Vendôme und auch nicht die touristische Enge der Île de la Cité, sondern das Paris der Pariserinnen und Pariser: selbstbewusst, gelassen und voller Lebensfreude.
So war der Herbst dahingegangen mit vielen stürmischen, aber auch einigen schönen Tagen. Nicholas war oft an dem kleinen Blumenladen an der Ecke zur Rue du Regard vorbeigekommen. Aber da er niemanden hatte, dem er Blumen hätte schenken wollen, hatte es keinen Anlass gegeben, jemals einen Fuß hineinzusetzen. Der September verging und auch der Oktober, und plötzlich war die Leichtigkeit dahin. Es wurde kalt und nass. Die Tische und Stühle wanderten wieder hinein in das Lokal, und Nicholas ließ den kleinen Umweg zum Café du Midi nun oft ausfallen.
Die Straßen waren voll mit Autos, doch die Gehwege waren beinahe verwaist. Trotz der spätnachmittäglichen Stunde blieb zu Hause oder im Büro, wer nicht dringend vor die Tür musste. Der nasse Schnee hatte sich zu einem echten Verkehrshindernis entwickelt, und Nicholas Matin spürte, wie die Nässe in seine Schuhe drang. Wenn er nicht rasch ins Warme kam, würde er eine Erkältung davontragen.
Normalerweise hätte er um diese Uhrzeit Feierabend gemacht. Doch an diesem Tag war noch eine Teamsitzung für achtzehn Uhr anberaumt worden. Es ging, wie so oft, um Prozessoptimierung und Effizienzsteigerung. Auch wenn er diese Managementtermine hasste, wusste er, dass seine Abteilung davon profitieren würde. Nicholas Matin war Leiter der Abteilung CR2, Customer’s Relations, zuständig für »Reklamationen und Problemfälle«. Wer immer Grund hatte, sich über das Louis XV zu beklagen, landete bei ihm. Wer den Service nicht angemessen, die Mitarbeiter unfreundlich, das Zimmer nicht sauber genug, die Qualität der Waren nicht perfekt, wer seine Matratze zu weich oder das Kissen zu hart fand, den Preis zu hoch oder die Toiletten zu tief, der wurde an Monsieur Matins Abteilung verwiesen ‒ und es war seine Aufgabe, den Kunden davon zu überzeugen, dass er völlig recht hatte und dass man sich seine Beschwerde mit größter Dankbarkeit zu Herzen nehmen werde. Denn es gehörte zu den ungeschriebenen Gesetzen dieses exquisiten Hotels, dass der Kunde immer recht hatte, egal wie unsinnig seine Reklamation im Einzelfall auch sein mochte. Unabhängig davon war es natürlich Monsieur Matins dringendste Aufgabe, möglichst jedes Entgegenkommen an die Kunden so kostenneutral wie irgend möglich zu gestalten, vor allem, seit Monsieur Trebouchet das Hotel leitete. Mit ein wenig Geschick, so hatte man es ihm an seinem ersten Arbeitstag klargemacht, sollte er den Gast sogar zu zusätzlichen Ausgaben bewegen. So und nicht anders machte man ein Hotel und seine Gäste gleichermaßen glücklich. Nicht nötig zu erwähnen, dass dies in der Praxis bedeutete, den Kuchen zu essen und ihn zugleich zu behalten, ein Ding der Unmöglichkeit also. Was Monsieur Trebouchet, der an der London School of Economics studiert hatte und nie müde wurde, darauf hinzuweisen, dennoch mit allem Nachdruck einforderte.
Aber Nicholas mochte diese Arbeit. Je nach Fall war es ihm eine Genugtuung, der einen oder der anderen Seite etwas weiter entgegenzukommen. Es verstand sich von selbst, dass eine echte Reklamation (wovon es naturgemäß in einem Hotel dieses Standards nicht viele gab) immer und ausschließlich im Sinne des Kunden abgewickelt werden musste. Wer auf seinem Zimmer ein unsauberes Glas vorfand, erhielt nicht nur ein funkelndes neues, sondern auch als kleine Entschädigung eine gute Flasche Wein dazu. Wessen Reservierung für das Restaurant versäumt worden war, der wurde vom Hotel auf ein Candlelight-Dinner in einer der Luxussuiten eingeladen. Es gab viele unverdient Reiche, die ihren Aufenthalt in der Stadt im Louis XV verbrachten. Gerade sie benahmen sich oft, als warteten sie nur darauf, ihre Mitmenschen schlecht zu behandeln, als wären sie geradezu versessen darauf, sich zu beschweren. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass sie sich selbst unablässig ihrer Bedeutung versichern mussten. Vielleicht war es aber auch einfach nur so, dass mit dem Geld nicht automatisch Respekt und gute Manieren kamen.
Jedenfalls schikanierten viele von ihnen die Zimmermädchen, nur um sich hinterher über sie zu beschweren, und suchten auch sonst überall das sprichwörtliche Haar in der Suppe.
Als Nicholas Matin endlich im Hotel angelangt war, war er bis auf die Haut durchnässt. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er einen Schirm bei sich gehabt hatte. Er hätte ihn nur aufspannen müssen. Aber dann hätte er für einen kleinen Augenblick an etwas anderes als an die Blumenhändlerin in der Rue du Cherche-Midi denken müssen. Und dazu war er bis jetzt nicht in der Lage gewesen.
»Blumen, Monsieur Matin?«, fragte der Portier, an dem er vorbeikam.
»Oui, Antoine! Eine kleine Aufmerksamkeit für Berenice«, erklärte Nicholas. »Sie hatte ziemlich viel Extraarbeit in den letzten Tagen.«
»Die wird sich aber freuen!«
Berenice war eine der Putzfrauen, die aus dem Süden Frankreichs kamen und in der Hauptstadt für ein besseres Leben schufteten. Eine einfache Frau mit einem guten Herzen. Niemand hätte gewagt, es auszusprechen, aber doch waren sich alle sicher, dass sie auch deshalb häufig Ziel von Reklamationen wurde, weil sie schwarz war. Zu allem Überfluss war Berenice in letzter Zeit auch immer wieder Anfeindungen aus der Personalabteilung ausgesetzt gewesen. Keine Beschwerde schien so an den Haaren herbeigezogen, dass man sie nicht dafür tadelte. Als Nicholas Monsieur Trebouchet gegenüber seine Zweifel an gewissen Anschuldigungen äußerte, musste er sich eine Lektion in erfolgreicher Unternehmensführung erteilen lassen: »Monsieur Matin, natürlich könnte ich über die Angelegenheit hinwegsehen. Aber wenn ich das im Fall dieses Zimmermädchens tue, dann werden uns bald alle Zimmermädchen auf der Nase herumtanzen. Und nach den Zimmermädchen tun es die Hotelboys und die Kellner … Nein, an der London School of Economics pflegten wir zu sagen: Zero tolerance.« Er sprach es ohne den Hauch eines Akzents aus. »Und das ist es, was wir brauchen. Zero tolerance. Ich erwarte, dass Sie das respektieren ‒ in Ihrem eigenen Interesse.«
Nicholas empfand diese Härte gegenüber einer so fleißigen Frau als Schande. Und da er nun schon zwei Blumenstöckchen erworben hatte, wollte er wenigstens etwas Gutes damit anfangen.
Rasch ging Nicholas in sein Büro und nahm ein Kärtchen, wie es für Präsente an die Gäste benutzt wurde. »Für Berenice! Danke für Ihren Einsatz ‒ Ihr Nicholas«, schrieb er darauf und band es an eine der Pflanzen, die er auspackte und deren Töpfe er mit dem Papier des Blumenladens wieder umwickelte. Dann stellte er die beiden Stückchen vor Berenice’ Spind, ehe er in die Managementetage eilte. Gerade noch rechtzeitig setzte er sich auf seinen Platz, als auch schon der Geschäftsführer ohne lange Vorrede anfing mit der Feststellung: »Wir sind mit der Situation nicht zufrieden. Es wird sich einiges ändern müssen. Monsieur Matin ‒ würden Sie bitte …?«
***
Die Rue du Cherche-Midi war eine der wenigen typischen Pariser Straßen, die noch nicht vom Tourismus zu einer Kulisse ihrer selbst verkommen, noch nicht von Immobilienspekulanten in eine Gelddruckmaschine verwandelt und noch nicht von Luxuslabels vereinnahmt worden waren. Es gab in ihr einen Trödler (LeBourgeois), eine Boulangerie (Coquette’s), ein Café, das ein wenig zu groß war, um das »typische kleine Pariser Café« zu sein, und zu klein, um als Institution zu gelten, einen Zeitschriftenladen mit Tabakwaren, einige kleinere Anwalts- und Steuerkanzleien ‒ und den Blumenladen von Fleur Danton, der an der kleinen Kreuzung zur Rue du Regard an sich sehr günstig lag, wenn auch nicht in bester Lauflage.
Durch diverse Büros in der Umgebung und natürlich durch die Nähe der geschäftigen Rue de Rennes war auch die Rue du Cherche-Midi nicht ganz verschlafen. Die kleinen Läden konnten sich einigermaßen über Wasser halten, ein gewisser Lokalpatriotismus sorgte dafür, dass nicht ständig die Pächter wechselten und an jeder Ecke ein Salon für Thai-Massage oder ein Waxing-Studio eröffnete.
An schönen Tagen konnte man die Inhaberin des Tabakwarengeschäfts vor dem Eingang stehen und mit einem Stammkunden sprechen sehen. Madame Goncourt aus dem Kaffeehaus tauschte Rezepte mit der Bäckerin des Coquette’s, manchmal transportierte der Trödler ein Möbelstück oder sonst eine Antiquität auf seinem Handkarren die Straße hinunter, um sie an einen Kunden in der Nähe auszuliefern, und mitunter geschah es, dass Fleur Danton vor ihrem Laden in der Sonne saß und ein Buch aus ihrer Schürzentasche holte, einen Roman von Stendhal vielleicht oder Gedichte von Baudelaire, um für einige Minuten ganz in einer anderen Welt zu versinken.
Im Sommer sah man die junge Blumenhändlerin oft mit ihrem Fahrrad die Straße entlangfahren: Sie lieferte ihre Bestellungen gerne selbst aus. Dann wehte ihr Haar im Fahrtwind, und ihre Wangen röteten sich. Sie genoss es, mitten in dieser lebenslustigen Stadt unterwegs und ein Teil von ihr geworden zu sein!
Im Winter freilich spielte sich das meiste im Inneren der diversen Geschäfte ab. Auch die Blumenhändlerin kam nur nach draußen, wenn ein Kunde etwa einen der von ihr selbst gewundenen, prächtigen Kränze kaufen wollte, die sie dort am knorrigen Ast einer alten Eiche aufgehängt hatte. »Kleine Waldkreise« nannte sie diese Kunstwerke, denn sie nahm niemals nur eine Sorte Zweige. Einen reinen Tannenkranz fand man bei ihr nicht. Dafür aber Kränze, in denen sich Tannen- und Kiefernzweige mit Zypressenbüscheln mischten, kleine Zapfen von der Lärche und große von der Kiefer. Getrocknete Hagebutten oder Ilex oder Stechpalmen schmückten die üppigen tiefgrünen Kränze.
Im vergangenen Jahr hatte ein Christbaumhändler seinen Stand an dem kleinen Platz vor dem Blumenladen aufgeschlagen. Für Fleur Danton war das eine problematische Bereicherung. Sie führte zwar keine Bäume, aber sehr wohl Tannenzweige, wie sie auch der Baumhändler im Sortiment hatte. Diese Konkurrenz hatte sie gespürt. Mehr noch aber die Aufmerksamkeit, die die Passanten dem ‒ sonst ja nicht vorhandenen ‒ Stand widmeten und die dem kleinen Blumenladen prompt fehlte. Doch der Händler hatte sich in diesem Jahr einen anderen Standort gesucht, und so fanden Koniferenzweige, Kränze, vergoldete Zapfen, Misteln und andere jahreszeitlich besonders beliebte Waren reißenden Absatz ‒ was freilich an der allgemein schwierigen Situation eines so kleinen Geschäftes nicht viel änderte.
Wenn die kleine Glocke über der Eingangstür der Blumenhandlung Fleurs de Fleur klingelte, so war dieses Klingeln immer ein Fünkchen Hoffnung, und es zauberte stets ein Lächeln auf das Gesicht der jungen Blumenhändlerin, die im Übrigen den festen Vorsatz hatte, sich niemals für Geld zu verändern ‒ vor allem aber nicht aus Mangel desselben. Ja, aus diesem Grund noch viel weniger. Sie war entschlossen, jedem Tag mit Neugier und Dankbarkeit zu begegnen. Denn es war schließlich keine Selbstverständlichkeit, dass man sein Leben auf dem Schönsten begründen durfte, was man sich nur denken konnte: einem kleinen Paradies voller Blumen.
Doch wie jeder Mensch, so schleppte auch sie ihr Päckchen.
Vor allem ihr Vater machte ihr Sorgen. Es verging kein Tag, an dem sie ihn nicht anrief. »Wie ist das Wetter bei euch, Papa?«
»Nicht anders als in Paris«, erklärte er dann halb brummig, halb amüsiert. »Wie geht es dir, mein Kind?«
»Wie geht es dir, Papa?«
»Nicht anders als gestern.«
Nein, aufregend waren ihre Gespräche meist nicht. Denn im Laufe der zurückliegenden drei Jahre, seit Fleur nach Paris gekommen und ihren kleinen Laden eröffnet hatte, hatten sie so oft miteinander gesprochen, dass es kaum ein Vorkommnis gab, das der jeweils andere nicht gekannt hätte. »Hast du Kunden?«
»Aber sicher, Papa. Das Geschäft läuft gut.« Sie würde ihm nicht auf die Nase binden, dass sie sich mit Existenzängsten herumschlug. Papa hatte es schwer genug.
»Das beruhigt mich. Du weißt, ich werde dir nichts vererben. Es ist nichts da.«
»Du wirst mir nichts vererben, Papa, weil du noch lange leben wirst.«
Er schwieg. Sie konnte hören, wie er überlegte, ob er protestieren sollte. Doch er tat es nicht. Und sie sagte auch nichts weiter. »Dann kümmere dich mal wieder um deinen Laden, Kind.«
»Ja, das mache ich. Au revoir, Papa.«
»Salut, cherie.«
Es waren Rituale. Und Fleur wusste, dass ihr Vater diese Rituale so wenig missen wollte wie sie.
***
Das Meeting war, wie nicht anders zu erwarten, zu lang, zu abstrakt und gespickt mit Anglizismen gewesen. In vielen Chefetagen gilt der Managerslang als Ausweis besonderer Befähigung. In Wirklichkeit ist er oft nur ein Ausdruck besonderer Armut an Kultiviertheit ‒ und damit eigentlich völlig unpassend für ein Haus wie das Louis XV. Hätte sich der Portier einer solchen Sprache bedient, wäre er nach spätestens zwei Wochen ersetzt worden. Denn mit Menschen kann man so nicht sprechen. Dass aber auch Mitarbeiter Menschen sind, das ist manchem Geschäftsführer oder Prokuristen offenbar nur schwer begreiflich.
Umso mehr bemühte sich Nicholas, seinen Vortrag lebensnah zu formulieren. Tatsächlich häuften sich ja die Reklamationen in der letzten Zeit. Das war nur zum Teil dem Qualitätsmanagement geschuldet. Hauptsächlich hatte es etwas mit den Kosten zu tun, die man drastisch zu senken versuchte. Die Folge waren schlechter geputzte Zimmer (weil die Putztruppe in weniger Zeit mehr Einheiten schaffen sollte), billige und damit minderwertige Kleinartikel (Zahnbürsten, die das Zahnfleisch verletzten, Badehauben, die zerrissen) und minderwertige Begrüßungskörbe (mit Obst, das aussah, als hätte man es vom Discounter gekauft ‒ was auch stimmte). Eigentlich hätte Nicholas dem Management Vorwürfe machen müssen, weil es mit zu ehrgeizigen Vorgaben solche Mängel provozierte. Aber an seinem früheren Arbeitsplatz bei einer internationalen Marketingagentur hatte er gelernt, dass man die Fehler seiner Vorgesetzten niemals als solche bezeichnen durfte. Also stellte er sich zum Schein hinter das Management ‒ und dabei doch eigentlich vor die Kolleginnen und Kollegen in den verschiedenen Abteilungen: »Das Louis XV hat die Aufgabe, stets und unter allen Umständen nur das Beste zu bieten. Das ist es, was unsere Gäste von uns erwarten, und das ist es, was geradezu in unserer DNA steht.« Ein Blick in die Runde zeigte ihm, dass all diejenigen, auf die es ankam, zuhörten. Nun galt es, die Geschäftsführung auf seine Seite zu ziehen: »Durch ein kluges und vielschichtiges Optimierungsprogramm haben wir es geschafft, dass uns die Kosten nicht mehr davonlaufen. Das gibt uns genügend Spielraum, nun auch bei der Qualität die letzten paar Prozent, die uns zur Perfektion fehlen, noch zu schaffen.« ]a, jetzt hatte er sie. Monsieur Trebouchet, der oberste Chef, schien geradezu die Ohren aufzustellen. »Das Gute ist: Es ist nichts einfacher als das. So ärgerlich Reklamationen sind: Sie helfen uns, die Schwachstellen herauszufinden. Ich schlage vor, dass wir ‒ das heißt meine Abteilung ‒ im Laufe der nächsten Tage die Kundenbeschwerden der letzten Monate analysieren und strukturieren und sie dann an die Geschäftsführung weiterleiten, sodass es umso einfacher ist, mit ganz konkreten Maßnahmen gegenzusteuern.«
»Das halte ich für einen guten Vorschlag, Monsieur Matin«, stimmte Trebouchet zu. »Schaffen Sie das bis Donnerstag?«
»Lassen Sie uns Freitag sagen, die Sache ist mir zu wichtig, als dass wir hier ungenau arbeiten sollten.«
»Gut. Freitag. Meine Damen und Herren …« Trebouchet erhob sich, womit, wie alle wussten, die Sitzung geschlossen war. Nicholas und die anderen Kollegen würden den Saal verlassen, die Geschäftsführung würde bleiben und über Themen beratschlagen, die nicht für die Ohren der Mitarbeiter bestimmt waren.
»Und worauf wird das hinauslaufen?«, wollte Jean Pelissier wissen, mit dem Nicholas das Büro teilte.
»Ist doch ganz klar, oder? Die meisten Sparaktionen müssen rückgängig gemacht werden.«
Pelissier schüttelte lächelnd den Kopf. »Du hattest das geplant, oder?«
»Ach, wenn es immer so einfach wäre.« Nicholas sah auf die Uhr. Es war spät, er würde direkt nach Hause gehen. Vielleicht… Sein Kollege schien den gleichen Gedanken zu haben. »Soll ich dich mitnehmen?«
»Bist du etwa mit dem Auto da?«
»Oui. Um die Uhrzeit…«
»Tja, dann gerne.«
Wenig später fuhren sie durch Schneeregen die Rue de Rennes hinauf Richtung Montparnasse. »Ein elendes Wetter ist das. Ich wünschte, der Winter wäre schon vorbei.«
»Ich weiß nicht«, sagte Nicholas. »Irgendwie mag ich alle Jahreszeiten.«
»Ja, das sagt man so. Aber dieses Wetter, ich bitte dich! Am liebsten würde ich eine Oase gründen.« Er schien zu überlegen. »Vielleicht sollte ich aus meinem Balkon einen Wintergarten machen.«
Ein Wintergarten, dachte Nicholas, ja, das wäre eine schöne Sache. Mit vielen Blumen darin, warm, duftend und bunt. Gleich würden sie an der Straße vorbeikommen, in der das Fleurs de Fleur lag. »Würdest du mich hier rauslassen, Jean?«
»Hier? Im Ernst? Dir ist klar, dass du bis auf die Haut durchnässt bist, wenn du von hier aus nach Hause gehst.«
Nicholas legte ihm die Hand auf die Schulter. »Ist mir klar, ja. Aber danke für deine Fürsorge.«
»Bof. Dann bitte schön.« Er blinkte und fuhr rechts ran. »Versuch bitte, dich nicht zu erkälten. Ich kann niemanden in meinem Büro brauchen, der mich ansteckt.«
»Ich werde mein Bestes tun, Jean. Gute Nacht.«
»Gute Nacht.«
Wenige Augenblicke später verschwanden die Rückleuchten von Jeans Wagen zwischen den unzähligen anderen Lichtern der Pariser Nacht, die sich im Regen funkelnd vervielfachten. Nicholas klappte den Kragen seines Mantels hoch und drückte sich nah an die Hausmauer. Nur wenige Geschäfte waren noch geöffnet, die meisten hatten bereits die Rollläden heruntergelassen, sodass die Straße dunkel und unwirtlich wirkte. Das Schaufenster des kleinen Blumenladens, von hier aus nicht als solcher zu erkennen, war noch erhellt. Nicholas steuerte seine Schritte dorthin, ohne zu überlegen, was er eigentlich tat. Es war, als geschähe alles von ganz allein.
Die Blumenhändlerin stand hinter ihrer Ladentheke und schrieb etwas in ein Buch. Vielleicht ihre Bestellungen für morgen? Vielleicht die Einnahmen des Tages? Vielleicht Notizen? Er bewunderte, wie sie den Stift hielt, wie sie sich elegant eine Locke aus dem Gesicht strich, wie sie gedankenversunken mit dem Finger auf ihre Nasenspitze tippte. Alles an ihr erschien ihm unendlich anmutig. Er merkte kaum, wie ihm der Regen in den Nacken rann, wie seine Schuhe durchweichten, wie seine Hände klamm wurden. Zwar stand er hier draußen auf der Straße, doch sein ganzes Selbst war gerade dort drinnen bei ihr, ganz nah. Betrachtete ihre Gesten und ihre Miene, lauschte ihrer Stimme, nahm ihren Duft wahr … Was natürlich Unsinn war. Denn in einem Blumenladen war die Floristin vermutlich das am wenigsten duftende Wesen. Die Luft in einem solchen Geschäft war stets voller Düfte, im Winter noch mehr als im Sommer, weil die Tür geschlossen blieb.
Die junge Floristin blickte auf, und Nicholas wich rasch einen Schritt zurück in den Schutz einer Palme, die zur Dekoration vor dem Schaufenster stand. Es wäre ihm unangenehm gewesen, wenn sie ihn ertappt hätte, wie er sie beobachtete. Es war ihm ja selbst unangenehm. Verwirrt riss er sich von dem kleinen Laden los und eilte davon. Was tat er hier? Wieso stand er auf der Straße und benahm sich wie ein … ja, was? Er kannte sich selbst nicht wieder. Und während in dem kleinen Laden die Blumenhändlerin sich fragte, ob sie den Kunden von heute Nachmittag gesehen hatte, schritt Nicholas Matin hastig durch die Pariser Herbstnacht, um rasch nach Hause zu kommen und vor allem: auf andere Gedanken.
***
Als Fleur Danton an diesem Abend ihr kleines Geschäft in der Rue du Cherche-Midi absperrte, hatte sie ‒ wie so oft ‒ einen kleinen Strauß Rosen dabei. Sie wären am nächsten Tag nicht mehr zu verkaufen gewesen. Doch an diesem Abend waren sie von jener lieblichen Pracht, der man bereits ihr baldiges Verblühen ansah und die dadurch noch zarter und zerbrechlicher wirkte. Gerade bei den roséfarbenen Blüten, die in ihren späten Tagen eine fast transparente Blässe annahmen, verspürte Fleur manchmal beinahe das Bedürfnis, sie zu trösten.
Sie wusste, dass Madame d'Alemberg, ihre Vermieterin, diese zierlichen Gebinde liebte ‒ und es war sicher nicht die schlechteste Idee, die gute Frau gnädig zu stimmen. Denn die Geschäfte gingen wirklich nicht besonders gut, und es war keineswegs sicher, dass Fleur mit ihrem kleinen Laden über den Winter kommen würde. Sie hatte schon einige Lieferungen rückgängig machen müssen, eine heikle Sache, weil die Kunden natürlich immer frischeste Ware verlangten. Und dann doch nicht kamen, wenn man das ganze Geschäft davon voll hatte. So blieb die Blumenhändlerin in manchen Wochen auf dem größten Teil ihrer Bestellungen sitzen und musste sie am Ende gar wegwerfen. In anderen Wochen, wenn sie vorsichtiger eingekauft hatte, standen die Kunden ratlos im Laden, kauften kaum etwas oder verließen ihn gar unverrichteter Dinge wieder, weil es eben keine frischen Tulpen gab oder weil ihre Moosröschen bereits allzu weit aufgeblüht waren. Der Handel mit Zierpflanzen war jeden Tag wieder eine Lotterie. Und dann hatte Fleur ein zu weiches Herz: Sie brachte es auch nach Jahren als Floristin nicht über sich, Blumen einfach zu schreddern und auf den Müll zu werfen. So verdarb sie sich bisweilen sogar selbst ihr Geschäft, indem sie verschenkte, was übrig war, und sich damit um Kunden brachte. Denn wer Blumen geschenkt bekam, brauchte nun einmal keine zu kaufen.
Die Straßen waren nass, ein kalter Wind zog durch das Viertel. Fleur spürte eine Erkältung aufkeimen. Sie würde sich rasch noch etwas Tee besorgen und dann früh schlafen gehen. Das nahm sie sich meist vor, aber dann wurde es doch ein oder zwei Uhr morgens, bis sie ihr Buch aus der Hand legte und einschlummerte. Die Welt der Bücher hatte sie fest im Griff, seit sie mit vierzehn zum ersten Mal Rimbaud gelesen hatte und später dann Flaubert. Klassiker, nicht immer leichte Lektüre, aber so aktuell, als wären ihre Protagonisten gestern noch durch diese Straßen gewandelt. Fleur blieb vor einem kleinen Lebensmittelladen stehen, in dem sie auf dem Nachhauseweg immer einkaufte. Ein Libanese führte ihn, doch es war kein typisch arabisches Geschäft. Eher im Gegenteil: Die Familie war weit französischer als alle anderen Menschen, die die junge Blumenhändlerin in Montparnasse kannte. »Bonsoir, Monsieur!«
»Bonsoir, Mademoiselle!« Der Alte freute sich sichtlich, Fleur zu sehen. »Was hätten Sie gerne?«
»Heute nur etwas Tee, Monsieur.«
»Aber natürlich! Schwarzen, grünen? Pfefferminze?«
»Was mir am besten gegen eine Erkältung hilft.«
Der Lebensmittelhändler zwinkerte ihr zu und hob den Zeigefinger. »Dann nehmen Sie diesen hier.« Er lief zu einem der Regale und kam mit einem kleinen Säckchen zurück, das ziemlich selbstgemacht aussah. Keine folierte Dose, kein eingeschweißtes Plastik. Eine Papiertüte mit einer grünen Schnur und einem offenbar handgeschriebenen Etikett. Fleur nahm es und las: »Fleurs de Fleur?«
Der Alte grinste. »Wie Ihr Laden, Mademoiselle.«
»Ja wirklich! Ich kann es gar nicht glauben. Wie kommen Sie… ich meine: Wer hat …?«
»Oh, das ist reiner Zufall. Nun ja, kann sein, dass ich den Namen Ihres Ladens einmal erwähnt habe. Ein Cousin von mir zieht Kräuter. In der Provence. Er mischt diese Tees.« Der Lebensmittelhändler tippte auf das Päckchen. »Und auf diesen hier schwört er. Meine Frau übrigens auch.«
»Tja, bei dem Namen muss ich ihn ja wohl kaufen«, lachte Fleur und suchte nach ihrer Geldbörse.
»Lassen Sie, Mademoiselle. Lassen Sie. Es steht ja Ihr Name darauf. Er gehört also ganz offensichtlich Ihnen.«
Und so kam es, dass Fleur Danton an jenem nasskalten Abend im November mit einer Teemischung nach Hause ging, die den Namen ihres eigenen kleinen Ladens trug.
Madame d'Alemberg war nicht da. Also stellte Fleur den kleinen Strauß in ein kurzes Glas und dasselbe vor die Tür ihrer Vermieterin, bevor sie sich ein Bad einließ und den Tee aufgoss. Dazu einen Roman über eine romantische Liebe an der rauen Atlantikküste, ein, zwei Kerzen, ein wenig Musik (Chopin) ‒ es würde ein schöner Abend werden, an dem sie mit etwas Glück ihre Erkältung im Keim erstickte.
Natürlich wurde nichts daraus. Zuerst klingelte es an der Wohnungstür, gerade als sie sich fürs Bad ausgezogen hatte. Rasch schlüpfte sie in den Morgenmantel und sah nach. Madame d'Alemberg. »Guten Abend.«
»Guten Abend, Madame.«
»Die sind von Ihnen?« Die Frau, sie mochte um die siebzig sein, vielleicht auch schon beinahe achtzig, hielt ihr das Glas mit den Rosen unter die Nase.
»Oui, Madame. Die habe ich Ihnen mitgebracht.«
»Das ist sehr nett«, erklärte Madame d'Alemberg, fuhr jedoch, bevor Fleur antworten konnte, fort: »Noch netter wäre es allerdings, wenn meine Miete pünktlich auf dem Konto wäre.«
»Ich weiß, Madame, es tut mir leid.« Fleur seufzte. »Der Laden … Es ist nicht leicht, wissen Sie?«
»Das ist es für niemanden, Mademoiselle. Auch für mich nicht. Sie wissen selbst, in welchem Zustand die Heizungen sind. Die Reparatur wird mich ein Vermögen kosten. Wenn ich die Mietzahlungen nicht bekomme, dann weiß ich nicht, wie ich die Handwerker bezahlen soll. Und wenn ich die Handwerker auf ihrer Rechnung sitzenlasse, dann … Mein Gott, Handwerker zu bekommen, das ist heutzutage, wie in der Lotterie zu gewinnen!« Sie verdrehte die Augen, aber nur ein kleines bisschen. Madame d'Alemberg neigte zwar zu Übertreibungen, aber nicht zur Dramatik.
»Gewiss, Madame«, hauchte Fleur. »Ich verstehe Sie zu gut. Und ich versprechen Ihnen …«
»Versprechen Sie nichts, Mademoiselle. Halten Sie es lieber.« Sie wandte sich ab, doch dann blieb sie stehen, blickte noch einmal zu der jungen Frau im Morgenmantel und schenkte ihr ein versöhnliches Lächeln. »Aber danke für die Blumen. Sie sind wunderschön.«
»Gerne, Madame. Wirklich sehr, sehr gerne.«
***
Ein Blumenladen ist eine Oase des Lichts in der Dunkelheit des Winters
Die Arbeit einer Floristin fängt sehr früh am Morgen an. Wenn man ein so kleines Geschäft hat wie Fleur Danton, dann ist es keine Selbstverständlichkeit, dass die großen Lieferanten mit ihren gigantischen Lastwagen ihn auf ihrer Tour durch die Stadt berücksichtigen. Gewiss, Delatour machte manchmal bei ihr Station, Van Beuten gelegentlich. Aber oft wurde das Fleurs de Fleur auch übersehen, der kleine Laden, der etwas abseits lag und stets nur kleine Mengen abnahm. Also fuhr die junge Floristin an zwei, wenn es gut lief, sogar an drei Tagen die Woche in den frühen Morgenstunden zum Großmarkt, um gegen acht Uhr, den alten Renault bis unters Dach mit frischester, bester Ware vollgepackt, wieder bei ihrem geliebten kleinen Laden zu landen.
Sie hatte einige Stammkunden, die an diesen Tagen ‒ Montag, Mittwoch und Freitag ‒ mehr oder weniger regelmäßig vorbeikamen, um den Blumenschmuck für die Woche zu kaufen. Da war Madame Chirac (nicht verwandt mit einem ehemaligen Präsidenten desselben Namens, was sie aber außer Fleur kaum jemandem verraten hatte). Sie nahm regelmäßig einen kleinen Strauß Margeriten und eine Tasse Tee, Letztere selbstverständlich kostenlos, blieb eine halbe Stunde, um zu plaudern, und wurde dann von ihrem Hund nach draußen gebellt. Oder Madame Rolande (nicht verwandt mit einem Premierminister desselben Namens, worauf sie stets hinwies), die buchstäblich jede Woche mit neuen Tipps zur Blumenpflege kam und nicht zögerte, die junge Floristin an ihren handwerklichen Kenntnissen teilhaben zu lassen. Monsieur Heineken (aus einer großen Bierdynastie stammend, was er aber nie erwähnt hatte, weshalb es auch Fleur nicht wusste), der einige Zeit Woche für Woche einen Blumenstrauß für seine Frau mitgenommen hatte, bis er auf die Idee gekommen war, dass er dergleichen auch »abonnieren« konnte. Seither stellte Fleur allwöchentlich selbst einen entsprechenden Strauß für den immer gleichen Betrag zusammen und lieferte ihn ‒ an schönen Tagen mit dem Fahrrad, sonst mit dem alten Renault ‒ an Frau Heineken aus, die sie regelmäßig zu einem Glas Pastis nötigte. Ein älteres Ehepaar, dessen Namen Fleur nicht kannte, hatte seine Freude an den exotischsten Blumen, die der kleine Laden im Sortiment führte. Ein junger Mann, beinahe noch ein Teenager, trug offenbar sein ganzes Geld (was nicht viel hieß) zu Fleur, um sich von ihr beraten zu lassen. Sein romantischer Plan schien noch nicht aufgegangen zu sein, womöglich würde er nie aufgehen, wie sehr die beiden sich auch bemühten ‒ der Junge mit seinem kleinen Budget, Fleur mit ihren Blumensträußen, die weit jenseits desselben lagen. Diese und andere mehr oder weniger bemerkenswerte Menschen tauchten regelmäßig in dem kleinen Geschäft in der Rue du Cherche-Midi auf und trugen dazu bei, dass es das Fleurs de Fleur überhaupt noch gab. Denn der Laden erfreute sich keiner bevorzugten Lauflage und war schlicht zu klein, um die Umsätze zu erzielen, die man angesichts der Mietpreise in einer Stadt wie Paris erzielen musste, um dauerhaft zu überleben. Wäre nicht Monsieur Franche-Bas von der Bank unsterblich in Fleur verliebt gewesen (oder vollkommen unfähig), man hätte ihr längst den Geldhahn zugedreht. An manchen Tagen konnte die junge Floristin es selbst kaum glauben, dass der Geldautomat noch Scheine für sie ausspuckte. Die Zinsen freilich, die für ihre ständige Überziehung fällig wurden, schnürten ihr jeden finanziellen Spielraum ab.