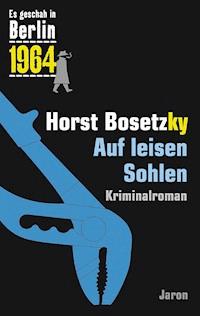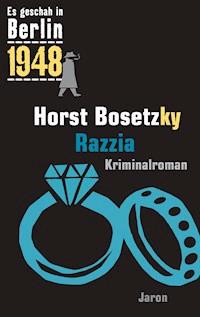Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Name August Borsig steht bis heute für die industrielle Revolution in Preußen und speziell für den Lokomotivbau. Der sagenhafte Ruf, den sich der 1804 in Breslau geborene Großunternehmer in Berlin erwarb, reichte bis weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Schon früh scheint der Weg des Zimmermannsohns vorgezeichnet: Er soll in die Fußstapfen seines Vaters treten und später sogar vielleicht Baumeister beim König werden. In seinem Herzen jedoch glüht August Borsig für Feuer und Eisen – sein sehnlichster Wunsch ist es, das Schmiedehandwerk zu erlernen. Besessen von der Idee, den technischen Vorsprung der englischen und amerikanischen Industrie aufzuholen und in Preußen eigene Lokomotiven herzustellen, gründet er mit 33 Jahren seine eigene Maschinenbau-Anstalt nordöstlich des Oranienburger Thores, im sogenannten Feuerland. 1841 wird die erste Lokomotive des jungen Unternehmers ausgeliefert – und eine einzigartige Erfolgsgeschichte beginnt. Der beliebte biografische Roman „Der König vom Feuerland“ des Bestsellerautors Horst Bosetzky erscheint nun erstmals als Taschenbuch. Packend erzählt das Werk nicht nur von einer beispiellosen Unternehmerkarriere, sondern zeichnet auch ein Panorama der geistigen und politischen Entwicklung Preußens in den turbulenten Zeiten des Vormärz und der industriellen Revolution.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Der König vom Feuerland
August Borsigs Aufstieg in Berlin
Roman
Jaron Verlag
Taschenbuchausgabe 1. Auflage dieser Ausgabe 2019 © 2011 Jaron Verlag GmbH, Berlin Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.www.jaron-verlag.de Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin, unter Verwendung eines Gemäldes von Karl Eduard Biermann (Borsig’s Maschinenbauanstalt zu Berlin) Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
ISBN 978-3-95552-250-6
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Epilog
Literatur
Prolog15. März 1854
»Borsig!«, stöhnte Ludwig Rellstab, wieder einmal bei Varnhagen von Ense eingeladen. »Hören Sie auf mit unserem König der Lokomotiven! Ich soll für die Vossische Zeitung zu seinem fünfzigsten Geburtstag im Juni eine ganze Seite über ihn schreiben, ein umfassendes Lebensbild entwerfen – und habe bis jetzt nicht eine einzige Zeile zu Papier gebracht.«
»Da geht es Ihnen wie mir«, fügte Friedrich von Gräbendorff an. »Ich sitze an der Rede, die mein Minister bei der großen Feier am 25. dieses Monats halten soll.«
Karl Varnhagen von Ense brauchte einige Sekunden, bis ihm die Zusammenhänge klargeworden waren. »Sie meinen also unseren preußischen Handelsminister August von der Heydt. Geht es um Borsigs fünfhundertste Lokomotive?«
Der Assessor nickte. »So ist es. Aber ich bekomme das Phänomen August Borsig nicht in den Griff, ich verstehe nicht, wieso ausgerechnet dieser Mensch zu dem geworden ist, was er heute ist. Es hätte eigentlich nicht sein dürfen. Aller Logik zufolge hätte es dieser Mann höchstens bis zum Meister einer kleinen Zimmerei im hintersten Winkel Preußens bringen können.«
»Versuchen Sie es mit dem Begriff telos!«, riet ihm Gottfried Keller, der aufmerksam zugehört hatte.
»Pardon, wenn Sie mir bitte einmal …« Friedrich von Gräbendorff war Jurist und wusste mit dem Begriff telos nichts anzufangen.
Gottfried Keller war so weit mit allen philosophischen Grundbegriffen vertraut, dass er ihm in knappen Worten erklären konnte, worum es hierbei ging: »Aristoteles zufolge hat alles ein telos, ein ihm eigenes Ziel, und strebt an, es zu erreichen – mit anderen Worten, das zu werden, was ihm vorgegeben ist. Eine Eichel hat das telos, eine Eiche zu werden. Das ist ihr Endzweck. Ein immanenter Endzweck ist Bestandteil der Grundstruktur aller Wirklichkeit.«
»Ah …«, machte von Gräbendorff, und es war ihm deutlich anzusehen, dass er noch immer nicht so richtig verstand, was es mit der Teleologie auf sich hatte.
Varnhagen versuchte, ihm mit einem Scherz auf die Sprünge helfen. »Ich schlendere die Linden hinunter und treffe meinen Freund Samuel Goldstein mit seinen beiden Enkelkindern. Wie alt denn die Kleinen seien, will ich wissen. Antwortet Goldstein: ›Der Leibarzt des Königs ist fünf, der Geheime Oberregierungsrath wird sieben.‹«
Ludmilla Assing, Varnhagens Nichte, die Gottfried Keller wie auch den Assessor ins Haus gebracht hatte, verfolgte eine ähnliche Spur. »Das erinnert mich an Calvins Prädestinationslehre. Die Geschichte wird bedingt durch die Errettung der Auserkorenen und die Bestrafung der Zurückgewiesenen. Für Calvin bleibt es unergründlich, warum Gott in der Vorhersehung die einen zum Glück und die anderen zum Verderben bestimmt.«
Varnhagen verzog ein wenig das Gesicht. »Warum denn alles so verkomplizieren! Es war ganz einfach die Zeit, die Menschen wie Borsig hervorgebracht hat. Die entscheidenden Erfindungen waren außerhalb Preußens gemacht worden, und wenn wir nicht hinter alle anderen Staaten zurückfallen wollten – insbesondere hinter England –, musste in unserem Lande etwas geschehen, mussten wir Verkehr und Maschinenbau entwickeln. Beuth hat das als Erster begriffen, und ohne Beuth hätten wir keinen Borsig. Es lag ganz einfach in der Luft.«
Seine Nichte wollte sich damit nicht zufriedengeben. »Schön und gut, lieber Onkel, doch diese Rolle, diese Aufgabe hätten auch hundert andere übernehmen und erfüllen können. Warum aber gerade unser Borsig?«
Ludwig Rellstab, der August Borsig schon einige Male begegnet war, hatte eine zusätzliche Erklärung parat: »Weil er ein Besessener ist!«
Gottfried Keller nickte. »So ist es. Letztlich siegen immer die, die von einer Idee oder einer Mission besessen sind, die voller Hingabe an die für sie heilige Sache sind und alles andere in ihrem Leben nur diesem einen großen Ziel unterordnen.«
Varnhagen lachte. »Da spricht jemand aus Erfahrung!« Alle wussten, dass der Schweizer jeden Tag und jede Nacht in seiner kleinen Wohnung am Gensdarmen-Markt saß und in qualvoller Arbeit seinen Roman Der grüne Heinrich zu vollenden suchte.
»Langsam beginne ich zu begreifen«, sagte von Gräbendorff.
»Wie schön«, sagte Ludmilla Assing, wobei sie sich des spöttischen Tons nicht ganz enthalten konnte. »Auch wenn alles letztendlich unbegreiflich ist. Soweit ich August Borsig kenne, ist er nicht ganz frei von Selbstüberhöhung.«
Varnhagen konnte nicht anders, als ihr zuzustimmen. »Ganz recht. Ich erinnere nur an die Frage eines Besuchers, warum er denn am Eingang zum Fabrikgelände keine Statue des Königs habe aufstellen lassen, sondern die eines Schmiedes. Die Antwort: ›Hier passt kein König her, hier ist der Schmied der König.‹ Wobei anzumerken ist, dass sich Borsig selbst in erster Linie immer als Schmied gesehen hat und nicht als Zimmermann, Maschinenbauer oder Fabrikherr.«
Gottfried Keller blickte zu Ludmilla Assing hinüber. »Das wäre doch ein Roman für Sie …«
Varnhagens Nichte winkte ab. »Nein, eher für Sie oder unseren wackeren Rellstab hier. Ich schlage den Titel vor: Mutmaßungen über Borsig.«
»Ich bin in erster Linie Musikkritiker und Dichter!«, rief Ludwig Rellstab.
Auch Gottfried Keller winkte ab. »Ich habe mit Der grüne Heinrich genug zu tun, und dann sind Die Leute von Seldwyla an der Reihe. Außerdem bin ich kein Preuße.«
Varnhagen lachte. »Schiller war auch kein Franzose und Goethe kein Holländer, und sie haben trotzdem Die Jungfrau von Orleans und Egmont zu Papier gebracht.«
Der Assessor stieß einen tiefen Seufzer aus. »Das alles kann ich doch meinen Minister nicht referieren lassen! Er ist Bankier von Hause aus.«
Ludmilla Assing, die als Feuilletonistin und Romanautorin viele Erfahrungen gesammelt hatte, wusste einen Ausweg. »Gehen Sie bei Borsig vorbei und lassen sich von ihm erzählen, wie das alles gewesen ist in seinem Leben. Sie brauchen ja nicht damit anzufangen, wie er in der Wiege gelegen hat und was er als Knabe alles so gedacht und gemacht hat.«
»Eine vortreffliche Idee!«, sagte Varnhagen. »Aber so viel Aufwand für ein paar Worte des Ministers? Dazu ist unser lieber Borsig doch viel zu beschäftigt, als dass er die Zeit dafür hätte.«
»Ich komme mit!«, rief Ludwig Rellstab. »Bei mir wird er nicht so leicht ablehnen können. Und ich kenne einige Leute, die uns die Türe öffnen könnten, Heinrich Strack zum Beispiel, seinen Hofarchitekten.«
Friedrich von Gräbendorff bedankte sich und verließ, Ludwig Rellstab im Schlepp, die kleine Gesellschaft, um in das Dienstgebäude des Handelsministers zurückzukehren, in die ehemalige Gold- und Silbermanufactur in der Wilhelmstraße 79. Dort war es in letzter Zeit sehr laut, denn das Gebäude wurde nach Plänen von Friedrich August Stüler um ein Stockwerk erhöht. An seinem Schreibtisch angekommen, läutete er nach dem Bureaudiener und fragte das devote Männlein, ob etwas Wichtiges anliegen würde. Das war nicht der Fall.
»Gut, dann bin ich den Nachmittag über außer Haus. Sollte der Herr Minister nach mir fragen, so richten Sie ihm bitte aus, dass ich wegen der Rede zur fünfhundertsten Borsig-Lokomotive unterwegs bin.«
Damit verließen die beiden Männer das Ministerium und schlenderten zum Gensdarmen-Markt, denn es war zu vermuten, dass sich Heinrich Strack zu dieser Zeit im Café Stehely aufhalten würde. Und richtig, er saß dort im Roten Salon an einem der hinteren Tische und war in die Lektüre der Vossischen Zeitung vertieft. Rellstab trat näher, entschuldigte sich für die Störung, stellte von Gräbendorff vor und bat, kurz sein Anliegen vortragen zu dürfen.
»Aber natürlich!«, rief Heinrich Strack, hörte sich alles an und versprach, mit Borsig in den nächsten Tagen zu reden. »Ich vermute einmal, dass der Gute sich geschmeichelt fühlen und Ihrem Besuch zustimmen wird.«
Keine Woche später saßen sie August Borsig in dessen Moabiter Villa gegenüber und fragten ihn, wie denn wohl bei ihm alles angefangen und seinen Lauf genommen habe.
»Nun, meine Herren …« Borsig schloss die Augen, um sich zu sammeln. »Ich sehe alles noch genau vor mir … Auch wie ich als Kind durch die Werkstatt meines Vaters laufe und mir überall Splitter einreiße … Aber ich will nicht zu weit ausholen … Die Zeit der französischen Besatzung lassen wir am besten beiseite und beginnen erst mit den Tagen, da ich schon ein reifer Knabe war, dreizehn Jahre alt, und mich darin übte, ein tüchtiger Zimmermann zu werden. Anderes schien in meiner Familie auch gar nicht möglich. Nun denn, wir schreiben das Jahr 1817 und begeben uns nach Breslau in die Neudorfstraße …«
Kapitel eins1817
Obwohl er Klassenbester war, ging August Borsig nicht gern zur Schule, aber sie gehörte halt zum Leben. Und die längste Zeit hatte er schon hinter sich, bald wurde er konfirmiert und kam in die Lehre.
»Wo war ich stehengeblieben?«, fragte der Lehrer hoch oben vom Katheder her.
»Nirgendwo«, antwortete Walter Rawitsch, Borsigs Freund und Nebenmann. »Sie sitzen doch.«
Das Gelächter der anderen quittierte Wilhelm Mistek damit, dass er Rawitsch nach vorne kommandierte. Das konnte er gut, denn er war ein altgedienter preußischer Feldwebel. Rawitsch musste die Finger seiner rechten Hand ausstrecken und nach oben drehen. Die fünf Hiebe mit der Haselrute steckte der Junge weg, ohne aufzuschreien. Er galt als harter Hund, und alle bewunderten ihn – auch Borsig. Mit Leuten wie Walter Rawitsch hätten sich die Preußen 1806 bei Jena und Auerstedt nicht so schmählich in die Flucht schlagen lassen.
»Beim Hausbau bin ich stehengeblieben«, sagte Mistek. »Da liegen Steine, Ziegel, Mörtel und Balken auf dem Boden herum – und ein Jahr später steht dort ein wunderschönes Haus. Wie kommt das?«
Mehrere Finger schnellten in die Höhe, denn die Antwort schien nicht schwer. »Weil da Maurer, Zimmerleute und Dachdecker am Werke waren.«
Mistek nickte. »Richtig! Aber kommen die am Morgen einfach so auf die Baustelle und fangen nach Lust und Laune an, der eine greift sich einen Stein, der andere einen Balken – und dann macht jeder Seins?«
»Nein, da ist noch ein Polier, der aufpasst!«, rief Walter Rawitsch.
Der Lehrer herrschte ihn an: »Du schreibst zu Hause fünfzig Mal: Ich habe mich in der Schule zu melden, bevor ich den Mund aufmache. Doch ansonsten gut beobachtet. Da ist also ein Polier, der alles überwacht. Aber reicht das?«
Nun gab es nur noch einen, der sich meldete – und das war August Borsig. »Nein, da muss vorher einer sein, der sich ausgedacht hat, wie das Haus gebaut werden soll.«
»Bravo, Borsig! Und wie nennt man einen solchen Mann?«
Und wieder wusste nur Borsig, was gemeint war. »Einen Baumeister. Knobelsdorff.«
Mistek war beeindruckt. Was dieser Zwölfjährige schon alles wusste! Dennoch musste er schmunzeln. »Nun, der Erbauer des Berliner Opernhauses und des Schlosses von Sanssouci wird nicht gerade zum Breslauer Ring kommen, um hier ein Bürgerhaus zu errichten, zumal er seit 1753 tot ist. Aber es stimmt, dass es neben den Materialien und der menschlichen Arbeitskraft jemanden geben muss, der eine Idee hat und sie zu Papier bringt, also Zeichnungen anfertigt, nach denen sich der Polier und die Maurer und Zimmerleute zu richten haben. Aber wer ist es, der dem Baumeister seine Idee eingibt?« Keiner meldete sich, was Mistek etwas verstimmte. Nur gut, dass der Pfarrer nicht im Schulhaus war und ihn wegen dieses Mangels tadelte! August Borsig war seine letzte Hoffnung. »Nun, wer fehlt uns noch, wenn ein vortreffliches Haus entstehen soll?«
Borsig überlegte einen Augenblick. »Na, der Bauherr.«
Mistek runzelte die Stirn. »Wie?«
»Na, einer muss doch das Geld haben und dem Architekten sagen, wie er das Haus haben will, und nachher die Arbeiter und die Steine und Balken und das alles bezahlen.«
»Gut, das mag ja sein, aber die alles entscheidende Kraft ist Gott. Ohne den Willen und die Gnade des Herrn geht es nicht.« Und er erhob sich, um an die Tafel zu gehen und zu schreiben:
Johannes 4, 24: Gott ist Geist.
Markus 9, 23: Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Seit der Völkerschlacht bei Leipzig und dem Ende der Befreiungskriege waren nicht einmal dreieinhalb Jahre vergangen, und im Januar 1817 zeigte sich das preußische Bürgertum ebenso erschöpft wie resigniert. Die Erschöpfung rührte vom langen Kampf gegen Napoleon her, die Resignation hatte ihren Grund in den geplatzten Träumen, denn beim Wiener Congress war allen liberal-demokratischen und patriotisch-nationalen Bestrebungen ein Riegel vorgeschoben worden. Der König hatte seinem Volk eine Verfassung versprochen, dieses Versprechen aber niemals eingelöst. Das fortschrittliche Bürgertum zog sich in seine vier Wände zurück, die Zeit der Restauration und des Biedermeiers begann. In Europa gingen die Uhren nun langsam und in Breslau noch etwas langsamer, doch aufzuhalten war das neue Zeitalter – das der Industrie – nicht mehr. Keiner hatte eine Ahnung von dem, was in den nächsten fünfzig Jahren passieren sollte, auch August Borsig nicht, obwohl er eine herausragende Persönlichkeit dieses neuen Zeitalters werden sollte.
Trafen sie sich im kleinen Haus des Zimmermannes Johann George Borsig in der Neudorfstraße, um zu Abend zu essen, dann redeten sie weniger über die Zukunft als über das, was gewesen war. Den Ton gab der Vater an, und auch heute kam er wieder auf die Schlacht bei Großgörschen zu sprechen, die am 2. Mai 1813 geschlagen worden war und an der er als Kürassier im Regiment von Dolffs teilgenommen hatte.
»Wir haben beim Dorfe Starsiedel gestanden, und als die Brigade Klüx die Franzosen angegriffen hat, sind wir nach links herausgerückt, um deren Flanke zu decken. Doch schnell ist alles ins Stocken geraten.«
August Borsig hörte zwar zu, aber das Ganze interessierte ihn nur wenig. Als Napoleon Einzug in Berlin gehalten hatte, war er noch zu klein gewesen, das alles zu begreifen, und erst die schrecklichen Berichte und Bilder vom Russlandfeldzug 1812/13 hatten sich bei ihm eingebrannt. Da war er schon acht Jahre alt, und Alpträume quälten ihn. Wie der Sturm über die Ebene an der Beresina fegte und plötzlich eine Hand aus einer hohen Schneewehe ragte … Ein dunkelblauer Uniformärmel mit rotem Aufschlag folgte ihr … Ein französischer Grenadier kam zum Vorschein … In seiner Brust steckte ein Bajonett. Da schrie August dann mitten im Schlaf auf. Auch an die vielen Soldaten musste er denken, die durch Breslaus Straßen gelaufen waren, an die blauen Grenadiere des Franzosenkaisers, an die schwarzen Kosacken, an die bunten Jäger und Reiter. Der Vater war auf einem Braunen als stolzer Kürassier durch Breslau geritten, und seine prächtige Uniform hing noch immer im Schrank. Auch den langen, breiten Säbel hatte er aufbewahrt, den Helm, das Bandolier und die schweren, hohen Reiterstiefel mit den angeschnallten Sporen. Das alles erfüllte den Jungen eher mit Angst denn mit Ehrfurcht. Krieg und Soldatensein waren einfach nicht seine Sache. Dazu war er zu weich, das fühlte er, nahm es aber nicht als Mangel, zumal für ihn feststand, dass es, solange er lebte, keinen Krieg mehr geben würde.
Der Vater kam von seinen Erinnerungen nicht mehr los. »Fast vier Jahre sind es nun her … Mitte März, Schnee und Eis waren gerade weggetaut, da zieht der Zar in Breslau ein … Und unser König lässt an alle Mauern große Bögen mit seinen Aufrufen anschlagen: An mein Volk! Jetzt geht es gegen den verhassten Franzosenkaiser. Das schlesische Freikorps wird in der Kirche von Rogau eingesegnet, und alle singen … Na, was singen sie?«
Er sah die Seinen erwartungsvoll an, aber nur August kannte den Text. Mistek hatte ihn den Kindern wochenlang eingetrichtert. Und so konnte der Junge das Lied nun aufsagen:
Der Herr ist unsere Zuversicht, Wie schwer der Kampf auch werde. Wir streiten ja für Recht und Pflicht Und für die heil’ge Erde. Drum retten wir das Vaterland, So tat’s der Herr durch unsere Hand. Dem Herrn allein die Ehre!
»Bravo!«, rief der Vater. »So ist es recht für einen guten Preußen. Theodor Körner hat das gedichtet, einer, der in Major Lützows Freischar mitgekämpft hat.«
August hatte noch deutlich das Bild vor Augen, wie sich auf den Plätzen Breslaus ganze Züge von Freiwilligen gebildet hatten, um sich in den Bierschenken für das Lützow’sche Corps einschreiben zu lassen. Was war er froh gewesen, erst neun Jahre alt zu sein! Denn es grauste ihm davor, von einer französischen Kugel niedergestreckt zu werden, bevor er richtig gelebt hatte. Als dann der Kanonendonner über die Hügel Schlesiens gerollt war, hatten die anderen Jungen beim Soldatenspiel als Blücher und Gneisenau, als Ney und Marmot agiert, er dagegen hatte die Rolle des Feldschers, der sich um die Verwundeten zu kümmern hatte, zugewiesen bekommen. Keiner traute ihm zu, ein richtiger Feldherr zu sein – was ihn ziemlich kränkte. Mit in den Jubel eingefallen aber war er, als im Oktober überall in Schlesien die Glocken des Sieges geläutet hatten.
Nach dem Essen hockte man dann im milden Schein einer Rüböllampe gemütlich auf der hölzernen Bank, die sich um den grünen Kachelofen zog, und beschäftigte sich bis zur Schlafenszeit mit nützlichen Dingen. August, sein Vater und sein Bruder Gottlieb schnitzten Figuren, Tiere zumeist, und Flöten, während die Mutter und seine größeren Schwestern, die Susanne und die Eleonore, strickten. Luise, das Nesthäkchen, gerade einmal drei Jahre alt, schlief schon selig in der Kammer der Eltern.
An der Wand hing der kunstvoll gezeichnete Stammbaum der Familie Borsig, und aus dem ging hervor, dass es für die Männer eigentlich nur einen Beruf gegeben hatte: den des Zimmermanns. Und auch August Borsig zweifelte keinen Augenblick daran, Zimmermann zu werden. Wie sein Vater, wie sein Großvater, wie sein Onkel Christian. »Das liegt uns eben im Blut«, hieß es. Und nach dem Geruch frischen Holzes war der Junge geradezu süchtig. Holz war ein lebendiger Stoff, Holz konnte man formen. Aus einer biegsamen Rute wurde ein Flitzbogen, aus einem Klotz schnitzte er einen Kopf, aus Brettern und Balken baute er sich hinten im Garten ein Häuschen oben in der Baumkrone. Und in jeder freien Minute besuchte er seinen Vater, um ihm auf der Baustelle zur Hand zu gehen, vor allem aber, um zu schauen und zu lernen. Mit seinen zwölf Jahren wusste er schon eine Menge über die Kunst des Dachstuhlbaus. Der Stuhl war ein Gestell, auf dem die Holzkonstruktion ruhte, welche wiederum die Dachhaut trug. Und selbstverständlich wusste er, was Sparren waren, Firstbretter und Fuß- und Mittelpfetten.
Der Winter war lang, und es gab für einen Zimmermann wenig zu tun, und so freute sich Johann George Borsig, als er Anfang Februar von Meister Ihle den Auftrag erhielt, zu einer kleinen, aber sehr dringenden Reparatur ins Haus des Geheimen Regierungsraths Ludger Krauthausen zu eilen. Der Sturm in der gestrigen Nacht habe dessen altersschwachen Schornstein einstürzen lassen, und dabei seien nicht nur die Dachziegel zerschlagen worden, sondern auch einige morsche, weil von Würmern zerfressene Sparren zu Bruch gegangen.
Es war Sonntag, und so fragte August, ob er den Vater begleiten dürfe. Es wurde ihm zugestanden, und so machten sich beide gleich nach dem Frühstück auf den Weg. Es war die Schweidnitzer Vorstadt zu durchqueren, bis sie den Stadtgraben erreichten. Dem folgten sie Richtung Westen, um nach knapp einem Kilometer den Königsplatz zu erreichen, von dem die Nicolaistraße abging. Hier, zwischen Barbara-Kirche und Residenz-Theater, hatte Krauthausen, der aus den preußischen Rheinprovinzen an die Oder versetzt worden war, Quartier genommen. Gerade hatten sie ihr Ziel erreicht, da kam auch Meister Ihle mit seinem Pferdefuhrwerk, und sie luden erst einmal alle Hölzer ab, die sie brauchten, um die maroden Teile zu ersetzen.
»Dann wünsche ich frohes Schaffen!«, sagte Ihle und machte sich wieder auf den Heimweg, um seine Sonntagsruhe zu genießen. Sein Polier würde es schon richten.
Das Mädchen öffnete ihnen, nachdem sie am Klingelzug gerissen hatten, und führte sie auf den Dachboden hinauf.
Bis zum Mittagessen hatten Vater und Sohn alles sauber ausgebessert, so dass der Dachdecker gerufen werden konnte. Als sie wieder herabgestiegen waren und auf dem Weg zur Straße waren, ging im Hausflur unten eine Tür auf, und eine weißgekleidete Gestalt erschien.
»Ein Gespenst!«, rief August Borsig und wich im Reflex zurück.
Doch wer ihnen da den Weg verstellte, war kein anderer als Ludger Krauthausen, eine der berühmten rheinischen Frohnaturen. Untersetzt und schwarzhaarig war er, was nur daran liegen konnte, dass vor rund zweitausend Jahren ein römischer Legionär ein germanisches Mädchen geschwängert hatte. Um sich ein bisschen Heimat nach Schlesien zu holen, wollte er am Fastnachtssonntag einen närrischen Maskenball feiern.
»Und zu dieser Maskerade gehe ich als Kaiser Nero«, erklärte er den Borsigs. »Meine Frau hat mir gerade meine Toga abgesteckt.« Er bemerkte die fragenden Augen des Jungen. »Du weißt nicht, wer Nero war?«
»Doch …« August Borsig zögerte mit einer Erläuterung, da er sie als unschicklich empfand. Aber der Geheime Rath schien ja Spaß zu verstehen, und so sagte er schließlich, dass Nero der im letzten Jahr verstorbene Hund des Zimmermeisters Ihle gewesen sei.
Krauthausen lachte und nahm sich die Zeit, dem Jungen einen kleinen Vortrag zu halten. »Nero kam aus der julisch-claudischen Dynastie und war von 54 bis 68 nach Christi Geburt Kaiser des Römischen Reiches. Er sah sich als großer Dichter und Sänger, und kurz vor seinem Tod soll er immer wieder ausgerufen haben: ›Welch Künstler geht mit mir zugrunde!‹«
Kaiser sein, Herr und Herrscher über viele Menschen, das faszinierte August Borsig. Nicht immer nur Befehle entgegennehmen – ob nun vom Vater oder von Mistek –, sondern tun und lassen, was man selbst wollte. Von nun an träumte er immer wieder, einmal Herr zu sein.
Den Borsigs selbst verging die Lust zum Feiern, denn aus Nieder-Pontwitz kam die Nachricht, dass die Oma im Alter von 68 Jahren unerwartet verstorben war. Die Großeltern hießen noch Burzik, George und Johanna Burzik, und erst als ihr Sohn Johann George nach Breslau gegangen und Susanna Catharina Werner geehelicht hatte, war durch einen Schreibfehler des Standesbeamten aus Burzik Borsig geworden. Manche vermuteten auch, er habe den Namen still und heimlich eindeutschen wollen oder aber Borsig für wohlklingender gehalten als Burzik.
Von Breslau nach Nieder-Pontwitz, das im Fürstenthum Oels gelegen war, brauchten sie bei bitterer Kälte und auf teils noch vereisten Straßen mit der Kutsche, die sie sich geliehen hatten, mehr als drei Stunden, und sie kamen gerade vor der Dorfkirche an, als der Pfarrer zur Rede ansetzte.
»Wir sind traurig, Herr, denn wir müssen für immer Abschied nehmen von einem Menschen, der uns so vertraut war wie niemand sonst. Mit seinem Tod geben wir auch einen Teil von uns selbst dahin.«
Da schossen dem Jungen die Tränen in die Augen. Zwar war in den Tagen der Napoleonischen Kriege viel vom Sterben die Rede gewesen, aber immer hatte es nur die anderen getroffen, und es war Mitleid gewesen, aber nicht Leid. Seine Großmutter war auch einmal so jung gewesen wie er, ein gesundes und kraftvolles Mädchen … Nun lag sie im Sarg, und auch er würde am Ende seiner Tage in einem solchen Sarg liegen, während die anderen trauerten. In diesen Sekunden begriff August Borsig, dass auch er sterblich war, und das war für ihn eine furchtbare Erkenntnis. Zugleich schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass es Menschen gab, die unsterblich waren, Friedrich II. von Preußen oder dieser Kaiser Nero beispielsweise. Nur wer Großes leistete, konnte damit rechnen, unsterblich zu werden.
Der Rest des Februars und der März 1817 verliefen ohne Ereignisse, die sich im Gedächtnis der Jungen festgesetzt hätten, und das Gleichmaß der Tage wurde erst mit den Ostertagen beendet. Der Ostersonntag fiel in diesem Jahr auf den 6. April, und am Karfreitag kam seine Tante Anna, die fünf Jahre jüngere Schwester seines Vaters, für ein paar Tage zu Besuch. Sie war in Trebnitz bei einem hohen Offizier in Stellung. Anna Borsig galt als etwas verschroben, »nerrsch«, wie die Schlesier sagten, und glaubte an gute wie an böse Geister. Schon am ersten Abend erschreckte sie die Kinder mit ihren Erzählungen.
Der Vater musterte seine Schwester. »Nu, mein Madla, du siehst mir gar nicht gut aus. So blass und dünne.«
»Ja, da magst du recht haben, Johann, das kommt von diesem dreimal verfluchten Czaja!«
Die Breslauer staunten, denn Joachim Czaja, ihr Verlobter, ein Kürassier aus Steinau an der Oder, war schon seit über zwanzig Jahren tot. Er war kurz vor der geplanten Heirat vom Pferd gefallen und hatte sich den Hals gebrochen.
»Trauerst du noch immer um ihn?«, fragte Susanna Borsig, ihre Schwägerin.
»Nein, das nicht. Aber er ist ein Nachzehrer.«
Was das war, wusste August: ein Toter, der unter der Erde liegt oder sitzt und seinen Hinterbliebenen die Lebenskraft absaugt. Im Gegensatz zum Vampir kam er niemals aus seinem Grab heraus.
»Das mit dem Nachzehrer, das ist doch Mumpitz!«, rief der Vater.
»Das ist es nicht!«, beharrte die Tante. »Als er beerdigt worden ist, haben wir vergessen, etwas auf seine Brust zu legen, das ihn gebannt hätte, ein Messer oder eine Schere.«
Als Anna Borsig am Ostersonnabend mit ihrem Neffen durch die Breslauer Innenstadt schlenderte, entdeckte sie in der Nähe der St.-Elisabeth-Kirche die Stube einer Wahrsagerin.
»Das kann ich mir nicht entgehen lassen, mein Jingla!«, rief sie. »Und du kommst mit!«
»Nein, ich …«
Sie zog ihn mit sich zur Haustür. »Sei kein Plotsch!«
Ein Plotsch, ein Dummkopf, wollte er nicht sein, also ging er mit. Auch damit er seinem Freund Walter Rawitsch etwas zu erzählen hatte. Die Wahrsagerin erinnerte ihn stark an die Hexe aus Hänsel und Gretel. Er begann sich zu fürchten. Seine Tante aber plauderte ganz unbefangen mit ihr, und so widerstand er dem Impuls davonzulaufen.
»Mein Neffe zuerst!«, sagte Anna Borsig. »Ich bin mal gespannt, was aus ihm werden wird.«
Die Wahrsagerin starrte in ihre Kristallkugel, in der sich das Licht einer dicken Kerze brach. August zitterte nicht gerade vor Erwartung, aber gespannt war er doch, sosehr er das alles für Humbug hielt.
»Ich sehe eine Menge … Du bist ein Liebling der Götter, hoch sollst du steigen – aber mit einem Schlag kann alles aus sein.«
Schien es in Breslau, als würde die Welt auf ewig bleiben, wie sie gerade war, so geschah anderswo vieles, was sie völlig verändern sollte. Man brauchte das Eisen nicht mehr, um Kanonenrohre zu gießen, es konnte zu anderem verwendet werden. Es begann die große Stunde der Tüftler und Erfinder. Auch bildete sich – vor allem in England – ein Menschentyp heraus, der Neues schaffen wollte und viel damit verdiente, dass er andere für sich arbeiten ließ: der moderne Unternehmer. Erfüllt von der puritanischen Idee, dass nur harte Arbeit Gott gefiel, man aber das verdiente Geld nicht verprassen durfte – denn jede Lust, insbesondere die des Fleisches, war Sünde –, häuften diese Männer so viel Kapital an, dass sie neue Unternehmen gründen und neue Märkte erobern konnten.
John Wilkinson, 1728–1808, genannt Iron Mad Wilkinson, der aus einer Familie von Eisenhüttenleuten kam, baute 1747 in Lancashire seinen ersten Hochofen und erfand eine Präzisionsbohrmaschine zum Ausbohren von Kanonenrohren. Obwohl ihn ganz England auslachte, schuf er das erste Schiff aus Eisen. Er war so besessen von diesem Werkstoff, dass er sich sogar in einem gusseisernen Sarg begraben ließ.
Benjamin Huntsman, 1704–1776, von Hause aus Uhrmacher, experimentierte so lange, bis er flüssigen Stahl, Gussstahl, herstellen konnte.
James Watt, 1736–1819, gelernter Mechaniker, verbesserte den Wirkungsgrad der alten Wasserhebe-Dampfmaschinen in den englischen Gruben und machte sie zum Prototyp der modernen Maschine.
Aber auch in Deutschland begann es sich zu regen: Friedrich Krupp, 1787–1826, gründete 1810 mit dem Geld, das er von seiner Großmutter geerbt hatte, die »Firma Friedrich Krupp zur Verfertigung des Englischen Gußstahls und aller daraus resultierenden Fabrikationen«.
Eine Ahnung von dieser modernen Welt sollte August Borsig bekommen, als er Meister Ihle und seinen Vater bei einer Reise nach Tarnowitz begleiten durfte. Das lag 170 Kilometer südöstlich von Breslau, nahe an der Grenze zum sogenannten Congresspolen, das Teil des russischen Zarenreichs geworden war. Sie waren, da Ihles Fuhrwerk mit einigen Ersatzteilen schwer beladen war, mehrere Tage unterwegs. Mit der Schule nahm das keiner so genau, und wenn August ein paar Stunden versäumte, machte das nichts.
Der Junge hatte gestaunt. »Was hat denn ein Zimmermann mit einer Dampfmaschine zu tun? Die ist doch aus Eisen – was soll er da reparieren?«
Die beiden Männer erklärten ihm die Sache: Beim Bau der ersten Dampfmaschinen taten sich Zimmerleute, Schmiede, Schlosser, Eisengießer und Feinmechaniker zusammen, und bei ihren Konstruktionen war noch viel Holz im Spiel. So bestand der – neben dem Dampfzylinder – wichtigste Teil der Maschine, der unförmige und viele Zentner schwere Schwingbaum, aus Eichenholz, das heißt aus mehreren splitterfesten Balken, die in sauberer Zimmermannsarbeit aneinandergefügt worden waren. Diese Arbeit hatte Ihle vor Jahren auf der Friedrichsgrube in Tarnowitz für einen gewissen Friedrich Wilhelm Holtzhagen ausgeführt, dem inzwischen die Aufsicht über alle Dampfmaschinen der Berg- und Hüttenwerke Ober- und Niederschlesiens übertragen worden war.
»Jetzt sind einige Balken zu erneuern, und da hat uns Holtzhagen nach Tarnowitz gerufen«, schloss Ihle.
Als August Borsig vor der ersten Kolbendampfmaschine seines Lebens stand, empfand er sie im ersten Augenblick als ebenso geheimnisvoll wie bedrohlich. Klein kam er sich vor und so verletzlich wie eine Ameise, die auf den Amboss eines Schmiedes geklettert war. Langsam aber begriff er, dass sie Menschenwerk war und von Menschen kontrolliert wurde. Was ihn am meisten beeindruckte, waren die ungeheuren Kräfte, die mit dieser Maschine erzeugt und in Arbeit umgesetzt wurden. Dabei war alles ganz einfach: Man nahm Kohle und erhitzte damit das Wasser so weit, dass es zu Dampf wurde. Und in diesem Dampf – wurde er gebändigt und in richtige Bahnen gelenkt – steckte mehr Energie, als Hunderte von Menschen und Dutzende von Pferden aufzubringen vermochten. Holz und Eisen gehörten auch noch dazu, eine Menge Handwerker und natürlich einer, der sich das alles ausdachte und auf große Bögen zeichnete. Genau so hatte es ihnen Mistek beim Bau eines Hauses erklärt. So etwas zu können steckte im Menschen, wie es in den Bienen steckte, sich ihre Waben und Stöcke zu bauen. Im Menschen? Nein, nicht in allen, nur in einigen.
Dass er zu diesen wenigen Menschen gehörte, war August Borsig an diesem Tag von Tarnowitz zu keiner Sekunde bewusst. Er sah in diesen Jahren nur alles, nahm nur auf, was ihm begegnete, und speicherte es irgendwo im Gedächtnis, ohne dass das eine mit dem anderen zusammenkam. Seine Großmutter hatte immer gesagt: »Mit den Augen kann man stehlen« – also stahl er ununterbrochen. Er hatte jedoch keine Absicht, dies irgendwann einmal zu benutzen – es war der reine Spaß am Stehlen, der ihn trieb.
Nun gut, manchmal kramte er etwas hervor, wenn in der Schule nach bestimmten Sachen gefragt wurde. So wollte Mistek kurz vor den Sommerferien wissen, wo die Oder entspringt.
»In Polen!«, riefen alle.
»Falsch.«
»Im Kaiserthum Oesterreich«, sagte August Borsig. Das hatte ihm Meister Ihle auf der Fahrt nach Tarnowitz erklärt.
»Wieso entspringt die?«, fragte Walter Rawitsch. »Die Oder ist doch kein Sträfling.«
»Rawitsch, die Finger!« Der Lehrer holte seine Haselrute hervor.
Augusts Freund nahm das Züchtigungsritual klaglos hin. Seine Rache bestand darin, dass er Mistek an einem der nächsten Tage scheinbar arglos fragte, ob sein Name vom Englischen mistake – Fehler – herkäme. Darauf hatte ihn sein Vater gebracht.
Mistek blickte böse, entschloss sich dann aber, nicht aus der Haut zu fahren, sondern die Sache mit Humor zu nehmen. »Richtig! Ich bin in London geboren worden und war Hauslehrer der englischen Prinzen. Als ich nach Breslau gekommen bin, haben sie den Namen Mistake dann eingedeutscht in Mistek.« Dass viele seiner ehemaligen Schüler ihn Miststück nannten, wusste er nicht.
Endlich war die Schule aus. Auf dem Nachhauseweg kamen August und Walter an einer Glaserei vorbei, die sich nebenbei darauf spezialisiert hatte, Ölbilder einzurahmen und zum Verkauf auszustellen. Diese Gemälde wurden ihr von berufsmäßigen Kunstmalern, aber auch Amateuren zugeliefert. Die Auswahl an Motiven war nicht eben groß. Da war die Oder und nochmals die Oder, dann gab es röhrende Hirsche und balzende Auerhähne im schlesischen Bergland und schließlich das Breslauer Rathaus und die Naschmarktseite des Ringes. Das alles interessierte August Borsig nur mäßig, ein Bild aber beschäftigte ihn Tag und Nacht und tauchte sogar in seinen Träumen auf: der Anblick eines Südsee-Atolls. Ein Schoner ankerte unter üppigen Palmen. Bougainville vor Tahiti stand auf dem Schildchen, das am Rahmen klebte.
»Palmen!«, rief Borsig. »Ich liebe Palmen über alles!«
»Dann kauf dir doch den Schinken, und häng ihn dir übers Bett«, riet ihm Walter Rawitsch.
»Das würde ich ja gern, aber was das kostet! Woher soll ich das Geld nehmen?« Von seinen Eltern bekam er kein Geld dafür, und sich das Palmenbild zum Geburtstag oder zu Weihnachten zu wünschen hatte auch keinen Zweck, da gab es zum Geschenk immer nützliche Sachen.
Nach einigem Hin und Her trauten sie sich in den Laden, um mit dem Glasermeister zu handeln, doch der ließ sich nicht erweichen und blieb bei einem Preis, der den Jungen astronomisch hoch erschien. Auch wenn er jeden Groschen sparte, den er ab und an von Meister Ihle und seinem Vater bekam, nachdem er ihnen bei der Arbeit geholfen hatte, er hätte lange Monate gebraucht, bis er das Bild hätte kaufen können – zu lange, denn bis dahin war bestimmt jemand gekommen und hatte es ihm weggeschnappt.
Wie konnte man als Junge zu Geld kommen? Sosehr er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er fand keinen Weg … Bis sein Blick eines Tages, als er seinem Vater beim Bau eines Dachstuhls in der Berliner Straße geholfen hatte, auf einen Haufen abgesägter Sparren, Balken und Bretter gefallen war. Es war der ganze Abfall, den Meister Ihle irgendwann mit seinem Pferdefuhrwerk abholen ließ, um ihn hinten im Hof verrotten zu lassen. Wenn nun Walter und er diese Reste mit Beil und Säge zerkleinerten und den Leuten als Anmachholz verkauften, dann …
»Mensch, das ist die Idee!«, rief der Freund am nächsten Morgen, denn auch im Sommer brauchte man Kleinholz zum Feueranmachen. In jeder Küche stand ja ein Herd, auf dem sieben Tage in der Woche gekocht werden musste.
Sie machten sich ans Werk, und August Borsig hatte den richtigen Riecher gehabt: Sie nahmen so viel ein, dass er schon bald an den Kauf des Palmenbildes denken konnte.
»Das werde ich mir selbst zum Geburtstag schenken!«, rief er.
Doch bevor es so weit war, erschien der Polizei-Commissarius in der Neudorfstraße, um seinen Vater zur Rede zur stellen. »Der Rentier Chalupka aus der Berliner Straße bezichtigt Ihren Sohn des Holzdiebstahls.«
August hatte nicht bedacht, dass der Abfall strenggenommen nicht Meister Ihle oder seinem Vater gehörte, sondern dem Bauherrn, und der war kein großzügiger Mensch, sondern einer, der sich wegen jeder Kleinigkeit mit seinen Nachbarn stritt.
Der Vater, der von der Geschäftsidee seines Sohnes nichts gewusst hatte, sah ein, dass er am kürzeren Hebel saß, und ersetzte Chalupka den Schaden. Große Schelte gab es nicht, denn die Eltern fanden es gut, was ihr Sohn da versucht hatte – aber sein geliebtes Palmenbild, das konnte August nun für immer und ewig vergessen.
Sein dreizehnter Geburtstag am 23. Juni stand ins Haus. Als wäre seine Existenz nicht Beweis genug, zeigte ihm seine Mutter kurz vor diesem Tag den Taufschein.
Militaria
Ein Tausend acht hundert und vier (1804) den dreiundzwanzigsten Junius ist zu Breslau dem Cairassier im Regiment v. Dollfs bei der 4. Leib-Eskadron, Johann George Bursig von seiner Ehefrau Susanna geb. Werner, EIN SOHN geboren worden, welcher den sechsundzwanzigsten desselben Monats getauft worden ist und die Namen erhalten hat Johann Friedrich August.
Solches wird hierdurch aufgrund des Kirchenbuches obengenannten Regiments von Amts wegen attestiert.
S. G. Böhm, Garnisonspfarrer
August staunte, dass da nun noch eine weitere Variante seines Nachnamens zu finden war, nämlich Bursig. Wie auch immer – Borsig gefiel ihm am besten.
Als er am Morgen des 23. Juni seinen Geburtstagstisch sah, stieß er einen Jubelschrei aus, denn was mitten auf ihm prangte, war das heißbegehrte Palmenbild. Was er in diesem Augenblick fühlte, war das Urvertrauen in die Welt: Alles war gut, auch das, was noch kommen sollte, das Leben war ein großes Geschenk Gottes.
Zum Geburtstagskaffee kamen seine Tante Anna aus Trebnitz, sein Großvater George Burzik und sein Onkel Christian Borsig, beide aus Nieder-Pontwitz, sowie sein Freund Walter Rawitsch. Man sprach weithin »Schläsch«, sagte also nicht schmatzen, sondern katschen, Lorke zum dünnen Kaffee, Koochmannla zu den Pfifferlingen, Muppa statt Mund und Tschelotka für die Verwandtschaft.
Friedrich, der Onkel, führte das große Wort. Er hatte mit seinen 36 Jahren schon viel erlebt, war als Zimmermannsgeselle auf der Walz gewesen und durch halb Europa gezogen und hatte seine Militärzeit im Leib-Kürassier-Regiment Großer Kurfürst in Berlin verbracht. Sprach er von der preußischen Residenz, dann geriet er ins Schwärmen.
»Ich habe ja viele Städte gesehen, aber nichts geht mir über Berlin!«, rief er enthusiastisch. »Wie gern war ich Unter den Linden! Das Opernhaus ist das schönste der Welt, und daneben steht die Königliche Bibliothek. Und nicht zu vergessen das Schloss, das Cadettenhaus in der Neuen Friedrichstraße, den Gensdarmen-Markt, die vielen Kirchen, die vielen Theater … Alles unbeschreiblich!«
Er warf einen Blick auf das Geburtstagskind. Sein Neffe hatte ihm mit großen Augen zugehört. Nein, der August sollte um Gottes willen in Breslau bleiben, denn Berlin war nichts für ihn. Für die Residenz war er viel zu zach und zögerlich, da würde er nur untergehen und sich selbst ins Elend stürzen.
Kapitel zwei1819
Meister Georg Ihle hatte schon so manchen Zimmermannslehrling unter seinen Fittichen gehabt, aber einem solch begabten Schüler wie August Borsig war er noch nie begegnet.
»Der Junge hat die Hände an der richtigen Stelle«, sagte er zu Hinke, seinem Polier. »Manche haben ja zwei linke Hände …«
»Kein Wunder«, brummte Hinke, »Sie wissen doch, das liegt dem Borsig im Blut … Der Großvater, der Vater, der Onkel – alles Zimmerleute.«
»Im Blut wird es weniger liegen, eher hat er sich alles bei seinem Vater abgesehen – und bei mir.«
»Nee, Meister, das ist der Instinkt bei dem. Entweder man hat’s, oder man hat’s nicht – und der Borsig hat es.«
Es war wirklich eine Freude, August zuzuschauen, wie unglaublich geschickt er mit Axt, Säge, Stemmeisen und Fuchsschwanz hantierte. Und alles, was neu war, erfasste er im Nu. Was er in Angriff nahm, gelang ihm, und nichts musste weggeworfen werden, egal, ob mit der Axt Balken zu behauen waren oder er Schrägen und Gehrungen zu sägen hatte. Und die Nuten und Zapfen, die mit dem haarscharf geschliffenen Stechbeitel herzustellen waren, passten immer. Auch wenn es galt, für einen Bauherrn etwas zu zeichnen, war er schnell bei der Hand und brachte etwas zu Papier, mit dem sich arbeiten ließ.
Auch Johann George Borsig waren die Talente seines ältesten Sohnes nicht entgangen. Bei jedem Besuch hatte er mit seinem Vater darüber gesprochen, der gänzlich seiner Meinung gewesen war. Noch auf dem Totenbett – gestorben war er am 22. März 1819 – hatte George Burzik in dem Gedanken Trost gefunden, dass sein Enkel in ihm weiterleben und mehr erreichen würde als alle anderen Burziks und Borsigs zuvor.
»Aber von nichts kommt nichts«, sagte Johann Borsig zu seiner Frau. »So begabt unser August auch ist, er hat mir zu wenig Träume.«
Susanna Borsig winkte ab. »Träume sind Schäume.«
»Ach, komm! Als ich so alt war wie er, da habe ich davon geträumt, nach Amerika zu segeln und dort in den Wäldern ein großes Sägewerk zu bauen.«
Seine Frau lachte. »Und wie weit bist du gekommen? Gerade mal bis Stettin.«
»Ich hatte ja auch nicht die Gaben, die August hat«, wandte Johann Borsig ein. »Aber aus ihm kann mehr werden als ein simpler Zimmermann.«
Seine Frau nickte. »Ja, natürlich, ein Meister wie Ihle mit einer kleinen Werkstatt.«
»Nein, mehr. Wenn ich mir ansehe, was er alles gezeichnet hat …« Er holte einen Stapel Blätter seines Sohnes aus dem Spind. »Schau dir das mal an, hier … Da hat er eine riesige Kuppel konstruiert – nur aus hölzernen Dreiecken, die aneinandergefügt sind.«
»Das würde doch alles gleich einstürzen. Kuppeln muss man doch aus steinernen Bögen bauen.«
»Aber wir sind nun mal Zimmerleute!«, rief Johann Borsig. »Und ich bewundere den Jungen. In dem steckt was Großes, das weiß ich.«
»Johann, das ist doch nichts weiter als dein Ehrgeiz. Du willst, dass er aufsteigt und Baumeister wird, am Hofe womöglich, nicht er. August kommt nach mir, und mir reicht das, was ich habe. August ist ein Fluss, der träge durch die Wiesen fließt, August ist kein stürmisches Meer.«
Johann Borsig seufzte. »Da magst du recht haben, dass er gar nicht weiß, was alles in ihm steckt, und von sich aus nichts tun wird, um etwas anderes zu werden als ein guter Zimmermann. Solchem Menschen wie ihm muss man auf die Sprünge helfen, das sind wir ihm als seine Eltern schuldig.«
»Und wenn er dadurch nur unglücklich wird?«, fragte Susanna Borsig.
»Er wird glücklich werden!«, rief Johann Borsig. »Und du weißt doch, der Volksmund hat immer recht: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.«
Zwei Tage nach diesem Gespräch, als man wegen des schlechten Wetters nicht arbeiten konnte, machte sich Johann Borsig auf zur Königlichen Provinzial-Kunst- und Bauhandwerksschule, um dort im Lehrerzimmer dem Hofrath Professor Bach und dem Regierungsarchitekten Hirt seinen Sohn August ans Herz zu legen.
»Als Zimmermann steckt er jetzt schon die meisten Gesellen in den Sack«, pries er ihnen August an. »Aber er hat auch noch ganz andere Talente, und die müssen hier bei Ihnen gefördert werden, denn der König braucht tüchtige Leute, soll Preußen vorankommen und nicht hinter anderen Ländern zurückstehen. Sehen Sie sich nur einmal seine Zeichnungen an! Ob das nun gewaltige Dachstühle, hölzerne Brücken oder Kuppeln sind.«
Hirt besah sich die Blätter. »Hm, das ist alles noch ziemlich kindlich, unbeholfen und unvollkommen …«
Johann Borsig hörte es mit einigem Schmerz, sein Gesicht hellte sich aber sofort wieder auf, als der Architekt hinzufügte, dass eine gewisse Begabung nicht zu übersehen sei.
Der Hofrath ließ sich die Zeichnungen reichen, setzte die Brille auf und studierte eine nach der anderen. Johann Borsig schlug das Herz so schnell und hart, dass er die rechte Hand auf die Brust pressen musste. Nicht nur das Schicksal seines Sohnes entschied sich in diesen Sekunden, auch seines.
»Nun denn, es sei«, brummte Bach. »Der Zimmerlehrling August Borsig möge am 14. April, wenn unser neues Semester beginnt, mit Skizzenheften und Zeichengerät bewaffnet durch unsere Tore schreiten. Er soll uns herzlich willkommen sein!«
»Im Sommer«, pflegte Meister Ihle zu seinen Lehrlingen zu sagen, »fangen wir Zimmerleute schon an zu arbeiten, bevor wir aufgestanden sind, und machen durch, bis es dunkel wird.«
So rasselte in August Borsigs Kammer jeden Morgen um vier Uhr der altertümliche Wecker, den er von seinem Großvater geschenkt bekommen hatte, manchmal weckte ihn auch der Hahn des Nachbarn, der beim Krähen immer irgendwie ins Stottern kam. Gerade brachen die ersten Sonnenstrahlen durch die Krone der Birke hinter ihrem Haus. Er wusch sich kurz unter der Pumpe im Hof, aß eine Schmalzstulle, trank ein Glas frisches Wasser und eilte zur Baustelle in der Gabitzstraße. Dort band er sich seine blaue Schürze um, griff zum Werkzeugkasten und kletterte, fröhlich pfeifend, Sprosse um Sprosse die steilen Leitern hinauf, die von einem zum anderen Stockwerk führten. Die Sonnenstrahlen tauchten die schon fertigen Sparren in ein wunderbares rötlich goldenes Licht. Breslau war so schön wie eine Stadt aus Tausendundeiner Nacht. Die Gesellen waren schon zur Stelle, und der erste Axthieb des Poliers war das Signal, mit der Arbeit zu beginnen. Borsig wurde angewiesen, einen Balken, der aufgrund eines Rechenfehlers um einiges zu kurz angeliefert worden war, mit ein paar Kunstkniffen zu verlängern, aber so, dass das Anstückeln dem Bauherrn nicht auffallen würde. Er krempelte die Ärmel hoch und beeilte sich, der Weisung nachzukommen.
Die Arbeit machte ihm Spaß, und er liebte es, mit eigenen Händen etwas zu schaffen, das nützlich war und Bestand hatte. Das war eine Erlösung von den Qualen, stundenlang still in der engen Schulbank zu sitzen und nichts zu erschaffen, was man anfassen konnte – einerseits. Andererseits aber war ein Tag wie der andere, und alles drehte sich irgendwie im Leeren. Dazu kam, dass er immer das tun musste, was andere von ihm verlangten, der Polier ebenso wie Ihle.
»Lehrjahre sind keine Herrenjahre«, sagte der Vater, als er ihm von seinen Bedrückungen berichtete. »Aber wer immer strebend sich bemüht, der kann es wohl schaffen, selbst einmal ein Herr zu werden.«
Ein wenig Abwechslung brachten die Bauherren, wenn sie mit besorgter Miene, unbeholfen und ängstlich die Leitern hochkletterten, um zu sehen, ob alles auch vorankam.
»Sagen Sie, Meister, mein Haus bekommt doch noch vor dem Winter sein Dach?«
»Aber ja!«, wurde ihm von Ihle versichert, und der Meister trieb seine Leute mit lauten Zurufen an, noch schneller zu arbeiten.
Nicht, dass die beiden Gesellen besonders derbe Menschen waren – aber das meiste, was sie miteinander besprachen, drehte sich um das andere Geschlecht. Mit welchem Mädchen sie gerade angebandelt hatten, welche Frau zu haben war und bei welcher sie garantiert auf Granit bissen. August Borsig hatte diesem Thema bisher wenig Beachtung geschenkt, denn wie junge Mädchen an sich waren – zwar hübsch anzusehen, aber immer schnippisch und zickig –, das wusste er von seiner Schwester Susanne, und seine Neugierde hielt sich in Grenzen. Wie Frauen »untenherum« gebaut waren, konnte er sich vorstellen, denn er hatte seine jüngeren Schwestern oft genug in den Badezuber steigen sehen, doch wie eine erwachsene Frau nackt aussah, das wusste er nicht. Sah er hübsche Mädchen oder Frauen auf der Straße, suchte er sich immer vorzustellen, wie sie denn ohne Rock und Mieder aussehen würden. So auch bei Henriette, der vielleicht achtzehnjährigen Tochter des Drechslers in der Gabitzstraße, die er von seiner Baustelle aus jeden Tag beobachtete. Der Mann war Ackerbürger und hielt sich Kuh und Schwein, so dass es für die Schöne immer etwas zu tun gab.
Eines Morgens nun war er als Erster oben auf dem Dach und nutzte die Gelegenheit, die Spanten des halbfertigen Dachstuhls nach oben zu klettern, um einen Blick in ihre Kammer erhaschen zu können. Aber es sollte noch viel, viel besser kommen, denn im Innenhof stand eine Wasserpumpe … Und zu der ging nun Henriette – und zwar splitterfasernackt …
August beugte sich weit nach vorn … zu weit. Seine wild rudernden Hände fanden keinen Halt mehr, er stürzte in die Tiefe.
Im Fallen hörte er noch die Wahrsagerin murmeln: »Mit einem Schlag kann alles aus sein.«
Am 21. Juli 1819 schuf Friedrich Wilhelm III. per Kabinettsorder ein Amt, das mit seiner Arbeit das Gewerbe und vor allem die Industrie in Preußen aufblühen lassen sollte: die Technische Deputation für Gewerbe. Sie ging zurück auf eine Initiative von Christian Peter Wilhelm Beuth und sollte sein Instrument werden, Preußen voranzubringen und den Rückstand, den man England gegenüber hatte, wirksam zu verringern.
Beuth war am 28. Dezember 1781 in Kleve zur Welt gekommen, der Stadt am Niederrhein, die seit 1815 wieder zu Preußen gehörte. Als Sohn eines Arztes hatte er beste Bedingungen für eine große Karriere, begann 1798 an der Universität Halle/Saale ein Studium der Rechte und Kameralwissenschaften, um 1801 in den preußischen Staatsdienst einzutreten. 1806 wurde er Assessor in Bayreuth, 1809 Regierungsrath in Potsdam und 1810 Geheimer Obersteuerrath im Finanzministerium zu Berlin. Als es dann darum ging, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln, war er ins Lützow’sche Freikorps eingetreten – eine bessere Adresse gab es nicht – und als Reiter durch Deutschland, Belgien und Frankreich gezogen. Eine feindliche Kugel hatte ihn niedergeworfen, doch er hatte überlebt und war mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet worden. Als sich Preußen daranmachte, Lehren aus der Niederlage gegen Napoleon zu ziehen und das Land zu modernisieren, saß er im Büro des Staatskanzlers Karl August von Hardenberg und war Mitglied der Commission für die Steuerreform und für die Reform des Gewerbewesens.
Nun war er, ewig ruhelos, Director der Technischen Deputation für Gewerbe geworden und streifte täglich in seinem altväterlichen blauen Überrock und mit der Soldatenmütze des alten Freiheitskämpfers auf dem Kopf durch die Berliner Straßen, um sich selbst ein Bild davon zu machen, was in den Werkstätten der Residenz geschah. Es reichte ihm nicht, in der Kanzlei zu sitzen und etwas anzuordnen, er musste mit den Männern reden, die an den Ambossen und Werkbänken standen. Wen er für wichtig hielt, den lud er in seine Wohnung in der Klosterstraße ein. Zu diesem Zweck führte er immer kleine Kärtchen bei sich: Wenn ein Mittagessen im Überrock und ohne Ansprüche Ihnen recht ist, so bitte ich Sie, sich am Sonntag, dem … gegen zwei Uhr bei mir einzufinden.
Einer dieser Gäste war auch Franz Anton Egells, geboren am 25. August 1788 im westfälischen Rheine und von Hause aus Kupferschmied. Nachdem sein Versuch, im westfälischen Gravenhorst Dampfmaschinen zu bauen, gescheitert war, war er nach Berlin gekommen und hatte in der Königlich Preußischen Eisengießerei zu Berlin, die im Winkel zwischen Panke und Invalidenstraße gelegen war, als Abteilungsleiter gearbeitet und den Guss von Denkmälern und anderen Kunstwerken überwacht. Er sah sich immer als Mechaniskus und schaffte es, mit der Verbesserung einer Druckluftwaffe, einer sogenannten Windbüchse, Beuth auf sich aufmerksam zu machen. Der hatte ihn dann nach England geschickt, um sich in den englischen Maschinenbau-Anstalten umzusehen. Die waren damals der Nabel der industriellen Welt, und Beuth hatte bei dieser frühen Form der Industriespionage keine Skrupel, hing er doch auch der allgemeinen Maxime an, dass man mit den Augen stehlen dürfe.
Nun war Egells zurück und erstattete Bericht. Was das Gießen von Eisen betraf, da habe man den Engländern gegenüber schon beträchtlich aufgeholt, aber im Hinblick auf die Lokomotiven hinke man ihnen noch erheblich hinterher.
»Schon 1813 hat ein gewisser William Hedley seine Puffing Billy für die Wylam-Zeche konstruiert, und die hat sich so gut bewährt, dass man mittlerweile schon mehrere Lokomotiven dieses Typs gebaut hat. Angeblich soll es schon 1804 eine funktionstüchtige Lokomotive gegeben haben, die war aber zu schwer für die gusseisernen Schienen einer Pferdebahn. Im Augenblick redet alles von George Stephenson, der ausgezeichnete Lokomotiven für die Kohlengruben bei Darlington gebaut hat.«
»Ach ja!« Beuth stieß einen tiefen Seufzer aus. »Während wir gerade mal gelernt haben, vernünftige Dampfmaschinen zu bauen, haben die Engländer längst Dampfmaschinen auf Schienen gesetzt. Und mit diesen Lokomotiven und den vielen angehängten Loren können sie im Handumdrehen ihre Waren an die Küste transportieren und dort auf ihre Dampfschiffe laden, um die Welt mit ihren Produkten zu überschwemmen.« Er richtete die Augen gen Himmel. »Der Herr schenke uns ein Genie, damit wir ihren Vorsprung endlich aufholen können!«
»Wir können das Rad nicht neu erfinden – uns bleibt derzeit nichts anderes übrig, als das englische Rad zu kopieren.«
Beuth stöhnte auf, und Egells tat es ihm nach, denn beide wussten, dass das Kopieren englischer Maschinen auch schiefgehen konnte. So hatte das Brandenburgische Oberbergamt 1814 zwei seiner Beamten, den Oberbergrath Ernst Philipp Ferdinand Eckardt und Johann Friedrich Krigar, den Hütteninspector der Königlich Preußischen Eisengießerei zu Berlin, nach England geschickt, um die dort in Betrieb befindlichen Lokomotiven zu studieren. Sie waren ein Jahr später nach Berlin zurückgekehrt und hatten Pläne des Lokomotivbauers John Blenkinsop mitgebracht. Dabei handelte es sich um eine Zahnradmaschine, da man der Meinung war, der Adhäsionsantrieb sei unzureichend. Die Zahnschiene war nicht zwischen den Gleisen angebracht, sondern neben ihnen. Auf dem Gelände an der Panke entstand nun in den Jahren 1815 und 1816 unter der Leitung Krigars die erste Lokomotive des Blenkinsop-Typs, wenn auch etwas kleiner. Obwohl dieser erste Dampfwagen, wie man in Preußen sagte, in der Minute lediglich fünfzig Meter zurücklegen konnte und nur wenig Zugkraft hatte, wurde er wieder zerlegt und – in fünfzehn Kisten verpackt – auf dem Wasserwege nach Königshütte gebracht, um die Kohlezüge des Bergwerks »Königsgrube« zu ziehen. Leider musste man an Ort und Stelle erkennen, dass die Spurweite der Lokomotive nicht der des vorhandenen Schienenstrangs entsprach und außerdem Kessel und Zylinder nicht dicht waren …
Nach diesem Fiasko war in Berlin eine zweite Lokomotive gebaut und auf dem Seeweg über Amsterdam ins Saarrevier transportiert worden. Am 5. Februar 1819 war sie in Geislautern eingetroffen, um auf einer 2,5 Kilometer langen Versuchsstrecke, dem Friederiken-Schienenweg, ausprobiert zu werden.
»Wir müssen unbedingt nach Geislautern, um zu retten, was zu retten ist«, sagte Beuth.
»Sehr wohl«, sagte Egells und überschlug im Kopf, wie weit es von Berlin nach Völklingen sein würde, der ersten größeren Stadt in der Nähe der Versuchsstrecke. »Ich schätze, bis dahin sind es ungefähr hundert Meilen, und da unsere Postkutschen nur wenig mehr als eine Meile in der Stunde schaffen, werden wir eine ganze Weile unterwegs sein.«
»Dennoch, was sein muss, muss sein.«
Sie machten sich also auf den Weg, doch als sie in Geislautern ankamen, mussten sie feststellen, dass es nicht gelang, die Maschine überhaupt in Bewegung zu setzen. Weder in der ersten noch in der zweiten oder der dritten Woche.
Auf dem Lehrplan standen Zeichnen und Perspektive, Kenntnisse in Grundriss und Aufriss, Planen und Entwerfen und Blick für die Bauten des Altertums und seiner Zeit. Den Schülern der Königlichen Provinzial-Kunst- und Bauhandwerksschule in Breslau wurde also einiges abverlangt, zumal sie gleichzeitig auch bei ihrem Lehrherrn die praktische Arbeit zu verrichten hatten – wobei allerdings der Unterricht in der Hauptsache in den Monaten stattfand, in denen auf den Baustellen nicht viel zu tun war. Langsam gewöhnten sich die kräftigen Handwerkerhände daran, mit dem Bleistift feine Linien auf das gelbliche Papier des Zeichenheftes zu ziehen und zu begreifen, dass die Rechtecke und Quadrate, die man zeichnete, Zimmer und Stuben meinten und sich am Ende zu einem Haus summierten. Aus dem Grundriss wuchs das Werk nach oben, ganz wie in der Wirklichkeit – nur viel schneller und müheloser. Es musste radiert werden, um Türen und Fenstern ihren Platz zuzuweisen.
»Borsig, was du da an Sparren und Pfetten zum Dachstuhl auftürmst, das passt auf den Turmbau zu Babel, aber nicht auf das Wohnhaus eines reich gewordenen Oderschiffers!«, rief Bauinspector Hirt, als er einen Blick auf Augusts Zeichenblatt geworfen hatte. »Und deine Schlangenlinien sind ja fürchterlich!«
Dass August Borsig nur mit Mühe eine gerade Linie zeichnen konnte, lag an seinen immer noch schmerzenden Handgelenken. Die hatte er sich beim Sturz vom Dach verstaucht. Es hätte aber noch alles viel übler ausgehen können, wenn er nicht in einen Misthaufen gefallen wäre. Henriette war zwar schreiend ins Haus gelaufen, als er dicht neben ihr gelandet war, Ihles Gesellen hatten aber schnell mitbekommen, weshalb er in die Tiefe gestürzt war, und hatten nun etwas zum Lästern. Es sei schon etwas ganz Besonderes, mit seiner Liebsten nicht ins Heu oder ins Bett zu gehen, sondern in einen Misthaufen. Harmlos war noch der Reim: Liegt unser August drin im Mist,/ändert sich’s Wetter, oder es bleibt, wie es ist. Nun, er nahm es mit Humor, hätte sich aber doch lieber als tapferen Helden gesehen anstatt als dummen August.
Das Planen und Entwerfen biederer rechteckiger Bürgerhäuser begann ihn bald zu langweilen, und er hätte die Königliche Handwerkerschule verflucht, wenn die Lehrer nicht einen Hang zum Höheren gehabt hätten und das ernst nahmen, was die Buchstaben über dem Eingang verkündeten, nämlich dass hier auch Kunst vermittelt werde. So legte man den Schülern Zeichnungen der griechischen und italienischen Altertümer vor und brachte sie dahin, die Feinheiten einer kannelierten Säule in all ihren Licht- und Schattenwirkungen zu verstehen. Und man machte auch Exkursionen zu den herausragenden Bauwerken Breslaus.
»Obwohl er 1732 in Landeshut geboren worden ist, möchte ich auch Carl Gotthard Langhans zu den Breslauer Künstlern rechnen«, erklärte Hirt. »Warum? Weil er ab 1782 mit seiner Familie das schwiegerelterliche Haus in der Albrechtstraße 18 bewohnt hat und am 1. Oktober 1808 in Grüneiche bei Breslau gestorben ist.« Er blickte in die Klasse. »Und was ist sein berühmtestes Bauwerk?«
Nur einer hob den Arm.
»Ja, Borsig …«
»Das Brandenburger Thor in Berlin.«
»Richtig, sehr gut. Und sein Sohn Carl Ferdinand, hier bei uns in Breslau geboren am 14. Januar 1782, tritt nun in die Fußstapfen seines berühmten Vaters.«
Man zog durch die Stadt, um sich alles anzusehen, was es an architektonischen Prachtstücken gab – angefangen bei der gotischen Sandkirche, die zwischen 1334 und 1440 entstanden war, bis zur Universität und dem Königsschloss aus dem Rokoko –, und hörte sich die Erläuterungen des Lehrers an.
»Wozu brauchen wir ’n das alles?«, fragte leicht maulend ein Klassenkamerad, dem schon bald die Füße weh taten.
Bei Meister Ihle hatte ein Zimmermann angeheuert, Georg Guttentag, der in seinen Wanderjahren auch durch England gezogen war, und als der Polier in der Frühstückspause erzählte, wie sich der Dampfwagen der Königlichen Eisengießerei in Geislautern keinen Fingerbreit von der Stelle bewegt hatte, da lachte er nur.
»Gott, vor elf Jahren war ich in London, und da hat einer … wie hieß er noch mal … Trevithick, ja, Richard Trevithick hat eine Lok mit ein paar Waggons dran immer im Kreis herumfahren lassen, wie im Zirkus. Ihr Name war Catch me who can – was aber keiner geschafft hat.« Er versuchte, ihre Umrisse im lockeren Sand nachzuzeichnen.
»Das verstehe ich nicht«, sagte August Borsig, der die riesige Dampfmaschine auf der Tarnowitzer Grube vor Augen hatte. »Der Kolben im Zylinder geht doch immer senkrecht auf und ab – der Dampfwagen aber rollt doch in der Waagerechten, oder?«
Der Geselle wusste es auch nicht so ganz genau. »Das Ding hatte jedenfalls kein Schwungrad, sondern einen stehenden Zylinder, und der muss über eine Kurbelstange direkt auf die Triebräder gewirkt haben.«
»Was Menschengeist so vermag«, sagte der Polier.
Der Geselle lachte. »Ja, und trotzdem ist Trevithicks Lokomotive eines Tages entgleist und umgestürzt, so dass sich keiner mehr für sie interessiert hat.«
Sie konnten sich nicht länger diesem Thema widmen, denn Meister Ihle erschien in diesem Augenblick und klatschte in die Hände. »Ans Werk, die Herren, von nichts kommt nichts!«
Alle sprangen nun auf, um wieder auf das Dach zu steigen. August Borsig aber wurde vom Meister zurückgehalten.
»Du eilst jetzt zum Schmied Witschel und holst mir ein paar Eisenklammern. Die müssten bald fertig sein.«
Als August Borsig in der Tür der Werkstatt stand, erstarrte er. Es war etwas Archaisches, das er da sah: Der Schmied war Gott, und er stand an einem gewaltigen Vulkan, um die Welt aus glühendem Eisen zu erschaffen. Funken sprühten auf, als er das erhitzte Werkstück mit einer langen Zange aus der Esse zog und zum Amboss trug. Dort stand ein Lehrling mit dem Schmiedehammer, der dem Eisen die Form geben sollte, die Ihle gewünscht hatte. Borsig beneidete diesen Lehrling, und er dachte in diesem Augenblick, dass er viel lieber Schmied geworden wäre als Zimmermann. Aus einer gestaltlosen Masse etwas zu formen, das war das Eigentliche. Man schmiedete das Eisen, das Schicksal, die Zukunft. Das war es, was er wollte: Schmied sein, sich als Schmied fühlen.
»Na, Junge, was treibt dich her?«
Borsig hörte die Stimme des Schmieds wie aus weiter Ferne und brauchte Sekunden, um zu sagen, dass er im Auftrag Ihles gekommen war.
»Der Friedrich ist gleich mit allem fertig.«
Borsig kam mit Friedrich Hermes ins Gespräch, und sie sollten für lange Jahre Freunde werden.
Nachdenklich trug August Borsig die fertigen Teile zur Baustelle. Ein dumpfes Gefühl des Unbehagens und der Enttäuschung erfüllte ihn: Er hatte den falschen Beruf ergriffen.
Kapitel drei1823
Christian Peter Beuth hatte auch nach dem Fiasko von Geislautern und weiteren Fehlschlägen keine Sekunde daran gedacht zu kapitulieren. Ihm war aber bewusst geworden, dass es nicht ausreichte, die Maschinen und Lokomotiven der Engländer einfach abzuzeichnen und die Pläne nach Preußen zu bringen. Man brauchte auch Männer dafür, Techniker und Handwerker, die in der Lage waren, nach den mitgebrachten Zeichnungen und Skizzen funktionsfähige Maschinen zu bauen. Da kam es manchmal auf Bruchteile von Millimetern an. Aber man musste auch das Wesen einer Maschine verstehen und sie lieben wie seinen eigenen Hund, zu ihr sprechen, sie streicheln und ihr gut zureden, wenn sie nicht anspringen wollte. Und solche Männer gab es in Preußen nicht, Männer, die er Maschinenärzte genannt hätte, wenn er dafür nicht verspottet worden wäre. Dieser James Watt, dem sie die Erfindung der Dampfmaschine zuschrieben, musste ähnlich gedacht haben, als ihm die Idee gekommen war, die Pferdestärke als Maßeinheit für die Leistung einer Dampfmaschine zu wählen. Auch an Fabrikanten mit den nötigen Kenntnissen, mit Weitblick und Wagemut fehlte es. Das alles war nicht weiter erstaunlich, denn alle hatten sich an den langjährigen Protektionismus ihres Staates gewöhnt.
Beuth fasste sich an den Kopf. Da hatte man in den preußischen Universitäten und in Kreisen jüngerer Beamter dem freien Wettbewerb und freien Handel das Wort geredet und dabei übersehen, dass der Rückstand der einheimischen Gewerbetreibenden viel zu groß gewesen war und nun die Engländer mit ihren Waren