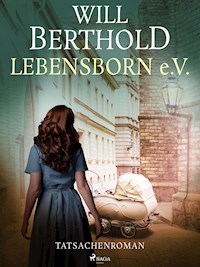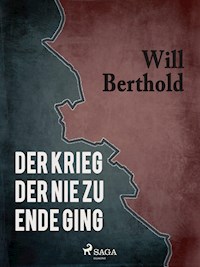
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Untergrundexperte "Solist" wird von Washington nach Ost-Berlin entsandt. Dort muss sich der gebürtige Berliner und US-Captain nun durchschlagen. In hohem Maße unübersichtlich ist die Welt, die sich ihm dort in der Zeit des Mauerbaus präsentiert. BND-Leute der Bundesrepublik treffen auf Stasi-Agenten, die in der Zentrale des BND in Pullach einen Maulwurf platziert zu haben scheinen. Doch die Agenten auf beiden Seiten verbindet ein entscheidendes Element. Sie rekrutieren sich häufig aus den bewährten Reihen der Agenten Hitlers, deren gemeinsame Wurzeln oft in die Machtzentralen des nationalsozialistischen Grauens zurückreichen. Und hier beginnt die Geschichte wirklich spannend zu werden.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Will Berthold
Der Krieg der nie zu Ende ging
SAGA Egmont
Der Krieg der nie zu Ende ging
Getreu bis in den Tod (Die Schicksalsfahrt der Bismarck. Sieg und Untergang)
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2017 by Will Berthold Nachlass
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de).
Originally published 1957 by Süddeutscher Verlag, Germany
All rights reserved
ISBN: 9788711727058
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Ich war sein Verfolger, er machte es mir leicht. Unsere Partnerschaft war einseitig. Er hatte mich noch nie gesehen. Ich gehörte auch nicht zu seinem Verein, aber ich kannte sein Foto und sein persönliches Dossier auswendig. Normalerweise wäre für mich Metzlers unauffällige Beschattung ein Kinderspiel gewesen, aber das Terrain, auf dem ich operierte, war heiß.
Das Regime nannte seinen Machtbereich den „ersten deutschen Arbeiter- und Bauernstaat“ – im Westen sprach man in dieser Zeit noch immer von der sowjetischen Besatzungszone. Seit nunmehr elf Jahren führte das Land zwischen Ostsee und Thüringer Wald offiziell die Bezeichnung: Deutsche Demokratische Republik, abgekürzt DDR, was von den Ostdeutschen in verzweifeltem Humor mit D(er) D(ämliche) R(est) übersetzt wurde.
Ich hätte mich – meinem Auftrag folgend – genausogut an Deschler oder Megede hängen können, aber die beiden gingen weisungsgemäß im Bezirk Neubrandenburg ihrem Erkundungsauftrag nach, während Metzler eine außerplanmäßige Tour nach Leipzig eingelegt hatte. Es war anzunehmen, daß er sich hier mit einem Vierten treffen würde, und diesen Unbekannten mußte ich mir genau ansehen.
Die „Firma“, für die Metzler arbeitete – ich selbst hatte mit Pullach höchstens indirekt zu tun –, war in letzter Zeit durch eine Reihe von Pannen und Einbrüchen in die roten Zahlen gekommen, so daß ihr der Konkurs drohte, und so hatte man mich als heimlichen Revisor auf drei der „tätigen Agenten im Feind mit dem verdeckten Auftrag“ angesetzt. Alle drei waren wetterfeste, erfahrene Burschen, Top-Leute aus Pullach, über Berlin in die DDR eingeschleust, um auffällige Bewegungen an den Sektoren-Übergängen und im Grenzgebiet zu erkunden. Eine Reihe von Straßen waren umgeleitet worden, Lastwagen mit Drahtsperren und Spanischen Reitern bewegten sich auffällig seit Tagen in Richtung Grenze, wo die Republik-Flüchtlinge in einem bisher noch nie gesehenen Ausmaß in den Westen einströmten.
Als ich erfahren hatte, daß sich Metzler in einem Hotelneubau am Rande des Messegeländes telefonisch ein Doppelzimmer reservieren ließ, war ich noch in Westberlin gewesen. Ohnedies befand ich mich erst seit vier Wochen wieder in Europa und seit vierzehn Tagen in meinem Geburtsland Old Germany. Es war alles bestens vorbereitet, ich konnte sofort starten. Ich fuhr mit der S-Bahn in den Ostsektor, ließ mich dann von einem Taxi zum ostdeutschen Regierungsflughafen Berlin-Schönefeld karren, und während der Fahrt verwandelte ich mich in den DDR-Bürger Fritz Stenglein, SED-Parteisekretär aus Hoyerswerda in der Lausitz.
Meinen Namensgeber gab es tatsächlich; er machte zur Zeit verdienten Funktionärs-Urlaub an der Schwarzmeerküste des sozialistischen Bruderlandes Bulgarien. Meine Tarnung würde nur einer sehr oberflächlichen Prüfung standhalten, aber wenn ich mich im Hinterland des Gegners aufhielt, währte meine angenommene Identität selten länger als die Tagesunschuld einer Dirne.
Ich hatte, pünktlich in Leipzig-Schkeuditz landend, Metzler überrundet und durchschritt ohne Schwierigkeiten die Polizei- und Gepäckkontrolle. Auf einem Parkplatz in der Nähe hatten unsichtbare Helfer einen verbeulten „Trabant“ für mich abgestellt. Als ich sicher war, daß mich niemand beobachtete, schlüpfte ich in den Wagen, fand unter dem Sitz den Zündschlüssel und die Wagenpapiere.
Ich fuhr los, betont langsam und vorschriftsmäßig. In der DDR kommen auf den Kopf der Bevölkerung doppelt so viele Polizisten wie in Westdeutschland, und die Vopos kontrollieren die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit nicht weniger stramm als die politische Gesinnung. Leipzigs Stadtplan hatte ich im Kopf, aber ich verfuhr mich ein paarmal, und so bekam ich gratis einige Sehenswürdigkeiten der im Krieg fast zu einem Viertel zerstörten, aber in ihrem Weichbild historisch getreu wieder restaurierten Stadt, mit: das alte Rathaus und die Thomaskirche, Auerbachs Keller und den größten Personenbahnhof Europas. Das Kroch-Hochhaus stand noch, ebenso wie die Alte Waage, der Barthelshof und die Nikolaikirche.
Viele Straßen waren der herrschenden Klasse angepaßt worden und trugen nun die Namen Klara Zetkin, Georgij Dimitroff, Rosa Luxemburg und natürlich Marx und vor allem Lenin. Der Erfinder des Bolschewismus hatte in Leipzig 1912 seine erste illegale Zeitung herausgebracht, und so feierten die roten Epigonen ihren kahlen Stammvater an allen Ecken und Enden. Lenin, wohin man sah – Luther, Lessing und Leibniz, Goethe, Schiller, Bach, Klopstock und Jean Paul, die einst in der Stadt gelebt hatten, die nach Meinung des deutschen Dichterfürsten ein „Klein-Paris“ war, galten offensichtlich als zweite Wahl, Leipziger Allerlei.
Als ich das 91 Meter hohe Denkmal der Völkerschlacht sah, fand ich mich wieder zurecht. Es war jetzt 18 Uhr 34, und mit einigem Glück würde ich noch vor Metzler im Messehotel eintreffen. Vor dem Gebäude waren noch Parkplätze frei, aber ich stellte sicherheitshalber meinen „Trabant“, diesen Lärm- und Gestank-Produzenten, in einigen hundert Metern Entfernung ab.
Ich achtete peinlich darauf, daß er vorschriftsmäßig geparkt war und auch während der Nacht von einer Laterne ausreichend beleuchtet wurde. Wenn kein Verrat im Spiel ist, sind es ja immer die kleinen Dinge, die uns an der unsichtbaren Front das Bein stellen.
Ich schlenderte gemächlich zum Hotel. Erst als ich sicher war, keinen „Schwanz“ zu haben, betrat ich die Halle und nahm an einem Tisch in der Nähe der Rezeption Platz. Der Raum war zu groß, seine Decke zu niedrig, die Einrichtung einfach, aber geschmacklos, berieselt von lauter Marschmusik.
Die Halle war nur mit wenigen Gästen besetzt, aber ich hätte die üppige Dreißigerin wohl auch bei Massenbetrieb nicht übersehen. Ein Blickfang. Eine Augenweide: brandrote Haare, moosgrünes Schneiderkostüm, große, provokante Augen. Sie war geschickt zurechtgemacht, vielleicht eine Spur zu aufgedonnert, zumindest in der zweitgrößten Stadt der Werktätigen. Fraglos hatte sie einen leichten Stich ins Vulgäre, den viele schätzen; jedenfalls war sie ein Typ, bei dem sich dem Betrachter eine ziemlich eindeutige und reichlich männliche Vorstellung aufdrängt.
„Süßer Racker“, sagte der Kellner, der an meinen Tisch herangetreten und meinen Augen gefolgt war, er lächelte plumpvertraulich. „Die hat vielleicht Musike unter’m Rock.“
Der Ober, offensichtlich aus Berlin nach Sachsen verschlagen, sprach so laut, daß es die Rotgrüne hören mußte, aber sie rührte gleichmütig in ihrem Kaffee. Neben der Tasse lag der Schlüssel, dessen übergroßer Anhänger auswies, daß sie das Hotelzimmer 705 bewohnte.
„Aber bei dieser Dame ham’wa wohl beide den Arsch zu tief unten, Kumpel.“ Der Kellner lächelte entsagend. „Wat woll’n se eigentlich, Mann?“ wurde er endlich berufstätig.
„Eine Tasse Kaffee und ’nen kleinen Cognac“, entgegnete ich.
Er schnupperte an meinem Zigarettenrauch, betrachtete anzüglich mein Parteiabzeichen am Revers, den stilisierten Händedruck, den die Ostdeutschen mit dem Slogan untermalten: „Eine Hand wäscht die andere!“ „Das Kraut, das Sie rauchen, ist wohl ooch nicht auf unser’m volksdemokratischen Mist jewachsen“, sagte er anzüglich.
Ich kramte ein Päckchen „Stuyvesant“ aus der Tasche, und er griff zu, flink wie ein Magier. „Weltniveau“. Das war ein DDR-Lieblingsschlagwort. Er ging ohne Eile zum Buffet.
Fast gleichzeitig erschien Metzler; er stand in der Tür, sah sich um. Ich erkannte ihn sofort. Er war ein schlanker, gutaussehender Mann mit einem kräftigen Körperbau und einem intelligenten Gesicht. Die Rotgrüne winkte ihm zu, und damit war wohl alles klar. Die Spannung wich aus Metzlers Gesicht. Er näherte sich ihr mit der Miene eines Mannes, der das große Los gezogen hat.
Sie küßten sich.
Er bestellte sofort Krimsekt und fummelte an ihr herum. Es war eine Szene wie aus einem Bilderbuch oder besser: aus einem Comic-Strip.
Aber Metzler war seiner Beurteilung nach einer der besten Gehlen-Leute überhaupt. Er stammte noch aus der Zeit der Nescafé-Agenten und Chesterfield-Spione, und sicher hatte er seine Haut nicht nur für ein paar lumpige Carepakete zu Markte getragen. Nach dem Zusammenbruch war die Wildwuchs-Spionage in der sowjetischen Besatzungszone vorübergehend zu einer Art Volkssport geworden. Viele Deutsche hatten sich angewöhnt, in den Engländern die Gentlemen, in den Amerikanern die Halbstarken und in den Franzosen die Hungerleider unter den Siegermächten zu sehen, die Rotarmisten aber nach wie vor als Feinde zu betrachten. Sie konnten sie nicht leiden, sammelten Informationen über die Verbände der Roten Armee wie Zigarettenkippen und brachten sie an den (Gehlen-)Mann. Und wenn sie genügend Stummeln aufgelesen hatten, konnten sie sogar wieder Aktive rauchen. Freilich, die Zeiten dieser Untergrund-Idylle waren vorbei. Wer jetzt zwischen den Machtblöcken herumturnte, kannte sein Risiko, mußte es kennen – außer, er trüge auf zwei Schultern.
Metzler galt als Idealist, als glasklarer Feind des Kommunismus, wenn er dies auch vielleicht ein wenig zu laut und zu häufig beteuert hatte. Das war vom fachlichen Gesichtspunkt aus ein Manko, durch das ich auf ihn aufmerksam geworden war. Gefühle sind in diesem Metier abzuschalten. Gefühle sind, wenn überhaupt, allenfalls als Freizeitbeschäftigung erlaubt. Sie gehören nach Teneriffa, Hawaii oder auf die Bermudas, aber keinesfalls in den mitteldeutschen Untergrund. Emotionen verzerren die Optik. Deshalb können ja auch viele Chirurgen, die Hunderte erfolgreicher Eingriffe hinter sich haben, die eigene Frau nicht operieren; das Gefühl macht ihre Hand unsicher, lähmt ihre Entscheidung.
Soweit die psychologische Seite – aber es gab auch noch eine andere Betrachtungsweise. Stammtischreden, am falschen Ort gehalten, sind nicht nur gefährlich, sondern oft auch faul. Als eifrigste Anhänger des sed-Regimes treten zum Beispiel meistens DDR-Bürger auf, die demnächst über Nacht unter Zurücklassung ihrer Habe sang- und klanglos verschwinden. Menschen, die die rote Attitude als Tarnung wählen.
Das läßt sich natürlich auch umgekehrt betreiben.
Endlich brachte der Ober den Kaffee. „Scheiße“, sagte er und deutete auf den Nebentisch: „Ihr Scheich is jekommen.“
„Treiben sich die beiden hier öfters herum?“ fragte ich ihn beiläufig.
„Nee“, antwortete der Ober. „Ick hab die noch nie jesehen.“
„Sind bei euch noch Zimmer zu haben?“
„Sieht schlecht aus“, erwiderte er, „aber wenn’se unser’m Objektleiter ’n paar von Ihren Glimmstengeln spendieren, wirkt das Wunder.“
Ich spendierte dem Ober noch einen für den eigentlich überflüssigen Tip.
Er ließ sich nicht lumpen. „Seh’n se zu, daß Sie ’ne ungerade Nummer bekommen, diese Zimmer jeh’n nach vorne raus. Hinten is ’ne Baustelle, die arbeiten dort ooch nachts.“
Ich ging an die Rezeption, legte die „Stuyvesants“ wie zufällig auf den Tisch. Ich brauchte keine Hemmungen zu haben. Westdeutsche, sogar amerikanische Zigaretten waren in jedem „Exquisit-Shop“ zu haben, freilich nur für Leute mit sehr viel Geld, für Handwerker also, für Schieber, Parteibonzen, Agenten oder Privilegierte mit hilfreicher Verwandtschaft im Westen.
Der Mann sah mehr auf das Päckchen als in mein Gesicht, jedenfalls hatte er begriffen.
„Eine Nacht nur“, sagte ich. „Höchstens zwei.“
Schon bevor der Portier nach dem Schlüssel griff, stellte ich fest, daß er mir das Zimmer Nr. 702 geben wollte. Immerhin auf der selben Etage wie Metzler. Ich schob das Päckchen noch ein bißchen näher an ihn heran, so daß er sehen konnte, daß es noch mindestens sieben oder acht Zigaretten enthielt.
„Vorne hinaus hätten Sie wohl nichts mehr“, versuchte ich mein Glück. „Ich schlafe schlecht und habe morgen eine ganz wichtige Parteisitzung. “ Ich zückte meinen Funktionärs-Ausweis.
Der Portier betrachtete ihn lustloser als meine anderen Fürsprecher; er warf einen Blick in das Gästebuch. „Aber nur für eine Nacht, Genosse Stenglein“, brummelte er, schob die „Stuyvesant“ ein und gab mir den Schlüssel für Zimmer Nr. 707.
Ich bedankte mich durch ein Kopfnicken und fuhr mit dem Lift hoch. So oder so würde mir eine aufregende Nacht bevorstehen. Ich wusch mir die Hände. Ich hatte nur eine kleine Tasche bei mir. Mein konspiratives Gepäck war im Kofferraum des „Trabant“ verblieben. Würde es gefunden, hätten die SSD-Leute noch lange nicht mich. Griffen sie mich, lägen die Beweise für meine Untergrundtätigkeit im Auto. Einen Zusammenhang zwischen dem Wagen und mir konnten sie nicht herstellen. Ich hatte peinlich darauf geachtet, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen.
Ich ging wieder nach unten, trat in den strömenden Regen hinaus und stellte fest, daß Metzler in einem alten Vorkriegs-„Kadett“ mit Berliner Nummer angereist war; das Prachtstück stand neben dem Eingang, ziemlich genau unter meinem Fenster. Ich konnte es leicht im Auge behalten, aber es sah nicht aus, als wollte der Verfolgte nächtliche Spritztouren unternehmen.
Ich ging in den Speisesaal. Der Ober reichte mir die Karte. Darüber stand: Essen Sie aus Anlaß der Woche der deutschsowjetischen Freundschaft Filet Stroganoff. Man lernt nicht aus. Dieser Stroganoff muß ein Russe gewesen sein.
Ich grinste und bestellte es.
„Stroganoff ist aus“, sagte der Kellner grob. „Aber wenn Sie etwas für die Verbesserung unserer Beziehungen mit den russischen Freunden tun wollen“, erwiderte er ernsthaft ohne eine Spur von Humor, „nehmen Sie Borscht.“
Sie saßen hinten links in der Ecke und verschlangen einander mit den Blicken, während sie aßen. Die zweite Flasche Krimsekt stand am Tisch. Ich wettete mit mir selbst, daß Metzler eine dritte aufs Zimmer hochschicken ließe. Ich gewinne meistens, wenn ich mit mir selbst wette.
Sie machten es mir leicht.
Ich ging nach oben.
Sie folgten wie gewünscht.
Es war nur eine dünne Sperrholzwand zwischen unseren Zimmern, so daß ich beinahe jedes Wort und jedes Geräusch mitbekam, obwohl sie das Radio eingeschaltet hatten. Ich erfuhr als erstes, daß Metzlers vollsaftige Dreißigerin eine späte Tochter August des Starken sein mußte, des Liebesmonarchen, der gesagt haben soll: „Wir Sachsen sind ein kleines, aber geiles Volk.“
Sie alberten miteinander, und ich hoffte, daß ich mich in gleicher Situation etwas interessanter benehmen würde. Der Dialog war lächerlich, aber jedenfalls mehr sexuell als subversiv. Dann machten sie mich zum Voyeur wider Willen, und ich erinnerte mich an das Dichterwort: „Und die Sächsin wirtschaftet, bis das Bett kracht.“ Ich fragte mich, von wem es stammte, es fiel mir nicht ein.
Ich starrte zum Fenster hinaus, auf den jetzt leeren Platz vor dem Hotel. Eine gepflegte Anlage wurde durch ein häßliches Transparent verunstaltet: Ewige Freundschaft mit der Sowjetunion – das ist der Herzschlag unseres Lebens.
Die DDR ist nicht arm an solcherlei Sinnsprüchen. Mochten sich seit dem Einmarsch der Roten Armee die Verhältnisse in Mitteldeutschland konsolidiert haben: Die Vergewaltigung der deutschen Sprache gehörte weiterhin zum schlechten Ton.
Auf einmal wußte ich, daß das Wirtschafterinnen-Zitat von Kurt Tucholsky stammte. Es änderte nichts daran, daß ich allein war und mir mit zunehmenden Pausen vorführen lassen mußte, wie stürmisch die Zweisamkeit sein kann.
Für mich war der Fall erledigt. Es war nicht meine Sache, herauszubekommen, wer Metzler diese mobile Puppe ins Bett gelegt hatte. Selbst wenn sie für das „Ministerium für Staatssicherheit“ arbeitete, war sie jedenfalls voll bei der Sache. Einer von Pullachs Top-Agenten hatte sich einen Verstoß gegen die lebenserhaltenden Regeln des Untergrunds erlaubt. Das war bedauerlich, aber vielleicht auch unvermeidlich.
Wir hatten einen Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen.
Ich schlief ein, wachte auf, und stellte fest, daß nebenan jetzt auch Bettruhe herrschte. Kurz nach sechs Uhr holte ich meinen Transistor aus der Tasche, klemmte mir den Hörer ins Ohr und schaltete auf eine von Berlins geheimen Kurzwellen. Die flotte Musik brach plötzlich ab. „Achtung, Solist“, sagte ein Sprecher in englisch: „Das Rennen fällt heute aus. Ich wiederhole: Achtung, Solist! Das Rennen fällt heute aus.“
Solist war für diesen Einsatz meine Tarnbezeichnung, die nur der Colonel kannte. Was er mir sagen ließ, war die Order, sofort die DDR zu verlassen und mich nach West-Berlin abzusetzen. Es hatte keinen Sinn, darüber nachzugrübeln, was dahinterstecken mochte. Ich wollte mir keinen Regelverstoß erlauben, der noch dazu weniger reizvoll war als Metzlers Extratour.
Ich brachte die Morgenwäsche hinter mich, rasierte mich. Dann ging ich nach unten. Um Zeit zu sparen, hätte ich nach Berlin zurückfliegen können, aber ich benutzte bei geheimen Ausflügen niemals das gleiche Verkehrsmittel auf derselben Strecke.
Als ich die beiden Männer sah, die die Halle betraten und auf den Portier zugingen, war ich sofort hellwach. Sie hatten blasse, leere Gesichter, geprägt von Langeweile und Verstellung. Sie trugen durchnäßte Ledermäntel mit hochgeschlagenem Kragen, die so benutzt aussahen, als hätten sie sie von ihren Vorgängern aus der Prinz-Albrecht-Straße direkt übernommen.
Es waren Stasi-Leute, ich roch das förmlich und hielt mich im Hintergrund.
„Bei Ihnen wohnt ein gewisser Metzler“, fragte einer der beiden.
„Ja. Zimmer 705.“ Der Mann wollte beflissen nach dem Hörer greifen, aber der Ledermantel legte die Hand auf seinen Arm.
„Sie werden ihn nicht anrufen“, sagte er und lächelte schief. „Es soll eine Überraschung sein.“
Die beiden Männer gingen zum Lift. Ich konnte Metzler nicht warnen, ich konnte in dieser Situation nichts anderes tun als schleunigst zu verschwinden. Einen Moment lang wollte ich mich als Zechpreller betätigen, aber ich durfte nicht unnötig auf mich aufmerksam machen. Ohnedies würden die Stasi-Leute auf meinen Zigarettentrick stoßen, wenn sie ernsthaft nachforschten.
Ich ging nach draußen. In diesem Moment geschah es – und ich war, eine Nachlässigkeit verfolgend, wieder einmal in eine Tragödie geraten. Später würde man in Kreisen des US-Geheimdienstes behaupten, meine fatale Fähigkeit, überall da zu sein, wo es brennt, hätte sich einmal mehr bewiesen.
Von oben kamen Schreie. Schüsse.
Passanten blieben auf der Straße stehen, starrten hinauf zum Fenster des siebten Stocks, hinter dem – undeutlich zu sehen – mehrere Personen in ein Handgemenge verwickelt schienen.
Sekunden später geschah es: Metzlers massiger Körper flog durch das Fenster. Sie schossen ihm nach, schienen ihn im Fall noch getroffen zu haben, aber das war unerheblich, denn er schlug als blutiger Klumpen auf dem Gehsteig vor dem Hochhaus auf, bettwarm in den Tod gesprungen.
Es war ein schauriges Bild: Zwei Meter über dem, was von Metzler noch geblieben war, hing – weiße Schrift auf rotem Grund – eine Wandparole: Der Sieg der Werktätigen wird den Kapitalismus zerschmettern.
Einen Moment lang stand ich wie gelähmt unter den Gaffern, aber ich verlor die Nerven nicht. Ein eiliger Rückzug wäre jetzt nur auffällig gewesen. Immer neue Zaungäste der Sensation strömten herbei, liefen von allen Seiten zusammen, mühselig von den Vopos gebändigt.
„Auseinander, Leute!“ sagte einer der Uniformierten. „Hier gibt’s gar nichts zu sehen.“ Er fuchtelte mit den Armen, aber keiner der Passanten wich zurück, obwohl sonst in Ostdeutschland der Respekt vor der Polizei groß ist. Die Vopos schwammen hier gegen den Strom. Jedenfalls war die Neugier noch kein Republikflüchtling. „Eine Familientragödie“, bequemte sich einer der Polizisten schließlich zu einer Erklärung, „nichts weiter.“
So konnte man es auch nennen, und ich fragte mich in diesem Moment, ob ich schon einmal eine ehrlichere Lüge gehört hätte. Sie deckten den Toten zu und bargen ihn kurze Zeit später in einer Blechwanne. Arbeiter der Straßenreinigung trockneten mit Sägespänen die Blutlache und fegten die Aufschlagstelle wieder sauber.
So sah der Start des Unternehmens „Flyaway“ aus, und die erste Stufe war verlaufen wie der abgeschmackte Witz: Operation gelungen, Patient tot.
Was die Volkspolizei nicht schaffte, erreichte der Regen; er trieb den Menschenauflauf auseinander. Ich ließ mich in einer Passantengruppe zum Parkplatz spülen, postierte mich wie auf der Flucht vor der Nässe unter einem Vordach und ging erst an den „Trabant“ heran, als ich sicher sein konnte, daß ihn keiner beobachtete.
Ich sah niemanden, der sich für mein Auto interessierte.
Ich stieg ein, fuhr los, diesmal sorgfältig darauf bedacht, mich nicht zu verfahren. Ohnedies ist es leichter, eine fremde Stadt zu verlassen, als sich in ihr zurechtzufinden.
Der Mann, den wir Paul Metzler nannten und der natürlich ganz anders hieß, war rehabilitiert – um einen furchtbaren Preis, ob er nun in einer Kurzschlußhandlung oder bewußt aus dem Fenster gesprungen war. Es war die brutalste und sauberste Lösung: Die Stasi-Männer konnten ihn nicht mehr vernehmen, nicht mehr quälen, nicht nach Bautzen schaffen oder ihn mit einem Lockangebot „umdrehen“.
Ich war zugleich erleichtert wie schockiert, ich schmeckte Blut statt Speichel in meinem Mund.
Der „Trabant“ hatte die Ausfahrtstraße erreicht. Ich fuhr auf den Zubringer zur Autobahn München–Berlin. Die Interzonenstrecke war zwar am schärfsten bewacht, aber auf ihr würde man mich am wenigsten vermuten, so man mich suchte.
Wurde ich bereits gesucht?
Es hing davon ab, ob die beiden Ledermäntel den Fall Metzler gründlich untersuchten. Es war klar, daß ihre Dienststellen den Gehlen-Mann lieber lebend gegriffen hätten als tot. Ich mußte damit rechnen, daß die Vorgesetzten der beiden Ledermäntel peinliche Fragen stellten und auf einer gründlichen Untersuchung bestanden. In diesem Fall würde der Staatssicherheitsdienst schnell erfahren, daß ein Mann namens Fritz Stenglein fast gleichzeitig mit dem verunglückten Liebhaber im Hotel aufgetaucht war, im Nachbarzimmer gewohnt und kein Reisegepäck bei sich gehabt hatte. Interessierten sie sich näher für den angeblichen sed-Funktionär, würden sie über das Ticket bei der „Interflug“ darauf stoßen, daß Stenglein nicht aus Hoyerswerda, sondern aus Berlin-Ost angereist war. Spätestens jetzt würden sie herausfinden, daß der echte Parteisekretär zur Zeit in Bulgarien weilte.
Das mußte sie wild machen, denn es röche nach Profi-Arbeit, und es wäre ihnen nunmehr bekannt, daß der BND-Agent in seinen letzten Stunden einen „Schwanz“ gehabt hatte, der nicht von der DDR-Spionagezentrale in der Normannenstraße 22 in Berlin-Lichtenberg angehängt worden war.
Ich ging die Einzelheiten noch einmal durch. Die Zusammenhänge klangen ein wenig konstruiert, aber auf solcherlei Dinge verstanden sich die SSD-Leute so, daß sie diese noch im Schlaf beherrschten. Wenn sie den Kellner und den Rezeptionisten ordentlich durch die Mangel drehten, müßte ohnedies mein Stuyvesant-Trick auffallen, und von da an würden sie hinter mir her sein wie Hunde hinter den falschen Hasen.
Vorsicht empfahl sich, ob es nun der Fall war oder nicht. Ich mußte mich genau auf gegenteilige Weise nach Westen durchschlagen als sie annehmen würden. Im August 1961 gab es noch keine hermetisch abgeriegelte Grenze, keine Todesstreifen, keine Selbstschußanlagen, keine als Schußfelder genutzten Kahlflächen. Wenn einem Flüchtling in Leipzig der Boden zu heiß wurde, würde er den kürzesten Weg zur Grünen Grenze einschlagen und sich im Interzonengebiet nach Bayern oder Hessen absetzen. Nach Berlin führe zur Zeit nur ein Tölpel, denn jeder Ostdeutsche wußte in diesen Tagen, daß die DDR-Hauptstadt, um die Massenflucht einzudämmen, militärisch völlig abgeriegelt war. Im Grenzgebiet konnte man kontrolliert, beim Betreten der Regierungsstadt mußte man es werden.
Also würde man mich dort wohl am wenigsten vermuten, und das hieß für mich: Auf nach Berlin, und dann nichts wie weg in den dekadenten Westen.
Ich rechnete die Zeit zusammen, die sie benötigen würden, um auf die Zusammenhänge zu kommen – falls sie gerissen genug wären –, und stellte fest, daß es für mich noch keinen Grund zur Panik gab. Bis sie gezielt hinter mir her wären, würden sie meiner Rechnung nach noch mindestens zwei Tage brauchen. Wenn ich bis dahin den „fortschrittlichen Teil Deutschlands“ – wie ihre Propaganda tönte – noch nicht verlassen hätte, würde ich das voraussichtlich nie mehr schaffen.
Ich passierte das Schkeuditzer-Kreuz, ließ den Flugplatz, auf dem ich gelandet war, hinter mir und bog bei der nächsten Ausfahrt auf die Landstraße nach Bitterfeld ab und zuckelte in Richtung Wittenberg weiter. Ich passierte eine idyllische Landschaft, Wiesen, Wälder, einen See. Ich hielt an, in der Art eines Mannes, der austreten muß, und wickelte den Funktionärsausweis Fritz Stenglein mit einem Stein in ein Taschentuch und schleuderte ihn in den See. Die Wellenringe wurden immer größer und die Gefahr immer kleiner. Ich zog die Lederjacke aus und verfuhr mit ihr genauso, nur daß ich einen größeren Stein benötigte. Es war schade um das schöne Stück mit der eingenähten Inschrift „HO-Berlin“. Aber an einen Lumberjack konnte man sich erinnern, weniger jedoch an einen grauen Sommerpullover, den ich darunter getragen hatte. Nach den Regeln des Untergrunds hätte ich Stengleins Ausweis verbrennen müssen, aber falls das Dokument überhaupt je gefunden würde, wäre es durch das Wasser unleserlich geworden.
Als ich weiterfuhr, war ich kein Parteifunktionär aus Hoyerswerda mehr, sondern der DDR-Bürger Martin Lange, laut Ausweis mit festem Wohnsitz in Berlin, Friedriehstraße. So würde ich von den abriegelnden Soldaten nicht aufgehalten werden. Mit ein paar Handgriffen hatte ich mein Gesicht dem Paßfoto angepaßt: leicht getönte Brille, ein aufgeklebtes Bärtchen auf der Oberlippe und einen volleren Gesichtsausdruck mit Hilfe von zwei in die Backenseiten geklemmten Hartgummiplatten. Sie störten freilich beim Sprechen, aber ich hatte trainiert, mich trotz Sprachfehler verständlich zu machen.
Die Zulassung des „Trabant“ war echt, und es war anzunehmen, daß sich der rechtmäßige Nutznießer gestern oder vorgestern in die Bundesrepublik abgesetzt hatte. In diesen Wochen war es verhältnismäßig leicht, sich für Ostgeld ein Auto zu kaufen. Mit dem Wagen gelangte man nur in Ausnahmefällen in den Westen: Auto, Wohnung, Möbel, Hund, Kanarienvogel und das Grab der Eltern blieben zurück, wenn man zum Beispiel in Leipzig in den D-Zug nach Rostock stieg, bei der Kontrolle vor Berlin seine Fahrkarte als Beweis für den Transit-Verkehr zückte und dann ausstieg, um mittels S-Bahn in eine besitzlose Freiheit weiterzurollen.
Ich bin Amerikaner, aber ich war als Deutscher zur Welt gekommen, und so empfinde ich die Tragödie der deutschen Zweiteilung stärker als meine neuen Landsleute. Ich war in Berlin aufgewachsen und dann nach 1945 von dem berühmten Onkel in Amerika in die Staaten geholt worden. In meiner Heimat hielt mich nichts mehr: Mein Vater war gefallen, meine Mutter und mein jüngerer Bruder sind bei einem Luftangriff von einer Bombe erschlagen worden.
Die Sowjets hatten ihre Westgrenze um vier Fünftel näher nach Europa hineingetrieben. Wenn Stalin wollte, konnten seine Panzer ungehindert bis zum Atlantik durchbrechen. Jedenfalls hatte ich schwarz für Europa gesehen, und so wurde ich einer der ersten deutschen Auswanderer, die, zusammen mit ein paar GI-Bräuten aus Germany, damals noch mit einer viermotorigen Propellermaschine, in die Staaten ausflogen. Noch bevor ich die US-Staatsbürgerschaft erhielt, wurde ich als Marineinfanterist nach Korea geschickt. Der Krieg, dem ich in Europa hatte ausweichen wollen, holte mich in Fernost ein.
Ich fluchte, biß die Zähne zusammen und tat, was zu tun war. Irgendwie fiel ich dabei angenehm auf, denn nach Beendigung des Konflikts am 38. Breitengrad wollte mich die US-Army behalten. Ich erhielt einen US-Paß, wurde zum Captain befördert, wegen meiner Sprachkenntnisse zum Geheimdienst kommandiert und für den Untergrund nach allen Regeln der umstrittenen Kunst gedrillt.
Ich habe mich niemals in diese Branche gedrängt, aber was sein muß, muß sein. Wenn der Osten Tausende von Agenten in den Westen einschleust, kann dieser nicht auf Gegenmaßnahmen verzichten. Ich wollte nicht eines Tages wieder unfreiwillig am Yalu oder das nächste Mal vielleicht sogar am Rhein oder Main kämpfen müssen. Das würde mit Sicherheit geschehen, wenn der Westen der Unterwanderung mit östlichen Agenten tatenlos zusähe.
Man muß die Arbeit im Untergrund so unromantisch und notwendig ansehen wie die Tätigkeit für die Müllabfuhr. Ich tröstete mich damit, daß mein Metier wenigstens nicht so übel röche, obwohl es mitunter doch weit anrüchiger sein kann. Müllabfuhr ist übrigens gut, denn ohnedies sind die meisten Müllwerker in Westdeutschland Gastarbeiter.
Der Colonel und ich – sein junger Mann – waren nach einem Gespräch am Washingtoner Kamin zwischen Präsident Kennedy und Bundeskanzler Adenauer als Leihgabe nach Germany entsandt worden. Mein Chef ist der mysteriöse Colonel mit dem im Untergrund legendären Decknamen „The Joker“, und diese Trumpfkarte spielt man bekanntlich immer dann aus, wenn das Spiel schlecht steht.
Das war zum Beispiel vor kurzem in Kubas Schweinebucht der Fall gewesen. Die Central-Intelligence-Agency hatte so versagt, daß der erboste US-Präsident sie kuzerhand auflösen wollte. Colonel Highmiller, der Joker, hatte in Rekordzeit die Fehlerquelle gesucht, den Laden gesäubert und reorganisiert, in aller Stille und aus dem Hintergrund. Die betroffenen Sündenböcke wußten nicht einmal, wie der Mann hieß, dem sie ihren Sturz verdankten. Seitdem waren der Joker und ich ein Gespann wie Herr und Hund, das heißt, daß der Colonel pfiff und ich apportierte.
Ich sage das ohne Bitternis, denn der Joker war ein grandioser Jagdherr. Er litt so wenig an einer Kreuzzugs-Idee wie ich, und schon gar nicht an der dummen Überheblichkeit vieler Zeitgenossen, die im Osten alles schlecht und im Westen alles gut finden. So einfach liegen die Dinge nicht, aber ich bewertete meinen Job nicht politisch, sondern professionell: Und wer bei der Überlegung eines Autokaufs besonders seine Sicherheit berücksichtigt, tut es schließlich nicht, um mit seiner Neuerwerbung zu verunglücken.
Ich war auf der Hut vor einer Kollision. An einem Tag wie diesem – nach dem Fenstersturz von Leipzig – benahmen sich die Vopos und SSD-Agenten wie aufgescheuchte Hornissen. Ich wußte nicht, ob Metzlers Rotgrüne als Stasi-Agentin die Falle für ihn aufgebaut hatte und wie lange und woher er sie kannte, aber wenn er unvorsichtig gewesen war, würden sie auch auf Deschler kommen, und von Deschler dann auf Megede stoßen.
Hier drohte mir eine weitere Gefahr, denn der kleine Sachse arbeitete gleichzeitig für Pullach und für uns. Trotz peinlicher Geheimhaltung ließ sich nicht ausschließen, daß er bei der Agency Dinge erfahren hatte, die nur drei oder vier Personen in Deutschland bekannt sein sollten: daß Bonn zur Aufdeckung unerklärbarer Ereignisse im Bundesnachrichtendienst die Hilfe von US-Spezialisten aus Washington in Anspruch nahm. Wenn sie Megede gefaßt hätten und ihre verdammten Methoden anwandten, die so brutal sein konnten, daß sie noch Steine zum Reden brachten, wäre ich auch noch von dieser Seite her gesehen in Gefahr. Aber falls Megede überhaupt etwas wußte, hätte er bis jetzt bestimmt noch geschwiegen, es sei denn, er wäre ein Überläufer. Auch damit mußte man rechnen, deshalb arbeiten auch die westlichen Geheimdienste nach des Leipziger Wahlbürgers Lenin Devise: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“
Das Mißtrauen war mir so eingedrillt, daß ich mich gelegentlich beim morgendlichen Rasieren im Spiegel selbst schon schief ansah. Das war natürlich übertrieben, aber sonst hielt ich mich peinlich an die Spielregeln der unsichtbaren Front. Es war die einzige Lebensversicherung, die es für mich gab, mit sehr viel Kleingedrucktem. Von dem „Trabant“ ging keine Gefahr aus, aber ich würde ihn doch kurz vor Berlin stehen lassen und dann sehen, wie ich weiterkäme.
Dicker Regen prasselte gegen die Windschutzscheibe. Von Sommer keine Rede, er war auch schon zur Legende geworden. Ich schaltete das Radio ein, hörte die Nachrichten. Leipzig wurde nicht erwähnt. Ich suchte die von der CIA genutzte subversive Kurzwelle Berlins.
Keine weitere Weisung.
Ich fuhr durch Wittenberg, die Luther-Stadt an der Elbe, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem rauchigen Industrierevier geworden war. Ich passierte die Stadtkirche Sankt Marien, in der der Reformator einst gepredigt hatte. Ich entschloß mich, einen kleinen Umweg einzulegen in Richtung Magdeburg. Sicher ist sicher. Kurz vor Erreichen der Bürde fuhr ich in einer hakenförmigen Absatzbewegung über die Landstraße 246-A in Richtung Potsdam weiter.
Ich sah eine große HO-Raststätte, die offensichtlich von Fernlastfahrern genutzt wurde. Ich einem spontanen Entschluß dirigierte ich den „Trabant“ in eine Parklücke, um ein spätes Frühstück zu mir zu nehmen. Ich stieß auf das obligate Transparent und stellte fest, daß die Mitteilung: Plaste und Elaste aus Schkopau diesmal schiere Erholung war.
Auch „die Zone“ hatte längst ihr Wirtschaftswunder und war dabei, die zehntgrößte Industriemacht der Welt zu werden. Sie hatte es schwerer gehabt als der Westen, weil von den Sowjets alles demontiert worden war, was sich bewegen ließ. Die erste Produktion in den volkseigenen Betrieben (VEB) war entsprechend gewesen. Damals war es vorgekommen, daß die Kühlschränke heizten und die Elektroöfen froren. Aber sechzehn Jahre nach Kriegsschluß hatte sich der Lebensstandard seit der Stunde Null erheblich gebessert. Ich kannte die Verhältnisse bestens, wenn auch bislang nur vom Schreibtisch her. Ich hatte die Produktionszahlen im Kopf, die Schlagkraft der Nationalen Streitkräfte, das Parteichinesisch war mir geläufig, mit seinen unerträglichen Abkürzungen, und ich wußte auch, daß der Staatssicherheitsdienst – im Volksmund Stasi genannt – nach offizieller Angabe über 17000 feste Mitarbeiter und über 100000 IM’s (inoffizielle Mitarbeiter) verfügt, wie man die ehrenamtlichen, wenn auch nicht ehrenwerten Spitzel nennt.
Sicher waren die Menschen in der DDR meistens schlechter angezogen als ihre Landsleute im Westen und wirkten eher satt als übersättigt, aber wenn sie nicht über das Wetter wetterten oder über ihre Regierung, dann kamen die gleichen Sorgen, Nöte, Freuden und Hoffnungen zum Vorschein wie überall auf der Welt, auch wenn politisch Welten zwischen Ost und West liegen. Beim Betreten der HO-Raststätte hörte ich wieder den Witz über den Unterschied – „Im Kapitalismus beutet der Mensch den Menschen aus, im Sozialismus ist es genau umgekehrt“, sagte der Fernfahrer lachend zu seinem Kumpel.
Der schmucklose Raum war voll besetzt. Schmutzige Tischdekken, fettes, aber geschmackloses Essen, das die Propaganda-Bekundungen zu bestätigen schien, die DDR-Bürger verzehrten mehr Butter als die Bundesbürger. Das mochte stimmen – aber deswegen war im Osten noch lange nicht alles in Butter.
Ich ließ mein Auge eine Weile durch den Raum schweifen, endlich fand ich einen Platz.
Dann wartete ich auf den Kellner. Ich wartete lange. DDR-Kellner sind notorisch mürrisch, denn die Abschaffung des Trinkgeldes gehörte zu den sozialistischen Errungenschaften und war doch nur eine Ausrede für Geizkrägen, denn Trinkgelder wurden auch weiterhin gegeben und genommen, selbst von Kellnern mit dem sed-Partei-Abzeichen.
Der Ober pflügte sich endlich heran. Er hatte seinen Daumen tief in meiner Terrine und trug eine speckige Jacke, alles in allem ein nicht gerade appetitanregender Anblick.
„Junge, Junge“, sagte einer der Blaukittel, die am Tisch saßen, „deine Montur mußt du auch mal wieder teeren lassen, damit das Weiße nicht rausschaut.“ Er tippte sich an die Stirne: „Weltniveau“, spottete er.
„Beschweren Sie sich beim Objektleiter, wenn Ihnen etwas nicht paßt“, erwiderte der Kellner pampig.
„Und nehmen Sie den Daumen aus meiner Brühe“, schaltete ich mich ein.
„Mensch, Kumpel“, wandte sich der Mann am Tisch lachend an mich, „sei doch froh, haste wenigstens ’nen Brocken Fleisch drin.“
Sie lachten dröhnend. Dann wurde das Radio laut aufgedreht. Radio DDR sandte Nachrichten. Nach den ersten Worten wußte ich, daß der fade Erbseneintopf, der vor mir dampfte, doch noch gewürzt würde.
„Berlin“, sagte der Sprecher mit gehobener Stimme. „Sicherheitskräften des Ministeriums für Staatssicherheit ist es heute im schlagartigen Zugriff wiederum gelungen, einen imperialistischen Agentenring zu zerschlagen. Drei Spione der Gehlen-Organisation wurden verhaftet; einer von ihnen ist in Leipzig bei einem Schußwechsel bei der Festnahme ums Leben gekommen.“ Nach einer Kunstpause setzte der Sprecher mit schmetternder Stimme hinzu: „Zur Stunde läuft auf dem gesamten Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik eine Sonderfahndung nach den Hintermännern der faschistischen Provokateure an, an der Tausende von Beamten der Volkspolizei teilnehmen. Gesucht wird ein weiterer Gehlen-Spion, der sich für den DDR Bürger Fritz Stenglein ausgibt. Dieser Mann ist etwa fünfunddreißig Jahre alt, einen Meter achtzig groß. Er hat ein glattes Gesicht, gescheitelte Haare und blaue Augen. Er spricht Schriftdeutsch mit Berliner Akzent, trägt eine braune Lederjacke zur grünen Hose. Hinweise nimmt jede Dienststelle der Volkspolizei oder direkt das Ministerium für Staatssicherheit entgegen.“
Die Schrecksekunde hatte ich mir wegtrainiert, die Jacke gewechselt, das Aussehen verändert. Der braune Lumberjack ruhte mit Stengleins Ausweis auf dem Grunde eines idyllischen Waldsees; ich trug jetzt einen grauen Pullover. Ich bin nur einen Meter achtundsiebzig, und meine Augen sind grau und nicht blau – aber das ändert nichts an der Tatsache, daß der Weg nach Berlin noch weit war und daß ich mich quer durch Vopos- und SSD-Streifen kämpfen mußte. Einen Moment lang hatte ich den Eindruck, alle im Saal würden mich anstarren. Ich befürchtete, daß sich auf meiner Stirn Schweißtropfen bilden würden – es war natürlich purer Nonsens.
„Diese Faschistenschweine“, sagte der Arbeiter, der mir gegenüber saß.
„Aber jetzt sind sie arme Hunde“, warf sein Kumpel mit einem Achselzucken ein.
„Geschieht ihnen ganz recht“, erwiderte der Blaukittel. „Die haben bei uns nichts zu suchen. “
„Und was ist mit den Leuten, die wir nach drüben schicken?“ fragte sein Widerpart.
„Das sind keine Agenten“, beendete der Arbeiter den Dialog. „Das sind verdiente sozialistische Kundschafter.“
Sie lachten beide schallend, und andere schlossen sich an. Es war die übliche DDR-Konversation, die offen ließ, ob die Teilnehmer sie ernst meinten oder ihren Staat veralberten. Ich nutzte das Gelächter, um mich nach draußen zu schieben.
Ich fing den Kellner ab, bezahlte im Stehen, quälte mich durch das Gedränge und lief prompt am Ausgang der Vopo-Streife in die Arme.
Der Sommertag wirkte wie ein fauler Wechsel, der jeden Moment zu platzen drohte. Zur Zeit lag Deutschland von der Nordseeküste bis zur Donau unter dichtem Regen, aber von den Bergen her war in die oberbayerische Landschaft eine Art Föhn eingefallen. Die Wälder schimmerten blau, der Himmel trug orangefarbene Flecke, und die Luft wirkte verbraucht wie Spülwasser. Die am späten Vormittag im Chefbüro in Pullachs „Weißem Haus“ zusammengetrommelten Teilnehmer einer improvisierten Besprechung wirkten abgeschlafft.
Den Spitzenleuten des bundesdeutschen Geheimdienstes war natürlich bekannt, daß – meteorologisch gesehen – im Hochsommer keine Föhnlage entsteht, aber als Experten der unsichtbaren Front wußten sie nur zu gut, daß auf dieser Erde vieles existiert, das es gar nicht geben darf, und so litten sie sichtbar, und nicht nur unter der Wetterunbill.
Der Hausherr des 60000 Quadratmeter großen und durch eine eineinhalb Kilometer lange Mauer abgeschirmten geheimen Hauptquartiers – im Isartal, zehn Kilometer südlich von München – saß an seinem Schreibtisch, ein schlanker, mittelgroßer Mann mit einem schmalen Kopf, kalten Augen, mit hohem Stirnansatz und schütteren Haaren. Auf den ersten Blick fielen seine übergroßen Ohren auf, überdimensionierten Horchgeräten gleich, wie sie einem Untergrundchef anstehen. Pullachs Chef nannte sich Dr. Schneider, aber jeder im Camp wußte, daß er in Wirklichkeit General Gehlen war, der frühere Chef der geheimen Nachrichtenabteilung „Fremde-Heere-Ost“. Hier, im engsten Mitarbeiterkreis, kannte jeder die wahre Identität des anderen, aber Pullachs legendärer und autoritärer Hausherr bestand darauf, daß sich seine Crew auch im internen Verkehr mit den falschen Namen anredete, und so kam es seinen Männern mitunter vor, als trügen sie ihre Pappnasen auch außerhalb des Karnevals.
Die Vertrauten des Chefs, von den Fernerstehenden mißgünstig „Pullachs Mafia“ genannt, waren fast vollständig zur Stelle: Dr. Grosse, der scharfsinnige Analytiker von der „Auswertung“, der kleine Karsunke, der schlaksige Söldner, der schieflippige, krummnasige Schluckesaft von der „Zentralen Abteilung“, Kleemann, der Schweigsame und der aggressiv intrigante Dennert mit dem Verschwörer-Gehabe.
Nur Ballauf fehlte, hatte die Aufforderung, bei Gehlen zu erscheinen, mit den rüden Worten: „Konferenzen sind der Sieg der Ärsche über die Köpfe“, quittiert, Ballauf, der mit seinen spektakulären Erfolgen an die großen ORG-Zeiten anknüpfte, konnte sich das Fernbleiben erlauben, obwohl er nicht mit dem General im gleichen Artillerieregiment gedient und weder der Canaris-Abwehr, noch dem Generalstab angehört hatte, was sonst für Pullachs Spitzengarnitur eine kaum umgehbare Voraussetzung war.
Die Herren, die der Günstlings-Crew zugerechnet wurden, hatten ihre Stühle zwanglos im Halbkreis um den Schreibtisch des Chefs gestellt. Keiner von ihnen fühlte sich wohl an diesem Tag; übereinstimmend deuteten die Akteure des Untergrunds ein flaues Gefühl nach Eintritt des Debakels als Vorahnung. Die Besprechung war zunächst wie alle anderen verlaufen; es ging um Berlin, wie fast immer in letzter Zeit. Seitdem der rote Zar, Nikita Chruschtschow, und sein sächsischer Lautsprecher und Statthalter Walter Ulbricht der früheren Reichshauptstadt – zunächst verbal – die Daumenschrauben angelegt hatten, glich die Vier-Zonen-Stadt einem Pulverfaß. Mit sowjetischem Segen hatte der Spitzbart den Sowjet-Sektor, unter Bruch des Viermächte-Abkommens, zur DDR-Hauptstadt erklärt, mit Anspruch auf die westlichen Sektoren. Der neue US-Präsident Kennedy sprach offen aus, daß eine Abschnürung des alliierten Zugangs nach Westberlin den Dritten Weltkrieg bedeuten könne, und die Franzosen erörterten bereits die verhängnisvolle Frage: Mourir pour Berlin – Sterben für Berlin?
Es war ein heißer Sommer, und es herrschten viel Kraftmeierei und Defätismus auf beiden Seiten. Pankow hatte 8000 Soldaten um Berlin zusammengezogen, um für die Bürger des „Arbeiterund Bauernstaates“ den Zugang in ihre eigene Metropole abzuriegeln. Viele Verkehrswege waren umgeleitet worden. Trotzdem ging ununterbrochen, Tag wie Nacht, ein Einbahnstrom von Flüchtlingen nach Westen. Die Ostdeutschen beteiligten sich zu Hunderten, zu Tausenden, zu Hunderttausenden, zu Millionen an der Volksabstimmung mit den Füßen.
Der Chef kam vom Thema ab. Ohne Übergang wandte er sich an Dr. Grosse von der Gegenspionage. „Noch immer keine Verbindung mit Metzler?“ fragte er. Obwohl er vor seinem Braintrust keine Geheimnisse hatte, bedeutete die Frage in Gegenwart von vier weiteren Mitarbeitern einen Verstoß gegen die selbst aufgestellte Regel einer lückenlosen Geheimhaltung.
„Sorry“, erwiderte der Referent; seine Stimme klang schläfrig, aber sein Adamsapfel bewegte sich aufgeregt. „Seit drei Tagen keine Nachricht. Nach seiner letzten Meldung ist Metzler nach Cottbus gefahren, und seitdem – “
Grosse brach mitten im Satz ab, es bedurfte auch keiner weiteren Erklärung. Die unterbrochene Nachrichtenverbindung konnte ein normaler Vorgang sein. Tatsächlich hatten alle „im Feind operierenden Agenten“ den Befehl, die Funkstille nur bei außerordentlichen Vorfällen zu unterbrechen.
Es brauchte nichts zu bedeuten, aber so hatte es immer begonnen: im Fall Auer im Januar; bei der Grainer-Affäre im März und bei der Panetzky-Sache im Juli. Januar, März, Juli. Schlag auf Schlag auf Schlag. Bis Ende Juli dieses Jahres waren 29 hochkarätige Agenten dem ostzonalen Staatssicherheitsdienst (Stasi) in die Falle gegangen. Im Vorjahr waren es 92 gewesen. Selbst wenn man einige Doppelagenten und Überläufer abzog, die aus propagandistischen Gründen im Osten hochgespielt worden waren, drohte der Aderlaß die bewährte „Firma“ zu ruinieren, denn drei in kurzen Abständen aus unerklärlichen Gründen hintereinander aufgeflogene Agentenringe konnte auch sie nicht verkraften. Das wußte jeder in dieser Runde, aber nur einer sprach es aus: Dennert, ein großer, knochiger Mann, erschrekkend hager. „Dann werden wir also auch Metzler abschreiben müssen“, sagte er. „Und womöglich auch noch Megede und Deschler.“
Der General schwieg verbissen. Karsunke und Schluckesaft nickten zustimmend. Ausgerechnet der sonst so schweigsame Kleemann erwiderte gereizt: „Sie sollten wirklich keinen beerdigen, Herr Dennert, bevor er gestorben ist.“
„Meinen Sie?“ entgegnete der Vize der Sonderabteilung „Strategischer Dienst“. Als stellvertretender Sicherheitschef war er der zweithöchste Hauspolizist und zudem ein Intimus des Generals. „Wenn ein Agentenring auffliegt, ist es eine Panne.“
Dennert sprach in einem süffisanten, überheblichen Ton. Sein Plisseegesicht wirkte blaß und hautig. „Wenn zwei – oder gar drei – hochgehen und die Fehlerquelle noch immer nicht entdeckt ist, dann gibt es wohl nur eine Erklärung.“ Sein linkes Auge flackerte wie in einem Wackelkontakt. Jedenfalls litt er, mit seinem Drittel-Magen ohnedies kein Gesundheitsathlet, am sichtbarsten unter dem Wetter. Im übrigen geisterte über den Unbeliebten durch das Camp das vergiftete Bonmot: „Hoffentlich wird der Dennert so alt wie er aussieht.“
„Was wollen Sie damit sagen?“
„Es liegt auf der Hand“, erwiderte Dennert. „Eine undichte Stelle. Hier in Pullach – im Camp Nikolaus, macht uns allmählich zu Weihnachtsmännern.“
„Das ist doch purer Unsinn“, warf Kleemann ein. „Wir hatten früher einen leichten Gegner gehabt und haben nunmehr einen schweren. Mit anderen Worten“, er lotete das Gesicht des Generals aus und registrierte stumme Zustimmung, „diese Stasi-Leute haben einfach dazugelernt – und wir müssen uns neue Wege einfallen lassen.“