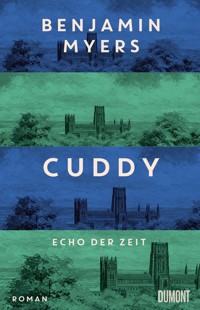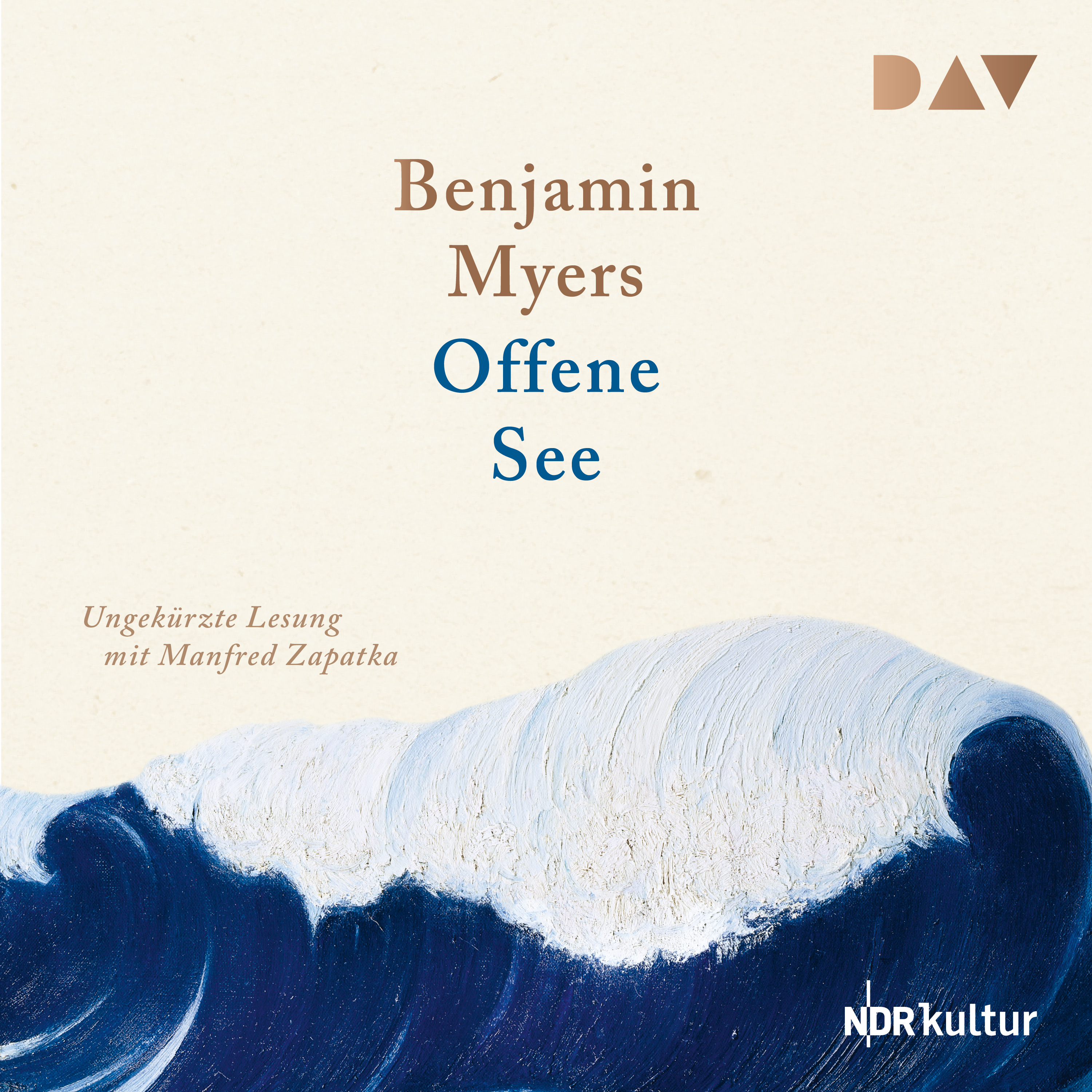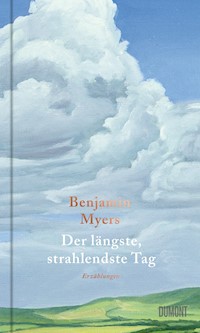
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die vornehmlich männlichen Protagonisten in Bejamin Myers' oft aufwühlenden Erzählungen haben weder das Strahlende der Helden vergangener Tage noch zeigen sie den Charakter, der sie das moderne Leben bewältigen lassen würde. Vielmehr kämpfen sie oft ums nackte Überleben, oft mit gescheiterten Lebensentwürfen und ihrer Vorstellung vom Mannsein. Harte Arbeit, Prinzipientreue, Pflichterfüllung, ohne Fragen zu stellen, all das ist ihnen nicht fremd. Vor Versagensängsten, Unsicherheit und Zärtlichkeit schrecken sie zurück. So wie der Ehemann der namenlosen Frau, die in ›Ein englisches Ende‹ beim friedlichen Schwimmen in einem abgelegenen See ihrer Ehe unsentimental und klarsichtig Revue passieren lässt. Sieger sind die Frauen und Männer in Myers' Erzählungen kaum, dennoch erleben sie ab und an Momente des Friedens und des Glücks. ›Der längste, strahlendste Tag‹ vereint die Arbeit von fünfzehn Jahren. Emotional und sprachlich dicht überzeugt jede einzelne Geschichte von Benjamin Myers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ein Museumswärter hält die Stellung an einem nahezu vergessenen Ausstellungsort; ein Farmer kämpft jeden Tag mit dem Land, das er liebt und das ihm harte Arbeit abverlangt; ein Paar hofft am längsten Tag des Jahres auf Lohn für seine Arbeit und alltäglichen Mühen: In diesen Erzählungen leuchten Benjamin Myers’ Charaktere mit all ihren Träumen und Sehnsüchten. Zugleich zeigen die Natur und das Leben vor allem den Männern die Grenzen ihrer Fähigkeiten und ihres Willens auf.
Benjamin Myers’ Erzählungen zeigen die ganze literarische Bandbreite dieses scharfsinnigen Autors.
© Alex de Palma
Benjamin Myers, geboren 1976, ist Journalist und Schriftsteller. Myers hat nicht nur mehrere preisgekrönte Romane, sondern auch Sachbücher und Lyrik geschrieben. Sein Roman ›Offene See‹ (DuMont 2020) steht seit Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und erhielt 2020 die Auszeichnung »Lieblingsbuch der Unabhängigen«. Er lebt mit seiner Frau in Nordengland.
Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, beide 1955 geboren, haben Anglistik in Düsseldorf studiert. Seither arbeiten sie als Übersetzerteam und haben u.a. Dave Eggers, Tana French, Andre Dubus III., Harper Lee, Jeanette Walls und Zadie Smith ins Deutsche übertragen.
Benjamin Myers
Der längste, strahlendste Tag
Erzählungen
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Von Benjamin Myers sind bei DuMont außerdem erschienen:
Offene See
Der perfekte Kreis
Die englische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel ›Male Tears‹ bei Bloomsbury Circus, London.
© Benjamin Myers, 2021
eBook 2022
© 2022 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ulrike Wasel/Klaus Timmermann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Peter Breeden/Bridgeman Images
Satz: Angelika Kudella, Köln
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8263-2
www.dumont-buchverlag.de
Die Tragödie des Machismo ist, dass ein Mann nie ganz Mann genug ist.
Germaine Greer
Tausend Morgen englische Erde
Der Hase sitzt schnuppernd auf den Hinterbeinen und beobachtet aus der Ferne den Mann, der gerade das mittlere Feld betritt. Er hat die Ohren in den Wind gedreht, und als der Mann über die Kante einer Furche stolpert, macht er kehrt, um dann in gemächlichem Tempo davonzulaufen.
Der Mann sieht den weißen Fleck am Hinterteil des Tiers über Stoppeln hüpfen. Er fand es schon immer eine grausame Laune der Natur, ein so scheues Geschöpf mit einer Zielscheibe zu versehen; ein Makel der Unvollkommenheit, damit es sich nicht über seine Möglichkeiten hinaus vermehrt.
Er bleibt stehen und schaut zu, wie der Hase mit großen Sprüngen auf den schützenden Schatten der Hecke am hinteren Feldrand zuläuft, wie sich die starken Sehnen seiner Beine straffen und dehnen.
Er ist in dem Glauben erzogen worden, dass es ein Zeichen ist, wenn man den ersten Hasen der Saison sieht, aber er weiß nicht mehr genau, ob es Glück oder Unglück bedeutet. Als Mann der Erde und der Wälder und der Hohlwege neigt er zu Letzterem. Für ihn ist der Hase ein böses Omen.
Der Mann geht am Rand des Feldes entlang und genießt die tief stehende Sonne im Gesicht. Er betrachtet die trägen Anfänge des Tagbogens, den sie über das Feld beschreibt, und zum ersten Mal in diesem Jahr ist er froh, dass er zu Fuß zur Arbeit gehen kann. Andere Farmer würden ihn für absonderlich halten für jede Sekunde, die er zusätzlich im Freien verbringt; und im Herbst und Winter kommt es oft vor, dass er den Anderthalb-Meilen-Fußweg verflucht, der ihn an der Eisenbahntrasse entlang unter der Brücke hindurch und auf den neuen Fahrradweg führt, der vor Kurzem mit schlechtem körnigem Mischgut angelegt wurde, in dem sich Pfützen bilden wie in den hohlen Händen eines durstigen Mannes, der an einem heißen Erntetag kühles Wasser aus einem Trog schöpft.
An dunklen feuchten Tagen, wenn er frühmorgens eine Taschenlampe braucht, um nicht in diese Wasserlöcher zu treten, oder im Winter, wenn harter Frost den Boden bedeckt und schneidender Wind über das offene Feld fegt und ihm unter die Kleiderschichten kriecht, wäre er lieber irgendwo anders. Aber heute ist er froh, denn wie der Hase wittert er die nahende Jahreszeit in der linden Luft.
Der Fußweg verbindet ihn mit der Vergangenheit. Er folgt einer vorgegebenen Spur, einer Route – einer Tradition –, die Jahrhunderte alt ist.
Der Weg, der vom mittleren Feld zu den Lagerschuppen führt, ist durch die Trockenheit hart geworden, und schon durchzieht ein Netz aus Rissen den Boden. Der dichte Stechginster, der den Weg säumt, verdeckt für einen Moment die Sonne, doch dann wird der Boden unter den Füßen eben, und der Mann überquert den Hof, um den Riegel zu öffnen. Er nimmt einen Schlüssel und schließt ein Vorhängeschloss auf, mit dem die Doppeltür zum größeren der beiden Wellblechschuppen verriegelt ist, zieht dann eine lange, dicke Kette durch die kalten Hände.
Der Mann öffnet einen robusten Türflügel und schaltet das Licht ein. Er deaktiviert die Alarmanlage. Er meint, das leise Huschen von Krallen auf Beton zu hören und ein Geräusch, als würde etwas – vielleicht der weggeworfene Deckel einer Farbdose – ein winziges Stück verschoben. Ein kurzes, deutliches Schaben.
Der Roder steht halb im Dunkeln wie ein großes schlafendes Untier, doch als der Mann den zweiten Türflügel öffnet und die Sonne hereinfällt, um den Glanz der roten Lackierung voll zum Leuchten zu bringen, ist es fast so, als würde sich die Bestie bewegen, als erwache sie nach einem längeren Schlaf wieder zum Leben. Die Maschine erinnert ihn an mythische Wesen, an wuchtige Ungetüme aus Kinderbüchern. Drachen und Greife und Phönixe, in Mechanik gegossen.
Jeden Morgen fühlt er sich in Gegenwart des Roders winzig klein und empfindet eine stille Ehrfurcht vor den zehntausend Bestandteilen, die in die Erschaffung dieses Geräts eingeflossen sind, das komplizierter und komplexer ist als ein menschliches Skelett.
Der Mann holt seinen Schlüsselbund hervor und klettert in die Fahrerkabine. Er startet den Motor. Er spürt, wie die automatisierten Vibrationen durch sein Innerstes aufsteigen.
Der Junge trippelte mit kleinen Seitenschritten die Böschung hinunter. Plastik. Überall war Plastik: ragte wie frische Triebe aus der Erde und wand sich um uralte und verschlungene Wurzeln.
Er rutschte ein Stück, fing sich dann und wendete wie ein Skiläufer, der die unteren Hänge der Eiger hinabfährt.
Er hätte in der Schule sein sollen, doch stattdessen war er draußen, in der grünen Kathedrale des alten Waldes. Hier hatte er das Gefühl, Dinge zu lernen, wichtige Dinge über Wachstum und das Leben und die Unabwendbarkeit des Todes. Im Vergleich zu einem solchen Unterricht kam es ihm wie eine sinnlose Ablenkung vor, etwas über Mathematik und längst begrabene Monarchen zu lernen.
Die alte städtische Müllhalde lag in einer jetzt überwucherten Lichtung des bewaldeten Berghangs, wo es schien, als fochten die Natur und die weggeworfenen Gegenstände des Menschen einen fortwährenden Kampf miteinander aus. Abfall, der zwei oder drei Jahrzehnte zuvor von Tiefladern und aus Containern gekippt, aus Kofferräumen und Schubkarren geholt und in die große Grube geworfen worden war, um dann unter einer dünnen Lage Erde begraben zu werden, kam langsam wieder an die Oberfläche. Der Regen in all den Jahren hatte den Lehm weggespült und eine Schicht aus einstmals gelebten Leben freigelegt: ein Nachlass von Hausmüll, der wie ein groteskes Beet aus Blumensträußen erblühte. Zerbrochenes Porzellan und alte Bierdosen mit Markenaufdrucken aus einer anderen Zeit, Glasflaschen mit Bügelverschlüssen statt Kronkorken. Der Junge sah Fetzen von Abdeckplanen und vereinzelte Schuhe.
An anderen Tagen schien es, als würde der Boden alles verschlingen, es wie Treibsand in die Tiefe ziehen. Die verfüllten Grubenschächte, die bekanntermaßen hier einstürzten, bewiesen, dass der Untergrund die Fähigkeit besaß, sich zu bewegen, dass er ein durchlässiges und amorphes Gebilde mit einem Eigenleben war. Deshalb galt der Wald jetzt als Gefahr und war dauerhaft für die Öffentlichkeit gesperrt.
Dieser Bereich gehörte nun den Nesseln und dem Efeu. Der Wald gehörte dem Springkraut und dem Kreuzkraut und den Tieren.
Der Junge hatte da oben Rehe und Füchse gesehen. Er hatte ein brütendes Rabenpaar gesehen, Eulen, Dutzende Eichhörnchen und Kaninchen und einmal, in der Abenddämmerung, einen Dachs. Am verbreitetsten waren die Ratten, die in den Spalten und Hohlräumen der Müllhalde nisteten. Anfangs waren sie von weggekippten Eimern mit Fett aus der Schulküche und stinkenden Schlachtereiabfällen angelockt worden, jetzt tummelten sie sich in einem Reich, wohin sich kaum einmal ein Mensch verirrte.
Es gab noch immer Dinge, die von den wenigen gefunden wurden, die nach ihnen suchten, Artefakte einer sich verändernden Welt. Alte Uhren und Einmachgläser und Murmeln und Kinderwagenräder, mit denen der Junge sich eine Seifenkiste bauen konnte, oder Wäscheständer und verrostete Fahrradketten, die als Waffen taugten, oder Teetabletts zum Rodeln, wenn es schneite. In einem Karton unter seinem Bett bewahrte er seine Schätze auf. Münzen und Glasperlen und ein großes Taschenmesser, die Klinge schartig und grün angelaufen.
Der Junge ging zum äußersten Ende der Müllhalde. Mit einem Stock stocherte er in der Erde. Er sah Sprungfedern und verfilzte Lappen mit Blümchenmuster und gebrochene Knöpfe. Er sah noch mehr Flaschen, umgedreht. Sie erinnerten ihn an Straußenvögel.
Er trat zwischen die Plastikteile von einst nützlichen Dingen, jetzt zerbrochen und verstreut, und einen Stapel Zeitungen, zu einem kissengroßen matschigen Berg verklebt, die Farben vom Regen zerlaufen und die Wörter in die Geschichte hinein verwischt. Es gab Ballastsäcke voller Beton, in seltsamen skulpturartigen Verformungen erstarrt. Gelbe Gummihandschuhe und Dachschieferplatten. Verbogene Reifen. Leere Spraydosen. Zerbrochenes Geschirr und verzogene Tupperbehälter. Eine Rolle Polizeiabsperrband. Ein Kabelknäuel.
Irgendetwas an der Form eines matten und verrosteten Metallteils, das aus der Erde ragte, weckte die Neugier des Jungen. Als er mit dem Fuß dagegentrat, gab es etwas nach, aber dabei ging sein Turnschuh auf, und er musste ihn wieder zubinden. Er versuchte erneut, es freizubekommen, und es lockerte sich weiter. Es schien Teil von etwas Größerem zu sein. Doch als er es mit beiden Händen packen konnte und ganz fest zog, als wollte er Möhren ernten, löste es sich plötzlich aus der Erde, und er taumelte ein paar Schritte rückwärts.
Der Junge drehte es um. Er sah, dass es zwei Bügel hatte. Die Bügel waren gezahnt, und die Zähne waren eingerastet, und der Junge war froh. Es hatte einen lose baumelnden Stift und eine Metallscheibe zwischen den Bügeln. Das Ganze wurde von einem Rahmen zusammengehalten.
Die Vorrichtung strahlte etwas Bösartiges aus. Die Jahre in der Erde hatten sie nicht ihres Gewaltpotenzials beraubt. Der Junge hatte das Gefühl, in Gefahr zu sein, indem er sie bloß in den Händen hielt, so ganz allein da im Wald. Aber er empfand auch Aufregung.
Tausend Morgen umgeben den Mann, und die Ernte läuft gut. Die Kartoffeln kommen leicht hoch, und er sieht, dass es sein Jahr sein wird. Eine Zeit der Fülle. Letztes Jahr hat Braunfäule die Ernte vernichtet – sie in einen infizierten Matsch verwandelt, den er nicht mal an Schweine verfüttern würde –, jetzt jedoch ist das Wetter auf seiner Seite.
Letzte Woche regnete es in Strömen, und noch gestern hingen die Wolken so niedrig, dass der Mann schon fest mit weiterem Starkregen rechnete, der die tiefen Kartoffelfurchen aufweichen würde. Doch es blieb trocken, und jetzt sitzt er oben in der Maschine, die spinnenartig über das Feld kriecht.
Der Kartoffelroder leistet die Arbeit von achtzehn Männern. So viele waren vor fünfzig Jahren erforderlich, als sein Vater diese Felder bewirtschaftete und abends zu Hause schon bei seiner ersten Selbstgedrehten vor Erschöpfung einschlief. Inzwischen pflügen und eggen und ernten die meisten Kartoffelbauern allein, arbeiten wortlos wie einsame Seefahrer auf ihren weiten Binnenmeeren aus Erde.
Der Mann kontrolliert das Bedienfeld, überprüft immer wieder Schalter und liest Anzeigen ab, um sicherzugehen, dass der Roder in der Spur bleibt und sich parallel zum Feldrand bewegt. Koordinaten auf einem GPS-Touchscreen leiten ihn.
Die Maschine brummt und summt und surrt, während mechanische Greifer die Erde durchkämmen wie ein Pflug hinter einem Ochsengespann, aber wesentlich schneller und gründlicher und ohne Schwielen oder überanstrengte Muskeln. Zwei Förderbänder heben, sieben und sortieren die Kartoffeln. Ein Knopfdruck befördert sie per Gummifließband ins Herz der roten Metallbestie, von wo sie hinten in einen Vorratsbunker fallen, der bis zu sechs Tonnen aufnehmen kann. Zu kleine Kartoffeln und Steinchen und Erdklumpen werden durch Netze ausgesiebt, während der Screen laufend Daten zur Ernte liefert. Auslastung der Lagerkapazität. Nettogewicht. Ertrag.
Unsichtbare Dreschmesser trennen das Kraut von den Knollen.
Früher musste ein Krautschneider vor einen Traktor montiert und durch die Kartoffelfelder geschoben werden, aber die Zeiten sind vorbei. Das große rote Untier erledigt auch das. Und hinterher, nach getaner Arbeit, wird die Maschine ihre Gliedmaßen anlegen. Der Druck eines anderen Knopfes wird dafür sorgen, dass ausgefahrene Teile eingezogen und zusammengeklappt werden, kompakt verstaut.
Die Maschine kostet mehr als ein durchschnittliches Einfamilienhaus.
Der Anblick, wie Tausende erdfleckige Kartoffeln das Fließband hinaufhüpfen und -kullern, ist für ihn hypnotisch. Versetzt ihn in Trance. Er sieht sie als Menschen. Er sieht sie als Köpfe. Sie lassen ihn an Flughäfen und Bahnsteige und London zur Rushhour denken.
Die Sonne steht jetzt hoch, und eine Biene ist bei ihm in der Kabine eingesperrt, aber sie stört ihn nicht, also stört er sie nicht. Er lässt sie träge gegen die Scheibe fliegen und schiebt den Ellbogen aus dem Fenster, beobachtet die rollenden Kartoffeln und spürt das dumpfe Rumpeln seiner Ernte in dem Vorratsbunker, der Klang von organischer Materie auf Metall. Heute gibt es kein schöneres Geräusch.
Der Mann erreicht das Ende von Reihe drei und wendet im weiten Bogen, sieht die Krümmung des Feldes leicht nach rechts abfallen und die Sonne noch höher steigen, und er gibt sich dem Ritual der Jahrhunderte hin.
Der Junge wartete bis zum Abend, um seinen Vater zu fragen, was es war. Er glaubte, es bereits zu wissen, wollte aber Bestätigung.
Nach dem Essen, mit einer Tasse Tee und einem lodernden Feuer im rauchgeschwärzten Kamin, war der richtige Moment, ihn anzusprechen.
Sein Vater war den ganzen Tag draußen auf dem Feld gewesen, und ihm sank schon das Kinn auf die Brust.
»Dad. Weißt du, was das ist?«
Sein Vater blickte auf, die Augen nach zwölf Stunden in dichten Wolken aus Staub und Spreu rot umrandet, und einen Moment lang starrte er seinen Sohn bloß an, als wäre er gar nicht da, dann blinzelte er und streckte die Hand aus.
Der Junge reichte ihm das schwere verrostete Ding.
Sein Vater nahm es und drehte es um. Mit dem runden Ende seines Teelöffels kratzte er etwas Rost ab.
»Das ist ein Tellereisen«, sagte er.
»Tellereisen?«
»So nennt man die. Eine Tierfalle.«
Der Junge wischte sich mit dem Handrücken die Nase ab.
»Die wurden aus geschmiedetem Stahl gemacht«, sagte sein Vater. »Woher hast du die?«
»Von der Müllhalde.«
»Die sind verboten. Und ich hab dir gesagt, du sollst nicht dahin.«
»Warum sind sie verboten?«
Sein Vater legte die Zigarette weg. Er fuhr mit den Fingern über die Metallzähne und versuchte dann, die Bügel auseinanderzuziehen.
»Muss geölt werden.«
»Warum sind sie verboten, Dad?«
»Weil sich die Menschen geändert haben«, sagte er. »Früher waren die Dinger erlaubt. Es gab mal eine Zeit, da hatte jeder Jäger und jeder Farmer ein paar von denen zu Hause – zumindest diejenigen, die keine Kaninchen in ihren Feldern haben wollten. Der Schmied hat sie hergestellt. Waren mal so verbreitet wie Steckrüben, diese alten Tellereisen.«
»Dann sind die dafür gedacht? Um Kaninchen zu fangen?«
»Hauptsächlich, aber die Dinger schnappen sich alles, was ihnen zu nahe kommt. Und dann haben die Leute angefangen, Kaninchen als Haustiere zu halten. Sie haben sie ins Herz geschlossen und immer öfter über Sachen gejammert, von denen sie keine Ahnung hatten. Du weißt ja, wie die sind, die Städter und die Zugezogenen. Die in den Siedlungen.«
Sein Vater zog ein finsteres Gesicht, als er das sagte. Jede Erwähnung der Neubausiedlungen machte ihn wütend, und sobald ihm das Wort über die Lippen kam, nickte er in Richtung der neuen Häuser, die eine halbe Meile entfernt gebaut worden waren. Der Junge war dazu erzogen worden, sie mit Misstrauen, Ablehnung und Verbitterung zu betrachten. Die Siedlungen, das war ein Schimpfwort, schlimmer als alle anderen.
Weil die neuen Häuser mit ihren akkurat gemähten Rasenflächen und den Straßen, die nirgendwohin führten, nur immer im Kreis, eindeutig das langsame Sterben der Landwirtschaft ankündigten. Laut seinem Vater waren sie ein weiterer Schlag ins Gesicht der Farmer, deren Grundstücke aufgeteilt und verkauft wurden, um unter Teer und Asphalt begraben zu werden.
»Seit wann sind die verboten?«
Sein Vater nahm seine Zigarette und zog daran, dann legte er sie wieder auf den Rand des Aschenbechers.
»Seit zehn oder zwanzig Jahren, schätze ich. In den Fünfzigern.«
»Ist es was wert?«, fragte der Junge.
Sein Vater gab ihm das Tellereisen zurück. »Wahrscheinlich keinen müden Heller. Schmeiß es weg.«
»Denkst du, wir könnten es wieder funktionstüchtig machen?«
»Mit so was spielt man nicht rum. Das ist gefährlich.«
»Wir könnten es in der Siedlung aufstellen«, sagte der Junge.
Sein Vater griff wieder nach der Zigarette und lächelte. Es war ein dünnes, wässriges Lächeln, aber immerhin ein Lächeln. Er lehnte sich im Sessel zurück.
»Hol mir mal die Ölkanne und einen Lappen aus dem Schuppen«, sagte er. »Und bring meinen Hammer mit.«
Möwen folgen dem Roder, suchen nach Würmern. Sie verharren in der Luft, rangeln miteinander, bevor sie eine nach der anderen herabstoßen.
Dicke, lang gestreckte, sich windende Stränge hängen aus ihren Schnäbeln, wenn sie auf und davon fliegen, und dann stürzt sich die nächste wirre Phalanx aus kreischenden Vögeln herab.
Das Meer ist dreißig Meilen weit weg, aber sie kommen trotzdem bis hierher.
Der Mann achtet nicht auf sie. Er beobachtet die Anzeigen und raucht eine Selbstgedrehte, die er zwischen zwei vergilbten Fingern der linken Hand hält. Die andere lässt er aus dem Fenster baumeln. Falls sich das Wetter hält, wird sein Arm am Ende der Erntezeit tiefbraun und mit einem von der Sonne gebleichten blonden Haarflaum bedeckt sein. Der Hautton eines echten Farmers.
Er lässt das Untier die ganze Arbeit machen, das gierig die Knollen aus dem gefurchten Acker rafft und sortiert. Es sind Maris-Piper-Kartoffeln, die Besten, die es gibt. Er wird einen Spitzenpreis dafür bekommen, und Ende September wird er irgendwohin weit weg reisen.
Nach der zehnten Wende erlaubt sich der Mann den Luxus, seine Gedanken schweifen zu lassen. Er stellt sich eine Restaurantterrasse mit Blick aufs Meer vor. Wellen, die sich sanft am Ufer brechen. Ein Glas Bier. Es ist so kalt, dass Kondenswasser daran perlt. Er nimmt es und trinkt einen Schluck. Leert es. Winkt dem Kellner, ihm noch eins zu bringen.
Das Untier ruckelt, und ein Geräusch ist zu hören, von dem er instinktiv weiß, dass es falsch ist. Ein Beben und dann ein mahlendes Knirschen, das das tiefe Brummen des Motors und das dröhnende Rumpeln der fallenden Kartoffeln übertönt.
Der Mann stoppt die Maschine, lässt aber den Motor laufen, um die programmierten Einstellungen beizubehalten. Er wirft seine Zigarette weg und steigt aus der Kabine. Er sieht den Möwenschwarm hinter dem Roder und dann etwas – er vermutet einen dicken Stein –, das die Messer auf der Beifahrerseite blockiert. Er ragt halb aus dem Boden, ein kleiner Felsbrocken, der noch nicht komplett eingeklemmt ist und der gut erreichbar zu sein scheint.
Der Mann geht in die Hocke, legt sich dann auf den Rücken und zieht ein Bein an. Er tritt gegen den Stein, der sich leicht bewegt. Er holt erneut aus und tritt fester zu, doch diesmal bewegt sich der Brocken nicht. Der Mann blickt hoch und kann durch die Maschine hindurch Tageslicht sehen. Er kann einen klaren blauen Himmel sehen, durchzogen von einem einsamen Kondensstreifen, der sich ausweitet und in der Ferne verblasst.
Er klettert zurück in die Kabine und holt eine Heugabel, und dann kriecht er unter die Maschine und stößt und stochert, aber der Stein lässt sich nicht bewegen, also klettert er seitlich um die Kabine herum und vorne auf die Maschine. Sie ist poliert. Blank gewienert. Die Sonne schimmert darauf. Die Maschine ist schön. Sie schnurrt.
Der Mann sieht den Stein im Krautschneider. Er dreht die Heugabel herum und rammt sie nach unten, und er trifft den Stein, und der gibt nach, doch durch die Bewegung rutscht der Mann weg, und sein Schwerpunkt ist etwas Vages, denn da reißt irgendetwas am Saum seines Hosenbeins. Es zerrt und zieht, und er spürt, wie sein Fuß zermalmt und zusammengequetscht wird, wie die letzte Windung beim Aufrollen einer Zahnpastatube. Der Schmerz entführt ihn auf einen anderen Planeten.
Dennoch gibt er keinen Laut von sich, als er das andere Bein hebt und sich dreht und krümmt, versucht, sich zu befreien, doch das scheint ihn nur noch tiefer hineinzuziehen, als die Messer des Krautschneiders erst das eine, dann das andere Bein auffressen. Die Maschine zerhackt seine Schienbeine und Oberschenkelknochen, und jetzt schreit der Mann und windet sich, und dann klappt eine Sicherungsvorrichtung herunter, und die Messer verlangsamen sich auf halbe Geschwindigkeit und bleiben dann stehen, und seine Beine sind eine längliche breiige Masse aus Muskeln, Bändern und Sehnen, die sich gut einen Meter tief in den Bauch des Untiers erstreckt.
Die Möwen schweben hoch über ihm, als er zuerst Blut und dann das Bewusstsein verliert.
Der Junge durfte nicht schon wieder die Schule schwänzen, deshalb stand er früh auf, trank leise Milch aus der Flasche und steckte eine der Capstan-Zigaretten seines Vaters ein. Die Vögel sangen, als er aus dem Haus trat, und der Tag war bloß ein schmaler, löchriger Streifen am Saum des dunklen Himmels.
Er hatte die geölte Falle in einen alten Lappen gewickelt und trug sie fest unter den Arm geklemmt. In seiner Tasche war ein Brötchen. Er ging durch die leeren Straßen, und er pfiff vor sich hin, während die Sonne sich über den Himmel breitete und der Tag geboren wurde, als wäre es das allererste Mal.
Er würde der Stadt einen Gefallen tun, wenn er die Müllhalde von Ratten befreite, dachte er. Ein oder zwei Ratten pro Tag wären schon eine ganze Menge, wie auch immer man es betrachtete.
Er stieg auf einen Zaun und sprang hinein in den reglosen und stillen Wald.
Als der Junge sich der alten Müllhalde näherte, schwebte ein geisterhafter Dunst in der Luft, und die Bäume waren so hoch wie Kirchtürme.
Er wickelte das Tellereisen aus, ging in die Hocke und schob den Daumen in die Federöse, drückte dann den Spannhebel mit dem Fuß nach unten und hielt ihn fest. Er brauchte seine ganze Kraft, um die Fangbügel auseinanderzudrücken. Er blockierte sie mit einem Stein, während er den Sicherungshaken einrasten ließ. Ohne die Falle aus den Augen zu lassen, tastete der Junge nach einem Stock, und als er einen gefunden hatte, klopfte er damit sachte auf den verrosteten Teller und – schnapp. Er zuckte zusammen, als die Fangbügel blitzschnell zusammenschlugen und den Stock glatt durchtrennten, die Zähne fest ineinander verbissen.
Die Brutalität der Falle war bestürzend und aufregend zugleich. Er wollte sie sofort noch einmal in Aktion sehen, also machte er noch einen Testlauf und beköderte sie dann mit Brot und entfernte sich mit Rückwärtsschritten, für den Fall, dass sie durch seine Bewegung ein drittes Mal ausgelöst würde.
Er setzte sich auf eine feuchte Matratze und holte die Zigarette hervor. Von hier aus konnte man durch die Bäume bis zu dem Flickenteppich von Feldern weiter unten im Tal sehen, wo sein Vater arbeitete. Die Zigarette war geknickt, aber nicht zerbrochen. Der Junge zündete sie an und inhalierte. Hustete. Er lernte noch, wie man raucht, und war am liebsten dabei allein. Außerdem wurde ihm davon schlecht und schwindelig. Er rauchte sie halb, drückte sie dann vorsichtig aus und steckte den Rest wieder ein.
Der Junge beobachtete die Falle noch ein bisschen länger. Der Wald war leise und ruhig, und obwohl er sich am liebsten ausgestreckt hätte und ewig hier liegen geblieben wäre, stand er auf, reckte sich und machte sich widerwillig auf den Weg zur Schule.
Als der Mann erwacht, ist alles still, und die Sonne scheint ihm ins Gesicht. Die Sonne blendet ihn. Es sind keine Vögel da, und seine Beine sind bis zum Oberschenkel zerstört. Sie sind zertrümmert und blutig, und sie tropfen.
Die Zeit wird jetzt zu etwas Neuem, das es zu bedenken gilt. Sie ist zu einer abstrakten, auf Schmerz basierenden Konfiguration rekalibriert worden.
Der Mann zittert unkontrolliert, und ihm ist kalt, und er kommt sich dumm vor, wie er da aufrecht in der Maschine hängt, wie eine im Toaster verklemmte Scheibe Brot oder ein alter Kontoauszug, der im Büro-Reißwolf festsitzt. Er hasst sich dafür, dass ihm das passiert ist. Dass er seine eigene Demütigung fabriziert hat.
Früher wären noch andere Männer hier gewesen. Landarbeiter und Erntehelfer. Es wäre ein Team da gewesen, doch jetzt gibt es nur eine Maschine, und die Maschine kontrolliert ihn, und niemand kann sein gepresstes Stöhnen und trockenes Würgen hören.
Der Mann spürt, wie die tausend Morgen englische Erde anfangen, um ihn herum zu kreisen. Er ist das Epizentrum einer Fliehkraft, von der die Landschaft und auch der Planet angetrieben werden, während der Boden rotiert. Er würgt, als etwas Bitteres in seiner Kehle aufplatzt. Er will ausspucken, besabbert sich aber stattdessen das Kinn. Etwas Nasses bleibt einen Moment dort hängen, ehe es auf sein Arbeitshemd tropft.
Schon allein die Bewegung eines Augenlids verstärkt seine Qual, und das Atmen lotet die Tiefen dieser Schmerzquelle aus. Doch er muss atmen, also konzentriert er sich darauf: einatmen und dann ausatmen. Es ist das Komplizierteste, was er je in seinem Leben tun musste. Einatmen und dann ausatmen. Jeder Atemzug ist ein Jahrhundert der Schmerzen, doch nicht so quälend wie die Erkenntnis, dass er vielleicht nie gefunden wird, dass die Sonne sich über den Himmel bewegen wird, dass der Tag zur Nacht und die Nacht wieder zum Tag werden wird und dass niemand ihn vermissen wird, und schließlich wird er verfaulen, und die Maschine wird jahrzehntelang hier mitten auf dem Feld stehen und vor sich hin rosten, ein Relikt für zukünftige Zeiten.
Die Möwen, die verschwunden schienen, sind jetzt zurückgekehrt. Der Mann kann sie hinter sich hören, zuerst, als sie sich um Würmer zanken, und dann noch lauter, als sie von einer ungestümen Krähe gestört werden, die wie eine schwarze vom Wind verwehte Serviette zwischen ihnen landet.
Der Motor summt im Leerlauf.
Die Dämmerung hatte sich wie ein Vorhang über den Wald gesenkt.
Das hartnäckige dünne Pochen eines Spechts in der Ferne klopfte einen Rhythmus, der durch die Baumsäulen hallte, als der Junge über die Müllhalde zu der Falle ging.
Der Abend war vollkommen still, bis sich etwas Rundes vor ihm aufzubäumen schien, ein plumpes Ding, zehn Meter von der Stelle entfernt, wo er die Falle aufgestellt hatte. Es war ein Dachs, die Zähne gebleckt.
Der Junge blieb stehen und hielt den Atem an, und dann suchte er sich einen Stock und ging langsam auf das Tier zu. Es zog den Kopf ein und krümmte sich zusammen. Sein rechtes Vorderbein war zwischen den Fangbügeln des Tellereisens eingeklemmt, dicht an seinem Kniegelenk.
Als der Junge näher kam, keckerte der Dachs. Es war ein diabolischer Laut reiner und geballter Angst.
Er hatte Blut um die Schnauze. Das Fell dort war verfilzt. Verklebt. Mit weit aufgerissenen Augen versuchte der Dachs zu fliehen, doch die Falle hielt ihn am Boden fest, und er konnte sie nur hilflos ein Stück hinter sich herschleifen. Der Junge sah eine weitere Blutspur, die sich über die Müllhalde zog.
Jetzt erst bemerkte er die ausgefranste Wunde unter den Zähnen der Fangbügel – ein gutes Stück tiefer, Richtung Fuß. Die konnte nicht von der Falle stammen. Der Junge schaute genauer hin und sah das Blut und die scharfen Zähne und die Augen des Dachses, und dann begriff er.
Diese Wunde stammte von dem Tier selbst. In seiner Verzweiflung versuchte es, seine eigene Pfote abzubeißen. Tief in dem warmen, nassen Rot der selbst zugefügten Wunde, die der Anfang einer Amputation war, konnte der Junge Knochen sehen.
Er fuhr herum und rannte und rannte immer weiter.
Die Sonne hat die Leiter des Himmels erklommen, und dem Mann brennt der Kopf von ihrem stechenden Licht. Seine juckende Kopfhaut macht ihm jetzt mehr zu schaffen als seine zerstörten Gliedmaßen.
Es muss kurz vor Mittag sein, schätzt er, so gut es ihm ohne Uhr möglich ist.
Vielleicht, weil sie woanders eine bessere Futterstelle erahnen – der Mann stellt sich einen aufsteigenden Heringsschwarm vor, der die Oberfläche der Nordsee silbern sprenkelt –, haben die Möwen ihn wieder verlassen, und das Feld ist still.
Er hat sich noch nicht getraut, nach unten zu blicken, aber als er sich endlich dazu zwingt, sieht er, dass seine Hüfte normal ist, doch unterhalb davon, zwischen den Lücken in der metallenen Maschinerie, ist eine zerfledderte, lose baumelnde Masse. Er kann Sehnen und Blut und Fetzen sehen, und keine Füße, und da erst erinnert sich der Mann an den Dachs seiner Kindheit.
Da erst erinnert er sich an den Ausdruck in den Augen des Geschöpfs vor so vielen Jahren, als es sich im Dreck der Müllhalde krümmte und wand. Und an das Geräusch, das es machte: das Jaulen eines in die Enge getriebenen und panischen Wesens.
Er hört es erneut, als er seine Lunge weitet und das gleiche Jaulen aus ihm herausbricht. Hört es, gefangen im Bernstein des Augenblicks.
Der Vater schlug den Jungen, und sobald der Junge nicht mehr weinte, nahmen sie Taschenlampen und gingen schweigend die Straße hinunter und dann auf den Trampelpfad. Nachts trug der Wald eine andere Maske. Er war ein geisterhafter Ort, erfüllt von Knarren und Ächzen und warnenden Schreien von Tieren. Einmal brach etwas Lautes aus den Ästen über ihnen, verschwand aber, ehe das Licht ihrer Taschenlampen es erfassen konnte. Später meinte der Junge zu spüren, wie irgendetwas im Gehen seine Schienbeine streifte, aber er traute sich nicht, es zu erwähnen.
Er führte seinen Vater den Hang hinab zur Müllhalde, und dort angekommen, leuchtete er mit seiner Taschenlampe, und noch bis zu diesem letzten Moment hoffte er, dass das Tier nicht da sein würde – dass es sich irgendwie hatte befreien können oder, noch besser, dass irgendwer es für sie befreit hatte –, und für einen kurzen Moment schien es, als wäre es fort, doch dann sah der Junge, dass es die Falle zu der Stelle zurückgeschleppt hatte, wo er sie anfangs aufgestellt hatte.
Der Dachs war müde. Sein Kampfeswille erlahmte, doch ihre Ankunft schürte in ihm einen letzten Anfall von Panik, und er duckte sich und stieß einen durchdringenden Laut aus. Es war ein verzweifeltes Jaulen, begleitet von einem rasenden Kratzen in der Erde.
Zwei metallisch blaue Augen stierten in die Lichtquelle, als sein Vater fest eine Hand auf die Brust des Jungen drückte und sagte: »Warte hier – und leuchte ihn weiter an.«
Der Junge tat wie geheißen, bis sein Vater den schweren Schraubenschlüssel hoch über den Kopf hob, und dann ließ er die Taschenlampe fallen, und alles wurde dunkel.
Die Folksängerin
Der Himmel spannt sich straff über der Stadt. Er hat einen eigenartigen Farbton, und die Luft ist aufgeladen. Ein Gewitter naht, und die Wolken türmen sich auf.
Er ist ungewöhnlich früh da und sucht sich einen Platz mit Blick auf die Straße, damit er sich ihren Gang ansehen, sie ohne den Vorwand des Interviews beobachten kann. Er sitzt eine Minute lang da und befindet dann, dass sie sich zur Schau gestellt fühlen könnte, wie Fleisch in der Auslage einer Metzgerei, also setzt er sich an einen Tisch weiter hinten, in der dunkleren Ecke des Cafés.
Er hat sieben Postleitzahlbereiche durch- und einen Fluss überquert, um hier in West London zu sein. Unbekanntes Terrain.
Das Café war der Vorschlag ihres Managers. Er hatte gesagt, es liege ganz in der Nähe ihrer Wohnung, und sie würde sich dort entspannt fühlen. Sie gab seit einiger Zeit nur noch selten Interviews. Sie sei nervös, hatte der Agent gesagt. Außerdem war das Wort zurückhaltend gefallen.
Der Journalist legt sein Notizbuch parat, checkt seinen Kassettenrekorder. Er bestellt einen Kaffee und ein Glas Wasser. Er öffnet eine Packung starke Pfefferminzbonbons und schiebt sich eins in den Mund, beißt aber unwillkürlich auf Anhieb darauf, und die scharfen süßen Bröckchen bleiben ihm im Hals kleben. Er hustet, als die Folksängerin eintrifft. Er trinkt Wasser, als sie auf ihn zukommt.
Sie gleitet.
In natura ist sie kleiner. Das sind sie seiner Erfahrung nach meistens – fast jeder Popstar, den er je interviewt hat.
Sie begrüßen sich mit einem missglückten Handschlag – er drückt zu fest zu, und sie zuckt zusammen, zieht die Hand zurück und geht dann wortlos zur Theke, um sich einen Kaffee zu bestellen.
Sie sieht älter aus als auf den Fotos, die ihm so vertraut sind. Das sollte ihn nicht überraschen – sie ist seit Jahren aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verschwunden. Sie tritt nicht mehr im Fernsehen auf, und ganz selten bringen Zeitschriften eine Retrospektive, wenn tatsächlich einmal was von ihr veröffentlicht wird, meistens die Neuauflage eines alten Albums. Aber ihr berühmter Körperbau ist noch immer hinreißend, und ihre kobaltblauen Augen leuchten im intensivsten Blau, das er je gesehen hat. So unheimlich blau, dass es ihm schwerfällt, sie direkt anzusehen.
Sie trägt eine muskatfarbene Bluse und mehrere Seidenschals trotz des schwülen Augustnachmittags.
Sie ist eine attraktive Frau.
Der Journalist fragt sich, ob sie attraktiv ist, weil sie sie ist, die Folksängerin, mit deren Musik er aufgewachsen ist, deren Stimme eine Ära geprägt hat, und ob diese Attraktivität lediglich auf Wiedererkennen und Bewunderung beruht, so ähnlich wie er einmal eine etwas unerwartete Schwärmerei für Germaine Greer entwickelte, nachdem er sie auf dem Markt in Brixton gesehen hatte, als sie geistesabwesend ein Croissant zerrupfte. Oder liegt es einfach daran, dass das Alter einer schönen Gestalt und aparten Wangenknochen nie so wirklich etwas anhaben kann – dass es die Farbe rissig werden lassen kann, aber nicht die Leinwand?
Ihre Armreifen klimpern, als sie sich setzt. Der Kaffee wird gebracht, und sie dankt dem Kellner, spricht ihn mit Vornamen an. Einen flüchtigen Moment lang hat der Journalist das losgelöste Gefühl, jemandem gegenüberzusitzen, der ihm zutiefst vertraut und doch völlig unbekannt ist: eine intime Fremde. Die meiste Zeit seines Lebens war sie eine Stimme in einer kreisenden Rille auf altem Vinyl und ein halbes Dutzend kultige Werbefotos. Ein in die Jahre gekommener Clip auf YouTube. Ihre Beziehung war eine Einbahnstraße – er konsumierte sie –, und jetzt flattert dieses seltsame Gefühl in Richtung Beklemmung. Als würden ihm Finger von unten gegen das Brustbein klopfen; eine Schärfung der Sinne und zugleich eine entwaffnende geistige Leere.
Die Folksängerin setzt ihre Brille auf und blickt ihn an, sieht ihn zum ersten Mal. Ihr Gesichtsausdruck ist neutral, und ihre Ohrringe sind zwei Miniaturpfauenfedern. Eine auf jeder Seite.
Ein zusätzliches Augenpaar, das ihn beobachtet.
»Glückwunsch zu Ihrem neuen Album«, sagt er, weil er irgendwas sagen muss. Selbstverständlich ist es sein Job, das Gespräch zu eröffnen. »Gefällt mir sehr.«
»Danke. Aber Sie müssen das wirklich nicht sagen.«
»Nein, es hat mir ehrlich gefallen.«
Sie nickt. »Das klingt, als wären Sie selbst erstaunt darüber?«
»Nein, es ist nur so, dass manche alte –«
Er kann sich gerade noch bremsen.
»Ich meine, wer eine so lange Karriere hatte wie Sie –«
»So lang war die gar nicht. Das meiste ist in einen Zeitraum von zehn Jahren gequetscht.«
»Die Siebziger?«
»Mehr oder weniger. Fing gegen Ende der Sechziger an und ging bis Anfang der Achtziger.«
»Interessant, dass Sie das sagen, weil ich Sie fragen wollte, wann Sie den Song geschrieben haben, der –«
»Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf. Ich glaube nämlich, dass ich weiß, was jetzt kommt.«
»Tatsächlich?«
»Ja. Wissen Sie, wie viele Songs ich aufgenommen habe?«
»Nein. Sehr viele, denke ich.«
»Mein Manager weiß es. Er sagt, es sind zweihundertvierundzwanzig. Das umfasst Singles, Alben, Coversongs, Background-Gesang, Jingles. Alles, was Tantiemen bringt.«
»Das ist beachtlich.«
»Es ist beachtlich. Und wissen Sie, zu wie vielen davon ich irgendwas gefragt werde?«
Er zögert. »Verstehe.«
»Zu einem«, fährt sie fort. »Zu einem einzigen Song. ›We Walk Through the Woodlands‹. Danach wollten Sie fragen, hab ich recht? Nach dem verdammten ›We Walk Through the Woodlands‹.«
Er hält einen Moment inne, um seine Gedanken neu zu ordnen.
»Aber finden Sie es denn nicht naheliegend, dass man nach diesem speziellen Song fragt? Er ist praktisch die Hymne der Folk-Welt, und die Leute werden ihn noch in hundert Jahren singen. Es gibt sehr wenige andere Songs, über die ich das sagen könnte.«
»Tja. Das werden wir beide wohl nie wissen.«
»Es muss Ihnen viel gebracht haben.«
»Sie meinen, finanziell?«
»Nun ja. Das auch.«
»Wahrscheinlich nicht so viel, wie Sie denken. Ich bin am Gewinn nur beteiligt.«
»Aber Sie waren nie gezwungen zu –«
Wieder unterbrach sie ihn. »Arbeiten? Ich hatte jedenfalls nie einen richtigen Job, wie zum Beispiel die Musik anderer Leute zu kritisieren, falls Sie das meinen.«
Sie ändern sich nie, denkt sie. Nicht wirklich. Erstens sind sie alle männlich. Immer. Und sie haben ein gewisses Auftreten. Nervös und ernst. Sie möchten unbedingt Eindruck machen, das ja, aber in ihrer Gesprächsführung schwingt stets eine fast streitlustige Pedanterie mit. Sie sind informiert, kennen Fakten und Daten und Studiomusiker und Chartplatzierungen – den geistigen Müll einer Patchwork-Karriere, der sie nie genug interessiert hat, um ihn sich zu merken.
Außerdem wissen sie noch immer nicht, wie man sich kleidet. Sie sieht, dass der Journalist als kleines Zugeständnis an die Etikette ein Hemd angezogen hat, aber es ist zerknittert und sitzt schlecht, frisch aus einer tristen Einzimmerwohnung in einer billigen Gegend.
Und sie leben in ihrer eigenen Welt, diese Jeans-und-T-Shirt-Männer. Musik ist ihr ein und alles. Und wäre es nicht Musik, würden sie sich garantiert mit dem gleichen Sammler- und Katalogisierungswahn auf irgendetwas anderes fixieren. Angeln, Autos, Fußball. Pornografie, vielleicht. Ihrer Erfahrung nach ist allen Musikjournalisten ein Hang zur Pingeligkeit gemein.
So waren sie schon in den frühen Siebzigern. Damals musste sie eine scheinbar endlose Parade von ihnen über sich ergehen lassen. Alle rauchten sie, alle ließen sich einen Bart stehen, und alle waren links – das war sie auch, aber hoffentlich nicht bis hin zur Karikatur. Und die Musiker unterschieden sich nicht groß von den Journalisten. Sie wetterten gegen Gewinnsucht und Geldgier, booteten sich aber gegenseitig aus, sobald ihnen ein Scheck vor die Nase gehalten wurde. Sie protestierten gegen Homophobie und Rassismus und Unterdrückung und ohrfeigten dann Frauen – ihre Frauen, denn es ging stets um Besitzansprüche und Vereinnahmung –, die es wagten, sie zu betrügen. Sie machten sie nieder. Traten sie mit Füßen. Umgekehrt jedoch durften sie natürlich mit jedem Mäuschen pennen, das ihnen gerade über den Weg lief.
Damals war sie soft. Sie war jung und aufgeschlossen und begeisterungsfähig und naiv.
Aber sie hatten sie hart gemacht, diese Männer mit ihren Fragen und bissigen Kritiken. Mit ihrem Bohren und Nachhaken. Ihren Schmeicheleien. Alle versuchten, mit ihr zu schlafen, und alle reagierten ungehalten, wenn sie ihnen eine Abfuhr erteilte. Jeder Einzelne von ihnen. Die anderen Musiker, die Tontechniker, die Roadies. Die Typen von ihrem Plattenlabel.
Wie seinerzeit gut dokumentiert wurde, waren eine Faust und ein abgebrochener Zahn in einem irgendwo im tiefsten Cornwall gelegenen Tonstudio dafür verantwortlich, dass sich das erfolgreichste männlich-weibliche Duo der Ära trennte. Das war in den frühen Achtzigern, und da hatte sie sich schon eine harte Schale zugelegt, um sich selbst zu schützen. Es fühlte sich an, als wäre auch die Welt hart geworden.
Noch in der derselben Nacht fuhr sie über Landstraßen direkt zurück nach London und sang nie wieder mit Simon Healy. Sie konnte danach jahrelang nichts mehr schreiben, weil es keine Liebeslieder mehr zu schreiben gibt, wenn du nichts als Hass empfindest – und ihr Hass tat sich schwer, eine Melodie zu finden, die ihn tragen konnte.
Schon bald – vielleicht zwangsläufig – rannten Journalisten ihr die Tür ein, nachdem die erste Pressemitteilung an die Wochenzeitschriften rausgegangen war. Noch mehr Männer mit noch mehr Fragen. Sie ignorierte sie alle, und sie schrieben ohnehin, was sie wollten: dass sie eine Schlampe war, die Healy das Herz gebrochen hatte; dass der sensible, labile Songwriter einer ganzen Generation jetzt allein und einsam seine Wunden leckte und nur Trost in seiner Gitarre fand.
In den Monaten danach konnte sie zusehen, wie die Geschichte vor ihren Augen umgeschrieben wurde. Plötzlich waren ihre gemeinsamen Songs seine Songs. Ihre gemeinsamen Erfolge seine