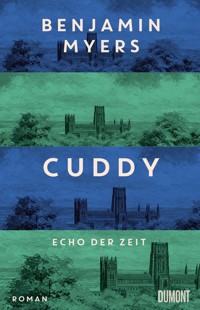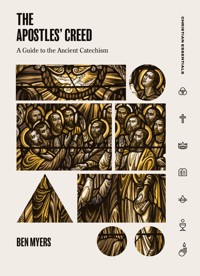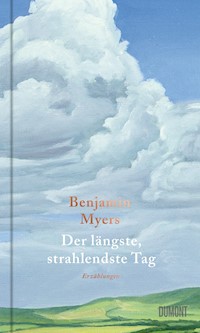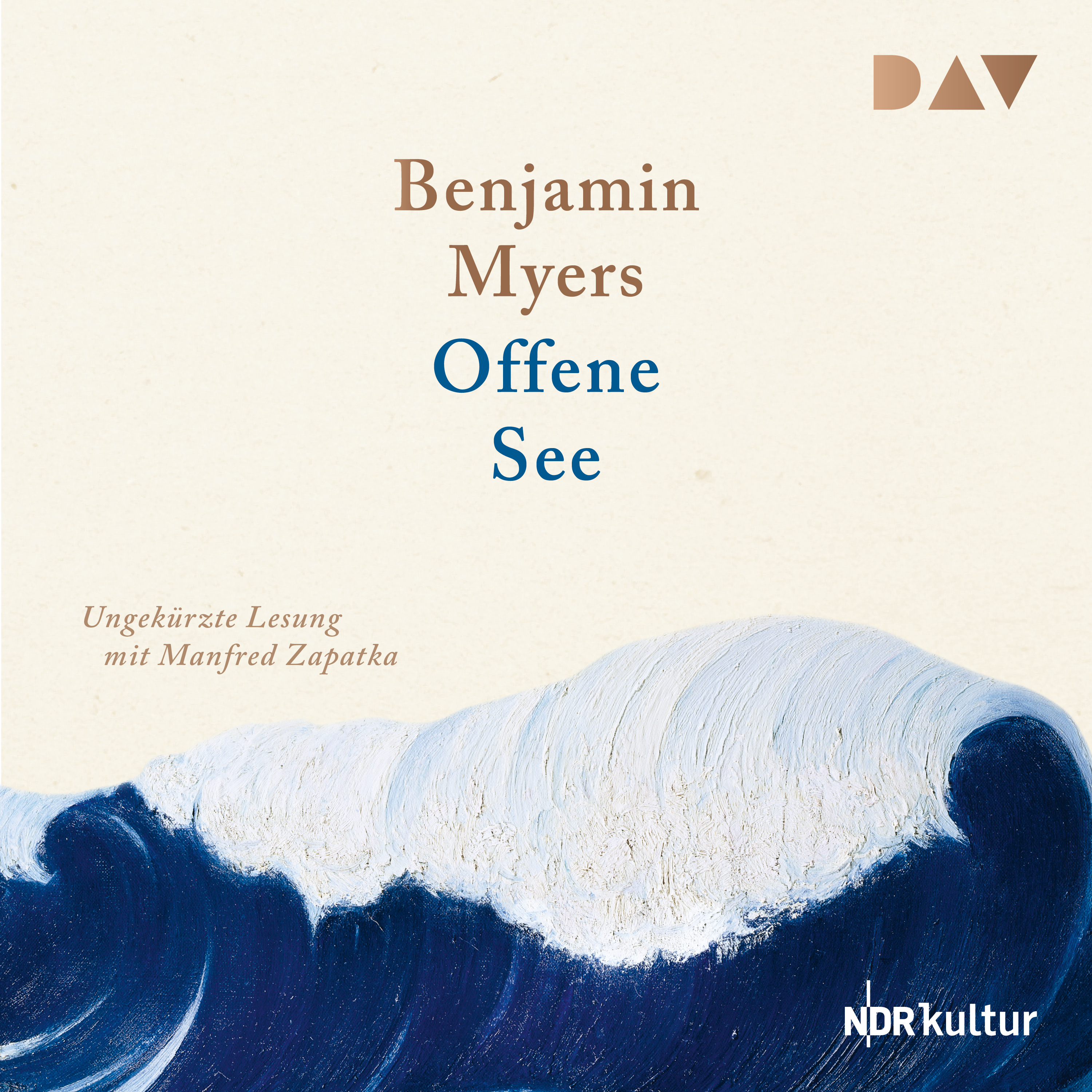9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ausgezeichnet als »Lieblingsbuch der Unabhängigen« 2020! Eine zeitlose und geradezu zärtliche Geschichte über die Bedeutung und Kraft menschlicher Beziehungen Der junge Robert weiß schon früh, dass er wie alle Männer seiner Familie Bergarbeiter sein wird. Dabei ist ihm Enge ein Graus. Er liebt Natur und Bewegung, sehnt sich nach der Weite des Meeres. Daher beschließt er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sich zum Ort seiner Sehnsucht, der offenen See, aufzumachen. Fast am Ziel angekommen, lernt er eine ältere Frau kennen, die ihn auf eine Tasse Tee in ihr leicht heruntergekommenes Cottage einlädt. Eine Frau wie Dulcie hat er noch nie getroffen: unverheiratet, allein lebend, unkonventionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten Ansichten zu Ehe, Familie und Religion. Aus dem Nachmittag wird ein längerer Aufenthalt, und Robert lernt eine ihm vollkommen unbekannte Welt kennen. In den Gesprächen mit Dulcie wandelt sich sein von den Eltern geprägter Blick auf das Leben. Als Dank für ihre Großzügigkeit bietet er ihr seine Hilfe rund um das Cottage an. Doch als er eine wild wuchernde Hecke stutzen will, um den Blick auf das Meer freizulegen, verbietet sie das barsch. Ebenso ablehnend reagiert sie auf ein Manuskript mit Gedichten, das Robert findet. Gedichte, die Dulcie gewidmet sind, die sie aber auf keinen Fall lesen will. »Ein intensiver und bewegender Roman, der an J. L. Carrs ›Ein Monat auf dem Land‹ denken lässt.« The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Robert weiß früh, dass er, der Familientradition folgend, sein Dasein als Bergarbeiter fristen wird. Dabei ist ihm Enge ein Graus. Er liebt Natur und Bewegung, sehnt sich nach der Weite des Meeres. Daher beschließt er, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, sich zum Ort seiner Sehnsucht aufzumachen. Fast am Ziel angekommen, lernt er eine ältere Frau kennen, die ihn auf eine Tasse Tee in ihr leicht heruntergekommenes Cottage einlädt. Eine Frau wie Dulcie hat er noch nie getroffen: unverheiratet, unkonventionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten Ansichten zu Ehe, Familie und Religion. Durch sie lernt Robert eine ihm vollkommen unbekannte Welt kennen: Musik, Malerei, Literatur, all das zählte in seinem Elternhaus nicht, doch Robert erkennt sofort seine Liebe hierzu. Als Dank für ihre Großzügigkeit bietet er Dulcie seine Hilfe rund um das Cottage an. Doch als er eine wild wuchernde Hecke stutzen will, um den Blick auf die offene See freizulegen, verbietet sie das barsch. Ebenso ablehnend reagiert sie auf ein Manuskript mit Gedichten, das Robert findet. Gedichte, die Dulcie gewidmet sind, die sie aber auf keinen Fall lesen will.
Benjamin Myers erzählt eine zeitlose und geradezu zärtliche Geschichte über die Bedeutung und Kraft menschlicher Beziehungen.
© Kevin McGonnell
Benjamin Myers, geboren 1976, ist Journalist und Schriftsteller. Myers hat nicht nur Romane, sondern auch Sachbücher und Lyrik geschrieben. Für seine Romane hat er mehrere Preise erhalten. Er lebt mit seiner Frau in Nordengland.
Ulrike Wasel und Klaus Timmermann, beide 1955 geboren, haben Anglistik in Düsseldorf studiert. Seither arbeiten sie als Übersetzerteam und haben u.a. Dave Eggers, Tana French, Andre Dubus III., Harper Lee, Jeanette Walls, Zadie Smith und Jess Kidd ins Deutsche übertragen.
Benjamin Myers
OFFENE SEE
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
eBook 2020
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel ›The Offing‹ bei Bloomsbury Circus, London.
© Ben Myers, 2019
© 2020 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Ulrike Wasel und Klaus Timmermann
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Bridgeman Images
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8496-4
www.dumont-buchverlag.de
Für Adelle
Die altvertraute Heimat ließ ich hinter mir,Die grünen Wiesen, all den himmelsschönen Raum.Der Sommer kommt, doch scheint er fremd mir hier,Ich halte inne und erkenn ihn kaum.
Wo ist das Leben geblieben?
Jeden Tag ertappe ich mich dabei, dass ich dem Spiegel die immer gleiche Frage stelle, und doch bleibt mir die Antwort stets versagt. Ich sehe bloß einen Fremden, der mir entgegenstarrt.
Also schleppe ich mich in die Küche, wo ich meinen Tee umrühre und meinen morgendlichen Haferbrei löffle und das Mantra murmele – du wirst nie wieder so jung sein, wie du jetzt bist –, aber es fühlt sich hohl zwischen den Lippen an. Ich kann weder die Zeit austricksen noch mich selbst. Ich werde immer so alt sein, wie ich jetzt bin, und dann noch älter.
Die Farbe der Dielen ist von meinen schlurfenden Schritten ganz abgewetzt. Mir schmerzen die Füße, weil sie eine Million Meilen gegangen sind, und die Holzbretter sind jetzt verzogen wie der Rumpf einer gestrandeten Galeone, und auch die Wiese ist verwuchert, während die Tage verstreichen und die Jahreszeiten kürzer werden. Ein paar Sommer hier, einige lange dunkle Winter da; Glück, Krieg, Krankheit, ein bisschen Liebe, noch etwas mehr Glück, und plötzlich blickst du ins falsche Ende des Fernrohrs.
In letzter Zeit tut mir alles weh, nicht nur die Füße. Die Beine, Hände, Augen. Die Handgelenke und Finger pochen, nachdem sie ein Leben lang auf Tastaturen herumgehämmert haben. Ich habe ein ständiges Ziehen im Nacken und staune über das kleine Wunder, dass mein Körper so lange durchgehalten hat. Manchmal fühlt es sich an, als würde er fast nur noch von Sehnen der Erinnerung und Bändern der Hoffnung zusammengehalten. Der Verstand ist ein verstaubtes Museum.
Aber ich war einmal ein junger Mann, so jung und grün, und das kann sich nie ändern. Die Erinnerung erlaubt mir, es wieder zu sein.
Damals wusste ich nicht, was Sprache vermag. Ich verstand die Macht, die Wirkungskraft von Worten noch nicht. Die komplexe Magie von Sprache war mir ebenso fremd wie das veränderte Land, das ich in jenem Sommer um mich herum sah. Jetzt wächst etwas Schleichendes in mir. Seine Wurzeln sind tief verankert, seine Ranken schlingen sich um Ecken, klammern sich fest und ziehen sich zu. Ich bin ein träger Gastgeber. Da ich zu müde bin, um mich zu wehren, finde ich mich damit ab und lehne mich stattdessen zurück und staune nur, wo das Leben geblieben ist. Und ich warte.
Mein Schreibtisch ist alt, und der Sessel knarrt. Zweimal habe ich ihn schon aufpolstern und die Verzapfungen reparieren lassen. Ab und zu hustet der alte Holzofen Rauch ins Zimmer, und die Regenrinnen sind mit Moos verstopft. Eine Fensterscheibe hat einen Sprung, und demnächst muss ich mir jemanden suchen, der das Dach ausbessert. Am ganzen Haus muss viel gemacht werden, aber für das alles bin ich inzwischen zu alt. Das Gebäude und sein Inhalt werden mich überdauern. Aber das alte Textverarbeitungsgerät funktioniert noch. In uns beiden steckt noch Energie, es gibt Strom, und solange der da ist, habe ich noch etwas mitzuteilen.
Während ich jetzt hier am offenen Fenster sitze, ein Glissando von Vogelstimmen auf einer hauchzarten Brise, die den Duft eines letzten nahenden Sommers in sich trägt, klammere ich mich an die Dichtung, wie ich mich ans Leben klammere.
1
Die Bucht tat sich vor mir auf, ein weites glaziales Becken, vor mehreren Hunderttausend Jahren von knirschendem Eis und rieselndem Wasser geformt.
Ich näherte mich ihr von Norden und sah ein gigantisches halbes Amphitheater mit Farmen und Dörfchen darin, während das Land vom Moor her hinunter drängte. Dahinter erstreckten sich die Felder bis hin zum blaugrünen Meer, über dem schwindelerregend einige Häuschen hingen, wie eingestreut in diesen Einschnitt ins Land. Zwischen ihnen und dem Wasser: ein schmaler glitzernder Streifen Sand. Ein bronzenes Band.
Die Häuser hockten waghalsig über den Gezeiten auf einer bröckelnden Steilklippe aus lockerer Erde und nassem Lehm, die durch salzige Gischt und Brandung allmählich erodiert wurde. Sie muteten an wie gestrandete Matrosen, die in den Stürmen von Jahrhunderten Schiffbruch erlitten hatten. Die Zeit selbst nagte an diesem Küstenabschnitt, gestaltete unsere Insel neu in einer Epoche der Unsicherheit.
Mir kam der Gedanke, dass das Meer uns die endliche Existenz aller festen Materie vor Augen führt und dass die einzig wahren Grenzen nicht Schützengräben und Unterstände und Kontrollpunkte sind, sondern zwischen Fels und Meer und Himmel liegen.
Ich blieb stehen, um meine Feldflasche am Straßenrand an einer Quelle zu füllen, die in einen Steintrog plätscherte, und kam mir vor, als hätte ich ein Gemälde betreten. Die Sonne war eine gleißend weiße Scheibe über einer lasierten Landschaft, und ich begriff, vielleicht zum ersten Mal, was Menschen dazu brachte, einen Pinsel in die Hand zu nehmen oder ein Gedicht zu schreiben: der Impuls, die den Herzschlag beschleunigende Empfindung einzufangen, dieses Im-Jetzt-Sein, ausgelöst durch eine ebenso atemberaubende wie unerwartete Aussicht. Kunst war der Versuch, den Moment in Bernstein zu gießen.
Das frische Wasser rann mir durch die Kehle wie seidene Bänder, kühlte meinen Magen für einen Moment und sammelte sich dort. Nie schmeckt Wasser besser, als wenn es frisch aus der Erde kommt und aus Metall getrunken wird; ganz gleich, welches Behältnis, ob Kelle oder Kanne, irgendwie scheint Metall den Geschmack zum Leben zu erwecken.
Ich trank noch mehr, legte dann die hohlen Hände zusammen und hielt sie in den Strahl, eine Pfütze auf meinen rosigen Handtellern, tupfte mir das Wasser auf Stirn, Gesicht und Hals. Ich füllte meine Feldflasche erneut und ging weiter.
Es war Krieg gewesen, und obwohl der Kampf zu Ende war, tobte er noch immer in den Männern und Frauen, die ihn mit sich nach Hause genommen hatten.
Er lebte in ihren Augen weiter oder hing ihnen schwer um die Schultern wie ein blutgetränkter Umhang. Und er blühte in ihren Herzen, eine schwarze Blume, die dort Wurzeln geschlagen hatte und nie mehr ausgerissen werden konnte. Die Samen waren so toxisch, so tief gesät, dass die Erinnerungen nichts anderes sein konnten als für alle Zeiten giftig.
Kriege dauern an, lange nachdem die Schlachten geendet haben, und damals fühlte sich die Welt an, als wäre sie voller Löcher. Sie erschien mir vernarbt und zerschmettert, ein Ort, der von den Mächtigen seines Sinns beraubt worden war. Alles war in Scherben, alles verbrannt.
Ich war weder alt genug, um mich zum Helden gemacht zu haben, noch jung genug, um den Wochenschaubildern entkommen zu sein oder den langen dunklen Schatten, die die heimkehrenden Soldaten wie leere Särge hinter sich herzogen. Denn niemand gewinnt einen Krieg wirklich; manche verlieren bloß ein bisschen weniger als andere.
Ich war ein Kind, als er begann, und ein junger Mann, als er zu Ende ging, und danach war Verlust allenthalben sichtbar, hing wie eine große schwere Wolke über der Insel, und selbst noch so viele rot-weiß-blaue Flaggen oder Orden, die den Überlebenden an die schluchzende Brust gesteckt wurden, konnten nichts daran ändern.
Den Geschichtsbüchern sollte nicht unbedingt Glauben geschenkt werden: Der Sieg der Alliierten schmeckte nicht süß, und die Winter, die folgten, sollten so eisig und unerbittlich sein wie alle Winter. Denn so wenig sich die Elemente auch um den Wahnsinn der Menschen scheren, denjenigen, die die ersten Filmaufnahmen von Stacheldraht und Massengräbern gesehen hatten, kam nun selbst der weiße, jungfräuliche Schnee unrein vor.
Doch mit den Augen der Jugend gesehen, war der Krieg eine Abstraktion, eine Erinnerung zweiten Grades, die bereits verblasste. Es war nicht unser Krieg. Er würde nicht unser Leben ruinieren, ehe es überhaupt begonnen hatte.
Im Gegenteil, er hatte in mir einen Hang zum Abenteuer geweckt, ein Fernweh, den Wunsch, über das Ende der Straße hinauszutreten, wo das Pflaster endlich in Felder überging und das industrialisierte Nordengland sich unter dem ersten warmen Dunst einer bevorstehenden Zeit des Wachstums verlor, zu erkunden, was genau eigentlich hinter dieser schimmernden Luftspiegelung lag, die den Horizont in einen wogenden Ozean aus erblühendem Grün verwandelte.
Ich war sechzehn und frei und hungrig. Hungrig nach Essen, wie wir das alle waren – die Mangelversorgung hielt noch viele Jahre an –, doch mein Appetit beschränkte sich nicht nur auf das rein Essbare. Allen, die das Glück hatten, am Leben zu sein, erschien der gegenwärtige Augenblick wie ein kostbares leeres Gefäß, das nur darauf wartete, mit Erfahrungen gefüllt zu werden. Zeit war wertvoller geworden. Sie war das Einzige, das wir in Hülle und Fülle besaßen, obwohl der Krieg uns gelehrt hatte, dass auch sie eine begrenzte Ressource war und dass es eine der größten Sünden war, sie unklug zu verbringen oder verschwenderisch mit ihr umzugehen.
Wir waren junge Männer und Frauen, und wir lebten jetzt für die Gefährten, die auf fremden Feldern gefallen oder wie Moorhühner vom Himmel geschossen worden waren, oder für die armen in Massengräbern verscharrten Seelen.
Das Leben wartete da draußen, bereit, gierig getrunken zu werden. Vertilgt und verschlungen zu werden. Meine Sinne waren erwacht und unersättlich, und ich schuldete es mir selbst und all den anderen meiner Generation, die nach ihren Müttern schreiend gestorben oder in den Lachen ihres eigenen Blutes ertrunken waren, mich mit dem Leben vollzustopfen.
Stärker als alles andere war jedoch der Lockruf der natürlichen Welt, in die ich mich versenken wollte. Aus Büchern wusste ich, dass der Norden Englands ein abwechslungsreiches Terrain aus Heidelandschaften und Wäldern, Mooren und Bergen, Schluchten und Tälern bot, alles bewohnt von Pflanzen- und Tierarten, die nur darauf warteten, von meinen staunenden und neugierigen Augen gesehen zu werden.
Zu Hause hatte ich alle Möglichkeiten erschöpft, gewissenhaft Aufzeichnungen von sämtlichen Zug- und Standvögeln gemacht, die ich gesichtet hatte. Ich hatte eine kleine Sammlung aus sorgfältig gewaschenen und von Fleischresten gesäuberten Knochen und Schädeln angelegt, die ich in einer Teekiste neben dem alten Kohlenkasten an der Hintertür aufbewahrte, da meine Mutter sie nicht im Haus haben wollte. Ich hatte geangelt und frettiert, Ratten gejagt und Fallen gestellt und einmal sogar mit schlechtem Gewissen das Ei eines brütenden Raben aus seinem luftigen Nest geraubt, doch schon bald war mir nicht mehr wohl bei der Vorstellung, Tiere aus Spaß zu töten, aus reinem Nervenkitzel zu erlegen. Schon allein, ihr gewohntes Leben zu stören, kam mir frevelhaft vor. Ich hatte so viel Zeit meiner Kindheit auf Bäumen verbracht, jetzt jedoch war ich der vertrauten Ausblicke überdrüssig, des immer gleichen Wandels der Jahreszeiten. Ich wollte sehr viel mehr von dem erleben, was anderswo geschah, jenseits der Grenzen meines ländlichen Bergarbeiterdorfs, das irgendwo zwischen der Stadt und dem Meer in einer sanft gewellten Landschaft lag. Ich wollte überrascht werden. Nur wenn ich allein in der Natur war, hatte ich je eine Ahnung von meinem wahren Ich bekommen; die übrige Zeit bestand nur aus Spielplatzlärm und Schulunterricht, häuslichen Pflichten und banaler Zerstreuung.
Ich war im Frühjahr voller Ungeduld aufgebrochen. Der Rucksack auf meinen Schultern enthielt lediglich das Allernotwendigste für eine Reise, deren einziges Ziel die Bewegung war: Schlafsack, eine Decke und eine Unterlegplane, Kleidung zum Wechseln. Zwei Töpfe, einen Becher, meine Feldflasche, Taschenmesser, Gabel, Löffel und Teller. Eine kleine Schaufel für das Geschäft im Freien. Keine Landkarte.
Einen Rasierer brauchte ich ebenfalls nicht.
Außerdem hatte ich Schreibblock und Stift dabei, ein Stück Seife, eine Zahnbürste, Streichhölzer und eine Maultrommel, die mir mein Großvater geschenkt hatte. Er gab mir den klugen Rat, dass man immer Geld verdienen könne, wenn man ein Musikinstrument beherrschte, da die Engländer ein Volk seien, das fleißiges Bemühen höher bewerte als Talent und dem es schon genüge, wenn jemand sich an etwas versuchte. Und obwohl ich mir noch nicht beigebracht hatte, dieses seltsame und verwunschen klingende Instrument zu spielen, hatte ich die feste Absicht dazu. Auf den Wegen und Straßen, die vor mir lagen, stellte ich mir jede Menge freie Zeit und ziemlich viele Abende vor, deren einsame Stille sich gewiss mit etwas Musik lindern ließe, ganz gleich, wie misstönend und ungeschickt sie erzeugt wurde.
Am Morgen meines Aufbruchs bestand meine Mam zudem darauf, mir ein Päckchen in den Rucksack zu stopfen, das einige dicke Scheiben Schinken, Käse, Äpfel und ein großes Fladenbrot enthielt, alles eingewickelt in einen Waschlappen, von dem ich ihr hoch und heilig versprechen musste, dass ich ihn wenigstens einmal am Tag benutzen würde.
Die Luft war kühl, als ich die historische Stadt verließ und den Fluss unterhalb der hohen Türme der mächtigen Kathedrale erreichte, die erhaben auf ihrem Felsvorsprung in die Höhe ragte. Ich ließ mich von dem träge fließenden Wasser leiten, folgte seinem Ufer flussaufwärts durch eine bewaldete Schlucht und dann weiter, hinaus ins große Unbekannte.
Den größeren Teil meiner Jugend hatte ich bislang damit verbracht, aus Klassenzimmerfenstern zu starren und mich nach einem Leben in der Natur zu sehnen, darauf zu warten, dass die Schulglocke endlich durch die Korridore schallte, damit ich frei durch Wiesen und Felder stromern konnte.
Und jetzt endlich war ich davon umgeben, einem Wunderland, einer blühenden Jahreszeit, erfüllt von den warmen Lauten der Ringeltauben und dem Klopfen der Spechte, von dem Geruch nach Kreuzkraut, Balsam und, jenseits der Bäume auf den sanften Wiesen, dem betörenden, einschläfernden Moschusduft des Rapses.
Bald würden auch die Schwalben und Mauersegler aus Nordafrika zurückkehren, um hier zu übersommern, dem Mittelpunkt der Welt, Nordengland, dem grünsten Land, das es je gab, so stark und saftig, dass es einen jungen Mann schwindelig machen konnte.
An den Flussufern würzte Bärlauch die Luft. Ich rupfte im Gehen die ledrigen Blätter ab und kaute sie, spürte den satten, intensiven Geschmack zäh auf der Zunge. Beinahe ölig.
Ich verließ den Wear, weil er mich, wenn ich ihm weiter folgte, nach Westen führen würde, stromaufwärts zu den Hochlandtälern von Wolsingham, Westgate und Wearhead, wo der Fluss angeblich aus der Erde quoll, kaum mehr als ein kleines gurgelndes Rinnsal, und dahinter nichts als winzige Dörfchen mit Namen wie Cowshill und Cornriggs. Arbeit würde ich dort kaum finden.
Hier und da ging ich an Gleisen entlang und über warme Teerstraßen. Ich sah verlassene Steinbrüche, gähnende Abgründe in der Erde, offen und zerklüftet wie klaffende Münder, aus denen riesige Zähne gezogen worden waren. Ich suchte mir meinen Weg an den verrosteten Resten von Bahnschienen entlang und über die Trampelpfade von Zinn- und Schiefergruben. Ich kam an stillgelegten Gipswerken vorbei, an Lichtungen, wo Kabeltrommeln und umgekippte Rollwagen herumlagen, aber keine Menschenseele zu sehen war. Wenn möglich blieb ich in Wäldern und Tälern, auf Wiesen und Feldern.
Ich suchte mir unterwegs Arbeit als Tagelöhner, auf Farmen oder kleinen Höfen und manchmal in abgelegenen Häusern, weil viele Familien Männer verloren hatten oder aber erleben mussten, dass sie erschöpft und entkräftet zurückkehrten, als Gebrochene, mit fehlenden Teilen wie gebrauchte Puzzlespiele. Nur wenige waren heil und gesund genug zurückgekommen, um ihr Leben so weiterzuführen, als wäre nichts geschehen, und obwohl manche noch immer körperlich bei Kräften waren, hatten sie ihre psychische Energie eingebüßt.
Diese Häuser benötigten stets junge Muskelkraft, um die Aufgaben zu verrichten, die diese kaputten Männer nicht mehr erledigen konnten, und wenn ich an Türen klopfte, wies man mich nur selten ab.
Hinter den Türen fand ich schweigsame Überlebende, die unvorstellbare Dinge gesehen hatten. Der Krieg war gewissermaßen eine Krankheit, die nur der Lauf der Zeit behandeln konnte und an der viele bis ans Ende ihres Lebens leiden würden.
Ich arbeitete mich unverdrossen weiter, bis Durham in Cumbria überging und Cumbria irgendwann von North Yorkshire begrüßt wurde, wo der Abbau von Zinn und Blei noch immer der Hauptindustriezweig war und ansonsten auf den windgepeitschten Hängen der Moore das ganze Jahr über Schafe grasten. Im Sommer trieb man die wolligen Geschöpfe zusammen, um sie zu scheren, und in den langen, nicht enden wollenden Wintern mussten sie zuweilen aus Schneewehen ausgegraben werden. Die Landschaft unterschied sich von der meiner Heimat – zwar war sie ebenso hügelig und vernarbt, aber irgendwie auf reizvollere Art und Weise. Die Neuheit des Unbekannten war berauschend. Hier klang sogar alles anders, die leere Weite der Moore ein flüsternder Ort, frei von dem Dröhnen und Rattern des Bergarbeiterlebens. Ein mit Mythen beladener Ort. Er begeisterte mich.
Auf einer dieser Farmen küsste ich ein wortkarges Mädchen namens Theresa, die nach Anis schmeckte und mit ihrer seltsam zuckrigen Zunge meinen Mund ganze zehn Sekunden lang erkundete, ehe sie sich umdrehte und davonlief. Obwohl sie mich mit einem Elan erforscht hatte, der schon fast brachial war, um mir dann urplötzlich nicht mehr Interesse entgegenzubringen als einem vorbeizockelnden Esel, war ich mir dennoch bewusst, dass ich einen kleinen Meilenstein in meinem Leben passiert hatte. Zu Hause in der Schule, wo sich in der Umkleidekabine der Turnhalle die erfundenen Geschichten über unbekannte, an fernen Orten geküsste Mädchen förmlich überschlugen, würde mir natürlich kein Mensch glauben. Solche Dinge geschahen immer nur irgendwo anders, ohne Zeugen. Und jetzt war ich tatsächlich im Königreich Anderswo, frei von den Fesseln der Vertrautheit von Orten und Menschen.
Der Boden in dieser Region eignete sich nicht für Ackerbau, und die Häuser lagen zu weit auseinander, also wandte ich mich nach Süden, fällte und sägte, hämmerte und klopfte, hackte und häckselte. Ich war einen Tag hier, einen Tag dort, folgte der Sonne und ruhte mich aus, wenn es Zeit zum Ausruhen war. Endlich war ich nicht mehr Sklave des bleiernen Tickens der Uhr im Klassenzimmer, deren Zeiger sich an manchen Tagen scheinbar mit quälend langsamem Spott bewegten und mitunter sogar ganz zu stocken schienen, sodass der erstarrte Moment sich ewig lang ausdehnte, während meine Klassenkameraden nichts von dieser Verschwörung mitbekamen, uns für immer gefangen und eingeschlossen zu halten. Stattdessen wurde ich mein eigener Herr, und mit jeder Wegkrümmung, die ich hinter mir ließ, konnte ich meine jugendliche Haut weiter abstreifen.
Wenn die Müdigkeit mich überkam, verbrachte ich die Nacht in Scheunen und Schuppen und längst verlassenen Wohnwagen, und mehrmals schlief ich den Schlaf des Gerechten eingezwängt zwischen dichten Heckenwänden aus Brombeersträuchern und Stechpalmen, die vielleicht schon seit dem Mittelalter hier wuchsen, drei Meter hoch und so undurchdringlich wie die Stacheldrahtrollen in Bergen-Belsen.
In anderen Nächten, wenn der Himmel wolkenlos war und die Farmer vorhersagten, dass es trocken bleiben würde, suchte ich mir eine Weide, baute aus meiner Plane ein improvisiertes Zelt und schlief mit dem Schein des sterbenden Feuers im Gesicht ein, ein Bett aus platt gedrücktem Gras unterm Rücken, um dann steif und oft auch klatschnass aufzuwachen und die unzuverlässigen Prognosen der Bauern zu verfluchen.
Essen bekam ich geschenkt. Ich ernährte mich hauptsächlich von Eiern und Kartoffeln und Äpfeln vom Vorherbst, und gelegentlich bekam ich Milch für meine Feldflasche oder ein paar Kugeln frische Butter, eingewickelt in Sackleinen, und vielleicht einen Kanten Brot, so hart und trocken, dass man damit Ziegel hätte zertrümmern können. Ich erhielt auch Gemüse. Spinat und Mangold hatten gerade Saison. Manchmal eine Rübe, die ich in großen Bissen roh aß, ohne je Geschmack daran zu finden. Fleisch war Mangelware. Einmal schenkte man mir ein Glas Honig, und ich stellte fest, dass ich fast alles hineintunken konnte. Selbst ein Stück Rübe, auf meine Gabel gespießt, wurde zur Delikatesse, wenn ich die Augen schloss und es bis in die bittere Mitte zerkaute.
Je weiter ich mich von allem entfernte, was ich je gekannt hatte, desto leichter fühlte ich mich. Das Unbehagen, das im Verlauf des letzten Schuljahrs immer stärker in mir gegärt hatte, legte sich allmählich, und zugleich stellte sich ein Gefühl geistiger Klarheit ein. Zum ersten Mal hatte ich den Schatten des quietschenden und rasselnden Förderturms verlassen, war weit weg von dem dunkelgrauen Staub, der sich an klaren Tagen scheinbar überall niederließ, sodass er ebenso aus Bettzeug geklopft werden musste wie aus der Wäsche, die auf den Hinterhöfen an Leinen trocknete. Jetzt atmete ich tief und ging mit so beschwingten Schritten, dass ich an manchem erwachenden Morgen schon glaubte, ich könnte tagelang wandern, ohne zu rasten. Auch spürte ich, dass meine Knochen, Gelenke, Muskeln und mein Gehirn in vollkommener Symbiose zusammenarbeiteten, wie die Einzelteile einer gut geölten Maschine, die im Grunde bloß von Jugend und gerade genug Essen angetrieben wurde.
Solange ich zurückdenken konnte, hatte die Unausweichlichkeit eines Arbeitslebens in der staubigen Dunkelheit wie ein Schreckgespenst in meinem Unterbewusstsein gelauert und alles mit einem dunklen Tuch bedeckt. Anfangs hatte ich mich vor der Vorstellung gefürchtet, doch in letzter Zeit lehnte ich sie mit einer Unnachgiebigkeit ab, die an Hass grenzte.
Meine Eltern hatten nie auch nur in Betracht gezogen, dass ich beruflich etwas anderes machen könnte, als im Bergwerk zu arbeiten. Es gab Jungen, mit denen ich aufgewachsen war, die bereits zwei oder drei Jahre unter Tage arbeiteten, doch für jemanden, der frische Luft und Einsamkeit so sehr liebte wie ich, war gerade die Erwartungshaltung, dass ich ebenso meinem Vater in den Schacht folgen würde, wie er seinem Vater in den Schacht gefolgt war, der Grund dafür, dass ich jetzt über Englands Landstraßen zog. Es war ein Akt der Befreiung und Rebellion, doch die Fesseln des alten Lebens waren noch immer so festgezurrt, dass ich mich fragte, ob meine Wanderung lediglich eine kurze Galgenfrist war, ein erstes und letztes Hurra vor der düsteren Aussicht auf den Ernst des Lebens. Ich musste wenigstens versuchen, eine andere Welt zu sehen, bevor die Kohle – oder schlimmer noch der Krieg – gänzlich von mir Besitz ergriff.
Um mich herum kam der Frühling zum Vorschein, und in jenen wärmer werdenden Wochen begegnete ich unterwegs mancherlei Sonderlingen. Vagabunden und Fischern und etlichen Landfahrern. Kesselflicker oder Lumpenvolk nannte man sie, und sie verdienten sich Geld, indem sie Töpfe und Pfannen ausbesserten, aus Weidenzweigen Körbe flochten, kauften und verkauften. Einmal saß ich mit einer siebenköpfigen Familie am Feuer, die sich jede Nacht irgendwie in einen Zigeunerwagen zwängte, der von einem sanftmütigen alten Gaul gezogen wurde.
Diese Zeit nach dem Krieg erwies sich noch immer als wie geschaffen für all jene, die in den Künsten Sparsamkeit und Improvisation bewandert waren. Ich traf an Land Matrosen, die keine Eile hatten, wieder in See zu stechen, ich traf Obstpflücker, die ungeduldig auf die erste Ernte von Blaubeeren oder Brombeeren warteten, Hopfenpflücker, die sich die Zeit vertrieben, bevor sie nach Süden aufbrachen, um dort den Sommer zu verbringen, und Männer, die riesige Besen aus großen rauchenden Teerfässern hoben und auf die Straße klatschten. Ich verbrachte träge Momente mit den Verlorenen und den Verstörten, Überlebende samt und sonders.
Das Wetter war der Schlüssel, um mit Fremden ins Gespräch zu kommen. Schließlich beschäftigen sich Engländer ständig damit, ob es zu heiß oder zu kalt ist, zu nass oder einfach nicht nass genug. Selten äußert sich ein Engländer über die bestmöglichen meteorologischen Bedingungen oder über das satte Grün seines Grases, wenn er weiß, dass es nur fünfzig Meilen weiter noch grüner ist. Über das Wetter zu reden, ist lediglich eine Art Code oder ein Währungsumtausch, eine Transaktion, um wichtigere Themen anzuschneiden, sobald gegenseitiges Vertrauen hergestellt ist. Das lernte ich unterwegs, als mich die Umstände und die schlichten Erfordernisse des Überlebens zwangen, öfter den Mund aufzumachen, als ich das von zu Hause gewohnt war. Dort ging es in meinen Interaktionen mit Erwachsenen lediglich darum, ihren Befehlen mit gelangweiltem Stöhnen und Ächzen zu gehorchen. Ein anfängliches Gefühl von Alleinsein lockerte mir die Zunge, wenngleich ich lernte, dass Einsamkeit in der freien Natur nichts Beängstigendes ist. Tatsächlich erlebte ich angesichts der überwältigenden Ziellosigkeit, die ich nun empfand, zahlreiche und völlig unerwartete Momente der Euphorie. Ich konnte irgendwohin gehen, irgendetwas tun. Irgendwer sein.
In diesen Gesprächen mit Fremden wurde der Krieg kaum erwähnt; diese Bestie blieb begraben. Sie war noch zu frisch, um exhumiert zu werden.
Mit der Zeit hatte ich genug von Bächen und Wäldchen und spürte stattdessen die Verlockung des Meeres, also wandte ich mich Richtung Europa und folgte den Straßenschildern, die mich durch Dörfer entlang des äußersten östlichen Randes von Cleveland und North Yorkshire nach Süden führten.
Skinningrove und Loftus.
Staithes und Hinderwell.
In jedem Ort fand ich genug Arbeit, um mich für ein paar Tage zu versorgen, ehe ich weiterzog.
Ich besuchte Runswick Bay und Sandsend, und schließlich erreichte ich das Städtchen Whitby mit seinem Bogentor aus Walzähnen und der würzigen Brise, und jenseits der Bucht sah ich hoch oben die Silhouette einer alten Klosterruine.
An diesem Teil der Küste kam ich an zwei Flugzeugen vorbei, die vom kriegsgeteilten Himmel geschossen worden waren, eines eine verkohlte Abstraktion aus hitzeverbogenem Metall, alles Glas in einem brüllenden Feuerball zerschmolzen. Das zweite entdeckte ich in einem Kornfeld, ein Flügel abgerissen, doch ansonsten intakt, die Nase zwischen die Weizenkeimlinge gesteckt, die jetzt ringsherum sprießten, als wäre es gedankenlos von Picknickausflüglern dort abgestellt worden.
Doch auf dem Heck und dem verbliebenen Flügel prangten die infamen Symbole eines Schreckensreiches, und drum herum lagen die Trümmer der grimmigen Todesmission, die von den Einheimischen noch nicht aufgesammelt worden waren, da sie den Fundort irgendwie übersehen hatten: ein verformtes Propellerblatt, so lang, wie ich groß war, und ein zerfetztes Stück Stoff, das ich mich nicht traute aufzuheben. Es fühlte sich an, als wäre der Bomber nur Minuten zuvor kreiselnd über den schachbrettartigen Feldern eines fremden Landes abgestürzt, eine Rauchfahne hinter sich herziehend, während der Tod auf den verzweifelt betenden Piloten zuraste, ein weiteres Opfer im irrwitzigen Tanz des Krieges.
Ich verweilte nicht länger dort, und schon bald erreichte ich das auf einem Hügel gelegene High Normanby und blickte hinab auf die Weidehänge von Fylingthorpe und die Bucht unter ihnen. Ihr Wasser war ein herrliches Mosaik, die zusammengefügten Splitter eines geborstenen Spiegels aus Smaragd und Malachit.
2
Ich ging durch die Wiesen, die sich zum Meer absenkten, und rostfarbene Pollen hafteten an meinen Hosenbeinen, bildeten ein Muster aus Staubpartikeln, und als ich mit dem Daumen darüberfuhr, hinterließen sie einen Streifen aus Korallenrot, die Farbe einer träge untergehenden Sonne.
Die Häuser, die ich sah, waren robust und solide und aus hellem Goathland-Stein erbaut. Es waren schöne Behausungen, dem Moor abgerungen, verwittert und mit roten Dachziegeln, viele auf ihrem eigenen Stück Land und so ganz anders als die rußgeschwärzten, zusammengedrängten Reihenhäuser in den engen Backsteindörfern daheim.
Es war eine eher landwirtschaftlich als industriell geprägte Gegend – der Erde zugehörig statt von ihr beschmutzt.
Hecken umsäumten mich, und ich kam an Kühen vorbei, deren Euter wie Partyballons herumbaumelten, gelegentlich auch an Pferden, die auf tristen Koppeln angebunden waren und mit großen feuchten Augen den Boden nach mehr als bloß kargen Stoppeln absuchten und deren Rippen hervortraten wie die Rümpfe von gestrandeten Booten. Das trostlose Vermächtnis des Krieges hatte die Tiere nicht verschont, aber solange ihre Herzen noch schlugen, bestand Hoffnung für diese ausgehungerten Geschöpfe.
Auf den Hängen grasten auch verstreute Schafe, und auf einer Weide etwas, das wie das absurde Zerrbild eines Schafs aussah – ein sonderbares Viech, etwa so groß wie ein kleines Pferd, mit einem überlangen Hals und wolligen Beinen, bei dem es sich, wie ich später erfahren sollte, um ein Alpaka handelte.
Es war eine Wohltat, bergab in die sanfte Brise hineinzugehen, die vom Meer heranwehte. Die Luft roch nach der sich verändernden Jahreszeit: Die frische grüne Würze der Wildgräser und Schösslinge und der steigende Saft in den Bäumen erfüllten die gewundenen Straßen mit ihrem Duft. Durch die hohen Hecken fühlte ich mich wie in einem Irrgarten, und an Gabelungen entschied ich spontan, welchen Weg ich nehmen wollte, ließ mich von den weiten Hängen abwärts tragen.
Die akustische Untermalung war das Blöken der im März geborenen Lämmer, die nun schon Schafe waren und bald geschoren würden. Hier war Leben, geschah überall um mich herum und in mir und durch mich hindurch, in dieser neuen Zeit des Wachsens und Werdens, dieser Phase des ungehemmten Entstehens.
Während meiner Wanderung auf diesen Landstraßen war das Meer gleichsam ein Trugbild im Kopf eines jungen Mannes, dessen einzige maritime Erfahrung ein verschlafener Kindheitsmorgen war, an dem er beobachtet hatte, wie das kabbelige graue Wasser gegen die steinernen Piers der Schiffswerften von Sunderland klatschte.
Schon damals hatte mich am Meer nicht das Wasser selbst am stärksten beeindruckt, sondern das, was vom Meer und für das Meer lebte: eine Welt aus Nieten und Funken, aus Feuer und Lärm, große graue Ungetüme wie stählerne Kathedralen, demontiert und zur Seite gekippt, ungeschlachte, halbfertige Kriegsschiffe, deren schiere Dimensionen fast unbegreiflich waren.
Das Flüstern der Wellen war vom Kreischen von Metall auf Metall ebenso übertönt worden wie vom Kreischen der Möwen hoch in der Luft.
Das Wasser selbst war mir nicht in Erinnerung geblieben, nur, dass es sich irgendwo versteckt hatte, kaum sichtbar, hinter den Betonmauern eines Trockendocks und dem Drahtzaun der Werft, der die geschäftige menschliche Kakofonie umschloss.
Mein Vater war an einem seiner seltenen freien Tage mit mir dorthin gefahren: fünfzehn Meilen und zwei lange Stunden im Bus, in dessen Oberdeck bläulicher Zigarettenqualm waberte. Wir hatten mithilfe von dicken Schnüren, die wir mit langen Nägeln beschwert und an die wir fettige Eisbeinstücke aus Metzgerabfall als Köder befestigt hatten, Krebse aus dem trüben Hafenwasser gefischt. Der Benzingestank und die grün schillernden Panzer der Krebse hatten ausgereicht, um uns den Appetit zu verderben, sodass wir den Eimer mit unserem Fang zurück in das ölige Wasser kippten.
Hier jedoch, nur sechzig oder siebzig Meilen weiter südlich, an einer Küste, die ich viele Wochen lang erwandert hatte, lagen die Werften und die koksschwarzen Wasser von Wearmouth weit hinter mir. Das Land strömte jetzt in einem grünen Potpourri aus Feldern und Weiden dahin, durchzogen von staubigen Feldwegen und dicht mit Bäumen bestandenen Waldwiesen. Durch schattige Senken und Gräben rannen winzige, glasklare Wasseradern, plätscherten der salzigen Nordsee entgegen, die glitzerte, als bestünde ihre Oberfläche aus gewaltigen frisch gelaichten Heringsschwärmen.
Die Küste hatte hier einen anderen Zweck als in meiner Heimat mit ihren Trockendocks und Kipploren, wo das Meer als Fertigungsband für eine Industrie diente, die vom Krieg profitiert hatte, und wo die müden Gezeiten mit der dumpfen Gleichmäßigkeit eines Steinmetzhammers an den schrumpfenden Klippen nagten.
Hier war der Ozean ein Tor, eine Einladung, und ich nahm sie bereitwillig an.
Ich folgte Pfaden durch wispernde Wiesen und zerfurchtes Gestrüpp, sprang über Steinmauern, stieg über Zauntritte und trat durch Schwinggatter, deren oberste Sprossen im Laufe der Jahrhunderte von den schweißfeuchten Händen umherziehender Landarbeiter oder Bergwanderer schädelglatt abgegriffen worden waren.
Ich nahm einen noch schmaleren Weg, der nicht für Fahrzeuge gedacht war. Hinter einer Biegung verwandelte er sich in einen bewaldeten Pfad, der bergab führte, und schließlich durchquerte ich eine kleine Furt mit uralten Trittsteinen. Auch hier hatte die Zeit sich eingeprägt, hatten genagelte Stiefel im grob behauenen Stein Riefen hinterlassen. Unwillkürlich fragte ich mich, ob diese Steine auch in weiteren hundert Jahren noch hier sein würden oder ob der Bach dann vergiftet wäre, die alten Cottages zerfallen, die Weiden überwuchert wie verwahrloste Friedhöfe. Würde, so fragte ich mich, ein weiterer Krieg das alles vernichten?
Ich bewegte mich durch ein altes Geflecht von Pfaden, jeder eine gewundene Rinne, eingegraben in den trockenen Lehm, von der Zeit geschlagene Kerben.
Tief im kühlen dunklen Schlund eines dieser Hohlwege sah ich einen Dachsbau in der lehmigen Böschung, umgeben von kompakten trockenen Erdhaufen. Stellenweise waren sie bis zu zwei Meter hoch. Diese aufgeworfenen Hänge führten in zahlreiche Kammern, die mit frisch gekratzten Krallenspuren verschönert waren. Es waren Hieroglyphen, gleichsam eine wortlose Poesie, und dicht daneben waren deutliche Muster von Tunneln zu erkennen, die durch Lücken in den Hecken ins hohe Gras der umliegenden Wiesen führten. Die Gänge dieses gewaltigen Baus verliefen mindestens zehn oder fünfzehn Meter in alle Richtungen, ragten tief in das dunkle Reich, das dieses rätselhafte Tier seit Generationen besiedelt hatte. Sie waren Portale zum Königreich dieser faszinierenden Geschöpfe.
Die Sonne fiel in breiten Strahlen auf die trockene, zusammengepresste Erde und beleuchtete die Kalligraphie der Krallenspuren. Ich verweilte einen Moment in dem Bewusstsein, dass ich höchstwahrscheinlich ganz in der Nähe einer Dachsfamilie war, die in ihren irdenen Bunkern schlief, geschützt vor den Geräuschen der Außenwelt.
Ich wollte einen Schluck aus meiner Feldflasche nehmen, stellte jedoch fest, dass sie leer war.
Ich schaute mich um, kroch dann unter einem Zaun hindurch und überquerte eine offene Wiese mit fast kniehohem wächsernem Gras, durch das die sanfte Brise vom Meer wehte. Nur von der Schwerkraft hangabwärts geführt, stieß ich bald auf einen weiteren Pfad, dem ich kurz folgte, ehe ich nach links abbog.
Irgendetwas bewog mich, diesem Sträßchen zu folgen, obwohl es sich ausnahm wie eine Sackgasse. Es sollte einer dieser Momente werden, in denen das Leben einen neuen Weg eröffnet, dessen Bedeutung sich vielleicht erst Jahre später voll und ganz erfassen lässt.
Nach gut hundert Metern verengte sich das Sträßchen, das inzwischen nur noch ein holpriger Weg war, von Furchen und tiefen, knöchelverdrehenden Löchern durchzogen, und ich gelangte zu einem Cottage.
Das Haus war aus einheimischem Stein erbaut und mit Wildem Wein bedeckt, der sich daran klammerte wie ein Krake im Sturm an einen Felsen, die wirren Ranken tentakelartig um die Ecken gestreckt. Ich erreichte das Haus von hinten und folgte der Wurzel der strangulierenden Pflanze, die aus dem Boden kam und seitlich um das Cottage herumwuchs, während ihre Blätter nacheinander flatterten, wenn eine leichte Brise hindurchstrich.
Es mutete an wie ein Traumbild.
Der Weg endete neben dem Cottage, hinter dem nur noch ein Dschungel aus Buschwerk wucherte. Vor dem Haus konnte ich einen Garten sehen, der aus einer kleinen Terrasse mit rissigen Pflastersteinen, einem Rasen und einem Gemüsebeet umgeben von Blumenrabatten bestand. Ringsherum war ein schieferweiß gestrichener Holzzaun, dem die Salzluft arg zugesetzt hatte, denn der Lack warf Blasen, blätterte ab und war stellenweise abgeplatzt.
Der Garten war eine halb kolonisierte Ecke in einer wilden, abfallenden Wiese, die den Blick zum gut eine Meile entfernten Meer lenkte. Die Hecken und Bäume zu beiden Seiten umrahmten die Aussicht wie der Motivsucher eines romantischen Malers.
Etliche Vogelhäuschen wurden emsig von vielerlei Meisen und Finken, Rotkehlchen, Zilpzalps und Mönchsgrasmücken besucht, und ich beobachtete sie eine Weile, still und unbemerkt, bis drei kreisende Krähen herabstießen, mit ihren Schatten die Sonne durchschnitten, ehe sie dem Festmahl mit gieriger Durchsetzungskraft ein Ende bereiteten. Erst da bemerkte ich, dass unter dem Dachvorsprung eines kleinen Backsteinhäuschens neben dem Cottage zwei Nester aus Lehm und Federn wie handgeformte Schüsseln frisch vom Töpferrad hingen, die Behausungen von Zaunkönigen.
In dem Moment hörte ich ein Knurren, ein tiefes Grollen, als würde ein Motor anspringen. Der Klang von Schleim und Fleisch. Kehlig.
Ich blickte über die Schulter und sah einen großen Deutschen Schäferhund bereit zum Angriff wie ein Sprinter, der auf den Startschuss wartet, die wachsamen Ohren angelegt und den Schwanz gestreckt wie eine Funkantenne. Seine suchenden Augen waren auf den Preis gerichtet: mein Handgelenk. Ich rührte mich nicht.
Dieser gefährlich aussehende Hund starrte mich an, das nasse Fleisch seiner Oberlippe hochgezogen, sodass seine langen Fangzähne und die leuchtende rosa-schwarze Marmorierung von Zahnfleisch und Gaumen zu sehen waren. Er knurrte erneut, ein tiefes Grummeln. Fleischiger Donner.
»Butters«, sagte eine Stimme, und eine Frau richtete sich aus dem dichten Wiesengebüsch hinter dem Gartenzaun zu voller Größe auf. Sie wandte sich erst dem Hund zu, dann mir. »Ach, da bist du.«
Die vertrauliche Begrüßung, die sich anhörte, als wäre ich nur mal kurz weg gewesen, um Wasser aufzusetzen oder ein paar Karotten aus der Erde zu ziehen, überraschte mich. Ich nahm an, dass sie entweder nur schlecht sehen konnte und mich mit jemand anderem verwechselt hatte, oder aber sie hatte den Hund gemeint. Vielleicht hatte sie mich überhaupt nicht bemerkt, und jeden Moment würde ihr Ehemann oder Sohn – ein muskelbepackter Mann vom Lande mit Armen wie Oberschenkel und einem krankhaften Argwohn gegenüber ungebetenen Fremden – aus irgendeinem Gartenschuppen kommen und all seine Vorurteile ausleben, die er gegen Landstreicher und Herumtreiber wie mich hatte, einen schmächtigen Wanderer aus dem aschgrauen Kohlerevier.
Die Frau war groß, knapp einen Meter achtzig, ihre Haltung keck und unverfroren, stolz, was sie nur noch größer wirken ließ, und obendrein würdevoll.
Ihr Gesicht war hager und katzenartig, die Wangenknochen markant, die Kieferpartie kräftig. Ihr Mund wirkte breit – fast zu breit für ihr Gesicht – und mit den leicht nach oben gezogenen Winkeln ebenfalls katzenhaft. Er ließ ein unterdrücktes Lächeln erahnen.
Ich hätte ihr Alter nicht schätzen können – für junge Menschen sieht jeder über vierzig alt aus –, aber ich konnte die jüngere Version von ihr auf Anhieb erahnen. Und zwar in den Augen und den Bewegungen. Trotz ihrer ungemein altmodischen Kleidung – vielleicht viktorianisch – bewegte sie sich leichtfüßig auf mich zu. Ihr Gang war flink und schien weder von der Last des Alters noch von der möglichen Bedrohung durch einen verschwitzten Fremden beeinträchtigt.
»Platz, Butters«, sagte sie, und prompt legte sich der Hund hin und drückte den Kopf auf die Pfoten, behielt mich aber weiterhin im Auge. »Er spielt sich bloß auf«, erklärte sie. »Er hat seine ganz eigene Art, Besucher zu begrüßen.«
Ich merkte, dass ich nach einer Antwort suchte, aber was auch immer ich sagen wollte, es kam bloß ein trockenes, überraschtes Krächzen heraus. Ein dürres Räuspern.
»Ich nenne ihn Butler, aus naheliegenden Gründen«, redete sie weiter. »Oder kurz Butters – obwohl ›Butters‹ ja eigentlich ein längeres Wort ist.«
Ich merkte plötzlich, wie durstig ich war, und schluckte bei dem Versuch, Speichel zu sammeln, um die Wörter zu ölen, die ich irgendwie nicht herausbrachte. »Ich bin bloß die Straße entlanggekommen«, erklärte ich linkisch.
»Ja, dachte ich mir«, sagte sie. »Musst du ja wohl – und von irgendwo weit dahinter, deinem Akzent nach zu urteilen, der klingt nämlich ganz nach dem Bergmannsdialekt hoch im Norden, wenn ich mich nicht irre.«
Damals war mir nicht klar, dass die Menschen in den Bergarbeiterdörfern des Nordostens einen eigenen Akzent hatten, der sich auch in meiner Sprache niedergeschlagen hatte. Doch als ich etwas erwidern wollte, wurde mir plötzlich bewusst, dass meine Zunge sich zäh im Mund anfühlte. Sie war wie gelähmt, und auch die Muskeln um meinen Mund herum schienen den Dienst zu verweigern. Ich brachte nichts heraus.
»Na, wie dem auch sei«, sagte sie, »ich wollte mir gerade Tee machen. Trinkst du einen mit?«
Ich schaffte es, mir eine Antwort abzuringen: »Tee?«
»Ja. Ein Tässchen. Oder zwei.«
Mein Akzent mochte ja der eines Auswärtigen sein, aber die Aussprache dieser Frau klang in meinen Ohren auch ungewöhnlich, wie von jemandem, den man überhaupt nur im Radio zu hören bekam. Sie war völlig anders als der schnodderige Singsangdialekt des Kohlereviers, mit dem ich aufgewachsen war.
»Falls es keine Mühe macht.«
Sie zuckte die Achseln. »Es macht mir keine Mühe, wenn du die Brennnesseln pflückst.«
»Brennnesseln?«
»Ja«, sagte sie. »Es gibt Brennnesseltee. Trinkst du den?«
Ich zögerte, schüttelte dann den Kopf. »Ich hab immer gedacht, Brennnesseln sind giftig.«
»Giftig? Aber nein. Sie brennen, aber das kommt von den feinen Härchen an den Blättern und Stielen, die sich wie kleine Nadeln aufführen. Gekocht können sie nichts mehr ausrichten.« Sie hielt inne. »Deine Scheu ist verständlich. Man hat uns beigebracht, diese Pflanze zu fürchten, aber für mich ist sie ein Freund. Meine Brennnesselvorliebe entstand aus der Not heraus, aber ich habe festgestellt, dass sie ein wunderbarer Durstlöscher ist, und du siehst aus, als wärst du halb vertrocknet.«
»Ich bin sehr durstig, Missus.«
»Na, also dann. Aber nenn mich nicht ›Missus‹, wenn du länger bleibst.« Die Frau machte einen Schritt auf mich zu und streckte mir eine behandschuhte Hand entgegen. »Wenn du mich irgendwie nennen musst, dann bei meinem Namen: Dulcie. Dulcie Piper. Diese bodenständige Förmlichkeit ist reizend, aber unnötig.«
Ich hatte wochenlang im Freien geschlafen, und plötzlich wurde mir bewusst, wie abgerissen ich aussehen musste, obwohl ich die Wünsche meiner Mutter beherzigt hatte. Aber falls Dulcie das bemerkte, so ging sie mit keinem Wort darauf ein.
»Klar«, sagte ich und wurde rot.
»Das wäre jetzt der Moment, wo du mir deinen Namen verrätst.«
Ich brachte ein verlegenes Lächeln zustande und nahm ihre Hand. Der Gartenhandschuh fühlte sich ebenso trocken und rau an wie meine Kehle. »Natürlich, ich heiße Robert, Miss –«
Sofort schnalzte sie mit der Zunge und hob drohend einen langen Finger. »Und wie heißt du mit Nachnamen, Robert?«
»Appleyard.«
»Nun denn, Robert, ich erkläre dir jetzt die simple Methode, wie man einen wunderbaren Brennnesseltee kocht, also pass gut auf. Du nimmst einfach eine Handvoll von dieser armen alten Urtica dioica, dem verkanntesten unter den einheimischen Gewächsen, und kochst sie in einem Topf Lebenswasser – es gibt nämlich kein reineres Wasser als das, was durch die Erde Yorkshires nach oben sprudelt. Sobald der Tee durchgezogen ist, gibst du entweder drei Spritzer oder eine dicke Scheibe Zitrone hinein, bis er die rosa Farbe einer Pfingstrose annimmt. Trink ihn aus einem blechernen Messbecher oder aus feinstem Ming-Porzellan, das spielt nämlich keine Rolle.«
Aus Verlegenheit unterließ ich es, ihr zu gestehen, dass ich noch nie eine Zitrone gesehen oder gekostet hatte und nicht richtig verstand, wovon sie eigentlich redete, doch vielleicht sah mir die alte Frau das an, denn sie verschonte mich mit weiteren Erklärungen.
»Ich weiß, was du denkst: Wie kommt man in einem verarmten Land an Zitronen? Sagen wir einfach, ich habe Kontakte. Beziehungen. Dieser impotente kleine Deutsche hat viele Dinge zerstört, aber nicht meine Teegewohnheiten. Nein. Außerdem gibt es Alternativen zu Zitronen. Thymian, Basilikum, Myrte und Eisenkraut können alle den Geschmack in gewisser Weise nachahmen, und dann wären da natürlich noch Zitronenmelisse und Zitronengras – obwohl, wenn du kein Botaniker bist, der über die Kontinente wieselt, glaube ich kaum, dass du die in absehbarer Zeit auftreiben könntest. Und was Limetten betrifft, vergiss es. Sind genauso selten wie Hitlers linker Hoden, wenn man den Spottliedern glauben kann. Nicht mal ich komm da ran. An Limetten, meine ich.«
Völlig überrumpelt von den ausschweifenden Gedanken dieser seltsamen Frau, entging mir der Witz völlig. »Warum Zitrone?«, fragte ich zögerlich.
»Nun ja, für Farbe und Aroma. Man braucht ein bisschen Farbe im Leben, selbst wenn sie illusorisch ist. Und das Leben ohne Aroma ist tot. Brennnesseltee ist ein ziemlich ödes Getränk, das erst durch Zitrone erträglich wird. Einen Vorteil hat er: Man braucht keine Lebensmittelmarke, um ihn zu bekommen. Man bedient sich einfach selbst. Die Blätter gibt’s gratis, und alles, was gratis ist, schmeckt immer besser. Findest du nicht auch?«
»Doch«, sagte ich und nickte. »Ja, unbedingt. Ich hab mich in letzter Zeit auch von der Natur ernährt.«
»Und das hast du gut gemacht. Angeblich ist er auch ein Allheilmittel, Brennnesseltee. Ein Segen für die Haut, ein Elixier für die Gelenke und ein Wachmacher für die Beweglichkeit. In meinem Alter holt man sich jede Hilfe, die man kriegen kann. Außerdem werden die Wiesen schön ausgedünnt, wenn man die Brennnesseln rausreißt.«
Als sie an mir vorbei zum Haus ging, hob der Hund den Kopf, und die Art, wie er langsam die Beine entfaltete und sich zu voller Größe erhob, erinnerte mich an den Wäscheständer, an dem meine Mutter immer die gestärkte Weißwäsche trocknete.
»Verbrennt man sich denn nicht?«, fragte ich. »Beim Pflücken, meine ich.«
Sie trat ins Haus und tauchte einen Moment später wieder auf. »Nicht, wenn man die richtige Technik anwendet. Du musst das Blatt entschlossen mit Daumen und Zeigefinger packen, dann passiert nichts. Wer beim Pflücken zögert, hat am meisten zu leiden, aber wovor du dich unbedingt