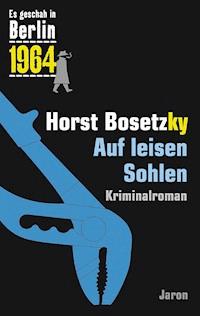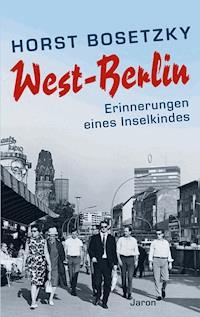3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
1348 taucht ein Pilger aus Jerusalem in der Mark Brandenburg auf. Ist er der rechtmäßige Erbe der Mark, oder ist er ein Scharlatan? Das Volk feiert ihn. Dem späteren Kaiser Karl IV. kommt er im Kampf um die Macht sehr gelegen. In den Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft in Europa wird der totgeglaubte Markgraf, der letzte aus dem Geschlecht der Askanier, zu einer Schlüsselfigur. Wer war der Mann, der als der »falsche Waldemar« in die Geschichte einging? Horst Bosetzky, bekannt als »-ky«, hat für diesen ungeklärten Kriminalfall des 14. Jahrhunderts eine verblüffende Lösung gefunden. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Ähnliche
Horst Bosetzky
Der letzte Askanier
FISCHER E-Books
Inhalt
Erster Teil Ein Schrecken ohne Ende
Kapitel I
1319 – Terra Transoderana und Kloster Chorin
Markgraf Waldemar ist tot!«
Die Bauern auf dem Feld ließen die Hacken fallen und sahen zum Wald hinüber, aus dem eine hochgewachsene junge Frau herausgelaufen kam. Es war Adela, die ältere und ausnehmend schöne Tochter des Müllers Jakob Rehbock, der erst vor kurzem von Niemegk bei Potsdam hergezogen war in die Neumark jenseits der Oder.
Adela fuchtelte wild mit den Armen. »Kommt, wir müssen ihn zur Mühle schaffen.«
»Dann man los«, sagte Denecken und gab seiner kleinen Schar das Zeichen, alles stehen- und liegenzulassen. Er war ein kluger Bursche, und der Vogt von Biesenthal wollte zusehen, daß er nach Frankfurt an der Oder zu einem Kaufmann kam. »Der Waldemar war ein großer Herr und hat in Brandenburg alles zusammengehalten, nach ihm aber wird es einen Schrecken ohne Ende geben. Gestern nacht erst sind die Sterne vom Himmel gefallen.« Er bekreuzigte sich, dann rannte er los.
Adela lehnte an einer Kiefer. Das lange blonde Haar hatte sie hochgebunden, ihr weites hellgraues Gewand flatterte im Wind.
Denecken glaubte, eine der alten germanischen Göttinnen sei auferstanden. Doch als er näherkam, sah er, daß sie ganz verweinte Augen hatte. Ihr Gesicht war müde und aschfahl.
»Wie ist es denn passiert?« fragte er.
»Er ist allein durch die Wälder gestreift und plötzlich krank geworden, hat mit hohem Fieber bei uns in der Mühle gelegen, aber dennoch weiterreiten wollen.«
Denecken pfiff durch die Zähne. »Es wird ja von ihm so manches Wundersame berichtet.«
»Woher soll ich das wissen?« Adela erschlug eine Bremse auf ihrem Unterarm. »Als ich mit der Mutter Beeren suchen wollte, haben wir ihn gefunden. Unten am Bach.«
»Wohin denn nun: hier den Pfad entlang?« Denecken wurde ungeduldig. Vielleicht war der Markgraf doch noch am Leben, und wenn er ihn rettete, konnte er als Knappe mit ihm ziehen.
Adela nickte und ging der kleinen Gruppe voran. Sie kämpften sich durch dichtes Gebüsch, das Brombeergesträuch riß ihnen an der Kleidung. Scharen von Mücken und Bremsen fielen an diesem heißen Augusttag über sie her.
Denecken blieb stehen und lauschte. Ihm war, als hätte er ein Pferd wiehern hören.
»Das ist seines«, sagte Adela. »Er ist gestürzt und …« Sie brach wieder in Tränen aus.
Auch Denecken war bestürzt, denn was nach Waldemar kam, war sicher schlimm für alle. Neue Herren neigten immer dazu, die Abgaben zu erhöhen, und die Bede war schon hoch genug. Das Beste wäre gewesen, Waldemar hätte lange genug gelebt, um die Dänen und Mecklenburger zu besiegen und den roten Adler Brandenburgs über deren Ländereien aufzuziehen. Der Biesenthaler Vogt hatte ihm viel von den Plänen Waldemars erzählt.
»Hierher! Zu Hilfe!«
»Das ist Mutter«, sagte Adela. »Sie ist bei dem Toten geblieben, damit wir ihn finden.«
Denecken spürte die Gier in sich hochsteigen, als Adela so vor ihm stand. Oft hatte er in diesem Sommer versucht, sie ins Heu zu ziehen, aber sie hatte ihn stets fortgestoßen.
»Da vorne ist der Bach!« rief einer der Bauern, der den Wald gut kannte.
»Dann waten wir zum Markgrafen hin, das geht schneller.« Auf Deneckens Geheiß zogen sich die, die nicht ohnehin schon barfuß liefen, die Klotzpantinen aus, und vorwärts ging es. Die Rufe der Katharina Rehbock, die bei dem Toten wartete, wiesen ihnen den Weg.
»Wir kommen!« schrie Denecken in den Wald, in dem es Gegenden gab, die seit der Erschaffung der Welt noch nie ein Mensch betreten hatte. Das Dickicht erschien ihm undurchdringlich.
»An der Schneise hier!«
Da kannte Denecken sich aus, denn diese Schneise hatten sie im letzten Jahr geschlagen, um einen Weg zur Lichtung zu bahnen, auf der die Klosterbrüder aus Soldin ein neues Dorf begründen wollten.
Als sie die Unglücksstelle erreichten, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. Im Morast, halb bedeckt von der schwarzbraunen Walze des sterbenden Pferdes, lag der Körper eines schmächtigen Mannes, den die Hufe übel zugerichtet hatten. Offenbar war das Pferd durchgegangen, hatte den Reiter an eine der mächtigen Eichen geschleudert und dann im eigenen Todeskampf zertrampelt. Panzerhemd und Lederkoller hatten den Mann nicht zu schützen vermocht.
»Erschlagt den Gaul und zieht den Markgrafen heraus, schnell! Vielleicht … O mein himmlischer Herrgott, so hilf uns doch!«
Adela mußte ihre Mutter beiseite führen.
Denecken machte sich mit seinen Bauern ans Werk, doch es gab nichts mehr zu retten. »Du hattest recht«, sagte er zu Adela. »Markgraf Waldemar ist tot.«
Im Jahre 1098 beschloß der heilige Robert von Molesme, aus Protest gegen die verderbten Sitten der Benediktiner einen neuen Orden zu gründen. Da er in der burgundischen Stadt Cîteaux lebte, die bei den gebildeten Mönchen den lateinischen Namen Cistercium trug, hießen seine weißgewandeten Ordensbrüder Zisterzienser. Weiß waren ihre Kutten deswegen, weil die ursprünglich schwarze Kutte des zweiten Abtes von Cîteaux, Alberich, unter der Berührung der Mutter Gottes weiß geworden war, wie man sagte.
Das Gelübde der Zisterzienser verlangte nicht nur Armut, Keuschheit und Gehorsam, sondern auch Fleiß: Gottes Wort sollte mit Axt und Spaten verkündet werden – ora et labora. Mit diesem modernen Slogan traten die Zisterzienser ihren Siegeszug an und erreichten Ende des 12. Jahrhunderts auch Brandenburg, wo sie 1183 das erste Kloster gründeten: Lehnin. Weitere folgten. In den Jahren 1273 bis 1334 wurde Kloster Chorin erbaut – ein Vorhaben, für das sich Markgraf Waldemar sehr erwärmt hatte.
Seit 1258 genossen die Zisterzienser in den Landen der Askanier volle Zollfreiheit. Die fleißigen Mönche nutzten diese Gunst, indem sie große Reichtümer anhäuften, sich die umliegenden Dörfer einverleibten und dem hanseatischen Getreidehandel beitraten. Kein Wunder, daß die Kreuzgänge des Klosters Chorin ganz besonders wuchtig ausfielen: Der Backsteinbau kündete von großer Glaubenskraft.
Hier nun im Choriner Mittelschiff, wo die Spitzbogen hoch zum Himmel strebten, saßen die Trauergäste, um vom letzten Askanier Abschied zu nehmen, dem Markgrafen Waldemar, geboren 1281 als Sohn des Markgrafen Konrad und seiner Frau Constantia von Polen, regierender Fürst in der Mark Brandenburg seit 1303, vom Jahre 1309 an verheiratet mit Agnes, ebenfalls einer Askanierin. Das Fürstenhaus Askanien hatte seit 1123 mit Albrecht dem Bären die Geschicke Brandenburgs bestimmt, 1170 war ihm Otto I. gefolgt, sodann in nicht abreißender Kette Otto II., Albrecht II., Johann I., Otto IV. mit dem Pfeil und schließlich Konrad, der 1304 gestorben war und die Regierungsgewalt seinen drei Söhnen übertragen hatte: Johann IV., Otto VII. und eben Waldemar, der nach dem Tode seiner beiden Brüder die Alleinherrschaft angetreten hatte und alsbald den Ehrentitel »Waldemar der Große« tragen sollte. Die meisten Askanier waren hier in Chorin beigesetzt.
Man schrieb den 24. August 1319. Nach einer neuntägigen Aufbahrung hatte man den Toten einbalsamiert und von Bärwalde aus in einem großen Leichenzuge über die Oder nach Chorin gebracht, wo sich eine Vielzahl von Adligen versammelt hatte, so unter anderen der Bischof Heinrich von Havelberg, die Truchsesse Graf Günther von Käfernburg und Lüchow, Droiseke von Kröcher und Johann von Blankenburg, der Marschall Redekin von Redern, Wedega von Wedel, Heinrich von Kröcher, die Pröpste Eberhard aus Berlin und Walter aus Pasewalk, der Kaplan und Notar Hermann von Lüchow, Heinrich von Steglitz und Hans von Lüddecke. Allen voran natürlich Agnes, Waldemars Witwe, gerade erst zweiundzwanzig Jahre alt.
Hinten an der Wand lehnten der Ritter Hans Lüddecke und der Ratsherr Andreas Grote, beide aus Gransee.
»Welch ein Verlust für uns«, sagte Andreas Grote und wischte sich verstohlen eine Träne aus den Augen.
»Welch ein Gewinn für uns«, knurrte Hans Lüddecke. »Er ist mir zu mächtig geworden.«
Die Totenrede hielt Propst Nikolaus von Bernau, der Hofkaplan Waldemars zu Spandau, den er vor zwei Jahren beim Begräbnis seines Bruders Johann liebgewonnen hatte.
»Wir blicken auf die sterbliche Hülle des Markgrafen Waldemar und lesen im Buche des Propheten Jesaja im zweiundvierzigsten Kapitel: »Siehe, das ist mein Knecht – ich erhalte ihn – und mein Auserwählter, an welchem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht matt werden noch verzagen, bis daß er auf Erden das Recht anrichte; und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf ist, den Odem gibt und den Geist denen, die darauf gehen: Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefaßt und habe dich behütet …«
Kapitel 2
1325 – Avignon, Terra Transoderana und Schloß Tirol
Avignon, die Stadt, in der Papst Johannes XXII. seit dem Jahr 1316 residierte, war in einer anderen Welt als Brandenburg gelegen, und dennoch entschied sich für viele tausend Männer, Frauen und Kinder der Mark das Schicksal hier am Ufer der Rhone.
Ein Minoritenpriester beugte sich zum Papst hinüber. »Ich habe Ludwig in Mailand mit Matteo Visconti zusammen gesehen …«
»Er ist damit selber ein Ketzer, und der Bann wird ihn treffen.«
Jedesmal, wenn Papst Johannes an die Wittelsbacher dachte, verließ ihn die gute Laune. Und das seit 1322, als Ludwig IV. der Bayer in der Schlacht bei Mühldorf über seinen Favoriten triumphiert hatte, Friedrich von Österreich, auch er mit dem Anspruch angetreten, Römischer König und Kaiser zu sein. Nun, zwei Jahre später, hatten sich die Dinge weiter zugespitzt. Der Papst winkte einen Vertrauten herbei.
»So darf es nicht weitergehen. Die Entscheidung über die Thronfolge im Reich ist und bleibt päpstliches Recht. Die Wittelsbacher werden exkommuniziert, und über das gesamte Reich verhänge ich das Interdikt.«
Der Vertraute nickte. »Schön, aber das Verbot, Sakramente zu spenden, wird sie nicht sonderlich treffen, sie werden’s überall umgehen, ohne daß wir’s hindern können. Eine andere Züchtigung könnte schmerzhafter für sie sein … Darf ich Euch raten, Heiliger Vater?«
»Was ist es?«
»Ludwigs Sohn – auch ein Ludwig, Ludwig V. – ist jetzt Markgraf von Brandenburg und hat Rudolf von Sachsen und die Anhänger der erloschenen Askanier aus Brandenburg verdrängt. «
»Und?« Johannes XXII. wurde ungeduldig.
»Da wäre König Ludwig am ehesten zu treffen – in Brandenburg …«
»Wie das?«
»Der Bischof Stephan von Lebus ist einer unserer treuesten Brüder – und er könnte zu König Wladislaw Lokietek von Polen reiten und ihn bitten, den Untertanen in der Mark zu zeigen, was es heißt, die päpstlichen Befehle zu mißachten. Wladislaw wird sich mit dem König Gedymin von Litauen verbünden – und beide werden ihre Mission zu unserer Zufriedenheit erfüllen.«
Zwei litauische Soldaten packten den Priester und schlangen ihm ein dickes Seil um den massigen Körper. Mit überschnappender Stimme rief der Geistliche Gott und alle Heiligen um Hilfe an, doch damit lockte er nur David von Grodno herbei.
»Halt’s Maul!« schrie der grimme Heerführer der Litauer und schlug ihm mit dem flachen Schwert auf den Mund, daß das Blut gewaltig spritzte.
Das brachte Skirgal auf die Idee, das Orakel zu befragen. Die Litauer wußten, nachdem sie die Neumark gebrandschatzt und verwüstet und über die Oder gesetzt hatten, nicht, ob sie den Sturm auf Prenzlau wagen sollten oder nicht. »Wir können ihn nehmen und sehen, wie das Blut aus ihm gesprungen kommt.«
»Keine schlechte Idee.« David von Grodno erteilte seine Befehle. »Aber macht schnell, ehe die Hitze unerträglich wird.« Der Juni 1325 war außergewöhnlich heiß und trocken.
Die beiden Soldaten rückten den gefesselten Geistlichen so zurecht, daß sein Rücken zu Skirgal zeigte, der sein Schwert schon bereithielt. Aber er wartete, bis sich alle seine Soldaten um ihn versammelt hatten. Der Priester schrie und flehte so jämmerlich, daß einer der Soldaten die Nerven verlor, seinen Kopf mit beiden Händen packte und ihn so zurechtstauchte, als wäre er eine Puppe. Im selben Augenblick öffnete Skirgal den Körper des Mannes. Das Blut schoß nicht heraus, es lief nur in zwei schmalen Rinnsalen den Rücken hinab.
»Es sollten zwei Heerzüge ins Brandenburgische gehen«, sagte Skirgal dies deutend. »Der eine Richtung Frankfurt, der zweite nach Prenzlau zu, das wir nicht um jeden Preis erstürmen sollten.«
Anselma war so sehr ins Gebet vertieft, daß sie die Äbtissin überhörte, die den Schleier zur Seite gezogen hatte und neben sie getreten war.
»Die Litauer setzen über die Oder. In einer Stunde sind sie hier!«
Die junge Nonne drehte sich zu ihr um. »… dein Wille geschehe.«
Die Oberin hörte aus den Worten Anselmas Ironie heraus. »Wenn die Zeiten andere wären, würde deine Strafe nicht gering ausfallen«, sagte sie.
Anselma erhob sich. »Solange ich hier bin, seid Ihr gegen mich und zweifelt meine Tugend an. Wenn ich in der Kirche sitze, verhüllt mich ein Schleier und schließt mich ab von allen anderen.«
»Du störst die Andacht der Leute, die zu uns in die Kirche kommen. Du bist über alle Maßen schön – und du weißt es genau.«
»Der Herr hat mich geschaffen, wie ich bin – und ich bin frei von jeder Hoffart.«
»Nun …« Die Äbtissin breitete die Hände aus, als wolle sie Anselma segnen, meinte mit dieser Geste indessen nur, daß für solche Betrachtungen die rechte Zeit nicht sei. »Alle Schwestern flüchten sich in die Kirche.«
Anselma wandte sich zur Tür. »Ich eile ja schon.«
Doch die Mutter Oberin hielt sie zurück. »Nein, geh du nicht mit uns, Schwester Anselma, denn uns schützt wohl der Herr, unser Gott, weil wir alt sind und gebrechlich. Du aber drohst mit deiner sündigen Schönheit unsere heilige Sterbestunde zu entweihen. Und darum entlasse ich dich, kraft der Macht, die mir gegeben, aus unserer Gemeinschaft. Flüchte dich, wohin du magst, und ich wünsche dir alles Glück. Verbirg dich im Dorf oder zieh mit den Krämern, die über den Fluß setzen; aber bleibe nicht bei uns, denn deine Schönheit ist uns allen verderblich.«
Anselma erschrak, die Tränen schossen ihr in die Augen. Oft hatte sie ihr hübsches Gesicht im Spiegel bewundert, jetzt aber wünschte sie, häßlich zu sein, denn ihre Schwestern verstießen sie ihrer Schönheit wegen. »Bitte, laßt mich nicht allein«, flehte sie. »Nehmt mich zu den anderen mit.«
»Die Zeit drängt, mein Kind.«
Da kniete Anselma nieder und erbat den Segen der frommen Frau.
Die Äbtissin legte ihr die Hand auf den Scheitel und sprach: »So bewahre dich selber unter Gottes Beistand; und wie er dir Schönheit verlieh, so verleihe er dir auch Klugheit, daß du dich und deine Reinheit ihm errettest, dem du angehörst.«
Damit verließ sie das Chorgestühl und ging zu den Schwestern hinüber in die Kirche. Anselma aber floh nicht zur Oder hinunter, sondern kehrte in ihre Zelle zurück und warf sich vor ihrem Betpult zu Boden. Alsbald hörte sie wüsten Lärm, Axtschläge und entmenschte Schreie. Wie ein Sturmwind fegten die litauischen Soldaten durch die Höfe, Kreuzgänge und Chöre. Die Kirchenfenster standen offen, und der Gesang der Schwestern drang zu ihr herauf.
Die alte Äbtissin stand mit ihren Nonnen am Hochaltar. Sie sangen die heiligen Horas, die Stundengebete. Und als die Litauer säbelschwingend ins Kirchenschiff einbrachen, drängten sich alle um das Kruzifix. Eine jede berührte es, und zur heiligen Katharina hatten sie vorher gebetet, daß sie ihre Unschuld bewahren und ihr Martyrium würdigen möge. So trat ein, was sie erwartet hatten. Alle, wie sie da standen, wurden von den Heiden niedergemetzelt.
Anselma hörte ihre Todesschreie, hatte deutlich das Bild vor Augen, wie sie zu Füßen ihres Heilands starben, der auch für sie geblutet hatte, und konnte keinen Finger rühren.
Nun war es still. Dann aber brach der Sturm von neuem los, denn jetzt verteilten sich die Mörder in den Gängen und Zellen, um Beute zu machen. Anselma hörte Fußtritte, die sich auf der Treppe näherten. Zelle um Zelle krachten die Türen auf. Und nun war ihre an der Reihe. Die Tür flog aus den Angeln und knallte gegen die Wand. Das löste ihre Erstarrung, und das Blut pulste ihr wieder durch die Adern. Der Herr war bei ihr, sie wußte es, und er gab ihr Kraft. Und so häßlich der Litauer ausschaute, mit Blut und Schmutz besudelt, er konnte sie nicht schrecken.
Skirgal aber erstarrte, als sich Anselma aufgerichtet hatte. Eine so schöne Frau war ihm noch nie begegnet. Fast wäre ihm das Schwert aus der Hand gerutscht, als sie mit festen Schritten auf ihn zutrat und zu sprechen begann.
»Ich weiß, warum du kommst, und ich bin dein, mit allem, was mein ist, nach dem Recht des Krieges. Nimm es, wenn du willst, du siehst, ich bin ein schwaches Weib und kann mich nicht verteidigen.« Anselma machte eine kleine Pause. »Aber wenn du es nimmst: was bleibt dir anderes als die Lust des Augenblicks? Wenn du mich fortschleppst, gehöre ich nicht mehr dir allein, sondern allen deinen Gesellen. Aber falls du verständig bist und den Handel eingehst, den ich dir vorschlage, so will ich dir etwas bieten, das dein Leben lang bleibt – und du wirst ein großer Krieger werden unter deinem Volke.«
Skirgal hörte es mit Verwunderung, denn so hatte er noch nie eine Frau sprechen hören. Es ging ein seltsamer Zauber von ihr aus, und warum sollte sie nicht ein Geheimnis kennen, das ihm bislang entgangen war? »Sprich weiter«, sagte er.
»Ich verfüge über magische Kräfte, und wenn ich sie gebrauche, kann kein Stahl mich treffen. Sonst stünde ich nicht hier, sondern wäre mit meinen Schwestern gefallen unten in der Kirche. Aber der Zauber wirkt nur, solange ich eine reine Jungfrau bin. Deshalb schone mich. Wenn du es tust, dann will ich dich an meinem Zauber teilhaben lassen und dir verraten, wie auch du unverwundbar wirst.«
Skirgal stierte sie an. Wilde Lust schoß in ihm auf, und alles drängte ihn, sie aufs Bett zu werfen und zu nehmen. Doch sein Ehrgeiz hielt ihn zurück. Wenn es stimmte, was sie sagte, konnte er vielleicht David von Grodno besiegen und selber Heerführer werden.
Anselma war sein Zögern nicht entgangen. Heilige Katharina, hilf mir, dachte sie, griff ihr Kruzifix, kniete vor dem Fremden nieder und fuhr dann fort: »Versuch es an mir selbst, ob mein Zauber wirkt. Siehe, ich knie vor dir nieder, und ich halte dieses Kruzifix in den Händen. Und wenn ich die Worte gesprochen habe, die ich dich lehren will, dann hebe dein scharfes Schwert und versuche, mich zu köpfen. Schlag ruhig zu mit aller Kraft. Du wirst sehen, kein Tropfen Blut wird fließen. Dabei trage ich doch keinen Panzer um den Hals, sondern sage nur die Worte: ›Meinen Geist, Herr, gebe ich in deine Hände.‹ Dieses allerdings in einer anderen Sprache. Warte nur …«
Skirgal, durchtrieben wie kein zweiter, sah den hellen Schimmer in Anselmas Augen, und er glaubte ihr.
»In manus tuas, domine, commendo spiritum meum.«
Da schlug der Litauer mit beiden Händen zu. Der Kopf der Schwester Anselma rollte ihm vor die Füße, und ein dicker Blutstrahl schoß hervor.
Als König Ludwig IV. der Bayer im Alten Hof zu München von diesen und ähnlichen Vorfällen Kenntnis erhielt, diktierte er seinem Schreiber eine Urkunde folgenden Inhalts:
O Jammer! Der, welcher sich jetzt in lügenhafter Weise Papst Johannes XXII. nennt, hat, was menschliche Ohren kaum zu vernehmen wagen, dem Ordensgebieter des deutschen Hauses der heiligen Maria in Preußen die Beobachtung eines Landfriedens mit den Ungläubigen an den Grenzen streng anbefohlen, damit sie zum Vorteil des christlichen Glaubens handeln, von welchem er in lügenhafter Weise vorschützt, daß er dessen augenscheinlichen Verfall wahrnehme. Wie viele Totschläge der Gläubigen sind durch diese gefährliche Erdichtung veranlaßt an wimmernden Kindern in der Wiege, an Männern und Weibern, die durch das Schwert der Ungläubigen niedergemetzelt wurden, wie viele sind zu ewiger Gefangenschaft fortgeführt, welch ein Wehklagen hat sich erhoben von Nonnen und gottgeweihten Jungfrauen, von Witwen und Ehefrauen, die mit auf den Rücken gebundenen Händen gewaltsam an Bäume gefesselt, genotzüchtigt wurden, welche Entweihungen wurden begangen an Kirchen und Sakramenten, besonders aber an dem köstlichsten und verehrungswürdigen heiligen Leibe Christi, den sie mit Lanzen durchstachen, in die Höhe hoben und Christo und allen Christgläubigen zum Ärgernis und zur Gotteslästerung ausriefen: Sehet hier den Gott der Christen! Wie ist die um ihre Söhne und Töchter klagende Mark Brandenburg mit Trauer und Jammer erfüllt! So hat sich dieser schändliche Verfolger gemacht zum Räuber der Familien, zum Verderber des Volkes, zum Totschläger der Söhne …
Vor dem Fenster spielten seine eigenen Söhne, Ludwig und Stephan, mit ihren Freunden, allen voran ihr Cousin Meinhard v.Attenweiler, der ihnen, zum Verdruß des Königs, an Geist und Körperkraft weit überlegen war. Die Aufsicht über die Knaben führte Margarete, die Tochter des Königs Christoph II. von Dänemark, die zehn Jahre älter war als Ludwig. Im Mai des Jahres 1323 hatte man Ludwig V., wie er im Hause Wittelsbach offiziell hieß, mit Margarete vermählt und mit der Markgrafschaft Brandenburg belehnt, die nach dem Tode des letzten Askaniers, des Markgrafen Waldemar, 1319 frei geworden war. Politische Kinderehen dieser Art waren so selten nicht, und Kaiser Ludwig verfolgte mit ihr die nördliche Erweiterung und Befestigung seines Herrschaftsbereichs. Für den achtjährigen Ludwig führte der Graf Berthold VII. von Henneberg die Geschäfte in der Mark Brandenburg, assistiert von einem juristisch gebildeten Rat. Doch das Geld, Brandenburg militärisch zu schützen, hatte Kaiser Ludwig nicht, auch hing sein Herz nicht an der Altmark, an der Prignitz, an der Uckermark, an der Herrschaft Ruppin und an der Terra Transoderana, der Neumark jenseits der Oder.
Kapitel 3
1325 – Terra Transoderana
Von der Oder her blies ein böiger Wind über das leicht gewellte Land und ließ die Mühlenflügel so schnell kreisen, daß Kerstian, der neue Müller, ängstlich nach oben blickte, ob das Gebälk wohl halten würde. Neben ihm auf einem ausgedienten Mahlstein saß der Dorfschulze und kaute an einem abgeknickten Roggenhalm.
»Wann wird denn Hochzeit sein?« fragte der Besucher.
Kerstian zuckte mit den Schultern. »Das hat wohl Zeit.«
Der Dorfschulze lachte. »Dir fällt die Auswahl schwer, was?«
Diese Frage wurde begleitet von einem Blick auf den etwas tiefer gelegenen Hof, wo drei Frauen geschäftig bei der Arbeit waren. Katharina Rehbock hängte Wäsche auf, während ihre beiden Töchter die Tiere fütterten. Adela, gerade fünfundzwanzig Jahre alt geworden, streute Körner für die Hühner, während Agnes, die jüngere Schwester, den Schweinetrog mit Kleie füllte. Denecken, der Knecht, schleppte derweil zentnerschwere Säcke zum Wagen des Schulzen.
Der gefiel sich weiterhin in der Rolle des lüsternen Kupplers. »So drall wie die Adela und die Agnes beide sind, da wüßte ich nicht, wen ich lieber unter meiner Daunendecke hätte. Aber dir geht’s ja wohl vor allem um die Mühle.«
»Die Katharina Rehbock kann ich nicht zur Frau nehmen. Was, wenn der Müller aus dem Heiligen Land zurückkommt?« gab Kerstian zu bedenken.
Der Dorfschulze winkte ab. »Gütiger Gott, seit sechs Jahren ist unser Jakob Rehbock nun verschwunden, der ist längst tot. Seine Gebeine bleichen da am Jordan oder irgendwo.«
»Ich weiß nicht recht.« Kerstian fehlte offenbar der Mut. »Solange sie nicht richtig Witwe ist …«
»Dann nimm die Adela.«
Wieder zögerte der neue Müller. »Nun … die ist so eigen und schweigt nur immer. Und andauernd ist sie am Beten.«
»Die hat’s vielleicht im Koppe hier, genau wie ihr Vater!« Der Dorfschulze faßte sich an den Kopf, um anzudeuten, daß er alle Jerusalempilger als Verrückte ansah. »Einfach so alles aufgeben hier, das ist doch …! Egal, ob man Bauer oder Müller ist.«
»Sag das nicht …« Kerstian setzte sich nun ebenfalls. »Was hast du denn hier? Als Kossät deine zehn Hühner, von denen du die Hälfte auch noch abzugeben hast an alle möglichen Herren. Sonst nur Knochenarbeit auf den Feldern. Aber an Korn ist nicht viel zu ernten. Das bißchen, was die Bauern mir zum Mahlen bringen …«
»Unser Herrgott hat sich etwas gedacht bei allem, was ist«, sagte der Dorfschulze, ohne daß er es so recht zu glauben schien. »Alle können leben davon.«
»Aber wie? Als Hüfner, mit zwei Hufen im Gewann, was hast du denn da? Dem Grundherrn mußt du seinen Zins entrichten, der Kirche den Zehnten und die Bede an den Markgrafen …«
»… sofern wir einen haben.«
»Die wachsen nach wie das Unkraut im Feld«, lachte Kerstian und sah zum Kloster hinüber. »Wie die Äbte da.« Er sah sich im Kreuzgang stehen, in einer Reihe mit den anderen, den Korb mit Eiern in der Hand, während der Bruder in der weißen Kutte mit ihm feilschte, ob die Gans, die er ihm gereicht hatte, fett genug war oder nicht. Alles wurde fein säuberlich in einer Kladde festgehalten. Und die feisten Herren Nichtstuer mästeten sich dann an dem, was er im Schweiße seines Angesichts gesät und geerntet, gezüchtet und geschlachtet hatte. Er hoffte jeden Winter, wenn der Schnee meterhoch lag und die Wölfe aus dem Weichselland kamen, daß sie diese unnütze Brut auffraßen bis zum letzten Mann.
»Ach ja«, begann nun auch der Schulze zu stöhnen, »es sind schlimme Zeiten angebrochen. Die Menschen werden immer weniger, und wer ist denn schließlich noch da, das Brot zu essen, für das wir hier auf unseren Feldern sorgen … und du mit deiner Mühle. Andererseits …«
Die beiden Männer schwiegen und ließen ihre Blicke zum Dorf hinübergehen. Das Gotteshaus, obwohl nur klein und aus Feldsteinen gebaut, überragte das Dorf. Um den Anger herum duckten sich die Häuser der Hüfner und Kossäten, ein wenig ärmlich allesamt, strohgedecktes Fachwerk aus Lehm und Weidengeflecht, Hufschmied und Krüger dazwischen. Der größte Hof gehörte selbstverständlich dem Schulzen, der seit kurzem auch die Zeidelei betrieb und aus seinen Bienenkörben schon so viel Honig erntete, daß sie sogar vom Kloster kamen, um danach zu fragen. Von der Schmiede drangen fröhliche Hammerschläge herauf.
»Wie auch immer«, brach Kerstian schließlich das Schweigen, »der Boden ist gut, und wir leben von ihm. Wir haben unsere Hochzeiten und Feste. Sieh nur die Kinder!«
Einige der Knaben waren heraufgekommen, hatten sich einen Besenstiel zwischen die Beine geklemmt und ritten damit um die Mühle herum. Hinter den Stützen kamen nun andere hervorgestürzt und spielten Bauern, die die Ritter überfielen.
»Das sollten sie lassen«, sagte der Schulze. »Die edlen Herren kennen da wenig Erbarmen.«
Die Mädchen spielten mit Puppen, die aus Stroh gebunden waren, würfelten mit Schweineknöchelchen oder versuchten, einen Reifen aus Schilfrohr zum Laufen zu bringen.
Die drei Frauen im Hof waren immer noch fleißig. Katharina Rehbock war dabei, ein Schaf zu scheren, während sich die beiden Schwestern um das Gemüsegärtchen kümmerten. Adela pflanzte Salat, Agnes zog Karotten aus dem Boden.
Der Dorfschulze hatte nicht lange Gefallen an dieser Idylle, sondern sah mit scharfem Auge zur Oder hin, wo vor einem kleinen Eichengehölz die beiden Schweinehirten auf dem Boden lagen. »Der Czaslaw und der Bucco sind wieder einmal auf der Jagd. Wenn sie das im Schloß erfahren, ist die Hölle los.«
Die beiden Schweinehirten waren bekannt dafür, daß sie Schlingen auslegten und dann mit einem gezähmten Frettchen die Kaninchen aus dem Bau und in die Schlingen trieben. Die Jagd aber, auch solche von geringem Wert, war dem Adel vorbehalten.
Der Dorfschulze sprang auf. »Die schnapp’ ich mir!«
Doch als er jetzt stand und ganz zufällig auch nach Osten blickte, verschlug es ihm die Sprache, denn über die Felder quoll es heran wie Jauche aus dem umgekippten Faß.
»Die Litauer!« schrie er. »Rette sich, wer kann!«
Katharina Rehbock hatte die Litauer nicht viel später als der Dorfschulze am Horizont erblickt. »Alle zur Mühle hoch, wir verschanzen uns!«
Kerstian und der Dorfschulze kamen indes vom Hügel heruntergerannt, während Denecken, der ungetreue Knecht, sich auf das Pferd des Schulzen warf, das ausgespannt am Trog gestanden hatte, und in Richtung Oder floh.
»Mutter, es hat keinen Sinn!« rief Adela. »Laß uns ebenfalls fliehen. Allein gegen ein ganzes Heer sind wir verloren.«
»Wir bleiben hier!« Mit der erhobenen Sense hinderte sie die anderen Knechte und Mägde, es dem Denecken gleichzutun.
Der Dorfschulze berechnete kühl, wo die Überlebenschancen größer waren. Auf dem Feld hetzten ihn die Litauer wie einen Hasen, in der festen Mühle aber konnten sie vielleicht die Stunden überstehen, bis Hilfe aus Bärwalde kam. Also beschloß er, wieder kehrtzumachen. Kerstian konnte nicht anders, als der Müllerin zu helfen. Sie hasteten den kleinen Hügel zur Mühle hinauf.
»Nehmt die Spieße!« Katharina Rehbock warf sie ihren Knechten zu. »Und Ihr, Schulze, und Ihr, Kerstian, klettert nach oben und schießt Bolzen aus den Löchern. Gott wird uns helfen gegen die Heiden.«
»Das ist Hochmut!« rief Adela. »Der Herr läßt sich zu nichts zwingen von uns.«
»Halt den Mund!« Katharina Rehbock stieß ihre älteste Tochter ins Innere der Mühle, wo sie gegen die Säcke fiel, die Denecken vergessen hatte, und zu Boden stürzte. »Du bist dasselbe schlappe Betweib wie dein Vater!«
Die Tür flog zu, und die Müllerin befahl den Knechten, Hölzer und Balken vorzulegen.
Da waren die ersten Litauer auch schon im Hof. Nicht mehr als zehn, und Adela hoffte schon, die anderen würden die Mühle links liegenlassen, um möglichst schnell über die Oder zu kommen und die reicheren Städte auf der anderen Seite heimzusuchen.
»Jeder nimmt sich einen vor«, wies Katharina Rehbock ihre Knechte an. »Von links nach rechts. Und mit der Armbrust auf den Anführer halten.«
Einige der Litauer wurden in der Tat getroffen, und alle rissen die Pferde herum. Erst unten am Weg kamen sie zum Stehen. Katharina Rehbock und ihre Tochter Agnes rissen eine Luke auf und verhöhnten sie mit kräftigen Worten.
Vitjanis, seit Skirgals Tod Unterführer der Litauer, rieb sich die Augen und stieß Mindaugas an, einen seiner Kameraden. »Du, was ist das für ein schönes Weib da in der Mühle!«
»Die muß ich haben!«
Inzwischen war auch David von Grodno, ihr bewährter Feldherr, an der Rehbockschen Mühle angekommen.
»Wer sie sich holt, der soll sie haben!« rief er seinen Männern zu.
»Sie haben Bolzen, Lanzen und Steine«, murrte einer der Reiter. »Und was ist denn da schon an Beute zu holen.«
»Dann steckt die Mühle an und räuchert sie aus!«
Und um den Reitern seinen Mut zu zeigen, ritt David von Grodno auf die Mühle zu, ohne sich um das zu kümmern, was ihm entgegenflog. Vitjanis wie Mindaugas zögerten nicht, ihn als Schild für sich zu nutzen und ihm bis zum Fuße der Mühle zu folgen. Beide blieben unverletzt. Die anderen setzten über die Mauer und stürmten in das Gehöft neben der Mühle. Schnell war Pech gefunden, und Fackeln flammten auf.
»Steckt die Tür in Brand und schleudert die Fackeln aufs Dach!« kam der Befehl. David von Grodno war wütend, daß sie hier so lange aufgehalten wurden. »Ihr Grab soll es werden!«
Bald waren die Eingeschlossenen von Rauch und Flammen eingehüllt, sie husteten und schrien, am schlimmsten aber wurde es, als das Gebälk auf sie niederzukrachen begann.
»Das schöne Weib!« rief Vitjanis. »So geht es mir verloren.«
»Mir auch!« Mindaugas setzte an, die Tür mit seiner Axt zu spalten. »Ich will sie retten.«
»Nein, ich!«
Vitjanis rang mit ihm, doch schließlich machten beide gemeinsame Sache und schafften es auch, sich hineinzukämpfen in die brennende Mühle und nach der Rehbock-Tochter zu suchen.
»Da sind sie!« Mindaugas riß den anderen mit. »An den Mühlsteinen da.«
Im dichten Qualm war die Mutter, die beiden Töchter an sich gepreßt, niedergesunken. Die Mägde waren allesamt erstickt und im Feuer verbrannt, während die Knechte, der Dorfschulze und Kerstian sich mit letzter Kraft den Weg ins Freie zu erkämpfen suchten. Vitjanis und Mindaugas wichen zur Seite und ließen sie vorbei.
Vitjanis zeigte auf die Rehbock-Töchter. »Du die eine, ich die andere.«
Als man ihr die beiden Töchter entriß, schlug auch Katharina Rehbock die Augen wieder auf, und die Angst um sie gab ihr die Kraft, auf den Knien ins Freie zu rutschen.
Das Bild, das sich Adela vor der Mühle bot, konnte schrecklicher nicht sein. Die Soldaten hatten Kerstian, den neuen Müller, den Dorfschulzen und die Knechte, so wie sie herausgetaumelt kamen, mit ihren Schwertern in Stücke gehauen. Als sie nun die drei Frauen erblickten, jubelten sie in Erwartung neuer Freuden.
Doch Vitjanis stieß sie zurück, als sie Agnes packen wollten.
»Die hier nicht, die gehört mir!« schrie er.
»Nein, mir!« Mindaugas versuchte, Agnes von ihm wegzureißen.
Die anderen grölten so laut, daß es bis zur Oder schallte. Bald waren Vitjanis und Mindaugas soweit, daß sie mit den Schwertern aufeinander losgingen. Agnes wurde inzwischen losgerissen von Mutter und Schwester und ein wenig abseits festgehalten.
David von Grodno sah dem Zweikampf um Agnes zu, bis seine beiden Soldaten drauf und dran waren, sich gegenseitig umzubringen.
»Aufhören!« brüllte er, und selbstverständlich gehorchten sie, denn er war ein Riese und ihnen überlegen in allem.
»Sie gehört mir, denn ich habe sie als erster gesehen!« rief Vitjanis.
»Nein mir!« fiel Mindaugas ein. »Denn ich habe sie in der brennenden Mühle als erster entdeckt.«
»Beim Perkunos, ich bringe jeden um, der sie mir wieder nehmen will!«
»Beim Pekollos, ich hacke dich in Stücke, wenn du sie mir nicht lassen willst!«
Sie machten Anstalten, wieder aufeinander loszugehen. Da riß David von Grodno das Schwert heraus und fuhr dazwischen. »Halt! Ich weiß genug. Beide seid ihr gute Kämpfer, und beide habt ihr gleiches Recht.«
Sie schauten ihren Feldherrn verdutzt an und konnten nicht begreifen, wie das denn gehen sollte. Doch ehe sie ihn fragen konnten, hatte er schon sein Schwert erhoben, und es sauste nieder auf Agnes.
»Vitjanis und Mindaugas, da: Nehmt jeder euren Teil!« rief er den beiden zu. »Besser ist es, ein Weib als zwei meiner besten Krieger zu entzweien!«
Kapitel 4
1325 – Berlin und Cölln
Leah fragte ihren Vater, ob das große Gebäude am Oderberger Tor ein Schloß sei, wo ein König drin wohne.
Baruch zögerte ein wenig mit der Antwort, da er sich unschlüssig war, was einer Fünfjährigen an Informationen alles zuzumuten war. »Nun … Man nennt es das Hohe Haus, und es wohnt kein König drin, sondern nur der Markgraf Ludwig. Wenn er denn mal da ist.«
»Warum ist er denn nicht da?«
»Eigentlich wohnt er weit weg von hier.«
»Da, wo wir herkommen?« fragte die Kleine.
»Nein, in München, in Bayern bei den Wittelsbachern.«
Leah wollte noch immer keine Ruhe geben. »Und hat der Markgraf Ludwig das große Haus gebaut?«
»Nein, das war der Markgraf Waldemar, der uns hier in Berlin aufgenommen hat. Dafür mußten wir aber sehr viel Geld bezahlen.«
»Warum denn?« bohrte Leah weiter.
»Damit uns die Gojim in Frieden lassen.«
Beide betrachteten den Bau, der aus Tempelhofer Backsteinen errichtet worden war und die Form eines nach vorn offenen Rechtecks hatte. Das Gebäude war vier Geschosse hoch und trug ein gewaltiges Dach, dessen Ecken mit runden Türmchen verziert waren. Der vergleichsweise schmale Innenhof war zur Straße hin von einer gut drei Mann hohen Mauer abgeschlossen, durch die aber ein breites Tor ins Innere führte. Wer hinein wollte, mußte unter dem Mauerbogen hindurch, den das Wappen des Landesherren schmückte, der rote Adler Brandenburgs. Im Inneren gab es neben vielen kleineren Räumen eine dreischiffige Halle mit zwei Säulenreihen, gotischen Spitzbögen und imposanten Deckengewölben.
»Da drinnen spricht der Markgraf mit dem Propst, mit dem Bürgermeister und den Ratsherren und manchmal auch mit seinen Rittern«, erklärte Baruch seiner Tochter.
»Darf ich da mal hinein?«
»Nein.«
Er war froh, daß er in diesem Moment – sie waren ein paar Schritte weitergegangen und inzwischen vor dem Franziskanerkloster angekommen – auf den Rabbi stieß, der von einer aufgeregten Frau von etwa vierzig Jahren geradezu angefallen wurde, der Rabbinerin selber.
»So ein Skandal! So eine Chuzpe! Der Badediener hat zuerst eine Hure ins Bad hineingelassen und mich erst danach. Und dies, obwohl ich noch vor ihr dagewesen bin.«
Der Rabbiner überlegte eine Weile, bevor er seiner Frau den Arm auf die Schulter legte. »Beruhig dich! Es ist dem Gesetz gemäß geschehen. Der Badediener ist im Recht. Denn auf die Dirne wartet die ganze Stadt und auf dich – nicht mal ich!«
Die Rabbinerin lief schimpfend davon, die beiden Männer lachten schallend, Leah stand verständnislos da. Auch dem, was die beiden Männer nun beredeten, konnte sie nicht folgen.
»Hast du was erreicht wegen des Judeneides?« fragte der Rabbi ihren Vater. Es war wirklich an der Zeit, mit der alten Vorschrift Schluß zu machen, daß Juden beim Schwören vor Gericht auf einer Sauhaut zu stehen hatten.
»Ich habe mit dem Rat gesprochen. Sie wollen gestatten, daß wir den Eid statt dessen auf das Buch Mose schwören, wenn ich ihnen billig Geld leihe.«
»Wozu?«
Baruch schmunzelte. »Sie wollen ein neues Freudenhaus aufmachen, nahe der Stadtmauer, in der Rosenstraße. Das hat sie überzeugt, daß das so nicht mehr geht mit dem Eid auf der Schweinehaut – ausgerechnet!«
Die beiden Männer lachten so herzhaft, daß sich zwei Tagelöhner aus der Spandauer Straße empört nach ihnen umdrehten.
»Dieses Wucherpack!« sagte der eine.
»Das Lachen wird ihnen schon vergehen, wenn wir ihnen die Buden ausräuchern«, fügte der andere hinzu.
Baruch nahm das nicht sonderlich ernst. »Wenn niemand mehr borgen will, borgt noch der Jude.«
»Und wie werden sie ihre Schuldscheine dann am leichtesten los?« gab der Rabbi zu bedenken.
Schweigend liefen sie die Brüderstraße hinunter, Leah zwischen ihnen in der Mitte.
»Gehen wir auf den Jahrmarkt heute?« Sie freute sich schon seit Wochen darauf.
»Ja …«
Drei Jahrmärkte hatte Berlin. Der erste wurde auf Lätare gehalten, das heißt, am dritten Sonntag vor Ostern, der dritte auf Kreuzerhöhung oder Crucis, am 14. September also, und der zweite dazwischen, acht Tage nach dem Fronleichnamsfeste beziehungsweise dreieinhalb Wochen nach Pfingsten. Das war in diesem Jahre der 13. Juni.
Auf dem Neuen Markt vor der Marienkirche schien an diesem Tage ganz Berlin zusammengeströmt, samt der Cöllner vom anderen Ufer der Spree. Aus den Schenken drang schon wüster Lärm, die Handwerksgesellen vertranken und verspielten wieder einmal ihren Lohn, so daß die Meister und die Ratsherren neue Unruhen heraufziehen sahen. Wohlhabende Stutzer stolzierten umher, schauten den Mägden nach und ließen die Glückswürfel rollen.
Dies alles nahm Leah mit großen, dunklen Augen auf. Die Händler mit ihren Ständen interessierten sie wenig, sie zog es zur Kirche, vor der die Spielleute, Akrobaten und Gaukler ihre Plätze hatten. Von weitem lockte schon ein etwa zehnjähriges Mädchen, das mit einem Fuß auf dem Kopf ihres Vaters stand und selber ein Äffchen auf dem Kopf sitzen hatte. Noch mehr aber bestaunte Leah den großen braunen Bären, der wie ein Mensch nach dem Takte tanzte, den sein Herr auf einem Tamburin schlug.
Plötzlich näherte sich vom Marienkirchhof her eine Schar von vielleicht zwanzig Männern, Frauen und Kindern. Viele humpelten und trugen dicke Verbände, und die meisten zeigten schreckliche Wunden. Sie weinten und schrien, flehten um Mitleid und hielten den Jahrmarktsbesuchern ihre Bettelnäpfe hin.
»Eine Kleinigkeit nur, wir verhungern sonst.«
Baruch sah den Rabbi verwundert an. »Was ist denn das?«
»Das sind die Leute, die vor den Litauern geflüchtet sind.«
Einer der Berliner, der Knochenhauer Balzer Brodowin, führte einen Mann am Arm, dem sie die Augen ausgestochen hatten. »Dies, ihr Leute, ist mein Vetter Heinrich aus Arnswalde. Er war ein Fleischer wie ich. Nun ist er blind. Gebt ihm reichlich!«
Mitleid erfüllte die Berliner, es kochte aber auch eine ungeheure Wut in ihnen hoch, vor allem gegen den Papst und die Kirche, die die Litauer und die Polen ins Land gerufen hatten, damit sie hier töteten, brandschatzten und schändeten, aber auch gegen die Wittelsbacher, die dieses nicht verhindert hatten.
In diesem Moment ging das Tor der Propstei von St. Marien auf, und heraustreten wollte der Propst von Bernau, Nikolaus, der gerade bei seinem Berliner Amtsbruder Eberhard zu Gast gewesen war.
»Der Pfaffe da ist schuld an allem!« schrie Balzer Brodowin.
Andere stimmten ein, denn es war allgemein bekannt, daß der Propst aus Bernau mit dem Bischof Stephan zu Lebus eng zusammenhing, und dieser, so sagte man, habe großen Anteil daran gehabt, daß die Feinde ins Land kamen.
Als der Propst Nikolaus nun Angst vor der Menge bekam, zog er sich schnell in die Berlinische Propstei zurück.
»Stecht ihn ab, das Schwein!« schrie einer derer, die den Litauerhorden entkommen waren. »So, wie die uns abgestochen haben.«
»Holt sie euch doch, die Bernauer Sau!« Balzer Brodowin riß einem der Händler eine Axt vom Tisch und rannte damit zur Propstei.
Mit Geschrei und Toben stürzte man ihm hinterher. Als der Berliner Propst nicht öffnen wollte, ließ man Balzer Brodowin die Tür in Stücke hauen, und als der das besorgt hatte, stürmte man hinein und suchte den Bernauer. Man fand ihn hinter Mehlsäcken versteckt und schleifte ihn nach draußen.
»Zum Marienkirchhof mit ihm, zu den Flüchtlingen, damit er mit eigenen Augen sieht, was er da angerichtet hat!«
Baruch nahm Leah, um mit ihr das Weite zu suchen, denn er ahnte, was geschehen würde. Beim Anblick des schrecklichen Flüchtlingslagers auf dem Friedhof wurde aus dem Zorn der Menge fanatischer Haß. Die ersten Steine prasselten auf den Propst nieder.
»Schlagt ihn tot wie einen räudigen Hund!« schrie Balzer Brodowin.
Nikolaus versuchte zu fliehen, kam ein paar Meter weit, wurde dann aber von Balzer Brodowin vorm Portal der Marienkirche niedergeschlagen und von der wütenden Menge zu Tode getrampelt.
»Verbrennt ihn auch noch auf dem Scheiterhaufen!« verlangten die, die draußen auf dem Markt geblieben waren und auch ihr Schauspiel wollten.
Man schleppte den Toten unter wütendem Geschrei auf den Neuen Markt, und von überall brachten die Leute Holz herangeschleppt. Balzer Brodowin und drei andere warfen den Propst auf den schnell errichteten Scheiterhaufen und verbrannten ihn unter dem Gejohle der Menge.
Als der Pfarrer Heinrich zu Eberswalde wenig später vom tragischen Schicksal seines Amtsbruders erfuhr, setzte er sofort ein Schreiben an den Papst auf, in dem er die himmelschreiende Missetat der Cöllner und Berliner schilderte und im Namen der beleidigten Kirche die schwerste Rache forderte. Der Papst verhängte dann – zusätzlich erzürnt, weil man am 21. September 1325 auch noch den Bischof Burchard von Magdeburg totgeschlagen hatte – den Bann über die Schwesterstädte an der Spree, die sich nun unter einem doppelten Interdikt befanden, einmal mit der ganzen Mark wegen der bayerischen Herrschaft und zum anderen wegen der Ermordung des bernauischen Propstes.
Balzer Brodowin kümmerte es wenig, was die Pfaffen machten, sein Vetter Heinrich aus Arnswalde aber war noch immer beschämt über das, was sich auf dem Neuen Markt ereignet hatte.
»Es war eine schreckliche Sünde, den Propst zu erschlagen.«
»Pilgere doch nach Jerusalem!« lachte Balzer Brodowin.
Kapitel 5
1335 – Jerusalem
Pater Marquardus, in brauner Franziskanerkutte, den weißen Strick als Gürtel um den mageren Leib gebunden, saß auf der Treppe zur Kapelle der Schwarzen Maria und las in der Bibel. Im ersten Brief des Paulus an die Korinther suchte er neue Zuversicht.
»Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft«, sprach er laut im schönsten Latein, daß es über den gepflasterten Vorplatz der Grabeskirche hallte, wo Bauarbeiter dabei waren, die seit langem zerstörte Anlage wiederherzurichten. Paulus hatte mit seinem Satz eigentlich das Fleisch gemeint, den irdischen Leib, Marquardus bezog es aber auf die ganze Christenheit und ihre derzeitige Rolle hier im Heiligen Land, die eine sehr schmähliche war. Es war eine lange Geschichte …
Am 27. November 1095 hatte in der südfranzösischen Stadt Clermont Papst Urban II. am Ende eines Konzils die Gläubigen in einer flammenden Rede zu bewegen versucht, Jerusalem und die gesamte Christenheit im Osten von muslimischer Herrschaft zu befreien. Und dann waren sie losgezogen, die miles christiani, die christlichen Ritter, um die Ungläubigen zu verjagen, um Länder zu erobern und Beute zu machen und das zu erhoffen, was der Papst ihnen immer wieder zugesichert hatte: daß ihnen im Jenseits die Strafen für alle Sünden erlassen würden.
Marquardus war klug genug, um zu wissen, daß sie nicht nur losgezogen waren, um das Wort des Herrn zu verkünden und friedliche Missionsarbeit zu leisten. Der erste Kreuzzug war auch ein voller Erfolg: Am 15. Juli 1099 wurde Jerusalem erstürmt, und es begann – Marquardus kannte die Berichte – ein solches Morden, daß die Christen bis zu den Knöcheln ihrer Füße im Blute der Feinde wateten. Im Anschluß daran kam es dann zur Gründung einer Reihe katholischer Staaten, so des Königreichs Jerusalem mit Gottfried von Bouillon als Herrscher, wohlhabender Städte wie Akkon, Tyrus und Antiochia und einflußreicher Handelsniederlassungen. Der Mangel an Siedlern aus Europa und damit an Kampfkraft wurde wettgemacht durch die Ritterorden, die in Nahost entstanden: die Templer vor allem und später dann der Deutsche Ritterorden. Doch mit Sultan Saladin kam die Wende; 1187 zwang er das christliche Jerusalem zur Kapitulation, und nachher konnten weder Kaiser Barbarossa noch Richard Löwenherz oder Ludwig der Heilige den Niedergang der Kreuzfahrerstaaten aufhalten. 1291 kam dann das Ende, die Muslime hatten auch die letzten Küstenfestungen der Christen – unter ihnen Akkon und Sidon – erobert.
Marquardus seufzte. Nun, wenigstens war es seinen Franziskanern 1333 gelungen, dem Sultan das Zugeständnis abzuringen, gemeinsam mit den Angehörigen der Orthodoxie und der Morgenländischen Kirche die Wacht an den Heiligen Stätten der Christenheit zu übernehmen und die nach Jerusalem kommenden Pilger angemessen zu betreuen. Ihm und seinen Brüdern hatten die Mamluken kürzlich auch erlaubt, einen Teil der Grabeskirche unter ihre Obhut zu nehmen. In Ausübung der Custodia terrae sanctae saß er also hier und hatte die Bauleute im Auge, die das Gemäuer über dem Eingang zur Johanneskapelle ausbessern sollten. Das war besser, als in der Werkstatt zu hocken und für die Pilger kleine Modelle der Grabeskirche zu basteln. Da hätte er auch zu Hause bleiben können als Schreiner beim Erzbischof in Magdeburg.
Einer der Männer auf den Gerüsten war ein Landsmann von ihm, der Müller Jakob Rehbock, und er nutzte jede freie Minute, um mit ihm zu reden. Rehbock hatte einige Zeit in Byzanz verbracht, war dort in den Bürgerkrieg hineingeraten, als sich Johannes Kantakuzenos zum Gegenkaiser ausgerufen hatte, und war dann eine Weile bei den Hesychasten zu Gast gewesen, einer mystischen Mönchsbewegung. Ein bißchen überspannt war er zwar, aber doch ein guter Kerl. Marquardus winkte ihm zu, und Rehbock kam auch, als sie eine kleine Pause machten, zu ihm herabgestiegen.
»Wie fühlst du dich als Maurer heute?« fragte Marquardus.
Rehbock lachte. »Ein Windmüller ist an Höhe gewöhnt. Oft hab ich an meiner Mühle die Flügel flicken müssen, wenn der Sturm allzu stark über die Oder hinweggefegt ist.«
»Das klingt nach Heimweh … Deine Frau, deine beiden Töchter, was werden sie machen?«
Rehbock setzte sich. »Ja … Katharina, Adela, Agnes … Vielleicht sollte ich heimkehren mit dem nächsten Pilgerzug.«
»Hast du denn das Geld für die Überfahrt beisammen?«
»Ja, und meine Pilgerampulle ist gefüllt mit dem Öl vom Holze des Lebens der heiligen Stätten.« Er wies auf das kleine Gefäß aus Blei und Zinn, das er, an einem Lederband befestigt, ständig bei sich trug.
Marquardus nickte. »Ein wertvolles Stück, es hat die Steine berührt, über die der Herr in seinen letzten Stunden geschritten ist.«
Rehbock sah zum Glockenturm hinauf. »Wenn mir doch nur der Herr ein Zeichen geben würde …«
»Wofür?«
»Ob ihm meine Buße genügt für all meine Sünden.«
»Nun …« Marquardus starrte auf seine Zehen, die ein wenig staubig aus den ausgetretenen Sandalen schauten, und rezitierte den 103. Psalm. »Der Herr handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, läßt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten.«
»Du meinst, es läßt sich nicht alles aufrechnen wie bei einem Krämer?«
»So ist es.«
»Und was soll ich tun?«
Wieder überlegte Marquardus eine Weile. »Wenn ihr beharret, werdet ihr euer Leben gewinnen. So steht es geschrieben im Lukasevangelium.«
Rehbock stand auf. »Ich danke dir, Bruder Marquardus. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich … Vielleicht will er, daß wir uns eines Tages wiedertreffen zwischen Elbe und Oder …«
»Sein Wille geschehe!«
Marquardus blickte dem Landsmann nach, der wieder zur Baustelle ging und vom Vorarbeiter angewiesen wurde, unter dem Gerüst in einer hölzernen Bütte Mörtel anzurühren.
Wie vorher abgesprochen, kam nun Bruder Ludovicus mit einer Pilgerschar von den Xenodochien, den Herbergen, zur Grabeskirche herauf und hatte den Cicerone zu spielen. Das Ganze konnte dauern, denn Hasan, der muslimische Türsteher vor der Grabeskirche, schien heute schlecht gelaunt zu sein, und auch die Beamten des Sultans, die an langen Tischen saßen, würden sich bei der Kontrolle der Papiere nicht übermäßig beeilen.
Marquardus begrüßte die Italiener, Spanier und Franzosen, die begierig waren, das Grab des Herrn in Augenschein zu nehmen, und hielt ihnen den gängigen Vortrag über die Geschichte Jerusalems und seiner Bauten.
»Hier hat Jesus Christus gelebt und das Reich Gottes verkündet, von hier hat er seine Jünger ausgesandt, um den wahren Glauben zu verkünden, überall in der Welt. Und hierher wird der Gottessohn zurückkehren am Jüngsten Tag, zu richten die Toten und die Lebenden. Bis dahin aber legt das leere Grab, das wir in Bälde sehen werden, Zeugnis ab von unser aller Hoffnung, an der Seite des Auferstandenen das ewige Leben zu schauen.« An dieser Stelle zitierte er jedesmal aus dem 21. Kapitel der Johannes-Offenbarung: »Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde vergingen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet wie eine geschmückte Braut ihrem Mann. Und er führte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederfahren aus dem Himmel von Gott, die hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, klar wie Kristall.«
Nach einer gebührenden Pause, die vom ehrfürchtigen Raunen der Pilger ausgefüllt wurde, kehrte er zu den historischen Fakten zurück. »Nach der Himmelfahrt Jesu blühte Jerusalem noch an die vierzig Jahre. Die Israeliten wurden derweilen von einer Reihe römischer Könige und ihrer Statthalter regiert, bis Titus kam, die Juden überfiel und massakrierte, die Stadt zerstörte und ihren Tempel wie ihre Bücher verbrannte. Auch das Heilige Grab fiel in der Folge der Zerstörung anheim und wurde erst im 4. Jahrhundert unter Kaiser Konstantin wieder ausgegraben, bis dann im Jahre 1009 die erneute Katastrophe nahte, denn Kalif Hakim ließ die Grabeskirche nicht nur plündern, sondern auch zerstören, die Basilika wie den Grabbau selbst. Der Felsen der Grabeshöhle wurde zerschlagen, von der Grabbank blieben nur Reste. Vieles aber ist seither geschehen – und seht daher mit Dankbarkeit das, was zu sehen ist: Der dreistöckige Turm links erhebt sich über der Kapelle der vierzig Märtyrer, rechts davon führt die Treppe zur Kapelle der Schwarzen Maria, und davor wiederum befinden sich die Eingänge zur Michaelis- und Johanniskapelle. Hinter dem Turm erblicken wir die Kuppel der Rotunde über der Grabkapelle. Wenn wir uns nachher im Innern der Grabeskirche befinden, dann …«
Ein gewaltiges Krachen unterbrach seinen Vortrag. Das Gerüst über dem Eingang zur Johanniskapelle war zusammengebrochen und hatte einige Arbeiter unter sich begraben. Aus der Staubwolke drangen ihre Schmerzensschreie.
Marquardus eilte zur Unglücksstelle, um Hilfe zu leisten. Einige waren glimpflich davongekommen und beklagten laut die Katastrophe, anderen aber hatten die schweren Balken Kopf und Glieder zerschmettert. Seine Sorge galt vor allem dem Landsmann aus der Mark Brandenburg. Als er Rehbock entdeckte, ließ er jede Hoffnung fahren. Sein Kopf war blutüberströmt, und links oben zeigte sich eine Wunde, als hätte ihn ein Schwerthieb getroffen. Schnell riß er seine Kutte auseinander, um Rehbock zu verbinden, dann rief er die Pilger herbei.
Sie brachten den Unglücklichen in ihr Hospital, wo er tief im Koma lag, zwei Wochen fast. Dann aber schlug er die Augen wieder auf. Sein Blick irrte umher, in Panik fuhr er hoch.
»Wer bin ich? Wo bin ich?«
»O mein Gott!« rief Ludovicus. »Er hat sein Gedächtnis verloren.«
»Der Balken, der ihm den Kopf zerschmettern wollte«, fügte Marquardus hinzu.
»Wer bin ich?« Diesmal kam es wie ein Schrei.
»Du bist der Müller Jakob Rehbock aus der Mark Brandenburg.«
»Jakob Rehbock …?«
»Ja.«
Marquardus glaubte nicht, daß er überleben würde. »Beten wir für ihn …« Er nahm sich vor, bei seiner Rückkehr in die Heimat Rehbocks Frau die traurige Nachricht zu überbringen.
Zweiter Teil Erlöse dieses Land
Kapitel 6
1348 – Brandenburg/Havel und Schloß Werbellin
Auf der Kanzel des Domes zu Brandenburg stand ein blasser Kapuzinermönch, und die hageren Arme, die aus den Ärmeln seiner Kutte fuhren, sahen aus wie die Krallen eines riesenhaften Geiers, der in den Lüften seine Beute packen wollte.
»Schmettere ihn zu Boden, allmächtiger Gott! Schlage ihn mit Blindheit und Raserei! Schleudere deine Blitze auf seinen Scheitel, daß die Erde unter seinen Füßen berste und der Abgrund ihn verschlinge! Verflucht sei er diesseits und jenseits, verflucht sein ganzes Geschlecht, verflucht Kind und Kindeskind in alle Ewigkeit! Amen!«
Die Gräfin Matilde, die schräg gegenüber der Kanzel auf dem Hochchor saß, zuckte zusammen. Das waren genau die Bannworte, die Papst Clemens VI. Ostern 1345 von Avignon aus wider Kaiser Ludwig, den Bayern, geschleudert hatte. Wenigstens in diesem Haß war sie sich einig mit dem Heiligen Vater. Sie stöhnte so laut auf, daß die Leute zu ihr herübergafften. Sie war keine von hier, und man hatte Grund genug, sich nach ihr umzudrehen, denn sie war eine ausnehmend schöne Frau, und ihr Mieder aus violettem Samt, mit goldenen Ketten und Spangen reich verziert, verschloß nur knapp die vollen Brüste. Doch wen ihre Blicke trafen, der zuckte zusammen, als hätte ihn ein Pfeil durchbohrt.
Allerdings war der Kapuzinermönch noch faszinierender als sie.
»Deine Hand, o Herr, ist stark!« eiferte er. »Und dein Atem ist ein Sturmwind, wenn du die Bösen vertilgst! Dein Blick ist ein Feuerstrahl, der Städte verschlingt, wenn du nur zürnst! So hast du denn auch Kaiser Ludwig gestraft, den Fürsten der Welt, der dem Fürsten der Ewigkeit die Stirn zu bieten wagte. Am 11. Oktober, im Jahre des Heils 1347, stürzte er in der Mittagsstunde in eine Schlucht und hauchte sein sündiges Leben aus!« Er machte eine kleine Pause und streckte dabei die Hände hoch aus, bis sie, so schien es, wie Flammen die Decke des Domes erreichten. »Wie lange aber willst du noch zaudern, Gott Zions, bis dein Gericht vollendet ist!?«
Die Donnerworte dröhnten durch die Gewölbe und ließen die Scheiben erzittern. Leichenblaß sah er aus, hatte schwarze Augen wie brennende Kohlen und ein Gesicht wie der Tod. Die zerlumpte braune Kutte schlotterte ihm um den Leib, als wäre darunter nichts als ein Gerippe verborgen. Er kam auf den Propst von Bernau zu sprechen, den die Berliner erschlagen hatten. Die Missetat lag zweiundzwanzig Jahre zurück, aber sie war unvergessen.
»Nun, du Herr Zebaoth, du warst langmütig, du ließest sie strafen durch Bann und Interdikt, daß sie zur Besinnung kämen. Oh, es ist schrecklich, wo die Glocken verstummen auf den Kirchen, als hörte Gottes Stimme auf, zu den Menschen zu sprechen. Durch die zerstörten Kirchen heult der Wind, in den verbrannten Klöstern nistet die Dohle, in den zerstörten Kapellen wuchert die Nessel. Scharen von Priestern ziehen barfuß, bettelnd und frierend durchs Land. Ist denn da kein Herr im Lande, der sich ihrer erbarmte!? Nein, keiner!« Er brach ab, denn draußen war ein Gewitter heraufgezogen, und der Regen setzte ein, als sollte es eine neue Sintflut geben. »Nun, Herr, so öffne denn die Schleusen, aber nicht nur Wasser gieße aus, denn das ist zu schwach, deine Feuerströme sende nieder, wegzubrennen die Schande und den Frevel in diesem Lande! Nichts soll bleiben denn Kohle und Asche von der Rotte Korah!«
Der Donner rollte mit höllischem Getöse, und der Wasserschwall schien die Scheiben einzudrücken. Die Frauen, die vorher nur geschluchzt hatten, schrien jetzt auf, und die Männer, die eben noch dagesessen hatten wie aus Erz und Stein, fingen an zu zittern.
Der Kapuziner aber riß in der wirren Verzückung seines Schmerzes händeringend die Arme in die Höhe. »O Herr, erbarme dich aber der wenigen, der Lämmer unter den Wölfen. Zeige ihnen den Engel auf einem weißen, leuchtenden Rosse, der sie führe zur Schlacht wider die Ketzer! Wie, unter den Lebendigen ist keiner!? So sollen deine Posaunen die Toten rufen! Blas sie lauter, Herr! Spreng die Todespforten! Öffne die Grüfte! Sende ihn zu uns, den Ersehnten, den Fürsten des Volks! Ich sehe ihn, Herr, durch die Schauer deiner Nächte, durch den Dunst der Gräber.« Er schloß die Augen, um selig zu empfangen, was der Himmel ihm gab. »Er regt sich. Jetzt, jetzt – krache, Tor des Grabes, hebe dich, Leichenstein!«
Drei, fünf, zehn Blitze zuckten zugleich, und durch alle Fenster flammte es im selben Augenblick. Ein grelles Licht ergoß sich in das Kirchenschiff. In alle Winkel drang es, auch hinter die Pfeiler. Und zugleich ließ ein Donnerschlag den Dom erbeben. Die Fenster klirrten, die Pfeiler zitterten, die Gewölbe bröckelten. Der Schlag, der niederfuhr, sausend, prasselnd, krachend, konnte hundert Türen aus den Angeln heben, hundert Grabgewölbe sprengen, hundert Leichensteine zur Seite wälzen. Während die Gläubigen zur Erde sanken, reckte sich der Mönch im Triumph hoch auf.
»Der Mann, der uns erlösen wird, ist da!«
Das Schloß Werbellin lag mit seinen Mauern, Türmen und Gräben am Südwestende des gleichnamigen Sees und machte auch im Frühjahr 1348 einen durchaus friedvollen Eindruck, doch im Hofe standen die Rüstwagen, und die Reisigen versorgten die Pferde. Unter erheblicher Bedeckung hatten sich, von der Gräfin Matilde herbeigerufen, Rudolf von Sachsen, Albrecht von Anhalt und Bernard von Plötzke hier eingefunden, geeint von ihrer Feindschaft zum Markgrafen Ludwig, um die Lage zu beraten.
Hundert Kerzen leuchteten, in den Kaminen glimmten die Kohlen. Die Geiger und Pfeifer spielten leise in der hinteren Ecke des Saales.
Es stand nicht eben gut um die Chancen der Sachsen und Anhaltiner, die Nachfolge der Askanier anzutreten, deren Linie mit dem kinderlosen Waldemar ausgestorben war.
»Ludwig wird stärker und stärker«, sagte die Gräfin Matilde. »Wir müssen ihn irgendwie beiseite schaffen.«
Rudolf von Sachsen, Reichserzmarschall und ein Ehrenmann von untadeligem Charakter, mißbilligte diese Sprache mit einem leichten Runzeln der Stirn, obwohl er in der Sache derselben Meinung war. Ihm war bekannt, weshalb Matildes Haß auf Ludwig so grenzenlos war, und das entschuldigte sie: Der junge Markgraf aus Bayern war ihre große Liebe gewesen, und ihre Leidenschaft hatte alles gesprengt, was ihm bis dato begegnet war, doch Ludwig hatte sie verschmäht und statt ihrer im Jahre 1342 in Meran auf Geheiß seines Vaters eine andere Frau geheiratet, Margarete Maultasch, die Erbin Tirols.
»Die Sache ist verfahren«, befand auch Albrecht, Graf zu Anhalt. Er galt überall als rechtschaffener und tüchtiger Fürst, der den Frieden liebte, aber wenn es darum ging, die Bayern wieder aus Brandenburg hinauszudrängen, dann war er allemal dabei.
Rudolf von Sachsen, der wenig redete, aber dafür um so mehr aß, stöhnte auf. »Wenn es doch bloß damals mit diesem Knäblein geklappt hätte.«
Er meinte Heinrich zu Sangerhausen, den zehnjährigen Vetter Waldemars, einen Sohn des 1318 verstorbenen Markgrafen Heinrich von Landsberg. Er war zwar nach allgemeiner Auffassung der rechtmäßige Anwärter auf die Mark Brandenburg, doch war es notwendig, ihm einen Vormund zu geben. Um diese Vormundschaft kämpften, indem sie sich den Jungen wechselseitig streitig machten, die Herzöge Wratislaw IV. von Pommern-Wolgast und eben Rudolf von Sachsen. Doch Heinrich machte beiden einen Strich durch die Rechnung: Er starb schon im Sommer 1320.
Bernard von Plötzke lachte auf. »Hätte sich eben einer von euch rechtzeitig auf die Agnes werfen sollen.«
Markgräfin Agnes, die Witwe Waldemars und nächste Erbin seiner Lande, war aber sehr schnell, schon Ende 1319, die Ehe mit dem Herzog Otto von Braunschweig eingegangen – nicht zuletzt, um sich ihres rechtlichen Vormunds zu entledigen, der kein anderer war als wiederum Rudolf von Sachsen.
»Was dich nicht abgehalten hat, dir gleich die halbe Mark Brandenburg unter den Nagel zu reißen«, fügte Albrecht mit einem schnellen Seitenblick auf Rudolf hinzu, als dies erörtert wurde. »Zauche, Havelland, Teltow, Barnim und später auch die Niederlausitz.«
»Die Stände haben mich gerufen – und zu dieser Zeit hat sich Heinrich in meinem Hause aufgehalten.«
»Alle haben sich ihr Stück vom großen Kuchen abschneiden wollen …« Gräfin Matilde schloß den Rückblick ab, indem sie auf den Herzog Heinrich II. von Mecklenburg verwies, der sich der Prignitz bemächtigt hatte, auf die Herzöge von Pommern, die in die Uckermark eingefallen waren, und die schlesischen Herzöge, die sich das Land Lebus sowie Sagan, Grossen und Züllichau genommen hatten, während die Altmark über Agnes an Herzog Otto von Braunschweig und die Lande Görlitz und Bautzen an den König von Böhmen gefallen waren. »Bis euch dann allen der Wittelsbacher Einhalt geboten hat.«
Anfang 1324