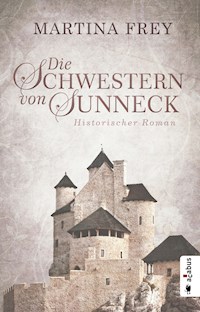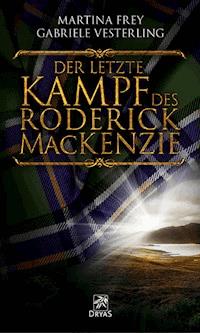
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Schottland 1743. Roderick MacKenzie, der Sohn eines Goldschmieds aus Edinburgh, bereitet sich darauf vor, die Werkstatt seines Vaters zu übernehmen. Die politischen Auseinandersetzungen um die Krone Großbritanniens zwischen König Georg und dem Hause Stuart kümmern ihn wenig. Eines Abends entkommt er jedoch knapp einem Überfall und lernt dabei Jonathan McGillivray kennen. Dieser öffnet ihm die Augen für die politischen Verhältnisse und Roderick beginnt, an seinen bisherigen Zielen und Vorstellungen zu zweifeln. Der Roman beruht auf der Biografie des Roderick MacKenzie, Doppelgänger und Leibwächter von Prinz Charles Stuart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lament for Culloden
The lovely lass o’ Inverness, Nae joy nor pleasure can she see; For e’en to morn she cries, “Alas!” And aye the saut tear blin’s her e’e:
“Drumossie moor — Drumossie day — A waefu’ day it was to me! For there I lost my father dear, My father dear, and brethren three.”
”Their winding-sheet the bluidy clay, Their graves are growin’ green to see; And by them lies the dearest lad That ever blest a woman’s e’e!”
“Now wae to thee, thou cruel lord, A bluidy man I trow thou be; For mony a heart thou has made sair
Kapitel 1
Edinburgh, Frühling 1742
Es musste etwas Wichtiges sein, da sein Vater ihn selten zu solch später Stunde zu sich rief. Seine Schritte wirkten unsicher. Roderick MacKenzie fragte sich nicht das erste Mal, warum Vater ihn zu sich rief. Zumeist wurden die Kinder nur zu ihm zitiert, wenn sie etwas angestellt hatten. Doch die letzten Tage waren ruhig gewesen. Roderick konnte sich nicht erinnern, etwas getan zu haben, was den Unmut des Vaters heraufbeschworen hätte. Seinen beiden Schwestern gegenüber hatte er sich anständig benommen, die Wünsche der Mutter erfüllt. Auch im Geschäft versuchte er den Ansprüchen Vaters gerecht zu werden. Was gab es so Wichtiges? Das Geschäft des Goldschmiedes lag auf der Vorderseite des Hauses, in der Gray’s Close. Einer Straße, in der am Tage reges Treiben herrschte. Nun, zur Dämmerung, kehrte Ruhe ein. Selten fuhr eine Kutsche über die Pflastersteine. Wegen des heftigen Regens waren kaum Fußgänger unterwegs. Roderick blieb vor der Tür stehen. Sie war mit einem Riegel versperrt, den sein Vater hatte anbringen lassen. Reine Vorsichtsmaßnahme. Die Furcht vor Überfällen war zu dieser Zeit allgegenwärtig. Gerade das Geschäft eines Goldschmiedes konnte in den Mittelpunkt räuberischer Aufmerksamkeit geraten. Roderick starrte auf die Tür, als befände sich dahinter ein Gericht, das ihn zum Tode verurteilen würde. Seine Befürchtungen waren lächerlich, überlegte er und begann sich zu ärgern. Warum dachte er nur, er würde von seinem Vater bestraft werden? Roderick seufzte. Wenn er weiter zögerte, würde er nicht herausfinden, was der wahre Grund für sein Kommen war. Er gab sich einen Ruck und klopfte an, bevor er die Tür öffnete. Rodericks Augen gewöhnten sich rasch an das dämmerige Licht. Vater saß an einem großen Tisch. Eine Öllampe brannte. Der Rest des Raumes lag im Dunkeln. Wider Erwarten lächelte Kenneth MacKenzie. Ein Zwicker klemmte auf dem Nasenrücken, tief genug, um einen kritischen Blick über die Gläser werfen zu können. Er hob eine Hand und zeigte auf einen Stuhl. Roderick folgte dem Wink. Ihm fiel sofort das Schmuckstück auf, das auf dem Arbeitstisch lag. Ein wertvolles Geschmeide, ohne Zweifel. „Du hast dich beeilt, gut, gut“, sagte Kenneth MacKenzie zufrieden. „Mutter sagte, es sei dringend, also habe ich keine Zeit vergeudet.“ „Setz dich, mein Sohn, ich muss mit dir reden.“ Er gehorchte, erkannte an dem Verhalten seines Vaters, dass dieser ihm nicht zürnte. Dafür kannten sie sich zu gut. Das Verhältnis zwischen ihnen war freundschaftlich, gar kameradschaftlich. Roderick teilte die Liebe zum Handwerk mit seinem Vater, genauso wie beide in ihrem Handeln bedacht waren. So sehr sie sich in ihrer Gesinnung glichen, so verschieden waren sie sich äußerlich. Kenneth MacKenzie war mager und machte einen gebrechlichen Eindruck, obwohl er mit seinen dreiundvierzig Jahren nicht zu den Greisen zählte. Sein Sohn dagegen entwickelte eine sehnige Figur, die sich im Laufe seines Alters noch kräftigen würde. Das hellbraune Haar des Vaters, das einzelne graue Strähnen aufwies, ähnelte kaum dem blonden Schopf des Jüngeren. Die blauen Augen allerdings hatten Vater und Sohn gemein. Ein Blau, das dem Frühlingshimmel glich und in dem bisweilen, sternengleich, Lichtpunkte funkelten. Roderick platzte fast vor Neugier. Er wusste, er würde sich gedulden müssen, denn es war ungehörig, den Vater auszufragen. Es blieb ihm nichts anderes übrig als zu warten. Kenneth machte nicht den Eindruck, sofort auf den Punkt dieses Gespräches zu kommen. Im Gegenteil. Ihn schien etwas anderes zu beschäftigen. Das Zucken seiner Lippen deutete ein Lächeln an. Er nahm den Zwicker ab und legte ihn bedächtig vor sich hin. Es war, als vertiefte er sich in Erinnerungen. „Manches Mal kommt es mir vor, als hätte ich eine Weile geschlafen und jetzt wache ich auf und sehe, meine Kinder sind erwachsen.“ Roderick grinste. „Willst du mir jetzt sagen, ich solle mich wieder in einen kleinen Bub verwandeln und dir Streiche spielen?“ Das Lachen des Vaters erfüllte den kleinen, ausgekühlten Raum. „Wenn es ginge, ich würde darüber nachdenken. Aber mir genügt, wenn ich mich an jene Streiche erinnere. Zum Beispiel, als du und deine Schwester mir diese nasse Ratte gebracht habt, die ihr vor dem Ertrinken retten musstet.“ „Das war kein Streich, Vater, das war ein Notfall. Alice hat darauf bestanden, sie zu dir zu bringen.“ „Was ich sagen will ist, dass ihr so schnell groß werdet. Besonders an dir merke ich das, Roderick. Ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, dir zu sagen, wie stolz ich auf dich bin. Du hast deine Ausbildung bei mir tadellos bestanden, bist gewissenhaft und tüchtig. Mit deinen zwanzig Jahren bist du ein stattlicher junger Mann geworden und …“ „Vater, bitte …“ Der verlegene Tadel in Rodericks Stimme schien dem Älteren aufzufallen, denn Kenneth hielt mit seiner Lobesrede inne. „Und du bist in deiner Bescheidenheit nicht zu übertreffen. Aber im Ernst. Es erfüllt mich mit Freude, weiß ich doch, dass du mein Geschäft eines Tages in meinem Sinne fortführen wirst.“ Rodericks Gesicht veränderte sich kaum, als er sich vorbeugte. „Das werde ich.“ Es kam ihm so einfach über die Lippen, und er wusste nicht einmal, ob er es ernst meinte. Er dachte oft darüber nach, was er nach der Ausbildung zum Goldschmied tun sollte. Nicht, dass er die Hoffnung seines Vaters zerstören wollte. Im Geschäft seines Vaters mitzuarbeiten war der einfachste Weg. Dennoch verspürte Roderick hin und wieder den Wunsch, etwas anderes mit seinem Leben anzufangen. Er wusste nicht was, daher sprach er nicht darüber. Seinen Vater zu enttäuschen war das Letzte, was er wollte. „Natürlich habe ich dich nicht rufen lassen, um dich mit Komplimenten zu überhäufen.“ „Aha“, dachte Roderick, „er kommt endlich zum Punkt.“ „Ich habe einen Auftrag für dich, mein Sohn. Einen wichtigen Auftrag.“ Der Mann setzte seinen Zwicker wieder auf die Nase und hob die Kette an, welche vor ihm lag. Die Edelsteine, die in den Goldfassungen vertieft waren, blitzten im Licht der Öllampe. Kenneth reichte seinem Sohn das Schmuckstück. „Daran habe ich seit Tagen gearbeitet.“ Roderick begutachtete die Kette, erkannte die feine Arbeit auf den ersten Blick. Er hatte lange Zeit seinem Vater bei solchen Handfertigkeiten zugesehen. „Das ist ein wertvolles Gepränge.“ „Sehr wertvoll, Sohn. Da ich heute wichtige Geschäfte erledigen muss, sollst du die Kette bei dem Kunden abgeben. Er will sie noch heute haben. Der Preis ist sogar schon bezahlt. Guter Mann.“ Roderick erinnerte sich, dass sein Vater die letzte Zeit bis spät in die Nacht an einem Auftrag gearbeitet hatte. Da das Goldschmiedegeschäft zurzeit nicht gut lief, war es wichtig, die Kunden zufrieden zu stellen. Er gab das Gepränge zurück und Kenneth ließ es in einen Beutel gleiten. „Bringe es zu dieser Adresse.“ Er zeigte auf einen Zettel. „Gib es direkt der Herrin des Hauses, verstehst du? Dies ist ein wertvolles Stück.“ Roderick wollte aufstehen. „Und riskiere nichts“, warnte Kenneth seinen Sohn. „Die Straßen sind nicht sicher, schon gar nicht zu solch später Stunde.“ „Mach dir keine Sorgen, ich werde dich nicht enttäuschen.“ Roderick fühlte sich so wichtig wie noch nie, als er durch die Straßen lief. Er spürte den Schmuck in seiner Tasche, wie ein Gewicht, das ihn zu Boden zu ziehen versuchte. Eine große Verantwortung, die sein Vater ihm auferlegte. Was, wenn er nun überfallen wurde? Er hatte keine Waffe bei sich. Davon abgesehen, hatte der Vater ihn in Buchhaltung unterrichtet und in anderen Dingen, jedoch nicht im Kampf. Hätte er eine Waffe besessen, sie hätte ihm nicht viel genutzt. Roderick blickte sich um, die Hand lag an seiner Jackentasche, schützend an der Ausbeulung. Um zu der genannten Adresse zu gelangen, war es kein weiter Weg durch Edinburgh. Er hätte sein Pferd nehmen können, doch er hatte sich entschieden zu Fuß zu gehen. Nun fand er diese Entscheidung nicht mehr so gut. Als er in eine Straße einbog, die dunkel vor ihm lag, verließ ihn der Mut. Zwei betrunkene Männer torkelten ihm entgegen. Sie lallten etwas, das Roderick nicht verstand. Er wechselte auf die andere Seite, um nicht mit ihnen zusammenzustoßen. Als er um eine Ecke huschen wollte, erkannte er aus dem Augenwinkel die Besoffenen, die ihm folgten. Seine Schritte wurden immer schneller. Schließlich eilte er an den Häuserreihen entlang, bis er zum King’s Garden kam, durch den er tagsüber gerne ritt. In der Nacht erschien er ihm düster und gefährlich. Roderick vernahm hinter sich keine Schritte mehr und wurde langsamer. Sein Herz pochte aufgeregt in seiner Brust. Er holte so schwer Atem, als wäre es der letzte Zug, den er tat. Angst schnürte ihm die Kehle zu. Obwohl er sich einen Narren schalt für seinen Verfolgungswahn, war er doch verunsichert. Plötzlich knackte hinter ihm ein Ast. Roderick fuhr herum. Der Schlag riss ihn von den Beinen. Unsanft landete er auf dem durchgeweichten Boden des Parks. Die Bäume ließen kaum Licht auf den Weg fallen. Die nächste Straßenlaterne war weit entfernt. „Gib uns, was du hast, Bursche und wir lassen dich leben.“ Die rauchige Stimme klang nicht danach, als würde der Mann lange zögern, ihm den Schädel einzuschlagen. Roderick richtete sich auf, sah zwei Gestalten über sich. Ihre Gesichter waren in der Dunkelheit kaum zu erkennen. Doch es mussten die beiden Betrunkenen sein, die ihn verfolgt hatten. Nun machten sie keinen berauschten Eindruck mehr. Roderick versuchte seine Stimme so ruhig wie möglich klingen zu lassen, obwohl die Aufregung ihm fast die Kehle zuschnürte. „Wenn ich Euch sage, dass ich nichts habe, würdet Ihr mir das glauben?“ Einer der Kerle lachte heiser. Er beugte sich zu seinem Kumpan. „Jetzt hör dir den mal an.“ Dann sah er auf Roderick „Ne, würden wir nich. Hast feine Kleidung an, gehst nachts im Park spazieren. Gib uns deinen Geldbeutel.“ Roderick fuhr sich nervös mit der Zunge über die Lippen. Er sah sich verstohlen um, als könnte er abwägen, in welche Richtung er besser entkommen könnte. Doch die Kerle waren zu aufmerksam und wahrscheinlich bewaffnet. Sie sahen nicht aus, als hätten sie ein Gewissen. Roderick krallte seine Finger in den feuchten Dreck. Es gab keine Chance ihnen zu entkommen. „Jetzt mach schon, Bürschchen, oder glaubst du, wir verbringen den ganzen Abend mit dir?“ Roderick hob rasch eine schmutzige Hand, um in seine Jacke zu greifen und die Geldbörse herauszuholen, in der sich zwei Silberpennies befanden. Nicht genug, um die Diebe zufriedenzustellen, vermutete er. Die Aufregung vergrößerte sich, als er den Geldbeutel anhob. Wenn sie ihn durchsuchten, würden sie das Schmuckstück finden. Wahrscheinlicher war noch, dass diese Kerle ihn erst töten und danach untersuchen würden. In seinem Kopf jagten sich die Gedanken. Das Gewicht in seiner Tasche schien schwerer zu werden. Unwillkürlich drückte Roderick die andere Hand auf das wertvolle Gepränge, schützend, entschlossen. Er würde es niemals herausgeben. Er würde das Vertrauen seines Vaters nicht enttäuschen. Niemals! Roderick blieb keine Zeit mehr über eine Flucht nachzudenken. „Her damit!“ Einer der Männer beugte sich zu Roderick und riss ihm den Geldbeutel aus der Hand. Gierig öffneten sie ihn und hoben die Köpfe. „Das is doch nich dein Ernst?“ „Ich sagte schon, ich habe nicht viel“, entgegnete Roderick. „Ja, ja, die Zeiten sind hart, wir kennen den Spruch. Jetzt geht’s dir an den Kragen, Bürschchen.“ Der Kerl trat nach Roderick, packte ihn im Nacken und schlug zu. Der Schmerz fuhr über sein gesamtes Gesicht. Roderick schüttelte das Schwindelgefühl ab. Er versuchte die nächsten Angriffe abzuwehren. Er verdammte sich dafür, keine Waffe bei sich zu haben, mit der er sich hätte verteidigen können. Mit aller Mühe kam Roderick auf die Beine. Schmerzen zogen über sein Gesicht. Er taumelte einige Schritte zurück. Die beiden Männer zerrten an seiner Kleidung. Roderick erkannte mit Schrecken, dass einer versuchte in seine Taschen zu greifen. Er schlug um sich. Irgendwie gelang es ihm, sich zu befreien, dann rannte er los. Er musste fort, schoss es ihm durch den Kopf. Fliehen war besser, als sich von diesen üblen Gesellen weiter verprügeln zu lassen. So hechtete er durch den Park, während er die Schritte hinter sich hörte. Die Kerle waren flink und holten ihn rasch ein. Als etwas an seiner Jacke zog, wusste Roderick, dass seine Flucht zu Ende war. Seine Verfolger hatten ihn eingeholt. Sein Inneres schien zu brennen. Die Anstrengung schnürte ihm fast die Kehle zu. Es ging um sein Leben, das wusste er. Roderick holte aus, rammte dem einen die Faust in den Magen und wurde von dem anderen geradewegs zu Boden gerissen. Er schlug mit dem Kopf auf dem lehmigen Boden auf. Alles drehte sich vor seinen Augen. Nur verschwommen erkannte er die Gestalt vor sich und versuchte nach ihr zu treten. Der Angreifer schien von den kläglichen Versuchen der Abwehr nicht sonderlich beeindruckt zu sein, sondern beugte sich zu ihm und schlug auf ihn ein. Vor Roderick verschwamm der Blick, während er versuchte, sich loszureißen und Luft zu holen, erfolglos. Plötzlich knallte ein Schuss. Roderick zuckte zusammen, als sei er getroffen worden. Er wartete auf den Schmerz, irgendwo an seinem Körper. Doch er spürte nichts. Sein Widersacher fuhr auf und lockerte den Würgegriff. „Und nun Gentlemen, würde mich interessieren, welcher Sportart ihr nachgeht.“ Die Stimme klang spöttisch. „Ich könnte mir vorstellen, dass es in den Kerkern der Rotröcke nicht sehr bequem ist. Also schlage ich vor, ihr verschwindet so schnell wie möglich.“ „Scher dich zum Teufel“, zischte Rodericks Gegner und erhob sich, um sich auf den Störenfried zu stürzen. Der fackelte nicht lange und schoss mit einer zweiten Pistole dem Mann ins Bein. Dieser heulte vor Schmerzen auf. Sein Kumpel eilte zu ihm, um ihn zu stützen. „Ich empfehle euch dringend zu verschwinden, ehe ich die Geduld verliere.“ Diese Warnung war unmissverständlich. Die beiden Kerle verschwendeten keine weiteren Worte und flohen durch den Park. Roderick atmete tief durch und richtete sich auf. Sein Gesicht brannte, er schmeckte Blut von seiner aufgeplatzten Lippe. Und sein Magen schien sich jeden Augenblick entleeren zu wollen. Der Fremde rührte sich nicht vom Fleck, sondern deutete mit seiner Pistole auf ihn. „Erheb dich oder macht es dir Spaß im Dreck zu liegen, Junge?“ Irgendetwas Bedrohliches lag an diesem Fremden und ließ Roderick weiterhin auf dem aufgeweichten Boden verharren. Nur langsam wurde ihm klar, dass er wahrscheinlich gerade dem Tod entronnen war. „Wollt Ihr mich ebenfalls überfallen?“ „Ich überfalle keine Schotten.“ Er lud seine Waffen nach, steckte sie an seinen Gürtel und trat zu Roderick, der sich langsam erhoben hatte. „Mein Name ist Jonathan. Klingt recht englisch, nicht wahr? Aber ich bin mehr Schotte als manch anderer mit schottischem Namen.“ Roderick starrte den Mann an, als benutzte er eine ihm völlig fremde Sprache. Noch war er zu verwirrt über das Geschehene. Der Schreck saß ihm in den Gliedern. Er fühlte sich wie ein kleines Kind, hilflos, eingeschüchtert. Er klopfte sich die feuchten Dreckklumpen von seiner Kleidung und widmete sich schließlich dem Fremden, der ihn geduldig beobachtete. Vor ihm stand ein großer, kräftiger Mann. Er war in Kilt und Plaid gekleidet, dem man, wäre es heller gewesen, die Hand eines Meisters angesehen hätte. Als der Mann näher kam, konnte er die Farben erkennen. Der Grundton war rot, durchwebt mit Grün und Blau. Dazu trug er derbe Schuhe, denen man ansah, dass sie schon einige Meilen zurückgelegt hatten. Seine kräftigen Waden steckten in dunklen Strümpfen und am Oberkörper trug der Fremde ein derbes Wollhemd in der gleichen Farbe. Das Gesicht des Mannes lag in der Dunkelheit verborgen, so dass Roderick nicht mehr an ihm erkennen konnte als einen Bart, der sich um den Mund kräuselte. „Ich danke Euch für Eure Hilfe.“ „Kein Ursache.“ Roderick bewunderte die Ruhe des Mannes, der eben noch mit seinen Waffen zwei Männer bedroht hatte, als würde er das jeden Tag tun. Irgendwie wurde Roderick das Gefühl nicht los, dieser Mann hätte nicht gezögert, die Halunken zu erschießen. Der Fremde wandte sich ab und machte Anstalten zu gehen. „Wartet doch.“ Roderick biss sich auf die Lippen, als ein stechender Schmerz durch seinen Oberkörper zuckte. Seine Rippen schmerzten. Während er dem Mann nacheilte, leckte er sich das Blut von der aufgeplatzten Lippe. „Mein Name ist Roderick MacKenzie. Ihr habt mir das Leben gerettet, wie kann ich mich bei Euch bedanken?“ „Jonathan MacGillivray hilft gerne und erwartet nichts von dir.“ „Was tut Ihr des Nachts in den Gassen?“ „Das Gleiche könnte ich dich fragen, Junge. Du solltest zu solch später Stunde nicht durch den Park gehen.“ „Er war eine Abkürzung.“ „Eine Abkürzung in den Tod. Geh lieber nach Hause.“ „Ich habe ein …“ Roderick biss sich auf die Zunge und erkannte mit Schrecken, dass er beinahe diesem Fremden verraten hätte, was er in seiner Tasche versteckt hielt. „Ich erledige einen Auftrag meines Vaters und Ihr, Sir?“ Jonathan MacGillivray musterte ihn zunächst, als dachte er über eine Antwort nach. „Wir sind uns ähnlich. Ich erledige auch einen Auftrag.“ Der Ältere lachte und schlug Roderick auf die Schulter. Sein Blick wurde aufmerksamer. Es schien ihm an dem Burschen etwas aufzufallen, denn für einen kurzen Augenblick leuchteten seine Augen auf. „Geh und erledige deinen Auftrag. Wenn du fertig bist, kannst du dich bei mir bedanken. Komm zum „Sailor’s Rest“ und spendier mir einen Whisky. Dann unterhalten wir uns etwas.“ Er wartete nicht auf eine Antwort, sondern schlenderte davon. Roderick hätte sich gerne gleich bei dem Fremden erkenntlich gezeigt, da er nicht wusste, über was er sich mit ihm unterhalten sollte, doch er fand keine Gelegenheit dazu. „Seltsamer Kauz.“ Der Abdruck auf seinem Hals schmerzte und seine Kleidung sah ramponiert aus, doch in der Dunkelheit war kaum etwas zu erkennen. So eilte Roderick weiter. Den Weg durch den Park würde er ab jetzt meiden. Ohne weitere Zwischenfälle erreichte er die Anschrift. Die Kundin, der er das Schmuckstück überreichte, war überglücklich und steckte ihm etwas Kleingeld für seine Mühe zu. Roderick verspürte eine tiefe Erleichterung, als er seinen Auftrag erledigt hatte. Ohne das Schmuckstück in seiner Tasche war auch dieses Gewicht von ihm genommen. Roderick sah die verlassene Straße entlang, die sich, nach einem Wolkenbruch, in einen kleinen Bach verwandelt hatte. Der erdrückende Geruch des Regens hing als Dunst zwischen den Häusern. Eine Kutsche fuhr an ihm vorbei. Wasser spritzte auf und traf Rodericks Beine. Als er den Heimweg einschlug, fiel ihm sein Retter aus dem Park ein. Im Grunde war er ihm wirklich dankbar, doch dieses Sailor’s Rest war ihm unbekannt und lag in einer fragwürdigen Gegend von Edinburgh, wo er eher die beiden Diebe wiedertreffen würde, als diesen Jonathan MacGillivray. Und doch war da die Neugier, die Roderick plötzlich zum Stehen brachte. Wer war dieser Mann, der ihn mit solcher Gelassenheit gerettet hatte? Immerhin hätte er auch einfach weitergehen und Roderick seinem Schicksal überlassen können. Er hatte es nicht getan. Er spazierte in der Dunkelheit durch einen Park, trug Waffen bei sich und schien keinerlei Skrupel zu haben, sie auf Fremde zu richten. Das Mindeste, was Roderick tun konnte, war, diesem Mann einen Drink auszugeben und sich mit ihm zu unterhalten. Also ging er nicht nach Hause, sondern schlug einen anderen Weg ein. Er wanderte über den großen Platz, auf dem Markt abgehalten und Hinrichtungen vollzogen wurden. Zu dieser späten Stunde war wenig los. Pärchen, die spazieren gingen, dunkle Gestalten, die vorüber huschten. Einen von ihnen hielt Roderick an, fragte nach seinem Ziel und hatte Glück. Der Weg war nicht weit und wurde ihm so gut beschrieben, dass er nach kurzer Zeit vor der Kaschemme stand, in einer anrüchigen Gegend, wie er vermutet hatte. Er sah sich lauernd um, hatte das Gefühl, jemand würde ihn beobachten. Er hatte diese Gegend noch nie aufgesucht, da ihn sein Vater vor den finsteren Gestalten warnte. Unnützes Gesindel, nannte er sie. Roderick öffnete die Tür, über der das Namensschild der Schenke hing und trat in einen spärlich erleuchteten Raum. Hitze schlug ihm entgegen, gemischt mit dem Dunst von Alkohol und Schweiß. Der Raum war erfüllt von Stimmen und Gelächter, dem Klirren von Gläsern. Die Tische waren alle besetzt und an der Theke drängten sich weitere Gäste. Viele von ihnen sahen nicht aus, als gingen sie rechtmäßigen Geschäften nach. In dieser Menge schien es Roderick unmöglich, jenen besagten Fremden zu finden. Ein eindringliches Gefühl riet ihm, so rasch wie möglich diesen anrüchigen Ort zu verlassen. „Sieh an, mein junger Freund aus dem Park.“ Roderick sah in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Einerseits war er froh, Jonathan MacGillivray zu sehen, andererseits hatte er sich gerade vorgenommen, nach Hause zu gehen. Das war jetzt unmöglich. Dass ausgerechnet ein Mann wie Jonathan dort verweilte, wunderte ihn nicht. Und irgendwie passte er in diese verrauchte, nach Whisky stinkende Kaschemme. Dieser Kerl war nichts weiter als ein nichtsnutziger Halunke, der eben mal ein großzügiges Herz zeigte und an diesem Abend eine gönnerhafte Tat vollbrachte. Roderick ging widerwillig auf die Theke zu, von der aus ihm zugewinkt wurde. Vor Jonathan stand ein Glas mit Whisky und eine Schale mit Wasser. Roderick wunderte sich darüber, bezweifelte, dass Jonathan sich die Hände darin waschen wollte. „Komm und trink mit mir ein gutes Wässerchen.“ Das Lallen zeugte von einigen Gläsern Whisky und der Blick war nicht mehr so zielsicher, wie es sich Roderick erhoffte. Jonathan MacGillivray machte nicht den Eindruck, als könnte er sich noch lange auf den Beinen halten. Nun konnte Roderick das Gesicht besser betrachten, obwohl die Hälfte davon unter einem Bart verborgen blieb. Dunkle Augen lagen eingebettet in Falten, während das Haar strähnig um seinen Kopf lag. „Was ziehst du für ein Gesicht? Hier, trink, dann versuch mal zu lächeln, Junge.“ Jonathan schob ihm ein Glas zu. Roderick zögerte, schüttete die Flüssigkeit in sich hinein und verschluckte sich an dem scharfen Getränk. Er hustete widerwillig. „Das weckt ja Tote auf.“, murmelte er mit krächzender Stimme und ärgerte sich über dieses Gesöff, das hier Whisky genannt wurde. Das war eher eine Beleidigung, dachte Roderick und schüttelte sich noch einmal. Dabei spürte er, wie der Schluck in seiner Kehle zu stecken schien, als brannte er sich einen Weg durch sein Inneres. „Man merkt dir an, dass du ein Lowlander bist, Junge. Bist reichlich verweichlicht.“ „Mein Name ist Roderick und nicht Junge und ich sehe nichts Schlechtes darin, ein Lowlander zu sein. Und verweichlicht bin ich auch nicht.“ Jonathan starrte auf sein Glas, in dem wieder die goldene Flüssigkeit schwappte. „Es lebe der König …“ Als er diesen Toast aussprach, hielt er sein Glas feierlich über die mit Wasser gefüllte Schale, dann stürzte er den Inhalt mit einem Schluck hinunter. Als der Mann absetzte, knallte das Glas hart auf den Tisch, als wollte er es zum Bersten bringen. „Ich möchte mich noch einmal bedanken, Mister …“, setzte Roderick an und starrte verwirrt auf die Schale mit Wasser. „Jonathan, nenn mich ruhig Jonathan“, lallte der Mann und griente schief. „Ich hätte großen Ärger bekommen, hättet Ihr mir nicht geholfen.“ „Du wärst tot, Junge. Aber wir helfen einander. Egal ob Highlander oder Lowlander, wir alle sind Schotten. Nur leider vergessen wir das manchmal.“ Jonathans Stimme hatte einen besinnlichen Klang angenommen. „Wie meint Ihr das?“ „Ich meine, dass wir nicht so einen Ärger hätten, wenn wir uns früher mal einig gewesen wären.“ „Von welchem Ärger sprecht Ihr?“ Jonathan hob seinen Kopf und starrte ihn so verblüfft an, dass Roderick sich fragte, ob er hätte lieber den Mund halten sollen. Doch der Mann sprach in Rätseln. „Welchen Ärger? Bist du blind, Junge? Siehst du nicht, was vorgeht?“ Roderick schob seine Unterlippe vor und dachte nach. Er machte ein solch ahnungsloses Gesicht, dass Jonathan darüber den Kopf schüttelte. Er nahm sein aufgefülltes Glas und trank. „Du bist blind oder fühlst dich wohl mit diesem Leben“, vermutete er schließlich. „Es geht niemanden wirklich gut, aber …“ Roderick wusste nicht, was ihm sein Gegenüber sagen wollte. Der Mann beugte sich vor. Der Geruch des Alkohols schob sich in Rodericks Nase und begann darin zu kitzeln. „Sie hocken da oben in der Festung und überlegen sich jeden Tag, wie sie weiter drangsalieren können. Und so geht das weiter und niemand tut etwas dagegen.“ „Sir?“ Roderick war wirklich verwirrt. „Nichts da Sir.“ Jonathan winkte mürrisch ab. „Du verstehst es nicht, nicht wahr?“ Roderick war so ehrlich und schüttelte den Kopf. Er verstand den Mann tatsächlich nicht, da dessen beträchtlicher Alkoholkonsum den nördlichen Dialekt verstärkte; MacGillivray stammte eindeutig nicht aus dieser Gegend, sondern aus den Highlands. Der Mann starrte ihn plötzlich an, als hätte er ihn vorher noch nie gesehen. „Blondes Haar, blaue Augen … du erinnerst mich an jemanden, Junge.“ „So, an wen?“ Jonathan schien darüber nachzudenken. Plötzlich sackte sein Kopf immer weiter nach vorne, bis er mit der Stirn auf der Tischkante aufkam. Der leichte Aufprall zeigte Roderick, dass der Mann nicht mehr so schnell aufwachen, geschweige denn nüchtern werden würde, um ihm zu erzählen, an wen er ihn erinnerte. Trotzdem schüttelte er an dessen Schultern. „Jonathan?“ „Der wacht so schnell nicht mehr auf. Der hat für heut genug“, sagte einer der Männer, der gerade an die Theke kam und grinsend Rodericks Versuche beobachtete. „Wenn Jonathan in der Stadt ist, gibt er sich hier die Vollen. Morgen früh steht er wieder stramm, als sei nie was gewesen, steigt auf sein Schiff und fährt zu diesen verdammten Franzosen.“ Roderick sah den Mann skeptisch an und fragte sich, woher er das alles wusste. Gleichzeitig dachte er darüber nach, ob er Jonathan hier sitzen lassen oder ob er sich um ihn kümmern sollte. „Was tut er in Frankreich?“ Roderick ärgerte sich über seine eigene Neugier. Der Mann lachte, holte zwei gefüllte Whiskygläser und drehte sich um, als wollte er Rodericks Frage nicht beantworten. Doch dann sagte er über die Schulter: „Das soll dir Jonathan besser unter vier Augen erzählen. Hier ist nicht der rechte Ort dafür.“ Jonathan kam also öfters hierher, und sein jetziger Zustand war nichts Ungewöhnliches. Roderick konnte ihn beruhigt zurücklassen. Jonathan wusste sicher, wohin er musste, sobald er aufwachte. Plötzlich ertönte ein Stöhnen und der Kopf des Mannes hob sich leicht an. Erst sah er aus, als erwachte er. „Du siehst ihm verdammt ähnlich, Junge.“, nuschelte er. Dann fiel der Kopf mit einem dumpfen Schlag auf die Tischplatte zurück. Roderick seufzte. Er konnte diesen Mann in seinem Zustand nicht hier sitzen lassen. Er hatte ihn vor diesen Verbrechern gerettet, nun musste sich Roderick erkenntlich zeigen. Er nahm den Mann bei den Schultern, hievte ihn von seinem Platz. Es war mühseliger, als er gehofft hatte und strebte den Ausgang der Schenke an. Da fiel ihm etwas ein. Roderick blieb stehen, wandte sich um und suchte den Raum ab, nach dem Mann, der vorhin mit ihm gesprochen hatte. Er entdeckte ihn in einer Ecke und schleppte sich zu ihm. „Kennt Ihr sein Quartier, Sir?“ Der Mann hob den Kopf und nannte ihm eine Adresse. Von der Straße hatte Roderick noch nie etwas gehört und diese Gegend war ihm nicht geheuer. Noch weniger, da er sich bewusst wurde, wie wenig er sich verteidigen konnte, besonders mit einer Whiskyleiche auf den Schultern, die immer schwerer wurde. Roderick irrte stolpernd durch düstere Gassen. Die Suche erwies sich als mühselig und nicht nur einmal verfluchte sich Roderick für seine Anteilnahme. Schließlich fand er die Straße sowie die Unterkunft seines bewusstlosen Begleiters. Er fragte nach dem Zimmer und war froh, in dem Quartier seines betrunkenen Begleiters angekommen zu sein, ohne von seltsamen Gestalten behelligt zu werden. Er ließ Jonathan auf sein Bett nieder, zog ihm widerwillig die Schuhe aus und wollte ihn seiner Jacke entledigen, als er auf einige Beutel stieß. Er hielt erstaunt inne. Die Lederbörsen waren an dem Gürtel der Hose gebunden. Es klimperte darin. Roderick konnte seine Neugier nicht bezwingen und öffnete einen der Beutel. Gold- und Silberstücke fielen ihm entgegen. Er starrte auf die schimmernden Münzen und wusste nicht, was er davon halten sollte. Woher hatte Jonathan MacGillivray so viel Geld? Hatte er es gestohlen? Jonathan war ein gewöhnlicher Dieb? Warum hatte er dann nicht ihn, Roderick, ausgeraubt? Er hätte einen guten Fang gemacht. Roderick war froh, diesem Fremden nicht mehr von sich erzählt zu haben, schon gar nicht davon, dass sein Vater Goldschmied war. Er fand diesen Mann eigenartiger denn je. Er hätte ihm gerne einige Fragen gestellt. Leider ließ dessen Zustand keine Fragen zu. Also beschloss Roderick nach Hause zu gehen und diesen Zwischenfall zu vergessen.Roderick erzählte seinem Vater weder von dem Überfall, noch von Jonathan und dessen gestohlenen Geldbeuteln. Es war besser, niemand erfuhr davon. Doch auch Tage danach ließ ihn dieser Zwischenfall nicht zur Ruhe kommen. Er musste sich eingestehen, wie hilflos er sich während des Überfalls gefühlt hatte. Es war beschämend. Da musste ein Fremder kommen, ein Dieb, der ihm das Leben rettete. Ein Halunke, ein Betrüger. Was sonst sollte Jonathan MacGillivray sein? Dieser Mann bewegte sich in Kreisen, in die kein rechtschaffener Mann geraten wollte. Und wenn man zu den Franzosen segelte, konnte man auch keine anständige Arbeit haben. Auf einen solchen Retter war Roderick angewiesen. Das war erbärmlich, dachte er ärgerlich. In Gedanken versunken überquerte er den Marktplatz und beobachtete geistesabwesend das Treiben der Menschen um sich. Er sollte für seine Mutter einige Dinge auf dem Markt besorgen. Nun bemerkte er, wie sich Schaulustige um einen Redner versammelten. Seine Stimme klang eindringlich und weckte in ihm Neugier. Der Mann stand beim Brunnen. Er trug einen zerschlissenen Kilt, sein Bart war so lang wie sein Haar. Auch wenn nur wenige Zuhörer bei ihm verharrten, schien er Wichtiges sagen zu wollen. „Hört mich an. Ich sage euch, es ist falsch, dass dort in London einer aus dem Hause Hannover sitzt. Es gibt einen rechtmäßigen König.“ Roderick blieb stehen. „Und wo ist denn dein wahrer König?“, rief ein Mann im Vorübergehen. „Er macht es sich irgendwo auf dem Festland bequem und lässt es sich gut gehen. Und sein Söhnchen hockt bei Ludwig XV. von Frankreich auf dessen Schoß, während wir hier schuften und hungern müssen. Die Stuarts kümmert es doch nicht, wie es uns geht.“ „Die Engländer haben das Gesetz erschaffen, dass kein Katholik mehr auf den Thron kommen darf. Die Stuarts haben nicht freiwillig ihr Land verlassen. Aber sie gehören hierher“, widersprach ein anderer. Eine Frau hob ihre Hand und fuchtelte damit in der Luft herum. „Ihr bringt uns alle noch in Verruf mit euren Reden. Die Stuarts gehören nicht mehr hierher. Sollen sie bleiben wo sie sind.“ „Richtig, immer wenn sie kamen, brachten sie Unheil mit“, rief ein anderer und ging weiter. Ein Mann blieb stehen. „Aber das, was wir jetzt haben, ist auch kein Leben. Als wir vor einigen Jahren alle die Menschen aus dem Gefängnis geholt haben, die die Engländer hineinwarfen, nur weil sie ihre Steuern nicht zahlen konnten? Ich wünscht mir, es würde sich endlich etwas ändern. Die Engländer bringen uns nichts Gutes.“ „Damals hätte uns auch kein Stuart helfen können“, erwiderte die Frau, winkte ab und ging weiter. Ein Mann verharrte vor dem Jakobiten. „Und wann helfen uns die Stuarts gegen diese Engländer? Wann werden sie sie endlich von dem Schloss da oben verjagen?“ Der Jakobit wusste eine Antwort: „Der rechte Augenblick wird kommen, dann werden sie den Thron erobern. Sie werden uns von den englischen Fesseln befreien. Und ich sage, dann wird es den Schotten wieder gut gehen. Nur ein Stuart kann die protestantischen Herrscher von ihrem Thron verdrängen. Wir sollten ihnen beistehen und helfen.“ Roderick ging weiter, als er Soldaten in roten Uniformen auf sich zukommen sah. Sie strebten auf den Redner zu und nahmen ihn mit. Er wehrte sich lauthals und äußerte sich empört darüber, seinen Vortrag abbrechen zu müssen. Am Ende rief er ein „Gott schütze den König“, und Roderick ahnte, dass dieser Mann nicht Georg II. meinte.Roderick ging an der alten Burg vorbei. Ein graues, altes Gemäuer, das seit langer Zeit diese Stadt überragte. Hier wurde damals James IV. geboren, der Sohn der schönen schottischen Königin Mary Stuart. Sie war eine stolze und mutige Frau gewesen. Den Tod vor Augen hatte sie von ihrer Cousine Elizabeth I. verlangt, dass ihr Sohn James, nach Elizabeths Ableben, König über Großbritannien werden sollte. Die kinderlose englische Königin hatte damals diesem Wunsch zugestimmt. So wurde aus James IV. von Schottland James I. von Großbritannien. Roderick kannte die Geschichten. Das Blut, das in all der Zeit vergossen worden war, hatte nichts gebracht, außer Tränen und Leid. Nichts hatte sich verändert im Streben nach Freiheit und Wohlstand. Kein Stuart hatte das bewirken können. Und kein anderer König. Roderick hob den Blick. Die Festung hatte sich im Laufe der Zeit zu einem bedrohlichen Schatten verwandelt. Auf dem höchsten Turm flatterte die englische Fahne im Wind. Unwillkürlich musste Roderick an diesen Jakobiten auf dem Marktplatz denken, und an seine Worte. Er hatte die Herrschaft des jetzigen Königs und die Anwesenheit seiner Armee in diesem Land in Frage gestellt. Seit Roderick denken konnte, waren sie in dieser Festung. Nie hatte er einen Gedanken daran verschwendet, es könnte anders sein.Kapitel 2
Loch Ussie, Nähe Castle Leod, Highlands
Elisabeth hatte die Schüssel am Brunnen ausgewaschen und richtete sich auf. Der frische Abendwind fuhr durch ihr Haar und es war ihr, als spielte eine Hand mit ihren dunklen Locken. Ihre spitze Nase hatte sich gerötet und stach aus dem schmalen blassen Gesicht hervor. Elisabeth strich mit dem Handrücken eine ihrer vorwitzigen Locken aus der Stirn. Müde sah sie an sich herab. Mutter wird wieder schimpfen, wenn sie meine Sachen sieht, dachte sie bei sich. Der blaue Rock und die weiße Bluse waren mit Schmutzflecken übersät, die von einem arbeitsreichen Tag herrührten. Elisabeth schloss ihre braunen Augen und atmete die kühle Frühlingsluft ein. Für einen Augenblick genoss sie die Ruhe. Am Tag war es angenehm warm gewesen. Die Sonne war erst gegen Abend hinter dicken Gewitterwolken verschwunden. Ein heftiger Regenschauer war über das Land gezogen und hatte den Boden aufgeweicht. Ihr fröstelte, während sie den Wolken zusah, wie sie im Dämmerlicht über sie hinweg zogen. Ihr Blick schweifte über den Hof und das Haus, aus dem die Stimmen ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester drangen. Ein Zaun umgab die Pferde und die Kühe in der Nähe. Dahinter erstreckten sich leicht gewundene Hügel, die sich in die Landschaft schmiegten. Ein Stück weiter wiegte sich der Wald im Wind. Er trug das Rauschen und den Duft von Blüten und frischem Gras zu ihr. Sie war froh, dass der Winter hinter ihnen lag und die Natur aus ihrem Schlaf erwachte. Die Hügel würden bald in einem kräftigen Grün erstrahlen und ließen das Land freundlicher aussehen. Die Zeit kam, in der sich Elisabeth jeden Tag draußen aufhalten, sich um ihr Pferd kümmern und durch den Wald galoppieren konnte. „Elisabeth? Träumst du? Du solltest doch nur eine Schüssel abwaschen.“ Die Stimme der Mutter riss Elisabeth aus ihrer Geistesabwesenheit. Rasch nahm sie die Schüssel und eilte auf das Haus zu. Ein Pferd wieherte. Sie drehte den Kopf zur Seite und wusste, dass es keines von ihren war. „Ich glaube, wir bekommen Besuch“, rief sie ins Haus. Ihre drei Jahre jüngere Schwester Cathleen kam heraus geeilt. Ihr kindliches Gesicht strahlte. „Vielleicht ist es Calum.“ Elisabeth schüttelte den Kopf. „Nein, Dummchen, der kommt sicher nicht zu solch später Stunde. Gehen wir lieber ins Haus.“ Sie nahm die schmale Hand des Mädchens und zog es mit sich. Von der Feuerstelle verbreitete sich wohlige Wärme und ließ in kurzer Zeit ihr Gesicht glühen, während sie sich neugierig über den Kochtopf beugte. Der Vater erhob sich von dem Tisch und zwinkerte seiner Ältesten zu. „Mal sehen, wer uns beehrt.“ Elisabeth ließ ihre Schwester los, stellte die Schüssel auf den Tisch ab und folgte ihrem Vater bis zur Tür. Während er hinaustrat, blieb sie stehen und spähte ihm nach. „Es ist unhöflich an der Tür zu stehen, so neugierig“, schalt sie die Mutter mit liebevoller Stimme. Der Bauch, der sich unter dem weiten Kleid hervor wölbte, zeigte deutlich ihren Zustand. Es dauerte nicht mehr lange, bis die Familie Zuwachs bekam. „Ich weiß, Mama.“ „Warum stehst du dann noch hier?“ Cathleen verharrte neben ihr und folgte ihrem Blick. Elisabeth erkannte fünf Reiter, die, vom Osten herkommend, hinter der Einzäunung auftauchten. Drei der Reiter steckten in roten Uniformen. Elisabeth wirbelte herum und starrte erschrocken ihre Mutter an. „Es ist Jacob Grant.“ Der Name löste selbst bei ihrer Mutter Grauen aus. „Mein Gott, was will er hier?“ Sie bekreuzigte sich und trat zu ihren Töchtern. Nun standen sie zu dritt an der Tür und sahen hinaus. Alan Kynach stand ungerührt vor dem Haus. Der Wind, der den Duft des Waldes mitbrachte, fuhr durch das längere Haar des Mannes, bauschte das dreckige Arbeitshemd auf und ließ den Kilt wallen. Alan wirkte auch selbst dann noch gelassen, als er erkannte, wer dort auf ihn zuritt. Die roten Uniformen der Soldaten stachen aus der grünen Landschaft, wie Mohnblumen aus einer Wiese. Elisabeth hielt den Atem an, als die Männer näher kamen. Der Anblick allein genügte, um Unwohlsein bei den Bewohnern dieses Hofes aufkommen zu lassen. Diese Engländer brachten nichts Gutes mit. Noch nie! Der Anführer der kleinen Gruppe war ihr bekannt. Jakob Grant zählte nicht zu den gerngesehenen Gästen, obwohl er der Lord Sheriff war. Die Soldaten, die ihm folgten, musterte sie nicht weiter, nur die zwei Männer in dunklen Umhängen erweckten ihre Aufmerksamkeit. Sie hielten sich im Hintergrund, beobachteten die Umgebung, als erwarteten sie einen Überfall. Ihrer Kleidung nach zu urteilen, waren sie von wohlhabender Herkunft. Die weißen Perücken boten keinen Kontrast zu den blassen Gesichtern. Ihre Röcke unter den Umhängen waren nach der neuesten Mode weit geschnitten. Die Rockschöße standen leicht ab und die Ärmelumschläge waren groß. Darunter trugen sie eine Weste, die oben mit Knöpfen verschlossen war und unten offen stand. Die dunklen Hosen wurden unter dem Knie von einer Seidenschleife gehalten. Die Beine steckten in derben Bauwollstrümpfen, den „derby-ribs“, die Füße in feinen Lederschuhen mit abgerundeter Spitze und einer großen silbernen Schnalle. Elisabeths Übelkeit verstärkte sich, als die Reiter ihren Vater erreicht hatten und abstiegen. Niemals waren diese Menschen gekommen, um Erfreuliches zu verkünden. Stets stellten sie Fragen, misstrauten ihnen, durchsuchten ihr Heim und verwüsteten den Hof. Sie machten sich einen Spaß daraus, andere einzuschüchtern. Etwas in Elisabeth ließ sie zweifeln, dass es diesmal anders sein würde. „Seid gegrüßt, Leutnant Grant“, hörte sie ihren Vater sagen. Der Mann zügelte sein Pferd vor Alan. „Wozu die Höflichkeit? Ich bin nicht hier, um mit Euch Tee zu trinken“, zischte Jacob Grant, nicht ohne seine Abscheu für sein Gegenüber zu zeigen. „Ihr seid ein Verräter an der Krone und daher kaum einer Höflichkeit wert.“ „Sir?“ Die versteinerten Gesichter der Männer blieben unverändert. Die beiden Fremden in ihren langen Umhängen beobachteten Alan Kynach in lauernder Haltung. Leutnant Grant ärgerte sich sichtlich über die Tatsache, wieder das Wort ergreifen zu müssen. „Ihr beherbergt Jakobiten unter Eurem Dach und ich weiß das.“ „Nun, es tut mir leid, doch ich lebe hier mit meiner Familie allein.“ „Ich habe dieses Spiel langsam satt. Ihr und Euer Clanführer, ihr seid selbst Jakobiten. Ihr seid alle Verräter.“ Einer der Männer im Umhang stieg von seinem Pferd ab und trat auf Alan zu. „Wir suchen einen Mann. Wir haben gehört, Ihr würdet ihn kennen und wissen, wo er sich aufhält. Oder vielleicht verweilt er zufällig hier? Jonathan MacGillivray ist sein Name.“ Wie der Fremde sprach, war er aus dem Süden. Ein Lowlander, vermutete Elisabeth und sah ihren Vater den Kopf schütteln. „Da kann ich Euch nicht behilflich sein. Ich kenne diesen Mann nicht.“ „Ihr wurdet mit diesem Mann gesehen. Wollt Ihr mich zum Narren halten?“, fuhr einer der beiden Fremden ungehalten auf. „Ich kenne gewiss keinen Jakobiten und ich beherberge auch keinen“, widersprach Alan, ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen. „Er wird auf der gesamten Insel gesucht. Er wird des Hochverrates beschuldigt und jeder, der ihm hilft, wird ebenfalls vom Gesetz verfolgt. Ihr wisst das!“ „Sicher, und da ich Familie habe, tue ich nichts, was sie gefährden könnte.“ Der Lowlander drehte sich voller Ingrimm zu dem Leutnant, der mit gelassener Ruhe die stille Frage entgegennahm. „Seht Ihr, ich sagte schon, dass es schwierig wird“, sagte Grant mit gelangweilter Arroganz. Der Mann, der Alan angesprochen hatte, schob seinen Umhang zur Seite und holte mit einer Hand aus. Der Fausthieb traf, ließ sein Gegenüber torkeln. Elisabeth zuckte zusammen. „Übrigens seid Ihr verhaftet, Alan Kynach. Wegen Verrats und Unterstützung der Jakobiten!“, fügte Grant mit einem süffisanten Lächeln hinzu. Selbstgefällig gab er ein Zeichen. Seine beiden Soldaten zündeten daraufhin Fackeln an. Sie taten dies mit auffälliger Ruhe, so als würden sie ihre Handlungen genießen. Zunächst gingen sie zu dem Stall und legten dort Feuer. Es dauerte nicht lange, da stand der Großteil in Flammen. Grant machte ein zufriedenes Gesicht und beugte sich zu seinem Gefangenen. „Wir brennen alles nieder, Kynach, wenn Ihr uns nicht sagt, wo sich dieser Mann aufhält.“ Alan hatte sich von dem Schlag erholt und richtete sich auf. Aus seiner aufgeplatzten Lippe lief Blut über sein Kinn. Er ignorierte es und starrte an dem Fremden vorbei zu Grant. „Ich sagte schon, ich weiß es nicht.“ Der Lowlander vor ihm schien um Beherrschung zu ringen. „Ihr seid ein starrköpfiger Dummkopf und das wird Euch noch leidtun. Ihr bringt Eure Familie in Gefahr. Liegt Euch nichts an ihrem Wohl?“ Alan Kynach hob den Kopf, starrte zunächst in das Gesicht des Fremden, dann sah er zu seinen Töchtern, die eng umschlungen an einem der Fenster in der Hütte standen. „Tut ihnen nichts.“ „Seid Ihr also gesprächiger, Kynach?“ Elisabeth beobachtete das Treiben mit weit aufgerissenen Augen. Die Angst, die bisher in ihr geschlummert hatte, brach aus und wurde übermächtig. Den Vater in solch hilfloser Lage zu sehen, brachte sie zur Verzweiflung. Obwohl sie wusste, dass Alan ein mutiger Mann war und sich nicht vor einem Kampf scheute, so erkannte sie seine Unterlegenheit. Es war sinnlos, sollte sich ihr Vater auf diese Männer stürzen. Doch irgendetwas musste geschehen. Elisabeth dachte fieberhaft nach. Was konnte sie tun? Wie konnte sie ihrem Vater beistehen? Nur hier am Fenster zu stehen und zu sehen, wie man ihm Leid zufügte, das allein würde ihm nicht helfen. Noch ehe sie zu einer Lösung kommen konnte, wurde sie von ihrer Mutter herumgerissen. „Ich fürchte Schlimmes. Elisabeth, lauf zu Cabarfeidh. Sag ihm, was hier geschieht. Er muss kommen und helfen.“ Die Worte versetzten sie noch mehr in Schrecken. Sie ahnte Schlimmes, doch dass ihre Mutter ebenso dachte, bestätigte all ihre Befürchtungen. „Nimm Cathleen mit.“ „Ich will nicht mitgehen“, widersprach das Mädchen mit zittriger Stimme. „Du musst, Cathleen. Ich will nicht, dass sie Euch etwas antun.“ „Und du, Mutter? Was ist mit dir?“, wollte Cathleen wissen. „Ich bleibe hier. Sieh mich doch an, ich kann kaum richtig laufen, geschweige denn rennen.“ Sie deutete auf ihren gewölbten Leib. „Aber wenn sie dir etwas tun.“ „Ich will jetzt nicht reden, geht endlich. Elisabeth, bitte. Hol Hilfe, dann wird alles gut. Wenn der Earl hier ist, werden sie Alan nichts tun.“ „Sie waren doch schon so oft hier und haben nichts getan“, erinnerte sich Elisabeth und verspürte deutlich die Hoffnung, dass es diesmal genauso sein würde. Doch der besorgte Gesichtsausdruck ihrer Mutter belehrte sie eines Besseren. „Bisher waren keine Lowlander dabei. Diese Männer sind nicht hier um zu reden. Sie werden uns töten.“ „Aber …“ „Elisabeth, um Himmels Willen. Tu endlich, was ich sage!“ Elisabeth schluckte all ihre Einwände hinunter und nahm ihre Schwester an der Hand. Cathi begann leise zu jammern. „Ich habe Angst, Mama“, flüsterte das Mädchen und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Die Mutter strich zärtlich über Cathleens feuchte Wange und lächelte aufmunternd. „Es wird alles gut, wenn ihr den Earl holt.“ Sie warf ihrer älteren Tochter einen auffordernden Blick zu, den Elisabeth verstand. Ohne ein weiteres Wort zog sie ihre Schwester durch das Haus zu einem der Fenster, das zur hinteren Seite zeigte. Hastig öffnete sie es, stieg hinaus und half Cathleen. Auf dieser Seite des Hauses lag das Beet, das die Mutter hegte und pflegte. Die neu gesetzten Kräuter waren vergessen, als sie darüber hinweg eilte und ihre Schwester hinter sich herzog. In ihrem Rücken vernahm Elisabeth das Knistern des Feuers. Der Stall stand in Flammen und ein Teil des Daches stürzte ein. Sie hörte die Tiere, die in dem Feuer eingesperrt waren und nach einer Fluchtmöglichkeit suchten, doch sie würden keine finden. Elisabeth versuchte das Grauen zu ignorieren, das ihr wie ein Schauer über den Rücken lief. Sie wäre am liebsten zu dem Stall gelaufen, um die Tiere zu befreien, doch sie musste mit ihrer Schwester fort und Hilfe holen. So würde sie die Pferde und Ziegen ihrem Schicksal überlassen müssen. Elisabeth versuchte all ihre Gefühle zu beherrschen, während sie weiter rannte. Angst saß ihr im Nacken und die Furcht zu spät zu kommen, wenn sie nicht schnell genug war. Sie musste nur den Hügel des Knock Bain überqueren, dann war es nicht weit nach Castle Leod. „Hey, ihr da drüben“, hörte sie plötzlich einen Ruf. Sie waren entdeckt worden! Einer der Soldaten schlug Alarm. „Sie kommen“, schrie ihre Schwester erschrocken auf. Elisabeth vernahm in ihrem Rücken Hufschläge. Ihr Verfolger kam zu Pferd. Eine Flucht war aussichtslos, dachte sie verzweifelt. „Sie werden uns umbringen“, rief Cathleen aus und stolperte. Elisabeth verlor ihre Hand und sah sich um. Der Reiter kam schnell heran, im wilden Galopp, mit einem Schwert in der Hand. Auch wenn sie wusste, dass ihr Versuch aussichtslos war, packte Elisabeth ihre Schwester, zog sie auf die Beine und rannte mit ihr weiter. „Bleibt stehen!“, rief der Soldat, doch Elisabeth ignorierte ihn. „Verdammtes Weibspack.“ Der Reiter holte auf. Elisabeth riss ihre Schwester herum und wechselte die Richtung, vom Weg fort. Der Untergrund war steinig und rutschig, doch sie eilte unbeirrt weiter. Der Hang des Knock Bain war steil. Jeder Schritt hinauf begann zu schmerzen. Der Soldat fluchte wieder, trieb sein Pferd an. Schließlich sprang er aus dem Sattel und hechtete den beiden nach. Er bekam Cathleen zu packen. Elisabeth spürte, wie die Hand ihrer Schwester aus der ihren gerissen wurde und wirbelte herum. Cathleen schrie hysterisch. Zuerst überlegte Elisabeth, ob sie weiter rennen sollte, doch sie konnte ihre Schwester nicht zurücklassen. Sie sprang auf den Soldaten zu und schlug auf ihn ein. „Lass sie los, du Ungeheuer!“ „Halt den Mund!“ Der harte Schlag ließ Elisabeth taumeln. Benommen stolperte sie zurück und fiel zu Boden. Sie schüttelte den Kopf, versuchte den Schmerz in ihrem Kopf zu ignorieren. Ein Gedanke ließ sie wieder auf die Beine kommen. Sie musste Hilfe holen. Sie musste zum Chief, egal was geschah. Elisabeth warf einen Blick über ihre Schulter und erkannte den Soldaten, der dicht hinter ihr war. Wehmütig sah sie zu ihrer Schwester. Der Rotrock würde sie zurückbringen. Was würde mit ihr geschehen? Wenn sie den Chief holte, würde alles gut werden, dachte sie entschlossen. Ehe der Soldat nach ihr greifen konnte, rannte sie los. Doch da kam ein weiterer Reiter, der keine auffällige rote Uniform trug. Er holte sie ein und stieß sie grob zu Boden. Ihre Flucht war zu Ende und mit ihr die Hoffnung auf Hilfe. Gemeinsam packten die Fremden die Mädchen und zerrten sie zurück. Die Tür der Hütte stand offen. Grelle Schreie erklangen. Die Pferde vor dem Haus schnaubten unwillig. Elisabeth wurde mit ihrer Schwester vor das Haus geschleppt, während eine Frauenstimme laut um Hilfe schrie. Ihre Mutter. Elisabeth wollte sich von dem Mann, der sie festhielt, losreißen. Sie zerrte an dem Umhang des Fremden, während die Schreie aus dem Haus verzweifelter klangen. Ihre Mutter war in Not. Elisabeths Blick zuckte zu ihrem Vater, der stöhnend auf dem Boden lag. Er war zusammengeschlagen worden. Blut floss über sein Gesicht. Elisabeth wäre gerne zu ihm gelaufen, um ihm zu helfen, doch der Lowlander ließ keine Flucht zu. Auch wenn ihr Versuch zum Scheitern verurteilt war, so trat sie nach dem Mann, schlug auf ihn ein. Dieser blieb jedoch unbeeindruckt. „Lass uns los“, schrie Elisabeth hysterisch. „Hört auf, meiner Mutter weh zu tun!“ „Halt die Klappe, Göre.“ Der Mann schlug ihr ins Gesicht. Die Wucht riss sie von den Beinen. Elisabeth landete unsanft im Dreck. Sie warf einen hasserfüllten Blick auf den Fremden. Eingefallene Wangen, zusammenliegende Augen. Ein Gesicht, das sie nicht vergessen würde. Das Schreien aus der Hütte verstummte. Da traten zwei Männer heraus und zogen ihre Hosen zurecht. Ihre Gesichter wirkten zufrieden. Der eine war Soldat, der andere schlang sich seinen Umhang zurück auf die Schultern. Unter seinem Bart verbarg sich ein befriedigtes Grinsen. Grant wandte sich gelassen zu Alan, der halb benommen von den Schlägen am Boden lag. Er würde sich kaum zur Wehr setzen können. Sein Zustand schien Grant zufriedenzustellen. Elisabeth zerrte an dem Griff, der sie zurückhielt, zu ihrem Vater zu eilen. Tränen der Verzweiflung ließen ihren Blick verschwimmen. „Lasst meine Töchter frei“, stieß Alan hervor. „Ich bitte Euch. Lasst sie gehen.“ „Ich habe Euch etwas gefragt und Ihr werdet mir jetzt antworten!“ „Ich weiß nichts von Jakobiten, ich schwöre es. Lasst meine Töchter gehen, Grant!“ Der bärtige Lowlander, der eben aus dem Haus gekommen war, beugte sich zu Alan hinunter, griff nach seinen Haaren und zog sein Kopf hoch. „Ich habe diese Fragerei satt. Sag uns, was wir wissen wollen. Weißt du etwas von diesem Jonathan MacGillivray?“ „Nein.“ „Du lügst.“ „Bei der Heiligen Jungfrau, nein, ich kenne keinen Jonathan MacGillivray. Wir sind Bauern, wir leben hier abseits von Euren Intrigen.“ „Jeder Schotte in diesen gottverdammten Highlands ist ein Jakobit!“ Der Bärtige trat nach dem Gefangenen. Alan stöhnte schmerzvoll auf. Elisabeth japste erschrocken nach Luft. „Und wir wissen, dass du etwas mit ihnen zu schaffen hast, besonders mit diesem MacGillivray.“ Grant zupfte an seinen schwarzen Handschuhen. „Das ist eindeutig Verrat an der Krone, Alan Kynach. Und wisst Ihr, welche Strafe auf dieses Vergehen folgt?“ „Ihr könnt nicht über mich richten, Grant.“ Der Leutnant lächelte überheblich. „Ihr werdet sehen, was Ihr davon habt. Ich vertrete hier das Gesetz des Königs.“ Er nickte einem der Soldaten zu. Dieser zog sein Schwert und stach auf Alan ein. Der Schrei war so laut und erschreckend, doch Elisabeth erkannte nicht, dass er von ihr kam. Sie sah, wie der Lowlander ihren Vater losließ. Der Kopf kippte nach hinten, die Augen starrten blicklos in den Himmel. Sie erkannte das Blut, das aus seiner Brust quoll und begriff nicht, dass ihr Vater tot war. Voller Entsetzen starrte sie auf den Körper, bis ihr Blick in den Tränen verschwamm. Das Feuer des Stalles griff auf die Hütte über und nach kurzer Zeit stand das Strohdach in Flammen. Ein Soldat warf eine Fackel in das Innere des Gebäudes und ging gemächlich zurück zu den anderen. Die Soldaten sowie die beiden Fremden ließen Elisabeth und Cathleen vor dem Feuer sitzen. Der Bärtige schwang seinen Umhang zurück und beugte sich zu Elisabeth. „Richte dem Earl of Cromartie aus, dass es jedem Jakobiten so ergehen wird wie deinem Vater.“ Wut, Angst und der Qualm ließen Elisabeth schwer Luft holen. Sie schwieg, während sich der Fremde aufrichtete und zu den anderen zurückging. Ihre Augen brannten im Rauch des Feuers. Die Männer stiegen auf ihre Pferde. Elisabeth kniete auf der Erde, fassungslos. Sie starrte auf den regungslosen Körper ihres Vaters, konnte nicht glauben, was geschehen war. „Oh nein, das Haus brennt. Mutter ist darin … Mutter …“ Cathleen schrie hysterisch und wollte auf das brennende Haus zulaufen. Elisabeth kam auf die Beine, stolperte über den Rocksaum ihres Kleides und bekam einen Ärmel ihrer Schwester zu fassen. Die Ruhe in ihr erschreckte sie selbst, als sie ihre Schwester zurückzog und an sich drückte. Die Flammen breiteten sich weiter aus. Die Hitze schmerzte fast auf ihrem Gesicht, während sie auf die offene Tür starrte. Das Feuer zuckte heraus, als versuchten Arme nach ihren Opfern zu greifen. „Wir können nicht mehr hinein.“ „Aber Mutter ist doch da drin. Sie wird verbrennen.“ Elisabeth hielt ihre Schwester fest und schluckte schwer. Sie verspürte Angst und noch etwas. Leere.Kapitel 3
Edinburgh, Sommer 1742
Roderick hob den Kopf und sah die St. Giles Kirche vor sich. Eigentlich wollte er weitergehen und das Treiben ignorieren. Die fast täglichen Bestrafungen auf dem Marktplatz waren für Roderick nicht interessant, ergötzten nur die Schaulustigen, die sich um das Podest für den Galgen drängten. Es war, als wollte jeder einen guten Blick auf den Todgeweihten haben, wenn er mit seinen letzten Atemzügen an dem Strick baumelte. Roderick verspürte nicht den Drang, ihnen nachzueifern. Er empfand weder Vorfreude noch den Wunsch, sich an dem Tod und dem Schmerz eines anderen zu ergötzen. Im Gegenteil, ihm war zuwider, dass die Bestrafungen in aller Öffentlichkeit durchgeführt wurden. Diejenigen, die hier das Recht vertraten, schienen die Strafen mit besonderer Hingabe zu vollstrecken.