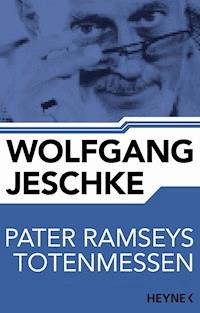Das Buch
Im Mittelmeerraum werden immer wieder Gegenstände gefunden, die zwar eindeutig aus fernster Vergangenheit stammen, doch aus Materialien bestehen, die es erst seit kurzem gibt – oder gar erst in der Zukunft geben wird. Diese Funde bestärken die amerikanische Regierung darin, dass sie mit dem geheimsten ihrer Projekte Erfolg haben wird: dem Plan, Menschen und Material mittels Zeitmaschinen fünf Millionen Jahre in die Vergangenheit zu schicken und die Erdgeschichte sozusagen nachträglich zugunsten der USA zu verändern. Das Spezialkommando aus ausgesuchten Technikern und Militärs soll einen riskanten Auftrag erfüllen: Das arabische Öl mittels Pipelines in den Westen befördern und es von dort in die Gegenwart heraufpumpen. Doch das ehrgeizige Unternehmen nimmt eine Wendung, die man sich in den kühnsten Träumen nicht hat vorstellen können …
Ausgezeichnet als bester SF-Roman des Jahres 1982, zählt »Der letzte Tag der Schöpfung« zu den bedeutendsten Werken der neueren Science Fiction – ein Klassiker, der bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat.
»Ein gutes Thema, ein brillantes Buch. Lesen Sie es schnell, bevor das Öl zu Ende geht!« Brian W. Aldiss
Der Autor
Wolfgang Jeschke, 1936 geboren, ist der Großmeister der deutschen Science Fiction. Lange Jahre als Herausgeber und Lektor für die Heyne SF-Reihe tätig, hat er vor allem auch mit seinen eigenen Romanen und Erzählungen das Bild des Genres geprägt. Jeschke wurde mehrmals mit dem renommierten Kurd-Lasswitz-Preis ausgezeichnet. Zuletzt ist sein Roman »Das Cusanus-Spiel« erschienen.
Wolfgang Jeschke
Der letzte Tagder Schöpfung
Roman
Mit einem Vorwortvon Frank Schätzing
Überarbeitete Neuausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Überarbeitete Neuausgabe 11/2005
Redaktion: Ursula Bergenthal
Copyright © 1981, 2005 by Wolfgang Jeschke
Copyright © 2005 des Vorworts by Frank Schätzing
Copyright © 2005 dieser Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München.
ISBN 978-3-641-01396-7
V003
www.heyne.de
Vorwort
von Frank Schätzing
Als mir angeboten wurde, das Vorwort zu Wolfgang Jeschkes Roman »Der letzte Tag der Schöpfung« zu schreiben, war meine erste Reaktion blankes Erstaunen. Ich erinnerte mich an den Titel, obwohl ich ihn nie gelesen hatte. Er repräsentierte damals neben den Werken Stanislaw Lems, Ray Bradburys und einiger weiterer eine Kategorie der Science Fiction, die etwas verkniffen als »ernstzunehmend« bezeichnet wurde. Aber lag das nicht ein Vierteljahrhundert zurück? Heilige Spiralgalaxis! Welch sinistren Plan verfolgte der Verlag? Wollte man mich etwa zurück ins Jahr 1981 transmittieren? Das Genre steckt voller Zeitreisegeschichten – wer seinen Planck gelesen hat und sich hinreichend in der Kosmographie von Paralleluniversen auskennt, weiß, dass man durch die Zeitalter purzelt, eh man sich versieht. Man würde mich also zum Kaffee einladen, heimlich scannen, in Moleküle zertrümmern, meine Bauanleitung in die beginnenden Achtziger irgendeines benachbarten Universums schicken und darauf hoffen, dass ich dort quantengesetzlich wieder zu einem vollständigen Frank Schätzing zusammengefügt werde, der Stein und Bein zu schwören bereit ist, er selber zu sein.
Zugleich war ich nostalgisch bewegt. Wolfgang Jeschke galt uns damals als der Obi-Wan Kenobi der deutschen Science Fiction, einer, der wispernden Respekt genoss. Als Teenager habe ich Zukunftsgeschichten verschlungen wie ein Schwarzes Loch, die Masse der absorbierten Seiten und Einbände dürfte sich rückblickend auf einige Zentner belaufen, und immer wieder tauchte der freundliche Herr mit dem Vollbart auf. Jeschke hatte eine trüffelfeine Nase für Autoren, er veröffentlichte einige der besten Anthologien aller Zeiten und ließ seine eigene Phantasie so virtuos über zukünftige Schauplätze pirouettieren, dass ihm das Feuilleton lange und nachdenkliche Artikel widmete. Damals beschloss ich, eines Tages auch Science Fiction zu schreiben und sie Wolfgang Jeschke – wem sonst!? – anzubieten, doch dann verschlang sich das Schwarze Loch irgendwie selber. Nachdem ich die Bekanntschaft hunderter Außerirdischer gemacht und begriffen hatte, dass die Weizenkörner im Spreu des Genres eher selten zu finden sind, verlor ich das Interesse an klassischer Science Fiction und wandte mich der kontemporären Kunst des Totschlags zu, die, wie man seit Agatha Christie weiß, von großer Ergiebigkeit ist.
Plötzlich wieder mit Jeschke konfrontiert zu sein, drehte die Zeit tatsächlich zurück. Ich war natürlich geehrt. Beruhigte mich über der Erkenntnis, dass man keineswegs beabsichtige, mich in Elementarteilchen zu zerlegen, sondern dem »Letzten Tag der Schöpfung« eine schicke Neuauflage widmete, was ich nur angemessen fand. Wie gesagt, ich hatte versäumt, das Buch beizeiten zu lesen, aber dass der Verfasser in den Olymp der raumfahrenden Rasse gehörte, war sternenklar, daran gab es nichts zu rütteln. Selbstverständlich würde ich ein Vorwort schreiben! Ich würde das Vergnügen haben, einzutauchen ins Zukunftsbild der frühen Jahre, als wir ernsthaft glaubten, die Mannschaft des schnellen Raumkreuzers Orion mit ihren Wirtschaftswunder-Trendfrisuren und den Taillen-Abnähern an Eva Pflugs Uniform repräsentiere das dritte Jahrtausend. Noch enthusiastischer wurde ich, als sich herausstellte, dass es sich beim »Letzten Tag der Schöpfung« tatsächlich um eine Zeitreisegeschichte handelte. Jeder ehrbare Science-Fiction-Fan der frühen Jahre liebt H. G. Wells und seine Zeitmaschine, aber richtig lustig wurde es eigentlich erst, als diverse Autoren den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik auf so abenteuerliche Weise verbogen, dass Zeitreisen regelrecht in Mode kamen. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts fuhr man wohl physisch nach Mallorca oder an die Adria, tatsächlich aber erholte man sich in ferner Zukunft oder im Mittelalter oder am besten gleich im Paläozoikum, und selbstverständlich nahm man nicht den nächsten Flieger, sondern stürzte sich in Singularitäten, quetschte sich durch Zeitrisse und drückte auf hübsch blinkende Knöpfe. Zeitreisegeschichten, muss man leider sagen, sind der Science Fiction zum lustvollen Verhängnis geworden. Sie machten zwar den meisten Spaß, bezogen ihn jedoch fast sämtlich aus der konsequenten Umgehung der Naturgesetze, ungetrübt von jeglicher physikalischer Sachkenntnis – Hauptsache, die Reiseroute stimmte.
Ich habe »Der letzte Tag der Schöpfung« dann endlich gelesen, mit knapp dreißig Jahren Verspätung, in einem Rutsch, schlaflos. Was immer ich erwartet hatte, die naive Weltsicht der Anything-Goes-Generation, Altersflecken im Papier, patiniertes Was-wäre-wenn und besagte Vergewaltigungen der Physik – nichts davon ist mir begegnet. Dass eine Erzählung, die so lange zurück liegt, aktuelle Bezüge aufweist, mag man sich noch vorstellen. Dass sie sich jedoch liest, als sei sie eben erst geschrieben worden, hinterlässt einen Augen reibend. Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich den Roman empfunden hätte, wäre er mir bei Erscheinen in die Finger gefallen, und war sofort entzückt, ihn damals verpasst zu haben. Denn mit Jeschkes hintersinniger Zeitreise verhält es sich wie mit einigen Bordeaux, die umso besser werden, je länger man sie liegen lässt. Und »Der letzte Tag der Schöpfung« ist heute zweifellos noch besser als zu Beginn der Achtziger! Er ist grandios!
Speziell vor dem Hintergrund der Bush-Administration gewinnt Jeschkes Abenteuergeschichte einen bitter ironischen Unterton, der die unilaterale Politik einer auf Ressourcen versessenen Weltmacht nachgerade prophetisch kommentiert. Die Idee des aberwitzig in Szene gesetzten Öldiebstahls – ob er gelingt, muss man unbedingt selber lesen! – ist zugleich die Chronik einer Intervention von reinster militärischer Blauäugigkeit, sie karikiert die neokolonialistische Haltung selbsternannter Freiheitshüter und den Kontrollwahn einer Menschheit, die gegenüber ihrer technologischen Entwicklung immer mehr ins moralische Hintertreffen gerät. Ob Jeschkes Rahmenbedingungen für eine Zeitreise physikalisch haltbar sind – reizvoll sind sie allemal -, spielt dabei keine Rolle. Die Reise, so spannend sie beschrieben wird, ist lediglich ein dramaturgisches Vehikel, sie nimmt sich weit weniger ernst, als man lange glaubt. Tatsächlich liegt hierin der besondere Charme von Jeschkes Erzählweise: Durchzogen von feinem Spott, gewinnt das Genre Distanz zu sich selbst, nimmt ganz nebenbei die unreflektierte Technikgläubigkeit der Politiker und Militärs auf die Schippe und wirft einen fast liebevoll ironischen und zugleich bitterbösen Blick auf den intelligenten Affen Mensch, wie er selbstherrlich in den dünnen Verästelungen seines Stammbaums thront. Dass im Buch ein Vertreter des zwanzigsten Jahrhunderts mit einer felligen Vorfahrin aus der Urzeit kopuliert, ist kein Zufall. Die Szene, erzählt von einem der Protagonisten, gehört zu den oft nur wenige Zeilen langen Miniaturen, die Jeschkes Roman zum wahren Vergnügen machen. Am Boden eines noch nicht existenten Mittelmeers werden neben Atomgranaten vor allem Seitenhiebe ausgeteilt, dass einem die Rippen schmerzen, oft vor unterdrücktem Lachen. An anderer Stelle wird ein Affenmensch standrechtlich vom Militär exekutiert, obwohl er doch gar nichts getan hat, außer einem Rivalen die Gurgel durchzubeißen. Bis zuletzt ist dem Verurteilten schleierhaft, was daran jetzt so schlimm war. Kabinettstücke dieser Art serviert Jeschke am laufenden Band: Affe entlarvt Affe, oder Mensch Mensch – je nachdem, wie man es lieber hätte.
Am Ende führt sich die Wissenschaft ad absurdum, entpuppt sich der kühne Traum von der Beherrschung der Zeit als Einbahnstraße, und die Helden werden zurückgeworfen auf ihr bloßes Menschsein. Zwischen Nukleargefechten, Kannibalismus und rapider Verelendung, inmitten eines völlig sinnfreien Stellvertreterkriegs, der fünf Millionen Jahre vor unserer Zeit ungehemmt von Genfer Konventionen und ähnlichen Lästigkeiten munter vor sich hin tobt, entwickelt sich so etwas wie eine neue Humanität. Der ganze Aufwand, um Truppen und Material in die Frühzeit zu schicken, findet seinen atomaren Niederschlag in der sattsam bekannten Zerstörung der Umwelt. Mit der Manipulation der Vergangenheit verliert die Zukunft zudem jede Gültigkeit – man kann auch sagen, der Job entledigt sich seiner Auftraggeber, einfach indem er durchgeführt wird. Was bleibt, sind Zeitreisende, die ihre Illusionen gegen die simple Erkenntnis tauschen, dass ein bisschen Freundschaft und ein Sonnenaufgang über Afrika womöglich zum Höchsten gehören, was Menschen je erreichen können. Und darin, man mag es glauben oder nicht, liegt tatsächlich etwas Tröstliches.
Sprachlich und dramaturgisch bietet »Der letzte Tag der Schöpfung« klassische Unterhaltung vom Besten. Bis zum Showdown zieht Jeschke alle Register des großen Abenteuerromans – und hier, nur hier, stellt sich tatsächlich so etwas wie Nostalgie ein, wenn die Gemeinschaft der Gestrandeten plötzlich an Filme wie Das dreckige Dutzend oder Der Flug des Phoenix denken lässt, an verschwitzte Männer unter brennender Sonne, die das Unmögliche vollbringen müssen. Da sind sie dann alle versammelt – John Wayne, Lino Ventura, John Huston und Lee Marvin -, bass verwundert, wer ihnen den Streich mit der blöden Zeitmaschine gespielt hat, und halten Ausschau nach Indianern, Nazis und anderen Lumpen. So ist »Der letzte Tag der Schöpfung« unterm Strich Science Fiction, Kriegsepos und Western in einem, sich zu allem bekennend, ohne je die Außenperspektive zu verlieren – etwa so, wie Papa sich zu seinen Kindern bekennt: stolz, mitunter belustigt und immer mit Nachsicht.
Wolfgang Jeschke, der von 1973 bis 2001 Herausgeber der Heyne SF-Reihe war, wurde für seine Romane und Erzählungen vielfach ausgezeichnet. Mehrmals erhielt er den renommierten Kurd-Laßwitz-Preis, unter anderem für den vorliegenden Roman, zuletzt für »Das Geschmeide« als beste Kurzgeschichte 2004. Dass er unangefochten zu den Edlen und Weisen seiner Profession gehört – nach Ansicht vieler ist er der beste deutsche Science-Fiction-Autor überhaupt -, wird auch sein visionäres Spätwerk »Das Cusanus-Spiel« zeigen. Einmal mehr blickt der Spötter und Humanist darin über den Tellerrand der Geschichte, so spannend, dass man keinesfalls fünfundzwanzig Jahre mit dem Lesen warten sollte. Andererseits wird auch »Das Cusanus-Spiel« wahrscheinlich wieder so ein seltener Bordeaux sein wie »Der letzte Tag der Schöpfung«, sprich, mit jedem Jahr besser werdend.
Was soll’s – trinkreif ist ein Jeschke immer!
Frank Schätzing schreibt Krimis und historische Romane – und hat mit seinem zuletzt erschienenen Buch, dem Wissenschaftsthriller »Der Schwarm«, die Bestsellerlisten im Sturm erobert.
Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendige Tiere, ein jegliches nach seiner Art: Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also.Und Gott machte Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei …
1. Mose 1, 23-26
Prolog
1959 war Steve Stanley 16 Jahre alt. Er hatte seine Kindheit in Paris und Rom verbracht, wo sein Vater Auslandsvertreter eines amerikanischen Pharmakonzerns war. In die Staaten zurückgekehrt, besuchte er das College in Springfield, Ohio, wollte Flugzeugbau studieren und Pilot werden. Nach Abschluss des Examens meldete er sich zur Air Force.
1959 entdeckte der amerikanische Geheimdienst im Umkreis des westlichen Mittelmeerraums Spuren, die auf ein Projekt hinwiesen, das die Wirklichkeit, wie wir sie kennen, radikal verändern sollte.
1968 war Steve Stanley 25 und gehörte zu den besten Piloten der amerikanischen Luftwaffe.
1968 wurden unter strengster Geheimhaltung und strikten Sicherheitsmaßnahmen in den USA die Vorbereitungen zu einem Projekt getroffen, das die US-Navy in Zusammenarbeit mit der NASA zu verwirklichen gedachte und das in der Geschichte der Menschheit einzigartig sein sollte.
1977 war Steve Stanley 34 und arbeitete als Testpilot bei Rockwell. Er verlor seine Stellung, als Präsident Carter die Entscheidung traf, dass die B-1 nicht in Serie gehen solle. Steve Stanley bewarb sich daraufhin bei der NASA, die für die geplanten Shuttle-Flüge erfahrene Piloten suchte.
1977 lief das geheime NASA/Navy-Projekt bereits auf Hochtouren, obwohl einige der beteiligten Wissenschaftler seit geraumer Zeit dringend vor den sich abzeichnenden Konsequenzen warnten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war nämlich allen Eingeweihten klar, dass nicht alles nach Plan verlief. Die Militärs schlugen die Warnungen in den Wind und forcierten das Projekt mit allen Mitteln, obwohl inzwischen sogar Laien auffiel, dass im Seegebiet westlich der Bermudas seltsame Dinge geschahen. Der CIA kamen die wilden Spekulationen über das so genannte Bermuda-Dreieck nicht ungelegen, und sie trug durchaus dazu bei, die obskure Gerüchteküche anzuheizen, damit kein Wissenschaftler auch nur daran dachte, sich ernsthaft mit den rätselhaften Phänomenen zu befassen.
Kurz darauf erschien der Name Steve Stanley auf einem Computerausdruck unter den Namen der Kandidaten, die man für die Teilnahme an dem Geheimprojekt in die engere Wahl gezogen hatte. Die Liste benannte Spezialisten aus einigen Bereichen der Wissenschaft, der Technik und der Logistik sowie ehemalige Angehörige der kämpfenden Truppe, die ganz bestimmte Forderungen erfüllten.
Steve Stanley konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, was man von ihm forderte – ebenso wenig wie die anderen, die auf der Liste des Projektleiters Admiral William W. Francis standen. Sie alle hatten keine Ahnung, dass ihr Leben einen ganz anderen Verlauf nehmen würde, als sie es sich in ihren kühnsten Träumen vorgestellt haben mochten. Sie waren ausersehen das Paradies zu betreten – doch es war nicht die Genesis, deren Zeugen sie wurden, sondern die Apokalypse.
Eines Tages war Steve Stanley spurlos verschwunden, und mit ihm verschwanden die meisten jener Leute spurlos, deren Namen der Computer aufgelistet hatte.
Spurlos?
Sie hinterließen Spuren.
Es war nur äußerst schwierig, sie zu erkennen, und noch schwieriger sie zu deuten – besonders für diejenigen, die nicht ihre Zeitgenossen waren.
ERSTER TEILSpuren
Bohrlöcher
Als am 13. August 1970 die Glomar Challenger den Hafen von Lissabon verließ, um in der Balearensenke Bohrungen im Meeresgrund durchzuführen, erwarteten nicht nur Wissenschaftler Aufschluss über rätselhafte Phänomene, auf die man in den fünfziger- und sechziger Jahren gestoßen war. Den Biologen und Ozeanografen ging es um die Klärung eines einschneidenden Vorgangs, der sich vor etwa fünfeinhalb Millionen Jahren ereignet haben musste und der den Übergang zwischen Miozän und Pliozän markiert. Er bedeutete für den Mittelmeerraum eine biologische Revolution, die mit einer drastischen Klimaveränderung in Europa verbunden war.
Die Expedition der Glomar Challenger wurde von der National Science Foundation finanziert und unter Aufsicht der Scripps Institution of Oceanography durchgeführt. Am Nachmittag des 23. August wurde das Forschungsschiff 100 Meilen südlich von Barcelona elektronisch verankert und in 2000 Metern Meerestiefe die erste Bohrung niedergebracht. Weitere Bohrungen folgten.
Die Ergebnisse bestätigten die Hypothesen von William E. B. Benson von der National Science Foundation und Orville L. Bandy von der University of Southern California. Sie bestätigten auch einige abenteuerliche Vermutungen von hohen Militärs im Pentagon, die mit einem militärischen Projekt beschäftigt waren, das sich Ende der Sechzigerjahre, auf dem Höhepunkt des Apollo-Programms, in Umrissen abzeichnete. Auf den Pressekonferenzen in Paris und New York, auf denen die Ergebnisse der Expedition bekannt gegeben wurden, hielt man vorsorglich einige Informationen zurück. Sie betrafen ein bei den Bohrungen zutage gefördertes Material, das man zunächst nicht identifizieren konnte, bei dem es sich jedoch um das schwerwiegendste Argument handelte, das die Befürworter des Projekts vorzubringen hatten. Dieses Argument bewog Präsident Nixon Mitte Februar 1971 – der Flug von Apollo 14 war gerade erfolgreich beendet worden -, das Raumfahrt-Budget der NASA drastisch zu kürzen, um Gelder für das Projekt bereitzustellen, das, zunächst als »Sealab« getarnt, in Zusammenarbeit von Navy und NASA vorbereitet wurde.
Die Ergebnisse bestätigten einige rätselhafte Details, die der Geheimdienst zusammengetragen hatte. Der erste Hinweis stammte aus dem Jahr 1959. Er kam aus dem französischen Verteidigungsministerium und war höchst alarmierend, da man keinerlei Erklärung für den Umstand hatte. Er wurde als »Artefakt 1« gekennzeichnet. Commander Francis, ein erfahrener Mann von der waffentechnischen Entwicklungsabteilung der US-Navy, wurde mit den Nachforschungen beauftragt. Er stieß aber erst 1968 auf ein weiteres sicheres Detail, das in diesen speziellen Zusammenhang passte: »Artefakt 2« war gefunden. Es stammte aus der Schweiz. 1969 tauchte eine Information auf, die der Geheimdienst im Vatikan aufgestöbert hatte. Sie wurde als »Artefakt 3« unter Verschluss genommen. Das Mosaik setzte sich Stück für Stück zusammen. Das Bild rundete sich – und allmählich nahm auch die wissenschaftliche Basis des Unternehmens die Form an, wie Francis und seine Mitarbeiter es längst vermutet hatten. Zu diesem Zweck wurden seit mehr als einem Jahrzehnt alle Publikationen auf dem Gebiet der theoretischen Physik weltweit gesichtet und ausgewertet.
Die Flöte des hl. Veit
Anachronismen sind schwer zu erkennen. Man muss Zeitgenosse von Dingen sein, um sie anhand ihrer Funktion und ihres Aussehens einzuordnen, oder ein Spätgeborener, der von ihnen aus Überlieferungen weiß. Dem Frühgeborenen werden sie allenfalls als Kuriositäten erscheinen – oder als magische oder heilige Gegenstände, ganz nach Einfalt des Herzens, nach Gläubigkeit oder wissenschaftlicher Einsicht.
Tatsächlich gab es seit Jahrhunderten Hinweise darauf, dass im westlichen Mittelmeerraum irgendwann in vorgeschichtlicher Zeit ein Ereignis stattgefunden haben musste, das man als »Zeitfraktur« bezeichnen könnte. Es waren merkwürdige Funde, die im Küstengebiet von Südspanien und Süditalien, auf Malta, Sardinien, Korsika und den Balearen, vor allem aber in Sizilien gemacht wurden und die man ihrer nahezu unzerstörbaren Beschaffenheit und Unerklärlichkeit wegen weit und breit als Reliquien verehrte und zum Teil heute noch verehrt. Es handelt sich in der Regel um Splitter eines leichten Materials von schmutzig weißer bis gelblich brauner Färbung, das man für sehr altes Elfenbein halten kann oder für Überreste von Totenschädeln und Knochen, die das Meer und der Sand in Jahrhunderten glatt geschliffen und so bis zur Unkenntlichkeit deformiert haben. Umso mehr findet die Phantasie Anreiz, in diese beinernen Fragmente Gestalt, Geschichtlichkeit, gar Heiligkeit zu legen und sie als wunderbarerweise gerettete Körperteile aller möglichen Heiligen zu interpretieren, die einst auf Erden wandelten.
So wird in San Lorenzo, unweit von Reggio, in Calabrien seit mehr als 500 Jahren ein zwanzig Zentimeter langes Stück dieses Materials als der Zeigefinger des Propheten Jeremias verehrt. In Algeciras vor Gibraltar bewahrt man ein Bruchstück von quadratischer Form und etwa zwölf Zentimetern Seitenlänge als Reliquie auf, die angeblich die Schädeldecke Johannes des Täufers darstellt, dessen abgeschlagenes Haupt auf wunderbare Weise an spanische Gestade geschwemmt wurde. Und in mindestens 37 Kirchen Siziliens ruhen Finger- und Zehenknöchelchen, Ober- und Unterkiefer, Rippen und Schienbeine von mindestens 27 Heiligen, Propheten und ähnlichen verdienstvollen Männern und Frauen.
Der merkwürdigste Fund indes ruhte bislang in einem Silberschrein zu Sta. Felicità in Palermo: das Allerheiligste des hl. Veit oder Vitus, wie er dort genannt wird. Vitus, als Heiliger heute unter anderem zuständig für Bierbrauer und Bergleute, Epileptiker und Kesselschmiede, Schauspieler, Apotheker und Winzer, angefleht bei Bettnässen und Feuersbrünsten, Schlangenbiss und Tollwut, Veitstanz und Fallsucht, Aufregung und bedrohter Keuschheit, stammte aus Mazara del Valla an der Südwestküste Siziliens und hatte bekanntermaßen unter den Häschern Diokletians um 304/305 Schreckliches zu erleiden. Er war der Sohn eines wohlhabenden Heiden namens Hylas und trat zu dessen Verdruss schon im zarten Alter von sieben Jahren der Sekte der Christen bei. Um den Nachstellungen des erbosten Vaters zu entgehen, floh er mit seiner Amme Crescentia und seinem Erzieher Modestus nach Lukanien. Er wurde jedoch erkannt, ergriffen und nach Rom gebracht, wo man ihn auf besonders grausame Weise vom Leben zum Tode befördern wollte, indem man ihn in einen Kessel siedendes Öl steckte. Engel retteten ihn im letzten Moment aus der Frittüre und trugen das arme Kerlchen zurück in die ferne Heimat, wo er aber bald darauf gestorben sein soll.
Im Jahre 583 begann man die sterblichen Überreste des Märtyrers zu zerlegen. Während der Leib nach Unteritalien überführt wurde, blieb das abgetrennte Glied in Sizilien. Der rührige Abt Fulrad von St. Denis ließ den verstümmelten Leichnam 756 in sein Kloster bringen, doch nicht alle seiner Nachfolger scheinen dem ölgesottenen Veit die gleiche Hochachtung entgegengebracht zu haben, denn Abt Hilduin schenkte die Leiche 836 dem Weserkloster Corvey. Dort wurde der Märtyrer – inzwischen zum Reichspatron avanciert – weiter zerlegt; 922 erhielt Herzog Wenzel einen Arm, als er zu Ehren Veits in Prag eine Kirche bauen ließ, eben an der Stelle, wo sich heute der berühmte Veitsdom auf dem Hradschin erhebt. 1355 versuchte Kaiser Karl IV. die fehlenden, in alle Winde verstreuten Teile der sterblichen Hülle einzusammeln, konnte aber nur in Pavia ein paar Knöchelchen erwerben, von deren Echtheit die Gottesgelehrten nie so ganz zu überzeugen waren. Heute gibt es mehr als 150 Orte in Mittel- und Südeuropa, die Körperteile des Heiligen zu besitzen glauben.
Die delikateste Reliquie, der Veit das Patronat über bedrohte Keuschheit verdankt, tauchte im zehnten Jahrhundert in Palermo auf. Sie wird urkundlich erwähnt im Jahre 938 anlässlich des Neubaus der Kirche von Sta. Felicità, wo sie einen sicheren Hort fand. Welch ungewissem Schicksal sie während der verflossenen 355 Jahre ausgesetzt gewesen war, verschweigen uns die Legenden, die sich sonst so üppig um die Gestalt des jugendlichen Märtyrers ranken.
Eine lokale Überlieferung will ihren Ursprung wissen und kommt der Wahrheit möglicherweise ziemlich nahe: Ein braver Fischersmann namens Rosso war des Nachts von einem Sturm überrascht und weit hinaus aufs Meer verschlagen worden. Er litt zwei Tage und zwei Nächte lang Unsägliches, bis der Sturm sich endlich legte und er am Morgen des dritten Tages wieder heimatliches Gestade sichtete. Als er sein Netz einholte, befand sich neben zwölf Fischen (dieser Zahl ist freilich zu misstrauen, denn gewiss handelt es sich um einen Hinweis auf die zwölf Apostel) ein seltsamer Gegenstand darin: ein gekrümmtes, schlauchähnliches, geripptes Gebilde von anderthalb Fuß Länge und einer halben Spanne Durchmesser aus einem unbekannten Material, das zugleich elastisch und brüchig wirkte und von blassgrauer Färbung war.
Dankbar für seine wunderbare Errettung übergab der Fischer seinen Fund dem Prior von Sta. Felicità, der das merkwürdige Ding unter Verschluss nahm, es vor allem den Blicken der Damenwelt entzog, da es möglicherweise zu unkeuschen Gedanken hätte Anlass geben können. So geschehen um die Mitte des neunten Jahrhunderts.
Wie durch ein Wunder überstand es unversehrt den Brand, der 922 das alte Sta. Felicità in Schutt und Asche legte. 932 wurde mit dem Bau des neuen Gotteshauses begonnen, wie es noch bis heute zum größten Teil erhalten ist.
Im Jahre 1277 erwirkte Ambrosius, ein junger und ehrgeiziger Prior von Sta. Felicità, beim Erzbischof von Palermo die Erlaubnis, beim Hl. Vater um eine Beglaubigung der Reliquie anzusuchen. Papst Nikolaus III. konnte sich nicht entscheiden, obwohl er gleich zwei Expertenkommissionen nach Palermo entsandte, die das Gebilde an Ort und Stelle untersuchten. Dann ruhte der Antrag, bis Bonifatius VIII. 1296 eine dritte Expertenkommission schickte; doch erst 1303, kurz vor seinem Tode, konnte sich der Hl. Vater zu einer positiven Entscheidung durchringen und erteilte seinen apostolischen Segen.
Seit dem 13. Jahrhundert ruhte das seltsame Stück Schlauch, von höchster Instanz der katholischen Kirche als Sinnbild christlicher Keuschheit und Zeugnis erstaunlicher sizilianischer Mannbarkeit bestätigt, in einem kunstvoll ziselierten und mit Seide ausgekleideten Silberschrein, der nur alle hundert Jahre zur Feier des Centenariums von Sta. Felicità geöffnet und zur Schau gestellt wurde, damit jedermann das wundersam der Verwesung entzogene Glied des Heiligen in Augenschein nehmen könne.
Professor Angelo Buenocavallo, Lehrer der Medizin zu Palermo, verfasste über diese Reliquie – im Volksmund »Der Unaussprechliche des hl. Vitus« oder auch manchmal ganz ordinär »Il gazzo di Santa Felicità« genannt – 1439 eine gelehrte Abhandlung, in der er entschieden bestritt, dass es sich bei besagtem Gegenstand um ein menschliches Glied im Allgemeinen oder gar Besonderen handeln könne, auf welch wundersame Weise auch immer es sich durch das Sieden in Öl verändert haben möge, denn es weise anatomisch nicht die geringste Ähnlichkeit mit einem solchen auf – von der Länge ganz zu schweigen. Zwar habe man etwa bei Schweineschwänzen wiederholt feststellen können, dass sie nach einiger Zeit in siedendem Öl aufquellen und schaumig verkrusten, wodurch sie größer und härter erschienen. Aber bei dem besagten Gegenstand handele es sich nicht um ausgebrutzeltes Fleisch, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach um Elfenbein. Alles deute eher darauf hin, dass es sich um eines jener heidnischen, aus Elfenbein gefertigten Musikinstrumente handeln könne, auf denen muselmanische Musikanten ihre schaurigen Töne hervorbrachten, die angeblich der Stauferkönig bei Hof so gern mochte.
Buenocavallo erhielt von seiner Fakultät keine Druckerlaubnis. Neider denunzierten ihn bei kirchlichen Stellen, er habe auf häretische Weise das Glied des hl. Vitus mit ausgebrutzelten Schweineschwänzen verglichen. Die Schrift wurde konfisziert und öffentlich verbrannt. Das tapfere Professorlein entging mit Not der Anklage wegen Ketzerei und erhielt zwei Jahre Lehrverbot. Er ging nach Padua, wo er noch drei fruchtbare Jahrzehnte als Anatom wirkte. Sein Ruhm drang weit über die Grenzen seiner Wahlheimat hinaus.
Inzwischen ruhte das Musikinstrument des hl. Vitus in seinem Silberschrein, widerstand dem Zahn der Zeit, überdauerte die Jahrhunderte und geriet fast in Vergessenheit.
Als 1938 der Schrein anlässlich der Tausendjahrfeier von Sta. Felicità erneut geöffnet und das hl. Glied den Blicken des Publikums preisgegeben wurde, nahm ein gewisser Luigi Risotto, Gymnasiallehrer in Tarent und im Ersten Weltkrieg an eben jener Stelle versehrt wie einst der berühmte Abaelard zu Paris, die Reliquie besonders gewissenhaft in Augenschein. 1939 erschien im Tarentiner Blättchen für Lehrerbildung ein Aufsatz, in dem Luigi Risotto die Echtheit der Reliquie entschieden bezweifelte. Er nannte es einen ungeheuren Skandal, dass die katholische Kirche sich noch im 20. Jahrhundert erdreiste, ein Stück Schlauch, noch dazu dieser Länge und Beschaffenheit, als Geschlechtsteil eines Heiligen auszugeben und verehren zu lassen. Das sei Fortschreibung des finstersten Mittelalters und eine unverschämte Verdummung des einfachen gläubigen Volkes, und das zu einem Zeitpunkt, da die große Kulturnation Italien sich anschicke, auch politisch eine der bedeutendsten Nationen der Welt zu werden. Eine Schande sei das, ereiferte er sich.
Bei dem Ding handle es sich, so führte Risotto weiter aus, um nichts anderes als um ein geripptes Stück Schlauch aus hart und brüchig gewordenem Gummiharz, wahrscheinlich das Verbindungsstück einer Wasserpfeife maurischen Ursprungs. Ihm entging in seinem aufklärerischen Elan und seiner einfältigen Gelehrsamkeit, dass dieses Stück Gummi bereits im zehnten Jahrhundert urkundlich erwähnt und 1303 als Reliquie sanktioniert wurde, die Mauren aber erst um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts mit dem Rauchtabak Bekanntschaft machten. Und was die Wasserpfeife betrifft: Sie wurde erst 1612 erfunden, und zwar von einem geschäftstüchtigen Kaffeehausbesitzer namens Ziad Kawadri zu Damaskus, der nach längerem intensiven Nachdenken die Nargileh zur gesteigerten Behaglichkeit der Gäste in seinem Lokal ersann. Von Damaskus aus trat dieser Quell orientalischer Behaglichkeit gurgelnd und blubbernd seinen Siegeszug an durch die muselmanischen Länder bis Budapest und Casablanca, bis Dar-es-Salam und Hyderabad.
Seit 1961 war auf Anweisung Johannes XXIII. eine vatikanische Gelehrtenkommission tätig, um in aller Stille den Reliquien-Dschungel auszuforsten. Es sollten in erster Linie all jene Fälle untersucht werden, die der Verehrung unwürdig, weil abgeschmackt, peinlich oder gar lächerlich seien. Im Verlauf von mehr als fünf Jahren hatte die Kommission 3786 derartiger Fälle zusammengetragen, von denen 1284 tunlichst sofort dem Vergessen anheim gegeben werden sollten. 1544 weitere, von deren Duldung auf längere Sicht abzuraten sei, sollten offiziell unerwähnt bleiben, und 958, die zwar stillschweigend geduldet werden könnten, sollten schließlich nur in Ausnahmefällen offiziell erwähnt werden.
Ein unerwartetes Ergebnis dieser Nachforschung war, dass in mehr als tausend Fällen die Reliquie aus einem Material von schmutzig weißer bis gelblich brauner Färbung bestand, das – wie die Beschreibung regelmäßig lautete – wie sehr altes, rissiges Elfenbein aussehe.
Die päpstliche Kommission erbat Proben von diesem Material und übergab sie dem physikalischen Kabinett des Vatikans, wo sie mit modernsten Methoden – unter anderem auch der Radiokarbon-Methode – untersucht wurden. Dabei machte man eine weitere überraschende Feststellung. Sämtliche Tests nach der Radiokarbon-Methode verliefen negativ, und das konnte nur eines bedeuten: Handelte es sich um organisches Material, also Knochen oder Elfenbein, Gummi oder selbst Bernstein, dann mussten sämtliche Proben älter als 30 000 Jahre sein, denn weiter reicht die Datierung nach diesem Verfahren nicht in die Vergangenheit zurück. Wahrscheinlich waren die Proben sogar älter als 100 000 Jahre. Also konnte es sich weder um den Zeigefinger des Propheten Jeremias, noch um die Schädeldecke Johannes des Täufers, weder um das rechte Fußknöchelchen der hl. Genoveva, noch um das Brustbein des hl. Paulus handeln.
Die Flöte des hl. Vitus – wie nicht anders zu erwarten, unter den peinlichen, tunlichst sofort dem Vergessen anheim zu gebenden Reliquien eingereiht – wich zwar in Färbung und Konsistenz von der Fülle des anderen Materials ab, wies jedoch, als man sie später ebenfalls inkriminierte und untersuchte, dasselbe vorbiblische, ja unbiblische Alter auf. Des hl. Vitus echtes Glied musste als verschollen gelten. Was der Fischer Rossi nach Seenot und unter größten Mühen im Netz aus den Tiefen des Meeres geborgen hatte, war indes mit einem Mal erheblich interessanter – auch für die Gelehrten des päpstlichen physikalischen Kabinetts. Was sich da am Horizont als unscheinbare Trübung zu erkennen gab, konnte sich zu einem Sturm auswachsen, der geeignet war, an den Grundfesten der Heilsgeschichte zu rütteln. Wenn sich die Vermutungen als richtig erwiesen, konnte diese Entdeckung von ungeheurer Tragweite sein.
Und sie sollten sich als richtig erweisen.
Am 2. März 1969 traf in Palermo eine Gesandtschaft Pauls VI. ein. Sie überbrachte dem Erzbischof von Palermo ein persönliches Handschreiben des Hl. Vaters, in dem dieser seine Eminenz bat, aus Gründen, die zu verschweigen er allerdringlichsten Anlass hätte, die in Sta. Felicità aufbewahrte Reliquie des hl. Vitus unverzüglich nach Sankt Peter zu überführen. Furchterfüllt müsse er Anzeichen zur Kenntnis nehmen, dass der Antichrist Jahrtausende der Heilsgeschichte mit einem Federstrich zunichte machen, die Welt ihres ersehnten und erlittenen Heils berauben und sie nachträglich in Besitz nehmen könne.
Stirnrunzelnd, da verärgert über den offenkundigen Mangel an Vertrauen des Hl. Vaters in seine Person, der ihn nicht über den Zusammenhang zwischen der schrulligen Reliquie und der drohenden Herrschaft des Antichrist unterrichtete, andererseits aber besorgt wegen der Dringlichkeit der Bitte, gab seine Eminenz Anweisung, den Schrein in Sta. Felicità zu öffnen und den gewünschten Gegenstand wohlverpackt der Gesandtschaft auszuhändigen.
Nach mehr als tausend Jahren der Ruhe ging die Flöte des hl. Veit, Schlauchstück einer Wasserpfeife oder heidnisches Musikinstrument, auf die Reise. Ein Jahrtausend lang als Anachronismus unerkannt, versetzte sie nun plötzlich Physiker, Moraltheologen und Politiker gleichermaßen in Aufregung.
Am fünften März traf die Reliquie in Rom ein und wurde ungesäumt dem Hl. Vater vorgelegt, der sie mit wachsendem Unbehagen in Augenschein nahm, seine schrecklichsten Ahnungen bestätigt sah und sich zum Gebet zurückzog.
Im physikalischen Kabinett hatte man inzwischen weitere Proben untersucht und war zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem Material weder um ein organisches noch um ein anorganisches handeln konnte, sondern dass es sich um ein synthetisches handeln musste. Dasselbe bestätigte sich bei dem etwas andersartigen Material, aus dem die Reliquie aus Palermo bestand. Darüber hinaus ähnelte »Il gazzo di Santa Felicità« ganz verblüffend dem gerippten Schlauch einer Atemmaske, wie sie Düsenjägerpiloten zu tragen pflegen.
Ungeklärt blieb allerdings vorerst die Frage, wie viele Jahrhunderte vor der Erfindung der Kunststoffe derartiges Material auftauchen konnte, das überdies zu jenem Zeitpunkt bereits Spuren extrem hohen Alters aufwies. Die Gelehrten des Vatikans standen vor einem Rätsel. Es gab weder eine wissenschaftliche Theorie, noch war eine technische Einrichtung vorstellbar, mit der sich der Sachverhalt hätte erklären lassen. Die Konsequenzen dieser fast undenkbaren Möglichkeit waren jedoch in höchstem Maße alarmierend.
Papst Paul VI. tagte mit seinen Gelehrten und Ratgebern in Permanenz. Nach langem Zögern rang er sich zu einer Entscheidung durch: Alle verfügbaren und beschaffbaren Proben dieser rätselhaften Materialien seien in eternitatem in den vatikanischen Archiven unter Verschluss zu nehmen und es gelte allerstrengstes Stillschweigen über sie zu bewahren.
So wanderte die Flöte des hl. Veit in das vatikanische Archiv mit der größten Sammlung merkwürdiger Gerätschaften, kurioser Apparaturen, Handschriften und Kunstwerke, die in anderthalb Jahrtausenden zusammengetragen wurde.
Was Paul VI. bei seinem weisen Entschluss aber nicht bedachte, war die Tatsache, dass die CIA sich grundsätzlich für alles interessiert und ihre Schnüffler allgegenwärtig sind. So hat der amerikanische Geheimdienst sozusagen auch ständig eine Nase unter dem Hl. Stuhl, um jedes päpstliche Lüftchen zu registrieren, das dem Pentagon ins Gesicht blasen könnte. Und so bekam man in Washington bald Wind von den rätselhaften Funden und der Besorgnis im Vatikan – und wenig später Unmengen an Fotos und einige Proben des seltsamen Materials.
Captain Francis reckte kampflustig das Kinn, als er die auf seinem Schreibtisch ausgebreiteten Fotos mit der Lupe musterte. Was da unverhofft aus dem Vatikan eingetroffen war, passte genau in den gezeichneten Rahmen und zu den beiden Steinchen, die aus den Jahren 1959 und 1968 stammten, aus Algerien und von Gibraltar. Die Glomar Challenger musste mit Bohrungen in der Balearensenke die letzten Steinchen des Mosaiks liefern. Die Vorbereitungen zu dem Deep Sea Drilling Projekt der National Science Foundation würden bald anlaufen, die Gelder für das Forschungsvorhaben standen bereit.
Francis warf einen Blick auf die schon etwas abgenutzten Kapitänsstreifen an seiner Uniformjacke. Es war höchste Zeit, dass er einen Schritt weiterkam, und er spürte befriedigt den Aufwind, den das Projekt mit der Sendung aus Rom erhalten hatte. Er würde auch ihn ganz nach oben reißen. Einer Beförderung zum Admiral stand dann nichts mehr im Wege.
Er zielte mit dem Plastiklineal und erschlug eine Fliege, die sich auf dem gestochen scharfen Foto der Reliquie niedergelassen hatte. Ein Blutfleck verunzierte den Unaussprechlichen des hl. Vitus, aber das störte Captain Francis nicht.
Er schabte sich mit der Kante des Lineals den Nasenrücken und lächelte, wobei er die Oberlippe mit dem schmalen Schnurrbart hob und die Zungenspitze zwischen seine großen gelben Schneidezähne und die Unterlippe schob. Er grunzte zufrieden.
Er war sehr, sehr zuversichtlich.
Der Streitwagen von Gibraltar
Während sich Österreicher und Franzosen im Spanischen Erbfolgekrieg um den Thron stritten, brachten sich die Briten mit sicherem Blick fürs Wesentliche in den Besitz des wichtigsten Stützpunkts im westlichen Mittelmeer. Am Morgen des 4. August 1704 stürmten deutsche Söldner Gibraltar, nahmen es im Handstreich und hissten die Flagge Großbritanniens.
Der Dschebel al-Tarik, der Felsen des Tarik, so benannt nach dem berühmten arabischen Feldherrn, der hier mit seinen Truppen 711 Fuß fasste, um die Pyrenäenhalbinsel zu überrennen, ist ein Klotz aus Jurakalk, der zusammen mit dem auf afrikanischer Seite westlich von Ceuta gelegenen Dschebel Musa einen schmalen Riegel bildete, der einst den Atlantik vom Mittelmeer trennte. Da im Mittelmeerbecken mehr Wasser verdunstet, als ihm von Flüssen zugeführt wird, ist ein ständiger Zustrom von Wasser aus dem Atlantik die Folge. Diese Wassermengen haben im Laufe der Jahrmillionen eine Bresche von mehr als 300 Metern Tiefe und 24 Kilometern Breite gesägt: die Straße von Gibraltar. In die südliche Flanke des Felsklotzes von Gibraltar frästen sie zwei Terrassen, den Windmill Hill und die Europa Flats, die zur Punta de Europa hin abfallen und sich geradezu ideal zur Befestigung eignen. 1714 mit dem Friedensvertrag von Utrecht im Besitz bestätigt, begannen die Engländer mit dem Ausbau zum Flottenstützpunkt.
Es hat in Spanien nie an Stimmen gefehlt, die die Rückgabe forderten; es gab sogar einige Eroberungsversuche, die jedoch kläglich scheiterten. Aber da England für die Spanier meist ein willkommener Verbündeter gegen Frankreich war, wie etwa während der Napoleonischen Kriege, blieb die britische Stellung, von der aus sich alle Flottenbewegungen zwischen Mittelmeer und Atlantik überwachen lassen, unangefochten.
Als Napoleon von der Bühne der Geschichte abgetreten war, mehrten sich wieder die Stimmen im Lande, die für eine »Befreiung« des Felsens plädierten. Zwar hatten die Stimmen kein Gewicht und die politischen Hitzköpfe waren mit der liberalen Revolution, mit der französischen Intervention und anschließend mit einem blutigen Bürgerkrieg zwischen Karlisten und den Anhängern der Regentin vollauf beschäftigt, doch da in Spanien alles, was auch nur entfernt nach Reconquista klingt, die nationalen Leidenschaften zu entzünden vermag, taktierten die Engländer auf Gibraltar behutsam und unauffällig. Jeder Zusammenstoß mit Einheimischen musste unweigerlich zu Querelen mit den europäischen Großmächten führen, die den Briten die strategische Position neideten und jede Schlägerei zwischen Matrosen der Royal Navy und spanischen Fischern zum »Freiheitskampf« emporstilisieren würden. Deshalb entschloss sich 1843 der Kommandant des Stützpunkts, Sir Walter Griffith, die Befestigungen über der Sandnehrung nordöstlich des Moorish Castle verstärken zu lassen. Im Herbst 1843 begannen die ersten Schanzarbeiten.
Das Gelände sollte möglichst unauffällig verändert werden, um den Nationalisten die Absicht zu verhehlen und nicht peinlichen Fragen in Madrid ausgesetzt zu sein. Die Leitung dieser Arbeiten lag in den Händen von Oberst Frank Gilmore, eines im Festungsbau erfahrenen Offiziers, der bereits in Ägypten als Berater Mohammed Alis tätig gewesen war, bevor sich dieser mit Großbritannien überwarf, und die Londoner Konvention gegen den abtrünnigen Statthalter der Pforte geschlossen wurde. Gilmore war ein begeisterter Amateurarchäologe und bei Ausgrabungen in Nubien dabei gewesen. Von den anderen Offizieren wurde er scherzhaft »Gilmore Pascha« genannt.
Es wurden zunächst der lichte Buschwald abgeholzt und Gräben gezogen – angeblich um das Wassereinzugsgebiet für das südwestliche Reservoir zu erweitern. Um die Fundamente für die Kasematten in den gewachsenen Fels zu setzen, ließ Gilmore Pascha die Wurzelstöcke ausgraben und das lockere Erdreich – vor allem Mergel und Tonschiefer – abtragen. In etwa acht Fuß Tiefe stieß man auf eine harte Tonschicht. Gilmore ließ einen Stollen hineintreiben, um ihre Stärke festzustellen. Die Arbeiter waren mit ihren Spitzhacken kaum drei Fuß tief eingedrungen, als Ton zutage trat, der mit Rost durchsetzt schien.
Der Oberst ließ die Arbeiten sofort einstellen, um das Material zu untersuchen. Es handelte sich in der Tat um sehr stark verwittertes Eisen, aber auch um Spuren anderer Substanzen, darunter stumpfe Splitter eines granulierten Materials, bei dem es sich möglicherweise um Glas handeln mochte.
Daraufhin ließ Gilmore vorsichtig ein zwanzig mal zwanzig Fuß großes Areal Zoll für Zoll waagrecht abgraben, weil er zu Recht vermutete, auf ein Artefakt gestoßen zu sein. In etwa zwei Fuß Tiefe stieß man auf weitere Rostspuren, und tags darauf zeichnete sich an der Grabungsstelle ein rechteckiger Umriss von etwa sechs mal zwölf Fuß Größe ab.
Oberst Gilmore fertigte eine maßstabgetreue Zeichnung des Umrisses an und ließ weiter Schicht für Schicht abdecken. Nach jeweils fünf Zoll Tiefe wurde der Umriss von neuem genau vermessen und eine weitere maßstabgetreue Skizze angefertigt, um den völlig verwitterten Gegenstand anschließend vertikal rekonstruieren zu können. Nach einem weiteren Fuß Tiefe war Gilmore felsenfest davon überzeugt, dass es sich nur um ein Artefakt handeln konnte. Als sich in zweieinhalb Fuß Tiefe der rechteckige Umriss zunächst auf einer Seite und in dreieinhalb Fuß Tiefe in seiner ganzen Fläche mit Rostspuren füllte, erkannte Gilmore, dass er die Überreste eines kastenähnlichen Gebildes vor sich hatte, wahrscheinlich eines Wagens, möglicherweise eines antiken Streitwagens, der hier im Schlamm versunken war. Der Schlamm musste ins Innere des Gefährts eingedrungen sein und den Innenraum völlig ausgefüllt haben wie der stützende Kern einer Gussform. Dadurch war das Fahrzeug sozusagen aufrecht stehend konserviert worden.
Mit Spatel und Pinsel bewaffnet, suchte Gilmore Pascha die Flanken des »Kastens« ab, um die Reste von Rädern zu finden, zunächst jedoch ohne Erfolg. Er wollte bereits aufgeben, weil er annahm, dass das Eisengefährt möglicherweise Holzräder besessen hätte, von denen keine Spuren mehr nachweisbar wären, als er vorn und hinten seitliche Auswüchse des »Kastens« entdeckte, die metallischer Natur waren und bei denen es sich sehr wohl um Räder oder Walzen gehandelt haben könnte. Das Fahrzeug hatte ursprünglich also vier Räder besessen, was bei einem antiken Streitwagen eine recht ungewöhnliche Konstruktion gewesen wäre.
Als Oberst Gilmore daranging, den Fund anhand der Horizontalskizzen vertikal zu rekonstruieren, schälte sich ein merkwürdiges Gebilde heraus, das eher einer leichten, niedrigen Equipage glich als jenen gepanzerten Streitwagen, die man von antiken Darstellungen her kannte.
Auf der einen Seite, die Gilmore instinktiv als »vorn« bezeichnete, schien sich ein größerer Metallblock befunden zu haben, der sich etwa bis zur halben Höhe der Seitenverkleidung über die Grundfläche des Chassis erhoben hatte. Ob es sich dabei um eine massive Plattform gehandelt haben mochte, auf dem der Wagenlenker seinen Platz hatte oder Bogenschützen standen, oder um eine Waffe, eine Art Rammbock oder dergleichen, wagte er nicht zu entscheiden. Auf jeden Fall schien das Fahrzeug von eher plumper Konstruktion zu sein und denkbar unpraktisch – unnötig massiv im Chassis und vor allem an der »Plattform«, dagegen fahrlässig schwach gepanzert an den Flanken. Vielleicht hatten sich dort Holz- oder Lederschilde befunden, von denen nichts übrig geblieben war, sagte sich der Oberst. Dennoch war er mit dem Ergebnis unzufrieden, weil er seinen Fund nicht so recht einordnen konnte.
Gilmore hatte selbstverständlich den Kommandanten von der Angelegenheit unterrichtet, und dieser hatte ihm – innerlich amüsiert, aber nach außen hin wie immer sehr formell – gestattet, die Schanzarbeiten an der fraglichen Stelle für einige Zeit zu unterbrechen, damit der Festungsbaumeister sein »ägyptisches Steckenpferd«, wie er es nannte, reiten könne. Sir Walter war allerdings der Meinung, dass es sich bei dem ominösen »Rostfleck« allenfalls um ein Fahrzeug handeln konnte, das den Mauren im Schlamm versunken war, als sie den Dschebel al-Tarik eroberten und von hier aus ihren Nachschub kontrollierten.
Der Oberst widersprach der Meinung des Kommandanten nicht, doch er war Archäologe genug, um zu wissen, dass es sich bei dem »Rostfleck«, nach Beschaffenheit des Untergrunds und Tiefe des Fundorts zu schließen, um ein Artefakt aus vorchristlicher, spätestens karthagischer Zeit handeln musste – wahrscheinlich aber war der Fund noch wesentlich älter.
Diese Vermutung erhärtete sich, als Gilmore Pascha bei neuerlicher Untersuchung der Grabungsstelle auf stark zerfallene Knochenreste stieß, darunter auf einen Schädelknochen, der ein daumennagelgroßes Loch aufwies. Der Lenker dieses Fahrzeugs war also offenbar eines gewaltsamen Todes gestorben.
Was den Oberst indes irritierte, war die Tatsache, dass die Knochenreste in einem Zustand waren, der auf ein weit höheres Alter schließen ließ als drei- oder viertausend Jahre. Gilmore hatte in Ägypten Skelettfunde gesehen, die unter weniger günstigen Umständen als den gegebenen sich mindestens fünftausend Jahre fast vollständig erhalten hatten. Die Tonschicht, in welcher das Fahrzeug steckte, hätte den Leichnam über den zehn- oder gar zwanzigfachen Zeitraum hinaus konservieren müssen.
Oberst Gilmore war ratlos und bat Sir Walter um Erlaubnis, mit dem nächsten Schiff eine Nachricht an die Royal Society in London absenden zu dürfen, damit sich Spezialisten mit dem Fund befassten.
»Ausgeschlossen, Oberst«, entgegnete Sir Walter rundheraus. »Völlig ausgeschlossen. Ich kann es nicht verantworten, dass hier eine Horde Wissenschaftler auftaucht, die mich in der Wahrnehmung meiner militärischen Aufgaben behindert. Die Schanzarbeiten nördlich des Moorish Castle wurden ohnehin schon lange genug verzögert, weil ich Ihren ägyptischen Interessen nachgegeben habe. Ich muss darauf bestehen, dass sie nun zügig fortgeführt und abgeschlossen werden.«
»Aber mit Ihrer Erlaubnis, Sir …«
»Gewiss. Doch Sie werden verstehen, Oberst, dass ich es mir nicht leisten kann, eine Diskussion in der Presse zu provozieren, bei Schanzarbeiten seien auf der Landseite von Gibraltar archäologische Funde gemacht worden.«
»Bei Kanalisationsarbeiten für das Reservoir, Sir.«
Sir Walter winkte ungeduldig ab. »Ich würde einem Archäologen, oder wie Sie diese Leute nennen, doch zutrauen, dass sie Schanzarbeiten von Kanalisationsarbeiten unterscheiden können, Oberst Gilmore.«
»Sir, es könnte sich möglicherweise um einen der wichtigsten vorgeschichtlichen Funde in Europa handeln, und das auf dem Territorium Seiner Majestät.«
»Auf einem militärischen Territorium Seiner Majestät, für dessen Sicherheit ich verantwortlich bin, Oberst Gilmore.«
»Das ist mir selbstverständlich bekannt, Sir. Aber bitte verstehen Sie auch meine Situation. Ich bin kein ausgewiesener Archäologe, mir fehlen die Hilfsmittel und Möglichkeiten zu einer eingehenden Untersuchung, vor allem zu einer genaueren Datierung. Der Wissenschaft könnte ein unersetzlicher Verlust entstehen. Ich möchte die Verantwortung nicht länger allein tragen …«
»Die Verantwortung überlassen Sie getrost mir, Oberst. Außerdem habe ich den Eindruck, dass Sie Ihren Fund etwas überschätzen. Sie tun ja geradezu, als hätten Sie das Gerippe eines Elefanten von Hannibals Armee entdeckt. Wahrscheinlich ist ein spanisches Bäuerlein im Rausch bei Nacht und Nebel vom Weg abgekommen und mit seinem Mistkarren im Sumpf abgesoffen. Wir wollen doch nicht so viel Aufhebens um diesen Rostfleck machen. Ich muss wohl nicht deutlicher werden, Oberst. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden.«
»Jawohl, Sir.«
Es war sinnlos. Sir Walter blieb bei seiner Entscheidung. Allerdings gestattete er Gilmore Pascha, einen befreundeten Lichtbildner in London, der eine Zeit lang in Reading Talbots Gehilfe gewesen war und heimlich nach dessen neuem Verfahren arbeitete, zu benachrichtigen und ihn zu bitten, nach Gibraltar zu kommen, um ein paar fotografische Aufnahmen von der Fundstelle zu machen.
Drei Wochen später war Archibald Wesley zur Stelle und belichtete etwa vierzig Platten, um den Rostfleck für die Nachwelt festzuhalten und für eine nachträgliche wissenschaftliche Auswertung zu retten. Sowohl ihm als auch Oberst Gilmore wurde zur Auflage gemacht, vorläufig nichts über die Angelegenheit zu publizieren. Daraufhin wurden die Schanzarbeiten weitergeführt und der Rest der Tonschicht abgegraben.
Als Oberst Gilmore 1846 in den Ruhestand trat, hätte ihn gewiss niemand mehr daran zu hindern versucht, über seinen Fund zu berichten, aber merkwürdigerweise sah er davon ab. Vielleicht hatte sein innerer Widerstreit zwischen Forscherinteressen und militärischer Loyalität sich endgültig zugunsten letzterer entschieden. Wahrscheinlicher aber ist, dass er zu dem Schluss gelangt war, als Amateur mit seinen Skizzen und technisch noch recht unzureichenden fotografischen Aufnahmen die Fachwelt nicht überzeugen zu können, er sich im Gegenteil heftiger Kritik ausgesetzt hätte, weil es ihm nicht gelungen war, Sir Walter in wünschenswertem Maße die Wichtigkeit des Funds und die Notwendigkeit einer eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung durch Spezialisten klar zu machen. Seltsamerweise kam ihm nie zur Kenntnis, dass zwei Jahre nach seinem Rückzug ins Privatleben in Gibraltar ein weiterer Fund gemacht wurde. Man stieß bei erneuten Schanzarbeiten auf den Schädel eines Vormenschen, den man jahrzehntelang für den eines Menschenaffen hielt. Sir Walter Griffith war zu dem Zeitpunkt nicht mehr Kommandant von Gibraltar. Der Fund wurde in Fachkreisen bekannt, fand aber erst hundert Jahre später – nach den Forschungen der Leakeys – das Interesse der Spezialisten.
Als Gilmore Pascha am 25. Dezember 1874 hochbetagt in seinem Landhaus in der Nähe von Chatham bei London starb, fielen seine Unterlagen, den rätselhaften Streitwagen bei Gibraltar betreffend, der Vergessenheit anheim.
Sein Enkel, Edward George Gilmore jr., ein erfolgreicher junger Architekt und begeisterter Automobilist, gab 1898 das Landhaus bei Chatham auf, um es zu renovieren und an einen reichen Textilfabrikanten aus Manchester zu verkaufen. Vor dem Umzug nach London Westend, wo er sich ein Haus gebaut hatte, machte sich Edward Gilmore jr. persönlich die Mühe, die zum Teil uralten Papiere und Briefe, die sich auf dem geräumigen Speicher des Landhauses angesammelt hatten, zu sichten, bevor er sie verbrannte. Dabei stieß er auf ein Bündel mit zweiunddreißig ziemlich stark vergilbten Fotografien, die auf der Rückseite in der Handschrift seines Großvaters säuberlich beschriftet waren, auf denen er aber nichts zu erkennen vermochte als die schwungvoll gestaltete Firmenbezeichnung »Archibald Wesley, Calotype Atelier, Chiswick« in der rechten unteren Ecke. Beigefügt waren ein sorgfältig verschnürtes kleines Papierpäckchen, das indes nur graubraunen, mit harten Krümeln durchsetzten Staub enthielt – offenbar Knochenstaub, dachte Mr. Gilmore jr., bevor er es achtlos wegwarf – und ein Bündel Skizzen von der Hand seines Großvaters, darunter eine Zeichnung, auf der sich unschwer ein Automobil erkennen ließ.
Mr. Edward G. Gilmore jr. hielt den Atem an. Das Blatt trug das Datum: 12. März 1844. Moment mal, dachte er. Hatte der alte Oberst sich etwa heimlich als Erfinder betätigt? War er bereits 1844 drauf und dran gewesen, ein Automobil zu konstruieren? Seines Wissens hatte der alte Gilmore sich weniger für Technik als vielmehr für Ausgrabungen interessiert.
Mr. Gilmore betrachtete mit geübtem Auge die Zeichnung von allen Seiten. Die übrigen Skizzen stellten Risszeichnungen dar, die das Fahrzeug in verschiedenen Querschnitten zeigten. Um eine Kutsche handelte es sich auf keinen Fall, eher um ein Automobil, auch wenn es von recht merkwürdiger Form war, darauf deutete der Motorblock vorn hin. Er ging den gesamten Nachlass seines Großvaters durch, um weitere Hinweise auf dessen Erfindertätigkeit zu entdecken, aber vergeblich. Möglicherweise hatte es sich um ein Gerät für Erdbewegungsarbeiten oder um ein militärisches Vehikel gehandelt, das bei irgendeinem Spezialeinsatz oder im Festungsbauwesen Verwendung gefunden haben musste.
Mr. Gilmore jr. verlor das Interesse. Immerhin schien ihm der Fund bedeutsam genug, um ihn in seinem Tagebuch zu erwähnen und Skizzen wie Fotografien aufzuheben und mit nach London zu nehmen, als er einige Wochen später in sein neues Haus zog.
Dort ruhte Gilmore Paschas Nachlass, bis an einem verregneten Samstagnachmittag im September 1968 Patrick Geston, seit 1966 verehelicht mit Catherine Geston, geborene Gilmore, Enkelin des Architekten Edward G. Gilmore jr. und Tochter des Bauunternehmers Arthur Edward Gilmore, in einem Anfall von Nostalgie das Tagebuch des Großvaters seiner Frau zur Hand nahm und darin schmökerte. Dabei stieß er auf jene Eintragung über das automobilähnliche Vehikel, das sein Vorfahr angeblich 1844 skizziert habe. Darunter stand in der säuberlichen Druckschrift des erfolgreichen Jugendstil-Architekten: »Es sind noch weitere Risszeichnungen und auch 32 Fotografien dabei, die jedoch leider schlecht fixiert wurden. Es sind nur Flecken darauf zu erkennen.«
Patrick Geston, Deutsch- und Englischlehrer, auch Gelegenheitsübersetzer, Liebhaber von Science Fiction und all der Literatur, die sich mit den Grenzen der Wissenschaft befasst und den Dingen, die jenseits dieser Grenzen liegen, wurde stutzig. Er trank sein Bier aus, kletterte auf den Speicher und durchstöberte Truhen und Pappschachteln, Kisten und Körbe. Schließlich wurde er fündig.
In einem festen braunen Kuvert, auf dem mit Tinte in denselben schönen Druckbuchstaben der Architektenschrift »Großvater Gilmore Paschas Automobil« geschrieben stand, steckte der gesuchte Packen. Zuoberst befand sich die Zeichnung des »Automobils«.
Geston zuckte zusammen, als hätte er einen elektrischen Schlag erhalten.
Das Ding war unverkennbar ein Jeep oder Landrover, auch wenn die Form nicht ganz stimmte. Kotflügel und Räder fehlten, und die Kühlerhaube lag tiefer, so als sei sie abgesackt.
Wo um alles in der Welt war der alte Oberst Gilmore im Jahre 1844 einem Jeep begegnet? Zu einem Zeitpunkt, da noch nicht einmal der Benzinmotor erfunden war?
Geston atmete tief durch und hielt die Blätter so vorsichtig, als drohten sie, ihm zwischen den Fingern zu Staub zu zerfallen. Wahnwitzige Ideen von Zeitsprüngen und Zeitreisen schossen ihm durch den Kopf: Die Story »Hawk among the Sparrows« von Dean McLaughlin, die zwei Monate zuvor in Analog erschienen war. Und die Zeitreisegeschichte eines deutschen Autors, dessen Name ihm nicht mehr einfallen wollte, die er in einem Science-Fiction-»Fanzine« gelesen hatte.
Er eilte hinunter in sein Arbeitszimmer und breitete mit zitternden Fingern die Fotos auf seinem Schreibtisch aus. Eine herbe Enttäuschung. Sie waren völlig vergilbt und wiesen braune Flecken auf. Einige davon zeigten bei exaktem Hinsehen zwar eine regelmäßige Struktur, aber was genau sie darstellten, daraus wurde er nicht schlau.
Dann legte er die achtundzwanzig Skizzen, chronologisch nach den Datumsangaben auf der Rückseite geordnet, hintereinander. Es war ihm sofort klar, dass es sich dabei um Querschnitte durch den »Jeep« handelte, und zwar von oben nach unten. Schließlich entdeckte er auch Ähnlichkeiten zwischen der Fleckenstruktur einiger der Aufnahmen und den Skizzen, die die untersten Querschnitte darstellten. All dies wies auf das Protokoll einer Ausgrabung hin.
Geston eilte hinaus ins Wohnzimmer und fragte atemlos seine junge Frau: »Was hat der alte Gilmore gemacht, Oberst Gilmore, dein Ur-Urgroßvater?«
Mrs. Geston blickte erschrocken von dem Buch auf, in dem sie las. Ein Regenschauer trommelte gegen die Fensterscheiben. »Was meinst du damit, was hat er gemacht?
Offizier war er. Ich glaube, Festungsbaumeister oder so was. Warum willst du das plötzlich wissen?«
»Und warum nannte man ihn Pascha?«, setzte Patrick nach, ohne auf ihre Frage einzugehen.
»Herrje, was weiß ich? Doch – warte mal! Ist er nicht eine Zeit lang in Ägypten gewesen? Ich glaube, er ist in Ägypten gewesen.«
Ägypten! Das Wort wirkte auf Patrick Geston wie ein magisches Zeichen. Er eilte in die Küche, holte sich eine Büchse Bier aus dem Kühlschrank und riss sie mit zitternden Fingern auf, um den Sand des ganzen Orients hinunterzuspülen, der sich plötzlich auf seinen Schleimhäuten abgelagert zu haben schien.
»Und wann war das?«, fragte er, als er ins Wohnzimmer zurückkehrte.
»Keine Ahnung, aber das muss sich doch feststellen lassen.«
Es ließ sich feststellen. Oberst Frank Gilmore war zum fraglichen Zeitpunkt nicht in Ägypten gewesen. Er war 1840 von Alexandria nach London zurückgekehrt und im Jahr darauf nach Gibraltar abkommandiert worden, wo er bis zu seiner Pensionierung 1846 den Ausbau der Befestigungsanlagen geleitet hatte.
Gibraltar?
Geston war enttäuscht, doch er gab nicht auf. Er schrieb an die Royal Society und an die National Geographic Society, ob in oder bei Gibraltar Mitte der vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts archäologische Ausgrabungen durchgeführt worden seien. Von beiden Institutionen erhielt er den Bescheid, dass von archäologischen Grabungen in oder bei Gibraltar nichts bekannt sei, weder zur fraglichen Zeit noch zu einem späteren Zeitpunkt. Allerdings seien 1848 bei Schanzarbeiten Schädelreste eines Menschenaffen gefunden worden, die man neuerdings eher für die eines Vormenschen halte.