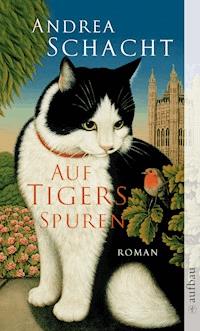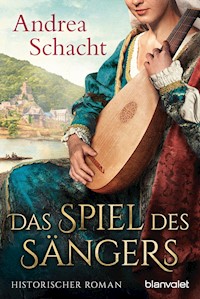7,99 €
7,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Die Schwestern Anita und Rose haben im Nachlass ihres Vaters einige Tagebücher entdeckt, die eine junge Frau vor etwa zweihundert Jahren in Köln verfasst hat. Zu dem Bündel gehört auch ein Lilienring mit der Gravur »Mors Porta Vitae«. Anita und Rose ziehen sich mit ihrem spannenden Fund in die Bretagne zurück und tauchen bald schon ein in die dramatische Geschichte der jungen französischen Adeligen Marie-Anne, die sich im Jahr 1811 aus Angst vor den Revolutionstruppen nach Köln durchgeschlagen hat …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
©2004 by Blanvalet Verlag, einem Unternehmen der
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlagmotiv: Bridgeman Redaktion: Petra Zimmermann SK ·Herstellung: Heidrun Nawrot
ISBN 978-3-641-03063-6V002www.blanvalet.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
Lob
Dramatis Personae
In der Gegenwart
Vorwort
1. Kapitel – Sphärentanz
2. Kapitel – Der Staatsanwalt
3. Kapitel – Neue und alte Geschichten
Unterlagen 1
4. Kapitel – Bretagne, 1795 – Flucht
Gegenwart
5. Kapitel – Zeugnisse der Vergangenheit
Unterlagen 2
6. Kapitel – Cologne um 1810
7. Kapitel – Ein Ball im Gürzenich und seine Folgen
Tagebuch 1 – Mors Porta Vitae
8. Kapitel – Ein Vorstellungsgespräch
9. Kapitel – Alltag im Hause des Kommerzialrates
10. Kapitel – Ein unangenehmer Verdacht
Tagebuch 2
11. Kapitel – Schmuggelfahrt
12. Kapitel – Beim Sous-Préfet
13. Kapitel – Kinderkrankheiten
14. Kapitel – Der Herbstball
Gegenwart
15. Kapitel – Denise
16. Kapitel – Ein Geständnis
Tagebuch 3
17. Kapitel – Der Brand im Wachhaus
18. Kapitel – Feiertage im Haus des Kommerzialrates
19. Kapitel – Erste Spuren
20. Kapitel – Ferien auf dem Lande
21. Kapitel – Skandale
22. Kapitel – Eine Mondfinsternis
23. Kapitel – Das Grab des Römers
Gegenwart
24. Kapitel – Helden und Götter
25. Kapitel – Ferien am Meer
Tagebuch 4
26. Kapitel – Madames Verärgerung
27. Kapitel – Wiedersehen mit alten Freunden
28. Kapitel – Graciellas Leiden
29. Kapitel – Nacht im Hause des Kommerzialrates
30. Kapitel – Glückliche Tage
31. Kapitel – Ein Kaiser auf Abwegen
Tagebuch 5
32. Kapitel – Die goldene Fibel
33. Kapitel – Sabotage
Gegenwart
34. Kapitel – Chateau Kerjean
35. Kapitel – Die Kreise der Planeten
36. Kapitel – Mehr als das Leben
Copyright
Buch
Köln im Jahre 1811. Marie-Anna, eine junge französische Adelige, flieht vor den Revolutionstruppen nach England und schlägt sich von dort nach Köln durch. Dort erhält sie von ihrem Geliebten, einem Schauspieler, einen Lilienring als Geschenk – mit der Inschrift »Mors Porta Vitae«. Da ihr Geliebter sich jedoch mit den französischen Besatzern anlegt, wird er bald darauf verhaftet, und Marie-Anna mit ihm. Doch der Sous-Préfet Faucon begnadigt sie – unter einer Bedingung: dass sie für ihn Spitzeldienste im Haus des reichen Kunstsammlers Valerian Raabe leistet. Marie-Anna hat Glück. Sie wird von der Hausherrin Ursula liebevoll aufgenommen, die Tochter Graciella freundet sich rasch mit ihr an, und auch Rosemarie, die Nichte des Hausherrn, ist ihr herzlich zugetan. Marie-Anna kann Faucon tatsächlich mit einigen Informationen dienen, doch den Dieb findet sie nicht.
Dann verunglückt die Dame des Hauses bei einem Unfall tödlich – und Rosemarie steht neben ihr, mit den gestohlenen Schmuckstücken in der Hand. Die Lage scheint eindeutig, und so wird Rosemarie des Mordes angeklagt. Marie-Anna ist fest von deren Unschuld überzeugt. Aber erst als das Mädchen Graciella ihr ein ungeheuerliches Geständnis macht, sieht sie eine Chance, ihre Freundin zu retten…
Autorin
Andrea Schacht, Jahrgang 1956, war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin in der Industrie und als Unternehmensberaterin tätig, hat dann jedoch den seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. Sie lebt heute als freie Autorin mit ihrem Mann bei Bad Godesberg.
Von Andrea Schacht bei Blanvalet:
Die »Ring-Saga« im Blanvalet Taschenbuch:Der Siegelring (TB 35990) – Der Bernsteinring (TB 36033) – Der Lilienring (TB 36034)
Die historischen Romane um die Begine Almut Bossart:Der dunkle Spiegel (geb. Ausgabe 0156) Das Werk der Teufelin (geb. Ausgabe 0157) Die Sünde aber gebiert den Tod (geb. Ausgabe 0204) Die elfte Jungfrau (TB 36780)
Die Lauscherin im Beichtstuhl (TB 36263) Kreuzblume (geb. Ausgabe 0220) Rheines Gold (TB 36262)
Ich bin in vielen Gestalten erschienen,bevor ich die passende Form fand.
TALIESIN, KELTISCHER BARDE
Dramatis Personae
In der Franzosenzeit
Marie-Anna de Kerjean, eine Tochter aus vornehmem französischem Hause, die vor der Revolution nach Köln flieht – ein leichtes Hemd und leichte Beute.
Rosemarie Klein, die Tochter eines verbitterten Professors, sie arbeitet als Archivarin und arme Verwandte an Raabes Kunstsammlung, wird aber so nach und nach entstaubt.
Valerian Raabe, Kolonialwarenhändler und begeisterter Sammler von Antiken und Kirchenschätzen. Ihm blieb in seiner Jugend einmal die Luft weg, weshalb er dauerhaft heiser ist.
Romain Faucon, der Sous-Préfet von Köln, der Informationen braucht und über Informationen verfügt. Manchmal auch über zartere Gefühle.
Markus Bretton, Sohn eines Pfandleihers und fescher Stadtsoldat, der aber quittieren muss und die einträgliche Laufbahn als Hehler einschlägt.
Jules Coloman, Marie-Annas etwas unzuverlässiger Geliebter, ein Schauspieler, der sich beim Verbreiten aufrührerischer Verse erwischen lässt.
Ursula Raabe, Gattin von Valerian Raabe, die nur ihr eigenes Wohlergehen im Auge hat und zur Befriedigung ihrer Gelüste eine neue Finanzierungsform findet.
Graciella Raabe, Tochter der beiden, der Tod ihrer Mutter.
In Cologne und auf dem Gut
Fabien DuPont, ein Munizipalbeamter, Professor Klein, der Kustos, Mathilda, die Hausdame, Berlinde, Die Schwägerin von Valerians Gattin, Yannick und Guenevere, ihre Kinder, Frizzi, eine Tänzerin, die Großeltern Raabe, Helga, die Köchin und Berolf, der Baumeister.
In der Bretagne
Brior de Kerjean, Marie-Annas Vater, Denise, ihre Mutter, Sophy, ihr Kindermädchen, Germain, der Verwalter, Charles, sein Sohn, Sir Garret, ein Handelspartner.
In der Gegenwart
Anahita Kaiser, genannt Anita – die einen schweren Unfall überstanden hat, der ihr Leben einschneidend verändert. Mehr noch verändern sie aber die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Herausforderung der Zukunft.
Rosewita van Cleve, genannt Rose – Anitas Halbschwester, die gemeinsam mit ihr den Weg in die Vergangenheit zurückgeht und dabei in der Gegenwart ihre Berufung als Künstlerin findet.
Caesar King, bürgerlich Julian Kaiser - Anitas und Roses Vater, ein Schlagersänger, durch mysteriöse Umstände zu Tode gekommen. Noch mysteriöser aber sind Tagebücher und Briefe, die er seinen Töchtern hinterließ.
Uschi Kaiser – Anitas Mutter, die weder mit der Vergangenheit noch mit der Gegenwart besonders gut klarkommt und daher häufig recht irrational reagiert.
Gracilla Valerie van Cleve, genannt Cilly – die jüngere Schwester von Rose, die die Zukunft vor sich hat und für Geschichten aus der Vergangenheit schwärmt.
Marc Britten – abenteuerlustiger Fotograf mit unerwartetem Einfühlungsvermögen und wider Erwarten leicht zerbrechlichem Herzen.
Falko – eine mögliche Zukunft für Rose.
Valerius – die einzig mögliche Zukunft für Anita.
Weitere Personen im Leben der Heldinnen: Tilly, die Haushälterin, Frederika Klosters, Kommissarin, Dr. Fabian Pönsgen, Richter, Valentin Cornelius, ene jote Frönd, Jan, ein noch viel besserer Freund, Denise, eine unerwartete Freundin, Cosy, eine Sekretärin und Sophia, Roses und Cillys Mutter.
Vorwort
Es ist nicht nur die Glockengasse 4711, die lebendiges Zeugnis der französischen Vergangenheit Kölns gibt. Auch die beeindruckenden Kunstsammlungen, die in jener Zeit entstanden, sind in den Museen noch heute eine inspirierende Quelle für jeden Schriftsteller. Ob mittelalterliche Gemälde oder römische Skulpturen – diese Kunstwerke wurden damals – auf sicher nicht immer rechtmäßige Art – zusammengetragen. Das Interesse an der Historie, vor allem an der Antike, fand gerade in Köln und im Umland reiche Nahrung. Dass zufällig bei Bauarbeiten ein vollkommen erhaltenes römisches Grab gefunden wurde, war keine Besonderheit.
Meine Heldin Marie-Anna darf also darin ihre Verknüpfung zu ihrer persönlichen Vergangenheit erkennen.
Als die französischen Besatzungstruppen vor rund 200 Jahren in die Stadt am Rhein einzogen, befand Köln sich in einem traurigen Zustand des Verfalls. Nicht nur die Bauwerke, auch die Gesinnung der dort lebenden Menschen war marode. War sie im Mittelalter als führende Handelsstadt noch aufgeblüht, hatte sich zu einer weltoffenen, heiteren Metropole entwickelt, so hat ihr die Neuzeit mit der Entdeckung Amerikas und den daraus sich verlagernden Handelsplätzen den Garaus gemacht. Der geistigen Wandlung durch Luthers Reformation versperrten sich die Kölner und erstarrten in ihren alten Traditionen.
Napoleon erst, der die neuen Ideen der französischen Revolution und seine eigenen genialen Verwaltungsvorschriften mitbrachte, gab Köln den notwendigen Tritt in die Seite, damit es wieder zu einer florierenden Stadt wurde. Die verkrusteten mittelalterlichen Zunftordnungen wurden aufgebrochen, Handel und Handwerk liberalisiert, das Rechtswesen reformiert, die Infrastruktur verbessert, die Häuser gezählt und durchnummeriert und die reichen kirchlichen Pfründe aufgelöst.
Mit durchaus positiven Folgen.
Aber nicht nur.
Wie üblich bringt eine Besatzung gleichzeitig Ärger mit sich. Sabotage ist ein Begriff, der aus jener Zeit stammt.
Doch wie konnten sie nur, die Franzosen – sie hatten sich des denkbar himmelschreiendsten Unrechts schuldig gemacht: Sie verboten den Kölner Karneval!
Köln hat auch das überlebt, und die Spuren der Vergangenheit sind, wenn man ein Auge dafür entwickelt, an jeder Ecke erkennbar. Eine Stadt überlebt, weil die Menschen in ihr es können. So, wie es Marie-Anna gelingt, aus dem persönlichen Elend zu neuem Glück zu finden.
1. Kapitel
Sphärentanz
Sie starb, und es wurde dunkel um sie. Das Gesicht ihres Geliebten war das Letzte, was sie mit ihren schwindenden Sinnen wahrnehmen konnte. Dann begann ihre Wanderung durch die Unendlichkeit, ohne Angst, wissend, dass sie sie finden würde – die himmlischen Sphären, die die Welt umspannten. Nicht das Fegefeuer wartete auf sie, nicht die Qualen der Hölle, aber auch nicht die Tore des Paradieses. Sie bewegte sich durch die Dunkelheit auf die fernen Lichter zu. Nach und nach verblich alles, was sie auf Erden erlebt hatte.
Sie wandelte lange, und es lösten sich Wehmut, Schmerzen und Trauer auf. Das tiefste Gefühl jedoch, das sie empfunden hatte, war bei ihr geblieben – ihre Liebe vergaß sie nie, und die Sehnsucht blieb immer bei ihr.
Sie tanzte zur Sphärenmusik mit den Sternen, doch plötzlich war die Konstellation der Himmelslichter so verlockend, dass sie nicht widerstehen konnte.
Und im Jahre 1783, kurz bevor die französische Nation in Flammen aufging, wurde in einem kleinen Schloss in der Bretagne, zur übergroßen Freude der Eltern, eine Tochter mit goldenen Haaren geboren. Sie nannten sie Marie-Anna.
2. Kapitel
Der Staatsanwalt
Er hatte unerwartet schnell die Stelle übernehmen müssen. Sein Vorgänger war in den vorzeitigen Ruhestand gegangen und hatte ihm einen Haufen halb oder vollkommen unerledigter Fälle hinterlassen. Einer brannte dem neuen Staatsanwalt aus den verschiedensten Gründen gewaltig unter den Nägeln. Doch dem Neuen war nicht umsonst bei den Kollegen der Spitzname »Meister Fix« vorausgeeilt. Dieser Name bezog sich nicht nur auf die mittelalterliche Bezeichnung für den Henker, sondern beschrieb auch seine Arbeitsmethode passend. Falko Roman war ein schneller und gründlicher Arbeiter. Wie gut er aber den Fall in den Griff bekam, der jetzt wieder von neuer Brisanz erschien, das hing nicht allein von seiner professionellen Methodik ab, sondern ebenfalls von einem sehr ungemütlichen Gefühl, das ihn dabei beschlich. Gefühle gehörten zu den Empfindungen, die er, wenn überhaupt, für sein Privatleben reserviert hielt.
Missmutig schlug er die Unterlagen des Vorgangs auf, die der alte Staatsanwalt in der Kategorie »Erledigt« abgelegt hatte. Der Fall war nicht erledigt, selbst ein flüchtiges Studium der Aktenlage zeigte das schon. Dazu waren weder das Interesse der Öffentlichkeit noch die Presseberichte und genauso wenig die plötzlich aufgetauchten Zeugenaussagen notwendig, um zu erkennen, dass hier schlampig gearbeitet worden war.
Im vergangenen Jahr, am siebten Juli, war der Schlagersänger Caesar King, bürgerlich Julian Kaiser, in den frühen Morgenstunden mit seinem Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Er war sofort tot. Was oberflächlich wie ein Unfall aussah, zeigte sich bei näherer Betrachtung diffiziler. Die Autopsie erbrachte nämlich, dass sich eine hohe Dosis Beruhigungsmittel im Blut des Mannes befand. Die Frage, ob es sich um Fahrlässigkeit oder Vorsatz handelte oder ob gar ein Dritter dem Mann die Drogen verabreicht hatte, war nicht geklärt worden. Warum auch immer, die Ermittlungen waren außerordentlich nachlässig durchgeführt worden. Irgendwann nach einem halben Jahr hatte Falko Romans Vorgänger die Untersuchungen für abgeschlossen erklärt und den ganzen Vorfall als Unfall abgetan.
Dabei waren verschiedene Punkte völlig offen geblieben. Zum Beispiel war Julian Kaiser am Vortag seines Todes um sechzehn Uhr von seinem Studio in Köln aufgebrochen, um seinen nächsten Termin um zwanzig Uhr in Koblenz wahrzunehmen. Dort war er nicht angekommen. Wo er die zwölf Stunden bis zu dem Unfall verbracht hatte, wusste niemand wirklich. Angeblich hatte er seine Geliebte besucht. Diese Aussage seiner Frau hatte sich allerdings als Wahnvorstellung erwiesen. Soweit bekannt war, gab es keine Geliebte.
Aber jetzt war ein Zeuge aufgetreten, der sich auf Grund des Presserummels, der eben mal wieder entstanden war, daran erinnerte, Julian Kaiser um siebzehn Uhr gesehen zu haben. Und zwar bei seiner Tochter. Seiner unehelichen Tochter, von deren Existenz bisher niemand in der Öffentlichkeit etwas geahnt hatte, die jetzt aber die Skandalblätter füllte. Diese Rosewita van Cleve hatte den Ermittlern verschwiegen, ihren Vater am Vorabend seines Todes getroffen zu haben. Warum, das war eine außerordentlich interessante Frage. Zumal die junge Frau vor zwei Wochen selbst mit einer bedrohlichen Menge Beruhigungsmittel im Körper ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ein Selbstmordversuch? Oder hatte derjenige, der Julian Kaiser die Drogen verabreicht hatte, es auch bei ihr probiert?
Falko Roman hatte sich im Laufe der Woche noch einige Zusatzinformationen geben lassen und studierte sie an diesem Freitag. Zuletzt nahm er sich die beiden knallig aufgemachten Boulevardzeitungen vor und betrachtete die Fotografien.
»Verdammte Scheiße!«, murmelte er und warf die Blätter ganz entgegen seiner ansonsten so kühlen und beherrschten Art in den Papierkorb.
Rosewita van Cleve und Anahita Kaiser, Töchter von Julian Kaiser, waren keine Unbekannten für ihn. Im Gegenteil – sie waren ihm nur zu gut bekannt. Er griff zum Telefon, um den Mann anzurufen, mit dem ihn, seit er denken konnte, tiefe Verbundenheit und Zuneigung verbanden. Valerius Corvin, der Bruder seiner Mutter, zwölf Jahre älter als er, hatte praktisch Elternstelle an ihm vertreten.
»Valerius, ich habe eine ausgesprochen unangenehme Sache in Erfahrung gebracht. Ich muss dich bitten, in der nächsten Zeit keinen Kontakt mit dieser Anahita Kaiser oder ihrer Schwester aufzunehmen.«
»Warum?«
»Der Fall Julian Kaiser wird wieder aufgerollt. Es besteht Mordverdacht. Die beiden sind darin verwickelt.«
»Falko, könnte es sein, dass du einer gewissen Voreingenommenheit unterliegst?«
»Nein, Valerius. Ich habe genug Material zusammen.«
»Nicht Anita, Junge!«
»Wenn einer voreingenommen ist, dann du, Val.«
Sein Gesprächspartner schwieg.
»Valerius, du hast diese Frau zwei Mal in deinem Leben gesehen. Was weißt du von ihr?«
»Nicht viel, da hast du Recht. Und was weißt du von ihr?«
»Beispielsweise, dass sie zwei Jahre lang mit einem Drogendealer zusammengelebt hat.«
»Und?«
»Mit mindestens einem Drogensüchtigen und einer Medikamentenabhängigen noch im vergangenen Jahr durch die Ferienclubs getingelt ist.«
»Und?«
»Eine nicht zu verachtende Erbschaft gemacht hat.«
»Soweit ich verstanden habe, war sie noch nicht einmal in Deutschland, als ihr Vater starb.«
»Wenn man die Gewohnheiten eines Menschen kennt, kann man ihn auch in Abwesenheit umbringen.«
Erneut herrschte Schweigen in der Leitung.
»Valerius, halte dich von ihr fern. Zumindest, bis wir Klarheit darüber haben, ob wir Anklage erheben müssen.«
»Halte mich auf dem Laufenden, Falko.«
»Natürlich.«
3. Kapitel
Neue und alte Geschichten
Ich war zunächst nur milde erstaunt, als mir die Aufforderung zur Vernehmung ins Haus flatterte. Vor kurzem erst hatte ich die Nachricht erhalten, das Verfahren um den Tod meines Vaters sei eingestellt worden. Aber da die Presse nun mal wieder ihren Spaß daran hatte, einen Prominenten und sein Privatleben durch den Dreck zu ziehen, war es wohl nicht ungewöhnlich, dass irgendwer sich wichtig genug nahm, diesen Fall noch mal juristisch aufleben zu lassen. Wenn die Öffentlichkeit genügend Druck ausübte, mussten die Behörden springen. Also nahm ich die Sache nicht sonderlich ernst und ging gelassen zur Polizei, um mit Kommissarin Klosters, die sich mit dem Vornamen Frederika auf ihrem Kärtchen auswies, zu plaudern.
Es wurde scheußlich!
Warum auch immer, sie hatten in meiner Vergangenheit gewühlt und herausgefunden, dass ich vor fünf Jahren einmal eine Zeit lang in einer Wohngemeinschaft gelebt hatte. Jan und Jennifer, Zwillinge, und ich hatten uns während des Studiums eine große Altbauwohnung geteilt. Es war sehr praktisch und viel gemütlicher für uns alle, als in einem Miniappartement alleine zu wohnen. Aber dann wurde Jennifer krank, unheilbar. Sie wollte allerdings so lange wie möglich die Normalität aufrechterhalten, und so sorgten wir für sie, so gut es ging. Dass Jan ihr Drogen verschaffte, um ihre Schmerzen – und sicher auch ihre Verzweiflung – zu mildern, erfuhr ich erst, als sie gestorben war.
An den Fragen von Kommissarin Frederika merkte ich, welchen bestimmten Verdacht sie hegte. Als Nächstes kam sie nämlich auf Titus zu sprechen. Titus war ein leicht verrückter Däne, der zu dem Team gehörte, in dem ich in den Semesterferien und in den Monaten nach meinem Abschluss in Ferienclubs als Sportanimateurin arbeitete. Wir waren eine Gruppe von sieben jungen Leuten. Nicht alle waren regelmäßig dabei, aber meist traf es sich, dass wir wochenlang zusammenarbeiteten. Es waren Ulla, die einer »besten Freundin« ziemlich nahe kam, die scharfzüngige und witzige Roxane, die an niemandem ein gutes Haar ließ. Grace dagegen war ein labiles Geschöpf, das sich fallweise mit Medikamenten voll stopfte und ansonsten ein reges Liebesleben führte. Marek war ein sanfter Junge, der viel zu viel Mitleid mit allem und jedem und vor allem sich selbst empfand. Dickhäutiger verhielt sich der trottelige Hawkins, der nur bei Sportarten, bei denen es auf Zielgenauigkeit ankam, keine zwei linken Hände hatte. Und völlig egomanisch trat Titus auf, ein perfekter Techniker, der aber frei von jeglicher Kontaktfähigkeit schien. Allesamt hatten am achten Juni des vergangenen Jahres in der Maschine gesessen, die uns nach Rom bringen sollte. Nur ich hatte umgebucht, da ich die Nachricht vom Tode meines Vaters erhalten hatte. Deshalb musste ich mit namenlosem Entsetzen beobachten, wie das startende Flugzeug vor meinen Augen explodierte. Glühende Trümmerteile trafen auch mich, und als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich, in zahllose Verbände gewickelt und an Tropf und Überwachungsapparaturen gefesselt, im Krankenhaus.
Welcherart meine Beziehung zu Titus gewesen sei, wollte die Kommissarin wissen. Und wie ich mich mit Grace verstanden hatte.
Ich gab ihr so detailliert wie möglich Auskunft. Dass Titus gelegentlich einen Joint geraucht hatte, wusste ich. Dass er auch Aufputschmittel genommen hatte, ahnte ich. Vom Koks wusste ich nichts. Graces Tablettenschächtelchen waren legendär. Manchmal hatte ich versucht, mit ihr darüber zu reden, aber dann bekam sie wieder ihre Heulanfälle, und es war besser, wenn sie ihre Glücksbringer einnahm. Ich war schließlich nicht ihre Therapeutin.
Die nächste Frage galt Uschi. Meine Mutter, die sich lange dagegen gewehrt hatte, von mir mit ihrem Namen angeredet zu werden, hatte ebenfalls so ihre Probleme. Nach dem Tod meines Vaters größere als vorher. Ja, auch sie nahm gelegentlich Antidepressiva und Tranquilizer. Und ich selbst?
Ich lachte die gute Frederika an.
»Haben Sie eine Ahnung, was die Ärzte Ihnen alles nach einem Flugzeugunglück verschreiben?«
»Sie standen unter Schock, natürlich. Niemand macht Ihnen Vorwürfe, Frau Kaiser. Aber ich denke, man hat Ihnen bestimmt entsprechende Mittel verschrieben.«
»Hat man, Frau Kommissarin. Ich habe sie aber nicht genommen. Mir langten die Schmerzmittel, die mich reichlich benommen gemacht haben.«
»Besitzen Sie diese Medikamente noch?«
»Die Schmerzmittel habe ich so gut wie aufgebraucht. Die anderen habe ich noch nicht einmal aus der Apotheke geholt.«
»Haben Sie die Rezepte noch?«
»Hat meine Krankenversicherung. Fragen Sie dort nach!«
Langsam wurde meine Kooperationswilligkeit auf eine harte Probe gestellt. Ich hatte den Eindruck, man unterstellte mir auf irgendeine verrückte Art, ich hätte Julian selbst umgebracht.
Als Nächstes kam es dann.
»Hatte Ihr Vater bestimmte Angewohnheiten, Frau Kaiser?«
»Er hatte viele Angewohnheiten. Zum Beispiel konnte er wunderbar Geschichten erzählen. Er las gerne archäologische Fachzeitschriften. In den letzten Jahren hatte er ein Faible für die Esoterik entwickelt. Nicht praktizierend, war aber interessiert an – nennen wir es weltanschaulichen Fragen.«
»Nicht praktizierend?«
»Wenn Sie jetzt wissen wollen, ob er mit bewusstseinserweiternden Drogen experimentiert hat, dann muss ich Sie enttäuschen. Übrigens hatten wir das Thema schon bei der letzten Vernehmung erschöpfend behandelt!«
»Wir haben neue Erkenntnisse.«
»Schön. Welche?«
»Hatte Ihr Vater bestimmte Angewohnheiten, Frau Kaiser?«
»Sie gehen mir ein klein wenig auf den Geist, wissen Sie das?«
»Und Sie sollten sich besser erinnern.«
»Ich könnte genauso gut ganz einfach schweigen.«
Sie wusste, dass ich das Recht dazu hatte.
»Freunde und Kollegen von Ihrem Vater erzählten, er hätte eine kleine Marotte gehabt.«
Jetzt wusste ich, worauf sie anspielte, und mir wurde schlagartig etwas klar.
»Die Bonbons, meinen Sie die?«
Kommissarin Frederika nickte.
»Er hatte immer welche dabei, in jeder Anzugtasche, in jeder Schublade, im Auto... Ja, ich weiß. Er behauptete immer, er brauche sie, um bei Stimme zu bleiben. Ein Sänger eben!«
»Und Sie haben ihm oft solche Bonbons geschickt, nicht wahr?«
»Sicher. Ich habe mir einen Spaß daraus gemacht, ihm entweder besonders exotische oder besonders kitschig verpackte zu schicken.«
»Auch von Ihrem letzten Aufenthalt auf den Kanarischen Inseln aus?«
»Ich denke schon.«
»Kennen Sie diese Dose?«
Sie zeigte mir eine Blechdose mit einem schreiend bunten Bild. Ein spanischer Gitarrenspieler schmachtete unter einem blumenbewachsenen Balkon eine Schöne im Mondlicht an. Ich erinnerte mich daran, Julian die Bonboniere im Juni geschickt zu haben, und nickte.
»Haben Sie die Dose vorher geöffnet?«
»Nein, Frau Kommissarin. Sie war original zugeklebt, als ich sie in das Päckchen legte. Doch bedauerlicherweise sind alle Menschen, die das bezeugen können, inzwischen tot.«
»Wann haben Sie Ihre Schwester zum ersten Mal getroffen?«
»Im August letzten Jahres. Ich habe im Juli erst von ihrer Existenz erfahren. Sie wissen das.«
»Wann haben Sie das erste Mal mit ihr gesprochen?«
»Uns erstmals getroffen und miteinander gesprochen haben wir zum selben Zeitpunkt.«
»Sie haben nicht vorher mit ihr telefoniert?«
»Nein.«
»Sie hat nicht von sich aus Kontakt mit Ihnen aufgenommen?«
»Nein. Wir haben keine heimlichen Briefchen miteinander gewechselt, wenn Sie darauf hinauswollen. Sie wusste von mir, ich wusste nicht von ihr.«
»Wieso wusste sie von Ihnen?«
»Mein Vater erzählte ihr von mir.«
»Trotzdem hat sie nie versucht, mit Ihnen zusammenzukommen?«
»Nein.«
»Sie erbt ein Drittel des Vermögens Ihres Vaters. Hat Sie das betroffen gemacht?«
»Nein.«
»Es ist nicht wenig, was sie da erhält. Im Falle ihres Todes fiele dieses Drittel an Sie.«
»Ja.«
»Wo waren Sie am zehnten April?«
Ich schwieg. Mehr Auskunft bekam Kommissarin Frederika jetzt nicht mehr von mir. Ich hatte keine Lust, mein Liebesleben vor ihr auszubreiten, denn das war es, was an diesem zehnten April meine Zeit in Anspruch genommen hatte. Und schon gar nicht wollte ich Valerius in die Sache mit hineinziehen. Im Übrigen nervten mich ihre unausgesprochenen Unterstellungen allmählich. Sollte sie doch anderweitig ermitteln.
»Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer Halbschwester?«
»Ausgezeichnet.«
»Was verbindet Sie mit Valentin Cornelius?«
Gegen alle Verstimmung musste ich plötzlich laut auflachen. Auf meinem Weg durch das Polizeirevier war ich nämlich diesem Valentin aus dem professionellen Zwielicht begegnet, den ich bei der Suche nach Valerius kennen gelernt hatte. Einer der vielen Irrläufer, doch dieser zeichnete sich durch besonderen Charme aus.
»Hey, Liebschen. Wie isset?«, hatte er gefragt, als er mich erkannte.
»Jot isset!«, antwortete ich ihm in gleicher Mundart.
»Un – hasse ding Macker jefunden?«, wollte er dann grinsend wissen.
»Ja, ich habe ihn gefunden.«
»Schaad, hättst och bei mir ding Auskommen ham können.«
»Vielleicht ein andermal, Valentin!«
»Na dann machet mal jot, ne!«
»Machs och jot!«
Amüsiert und mit einer gewissen Schadenfreude in der Stimme antwortete ich der Kommissarin: »Wissen Sie was? Dazu befragen Sie am besten den Richter Dr. Fabian Pönsgen, der hat uns zusammengebracht. Lassen Sie sich die Akte geben.«
Mehr Fragen fielen ihr dann zum Glück nicht mehr ein. Oder besser, mehr stellte sie nicht. Ich war entlassen, sollte mich aber weiterhin zur Verfügung halten.
Ich fuhr durch den regnerischen Apriltag nach Hause und überdachte noch einmal unser Gespräch. Wie es schien, hatte die weitere Beschäftigung mit dem tödlichen Unfall meines Vaters tatsächlich neue Erkenntnisse gebracht. Und die standen im Zusammenhang mit den Bonbons, die er beständig zu lutschen pflegte. Hatte ihm jemand präparierte Pfefferminzdrops in die Dose gefüllt? Das war sicher nicht schwierig. Tabletten konnte man zermörsern, Bonbons etwas klebrig zu bekommen war ebenfalls kein Problem, sie in dem weißen Staub zu wälzen ganz einfach. Dass sie ein bisschen komisch geschmeckt haben, wird Julian wenig irritiert haben. Denn er lutschte sie nicht wegen des Genusses, sondern in dem festen Glauben, sie hielten seine Stimme geschmeidig. Wenn also die Bonbondose, die er von mir erhalten hatte, mit derartig manipulierten Süßigkeiten gefüllt war, dann musste der Verdacht zunächst einmal auf mich fallen. In zweiter Linie würde er Rose treffen, zumal sie diejenige war, die er an jenem verhängnisvollen Abend noch besucht hatte. Wahrscheinlich war sie es auch, die ihn als Letzte lebend gesehen hatte.
Arme Rose, sie würde man als Nächstes in die Mangel nehmen. Noch war sie mit ihrer Mutter in einem Wellness-Hotel. Der Rummel um die erste, erfolgreiche Ausstellung ihrer gläsernen Kunstwerke und die unliebsame Aufmerksamkeit in der Presse, die über die Fotos von Rose und mir auf Julians wohl gehütetes Geheimnis gestoßen war, hatten ihre Nerven bis zum Zerrei ßen gespannt. Kurz vor Ostern, an jenem zehnten April, hatte sie versehentlich eine zu hohe Dosis Beruhigungsmittel genommen und dann unglücklicherweise noch Sekt dazu getrunken. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, hatte Sophia, ihre Mutter, sie kurzerhand ins Auto gepackt und war mit ihr fortgefahren. Roses jüngere Schwester, die vierzehnjährige Cilly, war für die Tage zu mir gezogen. Sie hatte gerade Osterferien, und so war sie mir eine willige Helferin darin, die Ausstellungsstücke zurück in Roses Atelier zu schaffen. Üble Nebenwirkung der ganzen Sache war nämlich, dass der Veranstalter, ein angesehenes Kreditinstitut, das sein Foyer engagierten Künstlern der Region für die Präsentation ihrer Werke zur Verfügung stellte, uns aufgefordert hatte, sofort die Ausstellung abzubrechen.
Als ich vor dem Haus einparkte, in dem ich im letzten Jahr eine Wohnung bezogen hatte, stand ein mir nicht unbekannter roter Porsche vor der Tür. Der Besitzer, Marc Britten, war offensichtlich schon oben, Cilly würde ihn mit Wonne eingeladen haben zu bleiben. Ich hingegen würde ihm mit Wonne gleich ein ungeputztes Gemüsemesser in die Seite rammen. Mit jeder Treppenstufe, die ich höher stieg, stieg auch meine Wut auf den Profi-Fotografen mit seinen sauberen Beziehungen zur Schmuddelpresse.
»Dass du dich überhaupt noch hierher wagst!«, fuhr ich ihn also an, als ich in mein Wohnzimmer trat, wo er sich lässig und leider wahnsinnig attraktiv aussehend im Sessel lümmelte und mit Cilly flirtete.
»Warum nicht, Herzchen. Hübsch siehst du aus. Du solltest häufiger vor Zorn schnauben!«
»Anders werde ich dir zukünftig auch nicht mehr begegnen. Weißt du eigentlich, was du angerichtet hast?«
»Nein, Anita-Schätzchen. Was denn?«
»Sie meint das hier, Marc!«
Cilly warf ihm ein Magazin hin, das mit der Überschrift lockte: »Caesar Kings geheime Tochter – Selbstmord?«
»Au Scheiße!«
»Jetzt sag nur nicht, dass du davon nichts gewusst hast!«
»Mädchen, ich war über Ostern bei Papa in L.A. Was ist passiert?«
»Jemand, liebster Marc, hat ein paar Schmierfinken auf Rose angesetzt. Jemand, liebster Marc, hat nicht nur der Lokalpresse Fotos von mir und Rose zugeschoben.«
»Anita, nicht ich. Ehrlich!«
»Deinen strahlenden blauen Augen soll ich mal wieder bedingungslos glauben?«
»Du wirst es tun müssen. Ich habe es wirklich nicht getan. Aber es gibt schon Gestalten, die eins und eins zusammenzählen können. Dein Gesicht, meine Geliebte, ist sehr einprägsam. Und nicht einmal ein Jahr ist es her, dass es neben dem von Caesar King abgebildet war.«
»Was ebenfalls dir zu verdanken war!«
»Sorry, damals ja. Aber diesmal nicht. Du hast selbst eingewilligt, dich mit Rose bei der Vernissage fotografieren zu lassen.«
Ich setzte mich seufzend auf das Sofa.
»Eigentlich wollte ich dir ein Stück Stahl in den Leib rammen, aber das werde ich jetzt wohl doch bleiben lassen. Schad drum eigentlich. Denn dann hätte Kommissarin Frederika wenigstens eine handfeste Leiche für ihre Ermittlung.«
»Lohnt es sich, Kommissarin Frederika kennen zu lernen?«
»Nicht wirklich. Sie bearbeitet den neu aufgenommenen Fall Julian King und hat mich im Verdacht, ihn mit Pfefferminzdrops ermordet zu haben. Und bei Rose habe ich es vermutlich ebenfalls versucht.«
»Spinnen die komplett?«, begehrte Cilly auf.
»Nein, die Fakten passen schon zusammen.«
»Erzähl mehr, Anita. Das hört sich nach Gestank an.«
Marc war, wenn ich mich nicht gerade seinen Annäherungsversuchen erwehren musste oder ihn daran zu hindern hatte, vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit weiterzugeben, ein durchaus guter Freund. Und ich brauchte jetzt einen Zuhörer. Ich begann mit Roses Unfall und schloss: »Tja, wir haben also die Ausstellung beendet. Das ist der erste unerquickliche Effekt. Der zweite ist, dass der Verlag, bei dem ich im August anfangen sollte, den Vertrag aufgelöst hat. Mit einer windigen Begründung, hinter der vermutlich auch nur wieder steckt, mit einer solchen skandalträchtigen Person wie mir wolle man den blütenreinen Ruf des Hauses nicht besudeln. Und drittens – Valerius habe ich zwar dank deiner Hilfe wiedergefunden. Doch er meldet sich jetzt nicht mehr. Verständlich, wer will schon mit einer potenziellen Mörderin in Verbindung gebracht werden.«
»Hat es zwischen euch nicht geklappt?«
»Doch, es hat geradezu gewaltig gefunkt. Aber bevor wir nur eine winzige Chance hatten, uns mit etwas kühlerem Kopf kennen zu lernen, kam Cillys Anruf, dass Rose im Koma in ihrer Werkstatt lag. Aus die Maus. Am Tag danach ist er mit seinem Neffen nach Frankreich gefahren. Er hat mir zwar angeboten, mitzukommen, aber das ging ja schlecht. Wir schieden mit den klassischen Worten: ›Ich melde mich dann!‹«
»Soll ich zu ihm fahren und mit ihm reden?«
»Und dann?«
»Wär doch eine Möglichkeit, oder?«
»Vergiss es!«, entfuhr es mir müde.
»Was bedeutet dir dieser Mann eigentlich, Anita?«
Cilly rückte an meine Seite und schlang ihren Arm um meine Taille.
»Anita, du solltest Marc die Geschichte mal von Anfang an erzählen.«
Ich schüttelte den Kopf. Das würde doch sowieso niemand verstehen.
»Dann tue ich es. Du gehst inzwischen in die Küche und kochst uns Kaffee.«
»Wenn du meinst!«
Ich erhob mich. Einen Kaffee konnte ich wirklich gebrauchen. Während ich mit Kaffeemaschine, Tassen, Milch und Zucker hantierte, hörte ich Cilly erzählen.
»Also, Julian hat Rose und Anita früher Geschichten erzählt. Solche, die in Köln spielten, als die Römer hier noch lebten. Wie sich herausstellte, hat er jeder der beiden andere Teile erzählt, und erst als sie sich gemeinsam hingesetzt und ihre Erinnerungen verglichen haben, kam eine ganze, zusammenhängende Episode dabei heraus.«
Marcs Stimme klang erstaunt, als er fragte: »Also wusste er, dass sich die beiden Schwestern einmal treffen würden, Cilly?«
»Sollte man fast meinen, nicht?«
»Worum ging es bei der Geschichte, und was hat dieser Valerius damit zu tun? Kannte euer Vater den auch schon?«
»Das ist es ja gerade – den nicht. Darum ist das alles so absolut irre.«
»Na, los. Was passierte bei den Römern?«
»Also – Annik, die Gallierin, wurde so um 70 nach Christus in der Bretagne geboren. Sie hatte ihre Familie bei einer Flut verloren und ist mit Mitte zwanzig mit ihrem Geliebten Martius und dessen römischem Freund, dem Präfekten Falco, von dort ins Rheinland gezogen. Nach Colonia, weißt du. So nannten die Römer nämlich Köln!«
»Setz mal einen Hauch von geschichtlichem Wissen auch bei mir voraus, Süße!«
»Na gut. Also – von Martius erhielt Annik bei einem Besuch der Stadt einen Siegelring mit der Inschrift ›Ad Perpetuam Memoriam‹. Das ist wichtig, denn Anita hat diesen Ring von ihrem Vater bekommen. Na jedenfalls, dieser Martius tritt in die Legion ein, und Annik arbeitet in der Villa des Patriziers Titus Valerius Corvus als Töpferin. Dessen Frau, weißt du, die hieß Ulpia Rosina, und die beiden freundeten sich miteinander an. Es gibt dann noch die Tochter, Valeria Gratia. Die ist wie ich. Übrigens, es spielt alles in der Zeit, in der Traian, der spätere Kaiser, Statthalter von Germanien ist und sich in Colonia aufhält. In der Gegend gibt es noch immer Aufstände gegen die Römer, und es sieht so aus, als ob in Valerius’ Haushalt eine Informationsquelle existiert, die die Gallier mit Nachrichten über die römischen Pläne versorgt.«
»Also nicht nur Aufruhr in jenem kleinen Dorf von Asterix und Obelix!«
»Quatsch, nee. Unterbrich mich nicht!«
»Entschuldige, Cilly!«
»Also – Annik gerät wegen ihrer Herkunft und vor allem wegen ihrer Freundschaft mit einem Barden in Verdacht, dass sie es ist, die die Informationen weitergibt. Aber sie kann Valerius von ihrer Unschuld überzeugen, und er gibt ihr stattdessen den Auftrag, herauszufinden, wer der Verräter ist.« Cillys Stimme wurde ganz leise, aber ich hörte dennoch, was sie erklärte: »Dieser Valerius ist übrigens siebzehn Jahre älter als Annik, hat früher in der Legion gedient und ist zweimal übel verwundet worden. Er trägt eine Narbe im Gesicht. So eine, wie Anita sie jetzt hat.«
»Oh!«, sagte auch Marc ganz leise.
»Also – Valerius verliebt sich in Annik, traut sich aber nicht, ihr das zu zeigen, weil er doch ein Krüppel ist, wie er meint. Aber Annik macht das nichts aus.«
»Ich dachte, sie hat diesen Martius?«
»Na ja – der hat sich inzwischen in Ulpia Rosina verliebt und ein heimliches Verhältnis angefangen. Annik weiß es aber, und sie macht sich nichts daraus, weil sie ihn eigentlich immer mehr als Kameraden betrachtet hat. Jedenfalls ergibt sich für Martius die Gelegenheit, mit einem Senator nach Rom zu ziehen, und er verabschiedet sich von Annik und Rosina. An diesem Abend opfert Annik den Siegelring, den sie von ihm erhalten hat, an einem Matronenheiligtum in den Wäldern, weil sie nämlich beschlossen hat, mit Valerius zu leben, der zum Provinzstatthalter von Nordgallien ernannt worden ist. Als sie nach Hause zum Gut zurückgeht, bemerkt sie, dass auch Rosina heimlich den Weg durch die düstere Gegend nimmt. Drei Tage später wird Martius in jenem dunklen Wald gefunden, erstochen von einem Stilett, das, wie nur Annik weiß, Rosina gehört. Der Präfekt Falco glaubt, der Barde und die Gallier seien schuld an seinem Tod, und Annik ist in einer fürchterlichen Zwickmühle, weil sie ihre Freundin nicht verraten will. Aber dann kommt der Befehl, das Dorf der Einheimischen niederzubrennen, und Annik wird bei dem Versuch, Falco daran zu hindern, von seinen Legionären umgebracht. Ein Pfeil hat sie getroffen, und sie nimmt mit ihren letzten Worten die Schuld an Martius’ Tod auf sich. Dann stirbt sie in Valerius’ Armen.«
Cilly zog die Nase hoch und griff nach einem Taschentuch, als ich eintrat. Mit einem müden Lächeln vervollständigte ich die Geschichte: »Tja, Marc, das ist der Hintergrund meiner Beziehung zu dem heutigen Valerius. Die Erzählung berührte Cilly schon damals, als wir sie uns erzählt haben, zutiefst. Zugegebenermaßen mich genauso. Als ich dann, wenige Tage nachdem wir sie beendet hatten, diesem Mann begegnet war, der so aussah, wie ich mir den Römer Titus Valerius Corvus vorgestellt hatte, da habe ich etwas die Kontrolle verloren.«
»Der Mann, der zu allem Überfluss tatsächlich Valerius heißt. Ja, Herzchen, ich verstehe. Ein geradezu unheimlicher Zufall.«
Ich stellte die Kanne auf den Tisch, goss Marc den Kaffee pur ein, den er in Form von schwarzem Schlicker zu trinken pflegte, füllte aber meine und Cillys Tasse zuvor zur Hälfte mit Milch auf. Die Konzentration des Getränkes war ansonsten nicht jugendfrei.
»Zufall – Julian hätte es nicht als Zufall bezeichnet.«
»Schicksal?«
»Möglicherweise. Doch eher Bestimmung.«
»Ich würde daraus ja eher schlussfolgern, deine Beziehung zu Valerius beruht auf einer Projektion. Du hast eine zu Herzen gehende Liebesgeschichte gehört und identifizierst dich mit der Heldin. Dann begegnet dir ein Mann, der so ähnlich aussieht wie der strahlende Held, und – schwups – springst du mit ihm in die Federn. So funktioniert das doch bei euch Frauen.«
»Wenn du meinst.«
»Bist du verschnupft? Komm, du bist ansonsten eine durchaus nüchterne Frau, Anita. Solche romantischen Anwandlungen sind deiner nicht würdig.«
»Rose ist ihrem Falko begegnet, Marc. Und es hat auch gefunkt!«, stellte Cilly trocken fest.
»Was? Den gibt es auch?«
»Den gibt es auch, Marc. Valerius’ Neffe. Staatsanwalt in Düsseldorf. Derzeit in Scheidungsschwierigkeiten.«
»Und Cilly, wem bist du begegnet?«
»Dir, Marc.«
Meine kleine Schwester-Schwester sah den blonden, braun gebrannten Abenteurer Marc mit strahlenden Augen an. O ja, er hatte etwas von dem verwegenen gallischen Legionär!
»Nix da, Mädels. Ich lebe derzeit zum ersten Mal und werde mich in keine Verwicklungen aus der Vergangenheit einlassen.«
»Nun, da hatten wir noch Marcel le Breton...«
»Der mit der Syph...«
»Der im fünfzehnten Jahrhundert gelebt hat...«
»Und die Stiftsschreiberin Anna angebaggert hat...«
»Und die Jungfer Valeska umgebracht hat...«
»Schluss jetzt!«
Marc stellte die Kaffeetasse mit einem Klirren auf den Tisch. Ich sah ihm an, dass er sich vor Unbehagen wand. So, wie wir uns auch gewunden hatten, als uns klar wurde, wie sehr die Geschichten von unserem Vater unser derzeitiges Leben berührten. Immer wieder mussten Rose, Cilly und ich uns sagen, Julian habe nur eine überaus lebendige Phantasie und habe vielerlei Quellen genutzt, sie zu nähren, wie etwa die Fragmente eines alten Stundenbuchs, die Ausgrabungsstätte einer alten römischen Villa, den Siegelring mit dem Pferdchen, den er mir einst geschickt hatte, vielleicht sogar die eigene Familiengeschichte.
»Hat er an Wiedergeburt geglaubt, der Julian Kaiser?«
»Er hat daran geglaubt. Zumindest scheint es mir jetzt so.«
»Und du, Anita?«
»Ich weiß es nicht. Aber ich weiß genauso wenig, ob wir nur einmal leben, und ich weiß nicht, ob es eine Anderwelt, einen Hades, eine Hölle oder die himmlischen Sphären oder nur das grenzenlose Nichts gibt. Nur eines weiß ich – optimistischer als Hölle und Fegefeuer ist die Vorstellung, in einer anderen Welt weiterzuleben, allemal.
»Auch wenn das Leben die Hölle ist?«
»Es hat auch seine guten Seiten, das Leben.«
Marc lächelte plötzlich.
»Ja, Anita-Schätzchen, hat es. Und was ist nun mit Valerius? Du hast ihn getroffen und – wie wir sattsam miterleben durften – nach wenigen genussreichen Stunden wieder aus den Augen verloren. Du hast ihn, dank meiner mildtätigen Hilfe, erneut aufgestöbert, einige weitere lustvolle Stunden mit ihm verbracht, und nun ist Ende-Gelände. Oder?«
»Marc, von meiner Seite aus nicht. Du magst es Projektion oder Einbildung oder wer weiß was nennen, ich fühle mich dennoch mit ihm verbunden. Aber ich habe den Eindruck, es steht noch immer etwas zwischen uns.«
»Du nimmst das alles viel zu ernst, Schätzchen. Nimm mich, ich bin leichtherzig, unzuverlässig, ganz dem Hier und Jetzt verpflichtet und ungemein sexy!«
»Stimmt. Darum nehme ich dich ja nicht!«
Bevor wir sehr zu Cillys Missfallen unser übliches Geplänkel weiterführen konnten, klingelte das Telefon, und mit Freude vernahm ich, dass Rose wieder im Lande war. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag, um gewisse Neuigkeiten auszutauschen. Marc hingegen brach genauso unerwartet wieder auf, wie er erschienen war. Er pflegte seinen Ruf des Unberechenbaren sicher nicht ganz ohne Selbstzweck. Er ließ sich nicht gerne auf Termine oder Orte festnageln, sondern bestimmte das lieber selbst. Verantwortung war ein Begriff, der in seinem Wortschatz nicht zu finden war. Und dennoch war er erstaunlich oft zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz.
Ich mochte ihn.
Rose war drei Tage älter als ich, neunundzwanzig also, und die Unterschiede zwischen uns hatten wir unseren Müttern, nicht Julian zu verdanken. Ich war recht groß, hatte glatte, schwarze Haare und einen dunklen Teint, was Uschis libanesischer Großmutter zu verdanken war. Rose war eher klein, hatte stiefmütterchenbraune Augen, eine helle, manchmal rosige Haut und einen Flausch von blonden Löckchen, der sie gelegentlich wie einen wirrköpfigen Engel auf Abwegen erscheinen ließ. Sie wirkte auf den ersten Blick sanft, nachgiebig und vage hilflos. Der Eindruck verlor sich spätestens dann, wenn man sie mit glühender Glasschmelze hantieren sah. Wenn sie auch nicht Julians musikalisches Talent geerbt hatte – ihre Gesangsproben veranlassten zufällige Zuhörer, spontan die Finger in die Ohren zu stecken -, so entfaltete sie ihre künstlerischen Gaben doch auf anderem Gebiet. Sie hatte eine Ausbildung als Glasdesignerin gemacht und etablierte sich gerade als eigenständige Künstlerin. Julian hatte ihr vor drei Jahren geholfen, sich mit einem kleinen Atelier selbständig zu machen, und ihr auch die ersten Aufträge verschafft. Zunächst arbeitete sie wertvolle Glaswaren auf, dann aber hatte sie sich einen gewissen Ruf im Restaurieren alter Bleiglasfenster erworben. Nach meinem Unfall, als ich mit Schmerzen und Operationsterminen zu kämpfen hatte und nicht in der Lage war, die Stelle anzutreten, auf die ich mich beworben hatte, machte sie mir das Angebot, in ihrer Werkstatt mitzuhelfen. Mit Scherben konnte ich gut umgehen, der Rest lernte sich schnell. Vor allem aber nahm ich Roses Öffentlichkeitsarbeit in die Hand, und gemeinsam übten wir uns darin, ihre eigenen Werke dem Publikum vorzustellen. Es gelang recht gut. Jetzt nahmen ihre künstlerischen Arbeiten beinahe gleichberechtigten Raum neben dem Restaurieren der Glasfenster ein.
Rose traf ich am nächsten Morgen in ihrer Werkstatt. Sie hatte sich in den vergangenen zwei Wochen erholt und wirkte entspannt und gelassen. Selbst Kommissarin Frederika hatte sie nicht aus der Fassung bringen können, wie ich beruhigt feststellen konnte. Zwar war ihr Verschweigen von Julians Besuch belastend, jedoch nicht wirklich ein haltbares Indiz dafür, dass sie ihm eine Überdosis Beruhigungsmittel verabreicht hatte. Sie hätte es tun können, aber schließlich waren da noch immer weitere elf Stunden, in denen wer weiß was geschehen sein konnte. Auch die Tatsache, ihre erste eigene Ausstellung abbrechen zu müssen, machte ihr weniger Kummer, als ich dachte.
»Weißt du, solange die Öffentlichkeit sich noch an der ›geheimnisvollen Tochter‹ weidet, ist es besser, ich halte mich im Hintergrund. Außerdem habe ich genug zu tun. Sieh mal, hier ist ein Fenster aus dem neunzehnten Jahrhundert. Hat man im Keller einer alten Villa gefunden, vermutlich war es im Zweiten Weltkrieg ausgebaut und gesichert worden. Beim Entrümpeln sind die Erben des Hauses darauf gestoßen und würden es jetzt gerne wieder einsetzen.«
Wir betrachteten das farbenprächtige Fenster mit seinen floralen Motiven und Medaillons. Die einzelnen Glasstückchen hatten sich stellenweise aus der Verbleiung gelöst, manche waren zerbrochen, andere fehlten. Ein Puzzle war ein Kinderspiel dagegen. Aber Rose war sehr geschickt darin, Fehlendes zu ergänzen und Splitter an die richtige Stelle einzufügen. Meine Erfahrung darin half auch, und uns beiden kam eine solche Arbeit gerade recht.
Außerdem gab es da noch das Tagebuch.
»Anita, hast du inzwischen Zeit gehabt, die Eintragungen zu übersetzen?«, fragte Rose, als wir die Tür der Werkstatt am späten Nachmittag hinter uns schlossen.
»Habe ich, und wenn du Lust hast, bring Cilly nachher mit, dann erzähle ich euch, was ich über Marie-Anna de Kerjean herausgefunden habe.«
Julian hatte Rose bei seinem letzten Besuch ein altes Tagebuch mitgebracht und sie gebeten, es zu lesen. Doch da meine Schwester noch in derselben Nacht zusammen mit Sophia zu einem Urlaub nach Australien aufgebrochen war, hatte sie dieses Heft unbeachtet auf ihren Schreibtisch gelegt. Als sie zurückkamen und von Julians Tod erfuhren, war es irgendwie in Vergessenheit geraten, und erst kurz vor Ostern hatte sich Rose wieder daran erinnert und es mir gegeben. Ich hatte es aufgeschlagen und war wie vom Donner gerührt. Es beinhaltete die Aufzeichnungen einer jungen Frau, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Köln gelebt hatte. Sie hieß Marie-Anna, und in dem Haushalt, in dem sie angestellt war, gab es eine Rosemarie und eine Graciella. Nun hatten die beiden anderen Geschichten, die wir aus Julians Vermächtnis rekonstruiert hatten, ebenfalls von drei Frauen mit ähnlichen Namen gehandelt. Darum waren wir jetzt überaus neugierig, ob uns dieses Tagebuch möglicherweise den Schlüssel dazu geben konnte, woher Julian seine Inspirationen bezogen hatte – und was er damit bezwecken wollte.
Wir saßen also an diesem Abend zusammen in meiner Wohnung, Cilly hatte den Laptop bereit, Rose machte den Mundschenk, und ich übernahm die Rolle der Erzählerin.
»Das Tagebuch selbst beginnt im Jahr 1810, und zwar an dem Tag, als Marie-Anna in den Haushalt des Valerian Raabe eintritt.«
»Valerian Raabe?«, quiekte Cilly. »Da isser ja wieder, der Valerius Corvus!«
»Richtig, da ist er wieder. Ich denke, wir werden einiges über ihn zu hören bekommen. Später, denn ihr seht, hier sind einige lose, beschriftete Blätter und Zeitungsausschnitte, die früher datieren. Sie geben Aufschluss darüber, wie die zu diesem Zeitpunkt siebenundzwanzigjährige Französin nach Köln kam. Ich habe versucht, die Vorgeschichte zu rekonstruieren. Manches ergibt sich aus den historischen Gegebenheiten, anderes habe ich nach bestem Wissen versucht, in einen Zusammenhang zu bringen. Marie-Anna scheint schon von ihrer Kindheit an ein recht bewegtes Leben geführt zu haben, und gelegentlich hat sie besonders beeindruckende Erlebnisse schriftlich festgehalten.«
»Das ist ja alles in Französisch geschrieben!«, stöhnte Cilly, die die Blätter betrachtete.
»Ja, und darum werde ich dir die Geschichte auch auf Französisch erzählen.«
»O Gott, nein!«
»Nein?«
»Ich hab’ schon die letzte Französischarbeit versiebt, weißt du!«
»Umso mehr könntest du Nachhilfe brauchen.«
»Ich dachte, das sei hier Freizeit und keine Schulstunde.«
»Nicht für die Schule...«
»Anita, reiz mich nicht!« Cilly, ebenso blond wie Rose, aber schlaksiger und von herberen Gesichtszügen als ihre Schwester, funkelte mich an. Sie konnte gelegentlich aufbrausend sein, war jedoch durch ein kleines Zwinkern von mir sofort wieder besänftigt. »Du willst mich nur auf die Schippe nehmen, nicht?«
»Du reagierst so schön schnell darauf, kleine Rakete!«
»Können wir jetzt anfangen, Anita?«, fragte Rose sanft.
»Ja, wir fangen an.«
Und ich erzählte, was sich im Jahr 1795 in der Bretagne abgespielt haben musste.
Unterlagen 1
4. Kapitel
Bretagne, 1795 – Flucht
Marie-Anna lief mit fliegenden blonden Zöpfen die Allee entlang. Das goldbraune Laub raschelte unter ihren Füßen. Erst hinter der Colombière, dem steinernen Taubenhaus, das wie ein riesiger Bienenkorb vor dem Tor hockte, hielt sie an. Es war nicht das ideale Versteck. Charles würde sie zu schnell finden. Der Sohn des Verwalters, wie sie selbst zwölf Jahre alt, hatte sie wie üblich aufgestöbert, als sie sich verbotenerweise aus dem Schloss gestohlen hatte, um die Eichhörnchen im Park mit Nüssen zu locken. Nicht dass es gefährlich war, die possierlichen Nager zu füttern, aber die Zeiten waren nicht danach, ungehindert die schützenden Mauern des Anwesens zu verlassen.
Das Chateau Kerjean lag einen gut dreistündigen Fußmarsch vom Meer entfernt inmitten von Flachsfeldern. Es war eigentlich kein richtiges Schloss, eher ein gro ßes Landgut. Doch der Vorfahr, der es im siebzehnten Jahrhundert gebaut hatte, ließ sein Anwesen mit einem Wassergraben und einer turmbewehrten Mauer umgeben, weniger um es gegen kriegerische Auseinandersetzungen zu schützen, als der Mode der Zeit zu folgen, die der Festungsbauer Vauban geprägt hatte. Der jetzige Gutsherr, Brior de Kerjean, hatte weder Lust noch Geld, diese Spielerei mit Wachleuten zu besetzen. Sein Anliegen galt der Landwirtschaft und der Leinenherstellung. Er exportierte das Rohleinen meist über den Kanal nach England und hatte dort verlässliche Abnehmer.
Marie-Anna lugte um die Colombière, Charles war nicht zu sehen. Sie hatte ihn also doch abgehängt, dachte sie zufrieden. Ihre Genugtuung endete in genau dieser Sekunde, als sie sich an den Zöpfen gepackt fühlte.
»Du meinst wohl, ich könnte es mit einem spillerigen Mädchen wie dir nicht aufnehmen, was?« Charles, strohblond, mit einem grinsenden, aber freundlichen Gesicht, war hinter ihr aufgetaucht und schnaufte noch etwas von dem raschen Lauf. »Hör mal, du sollst nicht alleine den Hof verlassen, hat deine Maman angeordnet.«
»Na, ich bin ja nicht allein. Du schleichst mir doch ständig hinterher.«
»Mademoiselle Sophy hat dich gesucht!«
»Die sucht mich immer, und wenn sie mich findet, verlangt sie, dass ich meine Stickarbeiten mache. Äh!«
»Trotzdem, Marie-Anna, es ist nicht gut, wenn du dich hier draußen alleine aufhältst. Du weißt doch, wie viel Gesindel sich hier herumtreibt. Und seit dein Vater verschwunden ist...«
»Mein Vater ist nicht verschwunden! Er wird bald zurückkommen!«
Traurig sah Charles das Mädchen an. Ob Brior, der Herr von Kerjean zurückkam, lebend und vielleicht sogar unverletzt, das war derzeit kaum anzunehmen.
Der schwarzbärtige Brior hatte das Schloss von seinem Vater geerbt und das zugehörige Land mit gutem Erfolg bewirtschaftet. Vor dreizehn Jahren hatte er Denise geheiratet, eine zarte, blonde Frau aus adligem Geschlecht, die er sehr liebte. Sie hatte ihm schon im ersten Ehejahr eine Tochter geschenkt, Marie-Anna, auf die er, auch wenn er es nicht häufig zeigte, sehr stolz war. Das Mädchen hatte die lockigen blonden Haare seiner Mutter geerbt, jedoch nicht deren Zartheit. Sie war ein robustes kleines Ding, das die vornehme englische Nanny kaum zu bändigen wusste. Leider hatte Denise in den darauf folgenden Jahren nur zwei tot geborene Söhne zur Welt gebracht, so dass nach wie vor kein Erbe im Hof und in den Gärten des Chateaus herumtollte. Dann brach die Revolution über Frankreich herein.
Zwar stießen die Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit auch bei den Bretonen auf Interesse, doch als es hieß, dass die Kirchen säkularisiert werden sollten und die Rekrutierungsoffiziere der Revolutionsarmee versuchten, die dringend in der Wirtschaft des Landes benötigten jungen Männer zu werben, da begehrte das schon immer seinen eigenen Gesetzen folgende Volk auf. Es bildete sich eine Gegenbewegung, die sich als katholisch und königstreu bezeichnete, und deren Mitglieder sich Chouans nannten.
Brior le Noir war einer von ihnen.
Doch der Kampf der Minderheit war vergebens. Im Jahr 1795, als die Chouans versuchten, mit britischer Unterstützung das neue Regime zu vertreiben, erlitten sie auf der Halbinsel Quiberon eine vernichtende Niederlage. Beinahe tausend ihrer Leute wurden unter General Hoche hingerichtet. Viele aber konnten auch fliehen und waren untergetaucht. Darunter war Marie-Annas Vater.
»Still, Charles, hörst du? Ein Reiter!«
Marie-Anna sah sich triumphierend zu dem Jungen um. Ein galoppierendes Pferd näherte sich, genau wie Brior stets die Allee heraufgeprescht war. Aber es war nicht der Schlossherr, der dort auf dem schwitzenden Hengst auf die heruntergelassene Torbrücke zuhielt.
»Das ist mein Vater, Marie-Anna. Und so, wie er reitet, bringt er wichtige Botschaften. Komm, wir rennen hinter ihm her.«
Die beiden Kinder folgten dem Reiter und sahen, wie er vor der Remise vom Pferd glitt, um sofort zum Wohnturm zu laufen. Sophy, die aus dem Küchentrakt kam, sah ihm mit bedenklicher Miene nach, nahm dann Marie-Anna wahr und ging zu ihr.
»Ich sollte dich ausschelten.«
»Ja, Miss Sophy.«
»Ich tue es aber nicht. Komm mit. Ich habe das Gefühl, es ist etwas Wichtiges geschehen.«
Sie stiegen gemeinsam die steinerne Treppe empor und klopften an die Tür des Zimmers der Schlossherrin.
Denise, wieder hochschwanger, bewohnte die Zimmer im südlichen Turm. Bei ihr war Germain, der Verwalter und Charles Vater, und redete eindringlich auf sie ein.
»Sie müssen fliehen, Madame. Gerüchte sagen, die Franzosen requirieren alles Gut, das den Aufständischen gehört. Die Soldaten gehen nicht eben gut mit Frauen und Kindern um.«
»Nein, Germain, du siehst doch, ich bin nicht in der Lage, auch nur das Haus zu verlassen. Die Niederkunft steht kurz bevor. Wenn nur ein Funken Menschlichkeit in den Soldaten ist, werden sie mich nicht belästigen.«
»Auf den Funken Menschlichkeit würde ich mich nicht verlassen, Madame. Und Ihre Tochter, sie ist zwölf, ein junges Mädchen...«
»Ja, Marie-Anna muss gehen.«
»Aber Sie müssen Schutz suchen, Madame. Wenigstens dürfen Sie nicht im Schloss bleiben.«
Denise seufzte und strich Marie-Anna über die Haare. Das Mädchen hatte sich zu ihren Füßen gesetzt, die Lippen weiß vor Angst, die Finger fest verschränkt.
»Marie-Anna, kleine Annik!«, flüsterte Denise. »Du musst tun, was er sagt. Sophy soll das Allernotwendigste einpacken. Ihr müsst zur Küste und sehen, ob ihr ein Schiff nach England findet.«
»Maman, ich kann Sie doch nicht alleine lassen!«, schluchzte Marie-Anna auf. »Papa ist noch nicht zurückgekommen. Wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist.«
»Du musst gehen, Kind. Nicht für immer. Irgendwann wird der Wahnsinn vorüber sein, und dann werden wir alle hier wieder vereint sein.«
»Aber wo soll ich hingehen, Maman?«
»Sophy wird dir helfen, Sir Garret zu finden. Er ist Papas Geschäftspartner. Er wird sich um dich kümmern.«
»Darf ich vorschlagen, dass Marie-Anna sich noch heute Nacht auf den Weg zur Küste macht, Madame. An der Ile de Sieck legen ab und zu englische Schiffe an. Einige der Kapitäne haben schon Ware von Ihrem Gatten transportiert.«
»Schmuggler.«
Der Verwalter zuckte mit den Schultern.
»Manch Adliger ist mit ihrer Hilfe dem Schafott entronnen. Gebt dem Mädchen etwas Geld mit. Aber lasst sie noch heute aufbrechen. Die Zeit drängt.«
So kam es, dass Marie-Anna als schlichtes Bauernmädchen verkleidet neben einer schweigsamen, hageren Frau mittleren Alters bei Anbruch der Dunkelheit das Chateau Kerjean verließ. Beide trugen Bündel mit Kleidern und darin versteckt, in Säume und Taschen eingenäht, einige Goldmünzen.
Den Weg zur Küste kannte Marie-Anna. Oft genug war sie ihn früher mit ihrem Vater entlanggeritten, um einen Tag am Meer zu verbringen. Als sie noch sehr klein war, hatte er sie auf den Sattel vor sich gesetzt, später war sie dann auf dem Pony geritten. Als sie alt genug war, hatte er ihr eine brave Stute geschenkt, die sie mit Begeisterung geritten hatte. Es waren glückliche Zeiten, die sie hinter sich ließ für eine ungewisse Zukunft, die eine ungewisse Sicherheit bot. Sehr ungewiss, denn der Gefahr waren sie noch nicht entronnen.
Es war eine stürmische Nacht. Je näher sie dem Meer kamen, desto heftiger zerrte der Wind an ihren Kleidern und Hauben. Er heulte zwischen den Felsbrocken, die überall wie von Riesenhänden hingeworfen aus den Feldern ragten, er peitschte die Hecken am Wegesrand und trug den Geruch von salziger Gischt herbei. Gegen Mitternacht waren sie durchgefroren und erschöpft. Dankbar nahmen sie Unterschlupf in einer baufälligen Scheune.
Im Morgengrauen wanderten sie weiter, umgingen das kleine Fischerdörfchen Plouescat, beschritten unebene Feldwege und vermieden vor allem den schmalen Küstenpfad, auf dem die Zöllner patrouillierten. Um die Mittagszeit erreichten sie hungrig und mit schmerzenden Füßen das winzige Dörfchen Dossen. Es herrschte Flut, und als sie an dem kleinen Hafen standen, trennte eine graue Wasserfläche das vorgelagerte Inselchen vom Festland.
»Wir müssen dort hinüber, Sophy.«
»Es wird bei Ebbe wohl möglich sein. Wir wollen hier in den Dünen warten, bis das Wasser abgelaufen ist. Komm, ich habe noch ein Brot und zwei Äpfel für uns.«
Die mit graugrünem, scharfhalmigem Gras bewachsene Düne schützte die beiden ein wenig vor dem kalten Wind, und langsam verzehrten sie die letzten Vorräte. Marie-Anna sah zu der Insel hinüber. Sie war nicht groß, nur zwei Häuser standen auf ihr. Sie waren, wie alle hierzulande, aus Feldsteinen gemauert. Die Dächer hatte man mit grauem Schiefer gedeckt, rechts und links ragten jeweils die Kamine auf, einer davon sicher in der Küche, der andere in der Stube. Auf der linken Seite der Insel hatte sich eine kleine, natürliche Mole gebildet, in deren Schutz zwei Fischerboote dümpelten. Auf der Insel selbst wuchs Getreide, wie es schien.
Eine Schar Möwen, weiß und grau, schoss im Wind über das Wasser hin, und ihre Schreie klangen wie raues Gelächter. Marie-Anna schauderte. Was mochte in Kerjean geschehen sein? Waren die Soldaten schon gekommen? Würden sie plündern, das Haus in Brand setzen, die Gärten zertrampeln?
»Marie-Anna, hör auf zu grübeln. Es hilft dir jetzt nichts.«
Sophy hatte dem Mädchen den Arm um die schmale Schulter gelegt. Sie hatte tiefes Mitgefühl für das Kind, dessen Welt von einem Tag auf den anderen zerstört worden war. Doch sie achtete die Kleine auch, die ohne Klagen tat, was notwendig war.
»Wann wird ein Schiff kommen, Sophy?«
»Wir werden es erfahren, wenn wir dort drüben sind. Ich bin mir sicher, die Leute, die dort wohnen, wissen eine ganze Menge. Und ich vermute auch, wir sind nicht die Ersten, die eine derartige Frage stellen.«
»Das Wasser sinkt.«
»Ja, kleine Annik, das Wasser sinkt. Nur noch kurze Zeit, und wir können trockenen Fußes hinübergehen.«
Bald darauf standen sie auf, schüttelten sich den Sand aus den Röcken und wanderten über das Watt in Richtung Insel. Als sie sich auf halbem Weg befanden, riss der grau bewölkte Himmel plötzlich auf und ein Sonnenstrahl fiel auf den feuchten, festen Sand. Staunend blieb Marie-Anna stehen und starrte auf die verwandelte Welt. Strahlend weiß wölbte sich der Halbmond der Bucht hinter ihnen, um sie herum glitzerte das Wasser in den verbliebenen Pfützchen und Prielen im Watt. Vor ihnen schimmerten blauschwarz die Schieferdächer der Häuser, und rosa, blau und violett leuchteten die Hortensienblüten vor den grauen Mauern. Vom First des ersten Hauses erhob sich mit lautem Krächzen ein Rabe, flatterte auf und glitt mit ausgebreiteten Flügeln über Marie-Anna hin.
»Wie schön die Insel ist!«
»Annik?«
»Siehst du es nicht, Sophy? Sie ist schön, und sie wird uns Schutz und Hilfe bieten. Der Rabe hat es mir gesagt.«
»Mädchen, rede kein dummes Zeug. Raben sprechen nicht. Und nun komm, wir wollen schauen, ob wir dort jemanden um Rat fragen können.«
Gehorsam setzte sich Marie-Anna wieder in Bewegung, aber ihr verstörtes Gesicht, das sie seit ihrem Fortgang von Kerjean getragen hatte, war weicher geworden, und dafür war sogar die nüchterne englische Nanny dem Raben dankbar.
Marie-Annas Instinkt hatte sie nicht getrogen. Die Bauersleute und die Fischerfamilie, die auf der Insel wohnten, nahmen sie gastfreundlich auf. Der Fischer erinnerte sich an Brior le Noir, und er wusste auch, dass er als Rebell gesucht wurde. Er gab ihnen eine kleine Kammer, und seine Frau bewirtete sie mit gebratenem Fisch, weißem Brot und gezuckertem Butterkuchen.
Zwei Nächte später saßen Sophy und Marie-Anna eng aneinander gedrängt in einer auf den sturmgepeitschten Wogen hüpfenden Schaluppe und überquerten den Kanal.
Gegenwart
5. Kapitel
Zeugnisse der Vergangenheit
»Hat Marie-Anna das so aufgeschrieben?«, fragte Rose. »Ich meine, gibt es diese Chouans, dieses Schloss und die Insel, oder hast du das erfunden?«
Ich zog die Karte aus dem Stapel Unterlagen, die ich bereits herausgesucht hatte.
»Über die Chouans und ihre Niederlage 1795 auf der Quiberon kannst du in den Geschichtsbüchern nachschlagen und in diesem Zeitungsartikel lesen. Kerjean ist ein häufiger Ortsname in der Bretagne, aber es gibt wirklich ein Chateau Kerjean in der Nähe von Plouescat. Der Tourismusverein hat mir ein aktuelles Faltblatt geschickt. Schau, so sieht es heute aus.« Ich legte den Prospekt mit den Fotos eines grauen Schlosses inmitten grüner Wiesen und Alleen auf den Tisch. »Und Marie-Anna erwähnt in ihren Aufzeichnungen die Ile de Sieck. Die hier liegt.« Ich deutete auf der Landkarte auf den Zipfel Land, der etwa fünfundzwanzig Kilometer von Kerjean entfernt lag. »Und daher vermute ich mal, die Geschichte hat sich wirklich in der Gegend so abgespielt. Was ich nicht weiß, Cilly, ist, ob der Rabe tatsächlich in diesem Moment aufgeflogen ist«, fügte ich lächelnd hinzu. »Das war meine Zutat zum Geschehen.«
»Und die Marie-Anna ist wirklich nach England geflohen?«
»Ja, Cilly, das ist sie. Dort hat sie die nächsten acht Jahre in dem Haushalt von Sir Garret gelebt. Hier gibt es einen Brief, den sie an ihre Mutter geschrieben, aber nicht abgeschickt hat, wahrscheinlich weil sie deren Aufenthaltsort nicht kannte. Sophy hat als Gouvernante bei Sir Garret gearbeitet und dabei auch Marie-Anna unterrichtet. Das Mädchen scheint ziemlich bald eigene Aufgaben übernommen zu haben, denn es gibt ein Arbeitszeugnis und ein Empfehlungsschreiben an einen Franzosen, der eine Englisch sprechende Lehrerin für seine Kinder wünschte. Bei ihm ist sie mit neunzehn in Stellung gegangen, als er als Munizipalbeamter nach Köln versetzt wurde. Durch ihn kam sie hierher.«
»Und dann?«
»Mehr habe ich noch nicht ausgewertet, Cilly. Aber was hältst du davon, wenn du dich zusammen mit Rose mal über diese Zeitungsausschnitte, Flugblätter und Karikaturen hermachst? Ich vermute, sie beziehen sich auf Marie-Annas Leben in der Stadt. Ein bisschen Übersetzungsarbeit wird dir nicht schaden.«
»Gib her, du hast mich neugierig gemacht.«
Ich händigte Cilly die vergilbten, brüchigen Blätter aus, die ich vorsichtig in Folientaschen geschoben hatte.
»Mach besser Kopien davon, wenn du damit arbeiten willst.«
»Gleich morgen.«
Rose hatte die ganze Zeit Kringel auf ein Blatt Papier gemalt und sah nachdenklich aus. Sie nahm schließlich das Tagebuch und schlug die letzte Seite auf.
»Das beginnt Ende Februar 1810 und endet Ostern im selben Jahr, wie es scheint, mitten im Satz.«
»Ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen.«
»Sie wird weitergeschrieben haben, nicht wahr?«
»Das ist stark anzunehmen.«
»Anita, diese Ururgroßmutter von Julian, die hieß doch Graciella Coloman. Diese Frau, die den Siegelring angeblich immer an das älteste Kind vererbt hat, muss also wohl verheiratet gewesen sein. Wäre es nicht möglich, dass sie die Graciella Raabe ist, die in dem ersten Eintrag genannt wird?«
»Der Gedanke ist mir natürlich auch schon gekommen. Es macht Sinn, denn wie sollte dieses Tagebuch ansonsten in Julians Hände gelangt sein? Ich wollte ja ein wenig Ahnenforschung betreiben. Jetzt werde ich mir also mal die Finger staubig machen und alte Unterlagen wälzen. Montag fahre ich zu Uschi und schaue, ob ich in Julians Ordnern oder Kisten etwas finde. Ich hoffe nur, sie hat nicht alles ausgemistet und weggeworfen.«
»Warum erst Montag?«
»Weil, meine Lieben, Uschi am Sonntag nach Malta fliegt und ich keine große Lust habe, ihr mit diesem Ansinnen unter die Augen zu treten. Sie ist bei allem, was Julian anbelangt, äußerst empfindlich. Und auf mich ist sie nicht gut zu sprechen.«