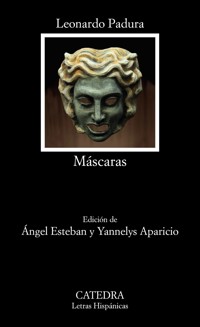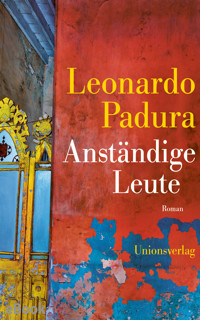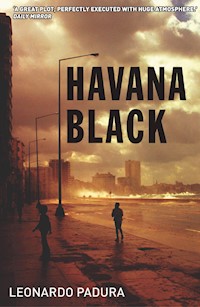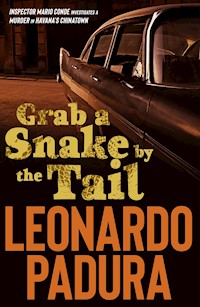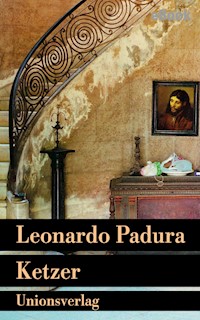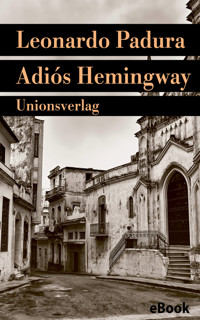14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Tötet ihn nicht! Dieser Mann muss reden«, rief der schwer verwundete Trotzki seinen Leibwächtern zu, als sie sich auf den Mann stürzten, der Trotzki mit einem Eispickel niedergeschlagen hatte. Leonardo Padura bringt ihn zum Sprechen. Ein rätselhafter Mann, der mit seinen beiden Windhunden am Strand spazieren geht, erzählt dem kubanischen Schriftsteller Iván die Geschichte des Trotzki-Mörders Ramón Mercader. Paduras vielschichtiger Roman führt uns an verschiedenste Schauplätze der Weltrevolution: ins Bürgerkriegsspanien, nach Moskau während der stalinistischen Schauprozesse, ins Prag von 1968, nach Kuba. In atemberaubender Prosa erweckt er die Protagonisten zu neuem Leben, zeigt sie in ihrer Bereitschaft zur völligen Selbstaufgabe zugunsten einer Ideologie – und zieht die Bilanz der gescheiterten Utopien eines Jahrhunderts.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1201
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Leonardo Paduras vielschichtiger Roman führt ins Spanien des Bürgerkriegs, ins Mexiko Frida Kahlos und Diego Riveras, ins Prag von 1968, nach Kuba. Geheimdienstler, Freiheitskämpfer, Verschwörer und Verbrecher kreuzen sich an den Schauplätzen der Revolution. Die minutiösen Vorbereitungen zur Ermordung Trotzkis gipfeln in einem furiosen Finale.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Der Mann, der Hunde liebte
Roman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
E-Book-Ausgabe
Mit 2 Bonus-Dokumenten im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2009 unter dem Titel El hombre que amaba a los perros bei Tusquets Editores in Barcelona.
Die Übersetzung aus dem Spanischen wurde mit Mitteln der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt durch litprom – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V.
Originaltitel: El hombre que amaba a los perros (2009)
© by Leonardo Padura Fuentes 2009
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30483-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 12:01h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER MANN, DER HUNDE LIEBTE
London, 22. August 1940 (TASS).Erster Teil1 – Havanna, 20042 – Der eiskalte Nebel verschluckte die Umrisse der letzten …3 – Ja, sag ihm, ja.«4 – Die versteinerte Scheiße der Gegenwart« … Lew …5 – Die laue Luft liebkoste die Haut, und das …6 – Ihre Eltern nannten sie África, wie die Schutzpatronin …7 – Karalambos musste kaum das Ruder bewegen. In der …8 – Ramón hatte das Gefühl, die Stadt sei alt …9 – Im Frühling 1977 fuhr ich mehrmals an den …10 – Er wusste, dass sie etwas im Schilde führten …11 – Jene frühlingshaften und so atemberaubenden Wochen im März …12 – Im Laufe der Jahre haben sich viele Einzelheiten …13 – Die Ereignisse seit dem 26. August 1936 machten …14 – Roman Pawlowitsch lächelte, als würde er wieder ins …15 – In der letzten Novemberwoche und im Dezember 1977 …Zweiter Teil16 – Was mag er empfunden haben, als er das …17 – Ramón Mercader war davon überzeugt, dass Paris die …18 – Welche der endlos vielen Schlachten, die er geschlagen …19 – Der 8. Januar 1978 war vielleicht der kälteste …20 – Jacques fühlte sich in eine frühere Zeit zurückversetzt …21 – Das Haus der Gewerkschaften in Moskau ist ein …22 – Jacques Mornard verspürte echte Freude, als er die …23 – Am 2. Mai 1939 hatten die Trotzkis die …24 – An einem trägen und schweißtreibenden Nachmittag des Jahres …25 – Jacques Mornard spürte, wie ihm ein kalter Schauer …26 – In der Nacht des 24. Mai, als die …27 – Als er über die Schwelle der Festung von …28 – Ich weiß nicht mehr genau, wann ich angefangen …Dritter Teil — Apokalypse29 – Moskau 196830 – RequiemDankbare NachbemerkungMehr über dieses Buch
Leonardo Padura: Perversion einer Utopie
Leonardo Padura: Was macht den Tod Trotzkis so bedeutsam?
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Karibik
Zum Thema Revolution
Zum Thema Spanien
Zum Thema Geschichte
Zum Thema Lateinamerika
Nach dreißig Jahren, noch immer,
für Lucía
Es war die Zeit, da nur der Tote lächelte,froh über die Ruhe.
Anna Achmatowa, Requiem
Das Leben ist größer als die Geschichte.
Gregorio Marañón, Geschichte eines Ressentiments
London, 22. August 1940 (TASS).
Radio London teilte heute mit: »In einem Krankenhaus in Mexiko-Stadt starb Leo Trotzki infolge eines Schädelbasisbruchs nach einem Attentat, das am Vortag von einer Person aus seinem engsten Umfeld auf ihn verübt wurde.«
Leandro Sánchez Salazar: War er nicht misstrauisch?
Gefangener: Nein.
L.S.S.: Haben Sie sich nichts dabei gedacht, einen wehrlosen alten Mann so feige zu überfallen?
G.: Ich habe gar nichts gedacht.
L.S.S.: Als Sie vom Füttern der Kaninchen zurückkamen, worüber haben Sie da gesprochen?
G.: Ich erinnere mich nicht mehr, ob er überhaupt gesprochen hat.
L.S.S.: Hat er nicht gesehen, wie du nach dem Eispickel gegriffen hast?
G.: Nein.
L.S.S.: Unmittelbar nachdem du ihm den Schlag versetzt hattest, was hat er da gemacht?
G.: Er ist herumgesprungen wie ein Verrückter und hat geschrien wie am Spieß, an sein Geschrei werde ich mich mein Leben lang erinnern.
L.S.S.: Wie hat er geschrien? Los, machs nach!
G.: A……….a…………a………..ah………! Aber viel lauter.
Aus dem Verhör, das Oberst Leandro Sánchez Salazar, Chef des Geheimdienstes der Polizei von Mexiko-Stadt, mit dem mutmaßlichen Mörder Leo Trotzkis, Jacques Mornard Vandendreschd alias Frank Jacson, in der Nacht von Freitag, den 23., auf Samstag, den 24. August 1940, führte.
Erster Teil
1
Havanna, 2004
Ruhe in Frieden«, waren die letzten Worte des Priesters.
Wenn dieser aus dem Munde des Geistlichen so furchtbar theatralisch klingende, abgenutzte Satz jemals einen Sinn gehabt hat, dann in diesem Augenblick, als die Leichenträger Anas Sarg mit gleichgültiger Routine in das offene Grab hinabließen. Die Gewissheit, dass das Leben schlimmer als jede Hölle sein kann und sich mit diesem Akt aller Ballast von Angst und Schmerz für immer in Luft auflöst, ließ mich erleichtert aufatmen, und ich fragte mich, ob ich meine Frau um diesen letzten Weg in die ewige Stille nicht irgendwie beneidete; denn tot sein, vollkommen und endgültig tot, ist für viele Menschen wahrscheinlich die höchste Gnade jenes Gottes, den Ana mir in den letzten Jahren ihres dahinwelkenden Lebens nahezubringen versuchte, allerdings mit mäßigem Erfolg.
Die Totengräber schoben die Steinplatte über das Grab und machten sich nun daran, die Blumenkränze der Freunde auf die Platte zu legen. Ich drehte mich um und entfernte mich langsam, um dem endlosen Schulterklopfen und den Mitleidsblicken zu entgehen, zu denen man sich offenbar verpflichtet fühlt. Denn in solchen Momenten ist jedes Wort zu viel. Lediglich die abgedroschene Formel des Pfarrers ergab einen Sinn, und über den wollte ich nachdenken. Ruhe und Frieden, das hatte Ana nun endlich gefunden, und auch ich sehnte mich jetzt danach.
Als ich mich in meinen Pontiac setzte, um auf Daniel zu warten, war ich einer Ohnmacht nahe. Wenn mein Freund mich nicht bald von hier fortbringen würde, würde ich gewiss nie wieder einen Weg zurück ins Leben finden. Die Septembersonne knallte auf das Wagendach, doch ich sah mich außerstande, auszusteigen und mich an einen schattigen Ort zu begeben. Ich konnte die Augen nicht mehr aufhalten und versuchte, gegen das Schwindelgefühl anzukämpfen. Die Strapazen hatten mich völlig erschöpft. Ich verglühte in dem Kunststoffsitz, und säuerlich riechender Schweiß lief mir über Augenlider und Wangen. Er sammelte sich in meinen Achselhöhlen, rann mir über Hals, Arme und Rücken und verwandelte sich in einen warmen Bach, der über die Beine in die Schuhe strömte. Ich überlegte mir, ob dieser Schweißausbruch und die totale Erschöpfung nicht der Anfang meines molekularen Zerfalls waren oder zumindest eines Infarkts, der mich in den nächsten Minuten umbringen würde. Beides schienen mir einfache, ja, sogar wünschenswerte, wenn auch, offen gestanden, egoistische und ungerechte Lösungen zu sein: Ich hatte kein Recht, mich einfach davonzustehlen und meinen Freunden noch ein zweites Begräbnis zuzumuten.
»Gehts dir nicht gut, Iván?« Danys Stimme ließ mich hochschrecken. »Du schwitzt ja wie eine Sau …«
»Ich muss hier weg, verdammt …«
»Keine Panik, Alter, wir fahren sofort los. Ich steck den Trägern nur noch schnell ein paar Pesos zu«, sagte mein Freund, und der Realitätssinn, der aus seinen Worten sprach, erschien mir in dieser Situation einigermaßen befremdend, wenn nicht abwegig.
Ich schloss wieder die Augen und rührte mich nicht. Schweißgebadet verharrte ich, bis der Wagen angelassen wurde und sich in Bewegung setzte. Erst als die kühlende Luft durch das offene Seitenfenster drang, hob ich die Lider. Als wir vom Friedhofsgelände fuhren, sah ich aus den Augenwinkeln noch die letzten Grabreihen und Mausoleen, die von der Sonne, der Witterung und dem Vergessen angefressen und so mausetot waren wie ihre Bewohner. Und wieder einmal fragte ich mich, keine Ahnung, wieso gerade jetzt und hier, warum irgendwelche Wissenschaftler ausgerechnet meinen Namen ausgewählt hatten, um den heranziehenden Tropensturm, den neunten in diesem Jahr, zu taufen.
Ich hatte mir abgewöhnt (besser gesagt, es wurde mir auf nicht immer freundliche Art und Weise abgewöhnt), an Zufälle zu glauben, für die Meteorologen gab es jedoch offenbar gute Gründe, jenen Sturm »Iván« zu nennen, denn bisher war dieser männliche Vorname, der mit dem neunten Buchstaben des Alphabets beginnt, noch nie verwendet worden. Die Unheil verkündende Wolkenbildung, die sich später zu »Iván« entwickeln sollte, war über den Kapverden entstanden, und in wenigen Tagen würde Iván, zu einem ausgewachsenen Hurrikan geworden, in die Karibik einfallen und seinen alles verschlingenden Rachen öffnen … Sie werden bald verstehen, warum ich Grund zur Annahme habe, nur ein böser Winkelzug des Schicksals könne jenem Zyklon, einem der verheerendsten in der Geschichte, meinen Namen gegeben haben, und das genau zu einem Zeitpunkt, als sich ein anderer Hurrikan anschickte, mein Leben heimzusuchen.
Ana und ich wussten schon seit langer, vielleicht zu langer Zeit, dass ihr Tod unausweichlich war, doch wir hatten uns durch die vielen Jahre, die wir uns mit ihren verschiedenen Krankheiten herumschlugen, daran gewöhnt, damit zu leben. Die Ankündigung, dass aus ihrer Osteoporose (wahrscheinlich bedingt durch den allgemeinen Vitaminmangel in der härtesten Phase der Krise der Neunziger) Knochenkrebs geworden war, hatte uns mit der Tatsache ihres baldigen Endes konfrontiert und mich dann überzeugt, dass nur eine perfide Heimsuchung des Schicksals meiner Frau ausgerechnet ein solches Leiden auferlegt haben konnte.
Seit Jahresanfang hatte sich Anas Gesundheitszustand rapide verschlechtert, und Mitte Juli, drei Monate nach der endgültigen Diagnose, begann ihr letzter aussichtsloser Kampf gegen den Tod. Anas Schwester Gisela kam zwar häufig zu uns, um zu helfen, dennoch musste ich Urlaub nehmen, um meine Frau zu pflegen; und wenn wir jene Monate überstanden, dann nur dank des Beistands von Freunden wie Dany, Anselmo und Frank, einem Arzt. Sie besuchten uns regelmäßig in unserer kleinen Wohnung im Stadtviertel Lawton und versorgten uns mit Lebensmitteln aus ihren bescheidenen Beständen, die sie auf den verschlungensten Wegen organisierten. Auch bot Dany wiederholt an, sich mit mir an Anas Krankenbett abzuwechseln, doch ich lehnte ab; denn zu den wenigen Dingen, die durch das Teilen nur noch mehr belasten, gehören der Schmerz und das Unglück.
Das Leben in unseren vier Wänden war so armselig und bedrückend, wie man es sich nur vorstellen kann; doch das Schlimmste daran war zu sehen, mit welch enormer Kraft Anas geschundener Körper sich an das Leben klammerte, auch gegen den ausdrücklichen Wunsch seiner Bewohnerin.
In den ersten Septembertagen, als der Hurrikan Iván den Atlantik überquerte und mit voller Wucht über die Insel Grenada herfiel, hatte Ana eine unerwartete Phase der Klarheit, und ihre Schmerzen ließen, ganz gegen jede Voraussage des Arztes, nach. Da wir auf ihren eigenen Wunsch hin eine Einweisung ins Krankenhaus abgelehnt hatten, übernahmen es eine Pflegerin aus der Nachbarschaft und unser Freund Frank, ihr die Infusionen zu setzen und das Morphium zu verabreichen, das sie in einen unruhigen Dämmerzustand versetzte. Diese Reaktion sei das Endstadium, machte mich Frank aufmerksam und empfahl mir, die Infusionen abzusetzen und die Sterbende nur zu füttern, falls sie danach verlange. Und wenn sie sich nicht über Schmerzen beklage, solle ich ihr auch kein Morphium mehr geben, riet er mir, um ihr noch ein paar Tage bei klarem Verstand zu schenken. In der Folgezeit, ganz so als wäre ihr Leben zur Normalität zurückgekehrt, begann Ana, mit all ihren gebrochenen Knochen, sich wieder für ihre Umgebung zu interessieren. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie auf den Fernseher oder lauschte dem Radio und verfolgte wie besessen die Richtungswechsel des Hurrikans, der seinen Todestanz aufführte und bereits über Grenada hinweggefegt war und mehr als zwanzig Tote zurückgelassen hatte. Ana begann, mir Vorträge zu halten über die Charakteristika dieses Zyklons: Er gehöre zu den schlimmsten seit meteorologischen Aufzeichnungsbeginns, und seine außergewöhnliche Heftigkeit sei eine Folge des globalen Klimawandels, der die menschliche Spezies ausrotten könne, wenn nicht umgehend die notwendigen Maßnahmen ergriffen würden, sagte sie voller Überzeugung. Zu sehen, wie meine todkranke Frau sich um die Zukunft anderer sorgte, bereitete mir zusätzlichen Kummer.
Während sich der Tropensturm mit der unverkennbaren Absicht, danach über den Osten Kubas herzufallen, zunächst Jamaika näherte, wurde Ana von einer Art meteorologischer Erregung erfasst. Sie steigerte sich in einen permanenten Alarmzustand, und die Anspannung verließ sie nur dann, wenn der Schlaf sie für zwei oder drei Stunden übermannte. Ihr Interesse richtete sich ausschließlich auf die Route von Iván, auf die Anzahl der Toten, die er auf seinem Weg zurückließ (einen in Trinidad, fünf in Venezuela, einen in Kolumbien, fünf weitere in der Dominikanischen Republik, fünfzehn in Jamaika, zählte sie, wobei sie ihre deformierten Finger zu Hilfe nahm), und vor allem auf die Zerstörungen, die er anrichten würde, wenn er an einem der von den Fachleuten errechneten möglichen Punkte Kuba erreicht. Was Ana erlebte, war so etwas wie eine kosmische Verbundenheit angesichts der symbiotischen Vereinigung zweier Organismen, die sich im Laufe der nächsten Tage selbst vertilgen würden, und ich begann zu grübeln, ob Krankheit und Morphium ihr nicht den Verstand geraubt hatten. Wenn der Hurrikan nicht bald über uns hinwegfegte und Ana sich nicht beruhigte, würde ich am Ende derjenige sein, der den Verstand verlor.
Die kritischste Phase für Ana wie natürlich für jeden Bewohner der Insel begann, als Iván sich mit rund zweihundertfünfzig Kilometern in der Stunde von Süden her Kuba näherte. Es war, als würde er sich mit all seiner krankhaften Bösartigkeit die Stelle aussuchen, an der er das Land in zwei Hälften teilen und eine riesige Spur der Zerstörung und des Todes hinterlassen wollte. Mit angehaltenem Atem, sämtliche Sinne auf das Radio und den Farbfernseher gerichtet, den ein Nachbar uns geliehen hatte, die Bibel in Reichweite und die Hand im Fell unseres Hundes Truco, so lag Ana auf ihrem Bett, weinte, lachte, fluchte und betete abwechselnd mit unvermuteter Kraft. Mehr als achtundvierzig Stunden hielt dieser Erregungszustand an. Sie verfolgte die geheimnisvollen Wege Iváns, so als könnten ihre Gedanken und Gebete dazu beitragen, die Insel vor ihm zu bewahren, der sich tatsächlich, kaum zu glauben, nach Westen wandte und sich noch immer nicht entschließen konnte, sich den Gesetzen der Geschichte und der Meteorologie zu unterwerfen und nach Norden abzudrehen, um dort das Land zu verwüsten.
In der Nacht vom 12. auf den 13. September, als die Satelliten und Radare sowie die Meteorologen aus aller Welt einhellig darauf hinwiesen, dass Iván Kurs auf Norden nehmen und sich mit seinen wie Rammböcke wirkenden Windböen, seinen gigantischen Wellen und seinen sturzbachartigen Wolkenbrüchen genüsslich der endgültigen Zerstörung Havannas widmen würde, bat mich Ana, das wurmstichige dunkle Holzkreuz, das ich siebenundzwanzig Jahre zuvor aus dem Meer geborgen hatte (das Kreuz des Schiffbruchs), von der Wand zu nehmen und es auf das Fußende des Bettes zu legen. Dann verlangte sie eine heiße Schokolade und Toast mit Butter. Wenn passierte, was passieren musste, würde dies ihre letzte Mahlzeit sein, denn das kaputte Dach unseres Hauses würde der Wucht des Hurrikans nichts entgegenzusetzen haben, und Ana, überflüssig zu sagen, weigerte sich natürlich, von hier fortgebracht zu werden. Nachdem sie die Schokolade getrunken und von dem Toast abgebissen hatte, bat sie mich, das Kreuz des Schiffbruchs neben sie zu legen, dann begann sie zu beten, die Augen starr auf die Stützbalken der Zimmerdecke gerichtet, und beschwor womöglich in ihrer Fantasie die Bilder der Apokalypse herauf, die die Stadt bedrohte.
Am Morgen des 14. September verkündeten die Meteorologen das Wunder: Iván hatte schließlich nach Norden abgedreht, und zwar so sehr westlich, dass er nur den äußersten Zipfel der Insel gestreift hatte, ohne größere Schäden zu verursachen. Anscheinend hatte der Hurrikan Mitleid mit uns und unseren dauernden Schicksalsschlägen, und hatte in der Überzeugung, eine weitere Heimsuchung wäre zu viel des Bösen gewesen, beschlossen, uns zu verschonen. Erschöpft vom vielen Beten, mit ruiniertem Magen wegen der Mangelernährung, jedoch glücklich über das, was sie als ihren persönlichen Triumph betrachtete, schlief Ana ein, nachdem sie die Nachricht über die Laune des Kosmos vernommen hatte. Auf ihren Lippen zeigte sich so etwas wie ein Lächeln, und ihre sonst so unruhige Atmung beruhigte sich wieder etwas. Zusammen mit den Fingern, die Trucos Fell streichelten, waren das für zwei weitere Tage die einzigen Anzeichen dafür, dass sie noch lebte.
Am 16. September, bei Einbruch der Nacht, während der Hurrikan auf dem nordamerikanischen Festland allmählich schwächer wurde und seine Winde immer mehr an Kraft verloren, hatte Ana aufgehört, unseren Hund zu streicheln und, wenige Minuten später, zu atmen. Endlich ruhte sie, und ich möchte glauben, in ewigem Frieden.
Irgendwann werden Sie verstehen, warum diese Geschichte, die nicht die Geschichte meines Lebens ist, obwohl sie es irgendwie doch ist, so beginnt, wie sie beginnt. Und auch wenn Sie noch nicht wissen, wer ich bin, noch eine Vorstellung davon haben, was ich erzählen werde, haben Sie eins gewiss bereits verstanden: Ana war sehr wichtig für mich. So wichtig, dass ich diese Geschichte für sie aufgeschrieben habe, schwarz auf weiß, wie man so sagt.
Ana kreuzte in einem jener häufigen Momente meinen Weg, als ich wieder einmal am Abgrund stand. Die ruhmreiche Sowjetunion lag bereits in den letzten Zügen, und auf uns fielen die ersten Strahlen der Krise, die unser Land in den Neunzigerjahren unterminieren sollte. Als eine der ersten Folgen der Katastrophe wurde, wie vorauszusehen, die veterinärmedizinische Zeitschrift, für die ich seit Jahrhunderten als Korrektor tätig war, wegen Strom-, Druckerschwärze- und Papiermangel geschlossen. So wie Dutzende von Leuten, die für die Presse gearbeitet hatten, angefangen bei Druckern bis hin zu Redaktionsleitern, landete auch ich beim Kunsthandwerk. Für eine begrenzte Zeit würden wir nun also Makrameearbeiten und dekorative Accessoires aus lackierten Pflanzensamen herstellen, die, wie jedermann wusste, niemand kaufen konnte noch sich zu kaufen trauen würde. Nach drei Tagen an meiner neuen und völlig überflüssigen Arbeitsstelle flüchtete ich, ohne offiziell zu kündigen, aus jener Wabe frustrierter, wütender Arbeitsbienen, und dank meinen Freunden, den Veterinärmedizinern, deren Artikel ich früher korrigiert und häufig sogar umgeschrieben hatte, konnte ich wenig später in der damals schon schlecht ausgestatteten Klinik des veterinärmedizinischen Instituts der Universität Havanna als Assistent oder, besser gesagt, als eine Art Mädchen für alles anfangen.
In Momenten grenzenlosen Aberglaubens überlege ich manchmal, ob nicht all diese persönlichen, nationalen und globalen Entscheidungen (man sprach sogar vom »Ende der Geschichte«, dabei fingen wir gerade erst an, uns eine Vorstellung von der Geschichte des 20. Jahrhunderts zu machen) nur das eine Ziel hatten, dass an einem regnerischen Nachmittag eine verzweifelte, völlig durchnässte junge Frau mit einem struppigen Pudel auf dem Arm in die Klinik kam und mich anflehte, ihren an Verstopfung leidenden Hund zu retten. Es war schon nach vier, und die Ärzte waren nach Hause gegangen, also sagte ich zu der jungen Frau (sie und der Hund zitterten vor Kälte, und als ich sie so vor mir stehen sah, spürte ich, wie mir die Stimme versagen wollte), dass ich nichts für sie tun könne. Sie brach in Schluchzen aus. Tato werde ihr wegsterben, sagte sie, sie sei schon bei zwei Tierärzten gewesen, aber die hätten keine Narkosemittel und könnten ihn nicht operieren, und da in der Stadt kein Bus fahre, sei sie mit ihrem Hund auf dem Arm den ganzen Weg von der Altstadt hierher zu Fuß durch den Regen gekommen, und ich müsse um Gottes willen etwas tun. Etwas tun? Noch heute frage ich mich, wie ich den Mut aufgebracht habe – oder ob ich mich in Wirklichkeit nach einer Gelegenheit gesehnt hatte, Mut zu beweisen –, aber nachdem ich dem Mädchen erklärt hatte, ich sei kein Tierarzt, forderte ich sie auf, eine Erklärung zu unterschreiben, die mich von jeglicher Verantwortung entband, und dann wurde der sterbenskranke Tato mein erster Patient. Wenn der Gott, zu dem das Mädchen betete, jemals beschlossen hat, einen Hund zu retten, dann muss es an jenem Nachmittag gewesen sein: Die Operation, über die ich viel gelesen und bei der ich schon oft zugesehen hatte, wurde ein voller Erfolg …
Je nachdem, wie man es betrachtet, war Ana die Frau, die ich brauchte, oder die, die am wenigsten zu mir passte: fünfzehn Jahre jünger als ich, äußerst anspruchslos in materiellen Dingen, eine furchtbar schlechte und verschwenderische Köchin, die Hunde über alles liebte, ausgestattet mit einem merkwürdigen Realitätssinn, der ihre abstrusen Ideen in klare, rationale Entscheidungen münden ließ. Von Anfang an gab sie mir das Gefühl, sie sei die Frau, die ich all die Jahre gesucht hatte. Darum war ich auch nicht weiter überrascht, als Ana wenige Wochen nach Beginn unserer zarten und äußerst befriedigenden sexuellen Beziehung (um Tato eine Spritze zu geben, war ich zu ihr in die Wohnung gegangen, die sie mit einer Freundin teilte) ihre Habseligkeiten in zwei Rucksäcken verstaute und mit einer Bücherkiste, ihrem Lebensmittelheftchen, in dem die Adresse bereits geändert war, und ihrem fast wieder genesenen Pudel in meine schäbige feuchte Wohnung im Lawton einzog.
Gequält – neben anderen Widrigkeiten – vom ständigen Hunger, den Stromsperren, Lohnsenkungen und dem lahmgelegten Busverkehr, erlebten Ana und ich eine Zeit der Ekstase. Dünn, wie wir waren, durch Mangelernährung und lange Fahrten mit den chinesischen Fahrrädern, die man uns für einen symbolischen Preis an unseren Arbeitsstellen verkauft hatte, verwandelten wir uns in beinahe ätherische Wesen, eine ganz neue Art von Mutanten, immerhin jedoch in der Lage, unsere letzten Energien auf die Liebe zu verwenden, auf stundenlange Gespräche und darauf, wie besessen zu lesen – Ana Poesie, ich nach langer Zeit wieder Romane. Irgendwie waren es unwirkliche Jahre in einem düsteren, lethargisch dahindämmernden und immer heißen Land, das mit jedem Tag mehr verfiel, ohne in die Tiefen jener Primitivgesellschaft abzustürzen, die uns später erwartete. Doch Jahre, in denen auch der schlimmste Mangel unsere Freude darüber nicht trüben konnte, zusammen zu sein, Seite an Seite zu leben wie Schiffbrüchige, die sich aneinanderklammern, um gemeinsam gerettet zu werden oder unterzugehen.
Außer dem Hunger und den materiellen Entbehrungen – die wir jedoch als äußerlich und unvermeidlich ansahen, sodass sie uns nicht eigentlich betrafen – war das einzig wirklich Traurige, das wir in jener Zeit erlebten, die Diagnose von Anas beginnender Polyneurose durch Vitaminmangel und später Tatos Tod mit sechzehn Jahren. Das Hinscheiden ihres Pudels betrübte Ana so sehr, dass ich nach ein paar Wochen ihre Trauer zu lindern versuchte, indem ich einen räudigen Straßenköter auflas und nach Hause mitbrachte. Ana taufte ihn auf der Stelle »Truco«, wegen seiner trickreichen Fähigkeit, sich in irgendeinem Winkel zu verstecken, und päppelte ihn mit dem auf, was sie von unseren schmalen Überlebensmittelrationen abzweigen konnte.
Ana und ich hatten ein so großes Vertrauen zueinander, dass ich, als wäre es mir ein natürliches Bedürfnis gewesen, eines Abends, an dem der Strom abgestellt, unser Hunger kaum gestillt war und wir von Sorgen und Hitze gequält wurden (wie war es möglich, dass bei dieser Scheißhitze nicht einmal der Mond so hell schien wie früher?), damit begann, ihr von dem Mann zu erzählen, den ich vierzehn Jahre zuvor getroffen und seit dem Tag unserer Begegnung »den Mann, der Hunde liebte« genannt hatte. Bis zu jenem Abend, an dem ich beschloss, Ana praktisch ohne Umschweife und wie aus heiterem Himmel diese Geschichte anzuvertrauen, hatte ich noch niemandem je enthüllt, wovon der Mann und ich gesprochen hatten, und schon gar nicht von meinem unterdrückten, immer wieder hintangestellten und in all den Jahren häufig vergessenen Wunsch erzählt, die Geschichte aufzuschreiben. Damit sie eine Vorstellung bekam, wie sehr mich die Begegnung mit jenem Mann und seine irre Geschichte von Hass, Betrug und Tod beeindruckt hatten, gab ich ihr sogar die Aufzeichnungen zu lesen, die ich vor Jahren in meiner damaligen Unwissenheit und fast gegen meinen Willen gemacht hatte. Nachdem Ana sie gelesen hatte, sah sie mich lange an, und ihre ernsten schwarzen Augen – jene Augen, die immer das Lebendigste an ihr gewesen waren – brannten mir auf der Haut. Schließlich sagte sie mit grenzenlosem Erstaunen, sie verstehe nicht, wie ausgerechnet ich bislang kein Buch über diese Geschichte, die Gott mir mit auf den Weg gegeben habe, geschrieben hätte. Ich sah ihr in die Augen – dieselben Augen, die jetzt von den Würmern zerfressen werden – und gab ihr die Antwort, die mir so oft als Ausrede diente und die einzige war, die ich Ana geben konnte: »Weil ich Angst hatte.«
2
Der eiskalte Nebel verschluckte die Umrisse der letzten Hütten, und der Treck tauchte wieder in die Schwindel verursachende, beklemmende Weiße ein, in der es weder einen Horizont noch sonst irgendeinen Halt gab. In diesem Augenblick begann Lew Dawidowitsch zu begreifen, warum sich die Bewohner jenes rauen Winkels der Welt seit Anbeginn der Zeiten nicht davon abbringen lassen, Steine zu verehren.
Die sechs Tage, die die Polizisten und die Verbannten gebraucht hatten, um, eingehüllt in das absolute Weiß, in dem jeder Begriff von Zeit und Raum verloren ging, durch die eisigen Steppen Kirgistans von Alma-Ata nach Frunse zu gelangen, hatten sie gelehrt, wie lächerlich jeder menschliche Stolz ist und wie unbedeutend angesichts der Urgewalt des Unendlichen. Die Schneemassen, die aus einem Himmel fielen, von dem jede Spur von Sonne getilgt war, und die alles, was sich ihrer zerstörerischen Gewalt entgegenzustellen wagte, zu verschlingen drohten, erwiesen sich als eine nicht zu bändigende Kraft. In solchen Momenten verwandeln sich die Umrisse eines Berges, ein Baum, die gefrorene Oberfläche eines Flusses oder ein einfacher Felsen inmitten der Steppe in etwas Besonderes, das leicht zum Gegenstand der Verehrung werden kann. Die Ureinwohner jener verlassenen Gegenden haben die Steine verherrlicht, weil sich in ihrer Widerstandsfähigkeit eine Kraft ausdrückt, die einen ewigen Willen für immer in ihrem Inneren eingeschlossen hat. Einige Monate zuvor, bereits in der Verbannung, hatte Lew Dawidowitsch gelesen, dass der allgemein als Ibn Batuta und im Orient unter dem Namen Shams ad-Dina bekannte Weise seinem Volk verkündet hatte, der Akt, einen heiligen Stein zu küssen, führe zu einer erhebenden spirituellen Erfahrung; man verspüre dabei eine so durchdringende Süße auf den Lippen, dass man den Wunsch habe, den Stein bis ans Ende aller Zeiten zu küssen. Um die Reinheit der Hoffnung zu bewahren, war es darum überall dort, wo sich ein heiliger Stein befand, verboten, Schlachten zu schlagen oder Feinde hinzurichten. Die Weisheit dieser Doktrin erschien Lew Dawidowitsch so einleuchtend, dass er sich fragte, ob die Revolution wirklich ein uraltes Gesetz umstoßen durfte, das in seiner Art vollkommen war und unmöglich von einem in rationalistischen und kulturellen Vorurteilen gefangenen europäischen Gehirn erfasst werden konnte. Zu der Zeit nämlich waren bereits politische Aktivisten aus Moskau auf dem Weg in jene abgelegenen Gegenden, um die Nomadenstämme zu Arbeitern in landwirtschaftlichen Genossenschaften und ihre Gebirgsziegen zu Staatsvieh zu machen und den Turkmenen, Kasachen, Usbeken und Kirgisen zu beweisen, dass ihr atavistischer Brauch, Steine oder Bäume anzubeten, eine bedauerliche, antimarxistische Haltung sei, die sie aufgeben müssten zugunsten des Fortschritts einer Menschheit, die begreifen werde, dass ein Stein letztlich nur ein Stein sei und die Berührung mit ihm nichts anderes als ein simpler physischer Kontakt.
Eine Woche zuvor hatte Lew Dawidowitsch erleben müssen, wie man ihm die letzten Steine abnahm, die ihn einen Platz auf der verworrenen politischen Karte seines Landes hatten finden lassen. Später sollte er schreiben, dass er an jenem Morgen starr vor Kälte und mit einer bösen Vorahnung erwacht war. Überzeugt davon, das Zittern seines Körpers rühre nicht nur von der Kälte her, hatte er es zu kontrollieren versucht und im Halbdunkel den wackligen Stuhl ausgemacht, der ihm als Nachttisch diente. Er tastete nach seiner Brille, bekam sie zu fassen, doch erst beim dritten Versuch schafften es seine zittrigen Hände, die Drahtbügel hinter die Ohren zu klemmen. In dem milchig grauen Licht des Wintermorgens konnte er an der Zimmerwand den Kalender mit dem Foto einiger wie versteinert in die Kamera blickenden Mitglieder des Leninistischen Komsomol erkennen. Der Kalender war ihm vor einigen Tagen aus Moskau zugeschickt worden, ohne dass er wusste, von wem, denn sowohl der Umschlag als auch der mutmaßliche Brief des Absenders waren verschwunden, so wie seine gesamte Korrespondenz der letzten Monate. Als das Datum auf dem Kalender und die raue Oberfläche der Zimmerwand ihn in die Wirklichkeit zurückholten, wurde ihm klar, dass er deshalb mit dieser inneren Unruhe aufgewacht war, weil er nicht gewusst hatte, wo er sich befand und welcher Tag es war. Deswegen, so schrieb er, erleichterte ihn die Gewissheit, dass es der 20. Januar 1929 war und er sich in Alma-Ata befand, auf einem quietschenden Bett, und dass neben ihm seine Frau Natalia Sedowa schlief.
Leise stand er auf, und sogleich spürte er Mayas Schnauze an seinem Knie: Die Hündin wünschte ihm einen guten Morgen, und er kraulte sie hinter den Ohren, wo er Wärme fand und ein beruhigendes Gefühl von Realität. In seinen Pelz gehüllt, um den Hals einen dicken Schal, ging er auf den Abort, um seine Blase zu entleeren, und dann in den Wohnraum, der gleichzeitig als Esszimmer und Küche diente. Es brannten bereits zwei Gaslampen, und der Ofen, auf den sein persönlicher Gefängniswärter den Samowar gestellt hatte, verbreitete eine angenehme Wärme. Eigentlich zog er morgens Kaffee vor, doch inzwischen hatte er sich mit dem abgefunden, was die elenden Bürokraten von Alma-Ata und seine Bewacher von der Geheimpolizei ihm zuteilten. Er setzte sich an den Tisch, nahe beim Ofen, und trank aus einer großen chinesischen Tasse ein paar Schlucke des zu starken, zu grünen Tees, während er Mayas Kopf tätschelte, ohne noch zu ahnen, dass er sehr bald schon die Bestätigung dafür bekommen sollte, dass sein Leben und sogar sein Tod nicht mehr ihm gehörten.
Vor exakt einem Jahr hatte man ihn nach Alma-Ata verbannt, in den asiatischen Teil Russlands, der chinesischen Grenze näher als der letzten russischen Eisenbahnstation. Seit er, seine Frau und sein Sohn Ljowa von dem schneebedeckten Lastwagen gestiegen waren, auf dem sie die letzte Strecke in den Verbannungsort zurückgelegt hatten, wartete Lew Dawidowitsch auf den Tod. Er war überzeugt: Sollte er Malaria und Ruhr wie durch ein Wunder überleben, würde der Befehl zu seiner Eliminierung früher oder später erteilt werden. (»Wenn er so weit weg stirbt, wird er bereits unter der Erde sein, ehe die Menschen von seinem Tod erfahren«, dachten seine Feinde zweifellos.) Doch noch bevor eintrat, worauf seine Gegner warteten, hatten sie ihn hastig aus der Geschichte und dem öffentlichen Gedächtnis, welche sich die Partei inzwischen ebenfalls angeeignet hatte, zu tilgen: Die Veröffentlichung seiner Werke war, kurz vor Erscheinen des einundzwanzigsten Bandes der Gesamtausgabe, gestoppt worden, und seine Bücher wurden aus Buchhandlungen und Bibliotheken entfernt; gleichzeitig begann man, ihn zu diffamieren und seinen Namen aus Geschichtsbüchern, Gedenkschriften und Zeitungsartikeln, ja, sogar sein Gesicht von Fotos zu entfernen, um ihn in ein absolutes Nichts zu verwandeln, in einen blinden Fleck im öffentlichen Gedächtnis. Wenn es etwas gab, so dachte Lew Dawidowitsch, das ihm bis jetzt das Leben gerettet hatte, dann war es die Furcht vor dem Erdbeben, das eine solche Entscheidung hervorrufen könnte, falls überhaupt noch etwas das Gewissen eines durch Ängste, Parolen und Lügen verbogenen Landes aufzurütteln vermochte. Doch ein Jahr erzwungenen Schweigens, ohne die Möglichkeit, auf diverse Angriffe zu reagieren, ein Jahr, in dem er mit ansehen musste, wie die Reste der Opposition, deren Anführer er war, nach und nach zerfielen, hatte ihm bewusst gemacht, dass sein Verschwinden notwendige Voraussetzung für das Abgleiten der Großen Proletarischen Revolution in eine Tyrannei war.
Jenes Jahr 1928 war zweifellos das schlimmste seines Lebens gewesen, auch wenn er bereits viele andere schreckliche Zeiten durchgemacht hatte, zum Beispiel in den zaristischen Kerkern, oder als er ohne Geld und Perspektive durch halb Europa gezogen war. Doch in jeder noch so entmutigenden Situation hatte ihn die Überzeugung aufrechterhalten, dass jedes Opfer sich lohnte, wenn es dem Wohl der Revolution diente. Warum sollte er noch kämpfen, jetzt, da die Revolution bereits zehn Jahre an der Macht war? Die Antwort lag auf der Hand: um sie aus dem pervertierten Abgrund einer Reaktion zu holen, die die hehrsten Ideale der menschlichen Zivilisation verriet. Doch wie? Das war die große Frage, und die widersprüchlichsten Antworten darauf schwirrten ihm durch den Kopf und lähmten ihn in seinem absurden Kampf als kaltgestellter Kommunist gegen andere Kommunisten, die sich die Revolution unter den Nagel gerissen hatten.
Mit zensierten und gefälschten Informationen war ein Prozess der Verwirrung in Gang gesetzt worden, durch den Stalin und seine Anhänger ihn seiner Stimme und sogar seiner Ideen beraubten, indem sie eben die Programme zu den ihren erklärten, für die er attackiert und am Ende aus der Partei ausgeschlossen worden war.
An diesem Punkt seiner Grübeleien hörte er, wie die Haustür mit viel Getöse aufgerissen wurde; herein kam der Soldat Dreitser und mit ihm eine Wolke eiskalter Luft. Der neue Chef des Wachtrupps der GPU, der politischen Polizei der UdSSR, pflegte sein bisschen Macht dadurch zu demonstrieren, dass er einfach ins Haus kam, ohne an die Tür zu klopfen, von der man die Riegel entfernt hatte. Der Polizist schüttelte sich den Schnee von seinem Fellmantel und der Pelzmütze mit den Ohrenklappen, ohne ihn anzusehen, denn er hatte einen Befehl, den nur ein einziger Mann in der gesamten Sowjetunion sich ausdenken und, mehr noch, ausführen lassen konnte.
Vor drei Wochen war der Soldat Dreitser als eine Art schwarzer Reiter aus dem Kreml gekommen, mit neuen strikten Anweisungen und dem Ultimatum, dass, sollte Trotzki seine oppositionelle Kampagne unter den Deportierten nicht unverzüglich beenden, er vom politischen Leben vollkommen isoliert würde. Was für eine Kampagne, wo er doch seit Monaten weder Briefe abschicken noch empfangen durfte? Und mit welcher neuen Isolierung wollte man ihm drohen, wenn nicht mit dem Tod? Zur Verschärfung der Kontrollen hatte Dreitser angeordnet, dass es Lew Dawidowitsch und seinem Sohn Lew Sedow verboten sei, auf die Jagd zu gehen, wohl wissend, dass das Jagen bei diesen Schneestürmen unmöglich war. Er hatte Gewehre und Patronen beschlagnahmen lassen, um seinen Willen und seine Macht zu demonstrieren.
Nachdem Dreitser sich vom Schnee befreit hatte, ging er zum Samowar, um sich Tee einzugießen. Aus dem Heulen des Windes schloss Lew Dawidowitsch, dass es draußen mindestens dreißig Grad unter null sein musste und der ewige Schnee nach wie vor das Einzige war, was, abgesehen von ein paar rettenden Steinen, in dieser verfluchten Steppe existierte. Nach dem ersten Schluck Tee begann der Soldat schließlich zu sprechen und sagte mit dem Akzent eines sibirischen Bären, er habe einen Brief für ihn, der soeben aus Moskau gekommen sei. Es gehörte nicht viel Fantasie dazu, sich auszumalen, dass ein Brief, der die Kontrolle passiert hatte, nur schlechte Nachrichten bringen konnte; auch war Lew Dawidowitsch aufgefallen, dass Dreitser ihn zum ersten Mal nicht mit »Genosse Trotzki« angesprochen hatte, dem einzigen Titel, der ihm geblieben war, bei seinem atemberaubenden Sturz vom Gipfel der Macht in die Einsamkeit der Verbannung, in die ihn dieser Emporkömmling Josef Stalin geschickt hatte.
Seit er im Juli die Nachricht bekommen hatte, dass seine Tochter Nina an Schwindsucht gestorben war, lebte er in der ständigen Furcht vor weiteren Schicksalsschlägen, die das Leben oder, daran dachte er immer häufiger mit Schrecken, der Hass ihm und seiner Familie zufügen würde. Sina, seine Tochter aus erster Ehe, war an den Nerven erkrankt, und ihr Mann, Platon Wolkow, befand sich wie viele andere Oppositionelle in einem Arbeitslager am nördlichen Polarkreis. Zum Glück war sein Sohn Ljowa hier bei ihnen, und der jüngste Sohn Serjoscha, der homo apoliticus der Familie, hielt sich aus den innerparteilichen Auseinandersetzungen heraus.
Natalia Sedowas Stimme wünschte ihm einen guten Morgen, um gleich danach die Kälte zu verfluchen. Er wartete, bis sie, angelockt von Mayas freudigem Gebell, ins Zimmer trat, und spürte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte: Würde er es fertigbringen, Natascha eine schlechte Nachricht vom Schicksal ihres geliebten Serjoscha zu überbringen? Sie hatte sich mit einer Tasse Tee in der Hand auf einen Stuhl gesetzt, und er sah sie an. Sie ist immer noch eine schöne Frau, dachte er, wie er später schreiben sollte. Dann sagte er ihr, sie hätten Post aus Moskau, und auch seine Frau war sofort alarmiert.
Dreitser hatte seine Tasse auf dem Ofen abgestellt. Er kramte in den Manteltaschen nach dem Päckchen dieser unerträglichen turkmenischen Zigaretten und zog, wo er schon mal gerade dabei war, aus der Innentasche seines Fellmantels den gelben Umschlag hervor. Kurz schien es, als wollte er ihn öffnen, doch dann legte er ihn auf den Tisch. Lew Dawidowitsch überspielte seine Angst, sah erst Natalia an, dann den Umschlag ohne Briefmarke, auf dem sein Name stand, und schüttete den kalten Tee auf den Boden. Er hielt Dreitser die Tasse hin, und der sah sich gezwungen, sie zu nehmen, wieder zum Samowar zu gehen und sie mit Tee zu füllen. Lew Dawidowitsch, der schon immer zu theatralischen Gesten geneigt hatte, wollte seine schauspielerischen Talente vor einem so kleinen Publikum nicht verschwenden, und so riss er, bevor ihm der Tee gereicht wurde, den Umschlag auf. Er enthielt ein maschinengeschriebenes Blatt Papier mit dem Briefkopf der GPU, aber ohne Datum. Nachdem er die Brille aufgesetzt hatte, las er den Text in weniger als einer Minute, schwieg aber noch eine Weile, diesmal ohne jede theatralische Absicht. Die Erschütterung angesichts des Ungeheuerlichen hatte ihm die Sprache verschlagen: Der Bürger Lew Dawidowitsch Trotzki hatte innerhalb von vierundzwanzig Stunden das Land zu verlassen. Die Ausweisung erfolgte aufgrund des soeben neu geschaffenen Artikels 58-10, der für alles Mögliche herhalten musste, doch in diesem Fall den Angeschriebenen beschuldigte, »konterrevolutionäre Bewegungen durch die Gründung einer den Sowjets feindlich gesinnten illegalen Partei« unterstützt zu haben. Wortlos reichte er das Schreiben seiner Frau.
Natalia Sedowa sah ihren Mann an, wie erschlagen von der Entscheidung, die sie dazu verurteilte, statt in einem abgelegenen Winkel des Landes zu erfrieren, den Weg in ein Exil anzutreten, das wie eine schwarze Wolke über ihnen schwebte. Dreiundzwanzig Jahre des Zusammenlebens, in denen sie Triumphe und Niederlagen, Ruhm und Ehre miteinander geteilt hatten, ermöglichten es Lew Dawidowitsch, die Gedanken seiner Frau in ihren blauen Augen zu lesen: Den politischen Führer fortzujagen, der 1905 das Gewissen des Landes aufgerüttelt hatte, dachte sie, der dem Oktoberaufstand von 1917 zum Sieg verholfen, inmitten des Chaos eine Armee begründet und die Revolution in den Jahren des Bürgerkriegs und der imperialistischen Invasionen gerettet hatte? Ihn auszuweisen wegen politischer und ökonomischer Meinungsverschiedenheiten? Wäre der Beschluss nicht so folgenschwer gewesen, man hätte über ihn lachen können.
Lew Dawidowitsch stand auf, und mit der ihm noch verbliebenen Ironie fragte er Dreitser, ob er eine Ahnung habe, wann und wo der erste Kongress seiner »illegalen Partei« stattfinden solle. Doch der Soldat begnügte sich damit, ihn aufzufordern, den Empfang des Briefes zu bestätigen. »Der durch und durch verbrecherische und in der Form illegale Beschluss der GPU wurde mir am 20. Januar 1929 zur Kenntnis gebracht«, schrieb Lew Dawidowitsch an den Rand der offiziellen Mitteilung, setzte rasch seine Unterschrift darunter und beschwerte das Blatt mit einem schmutzigen Messer. Dann sah er seine Frau an, die noch wie benommen war, und bat sie, Ljowa zu wecken. Sie würden kaum Zeit haben, Papiere und Bücher zusammenzupacken, sagte er und ging, gefolgt von Maya, ins Schlafzimmer, als triebe ihn die Eile an; in Wahrheit floh Lew Dawidowitsch in der Furcht aus dem Raum, der Polizist und seine Frau könnten ihn aus Ohnmacht angesichts der Demütigung und der Lüge weinen sehen.
Sie frühstückten schweigend, und wie immer gab Lew Dawidowitsch seiner Hündin Maya etwas Brot mit der ranzigen Butter, die man ihnen vorsetzte. Später sollte Natalia Sedowa ihm gestehen, sie habe in seinen Augen zum ersten Mal, seit sie sich kannten, den düsteren Schimmer der Resignation gesehen. Ein Gemütszustand, der so gar nicht mit seiner Reaktion auf die Verbannung aus Moskau in Einklang stand, als er von vier Männern auf den Bahnhof geschleppt werden musste, ohne dass er aufgehört hatte, lauthals auf »die Bande der Totengräber der Revolution« zu fluchen.
Mit Maya auf den Fersen ging Lew Dawidowitsch zurück ins Schlafzimmer und fing an, die Papiere, auf die sich sein Hab und Gut beschränkte, die ihm aber mehr bedeuteten als sein Leben, in Kisten zu packen: Essays, Aufrufe, Kriegsberichte und Friedensabkommen, die das Schicksal der Welt verändert hatten, doch vor allem Hunderte, Tausende von Briefen, geschrieben von Lenin, Plechanow, Rosa Luxemburg und vielen anderen Bolschewiken, Menschewiken und revolutionären Sozialisten, mit denen er in der romantischen Absicht, den Zar zu stürzen, zusammen gelebt und gekämpft hatte, seit, noch zu seinen Jugendzeiten, der Südrussische Arbeiterbund gegründet worden war.
Die Gewissheit der Niederlage legte sich zentnerschwer auf seine Brust und drohte ihn zu ersticken. Er ging ins Wohnzimmer, wo Ljowa die Archive ordnete, und begann, sich Stiefel und Überschuhe anzuziehen. Der erstaunte Junge fragte ihn, was er vorhabe, doch er nahm Mantel und Schal vom Haken und ging, gefolgt von seiner Hündin, hinaus in Wind und Schnee, hinaus in den grauen Morgen. Der Schneesturm, der zwei Tage zuvor begonnen hatte, schien nicht nachlassen zu wollen, und Lew Dawidowitsch spürte, wie sich sein Körper und seine Seele in Eis und Nebel auflösten, während der eisige Wind sein Gesicht peitschte. Er machte ein paar Schritte auf die Straße zu, von der aus die Ausläufer des Tian Shan zu erkennen waren, und es war, als umarmte er die weiße Wolke, um mit ihr zu verschmelzen. Er pfiff nach Maya und war erleichtert, als die Hündin angelaufen kam. Die Hand auf dem Kopf des Tieres, verharrte er eine Weile, bis er merkte, wie der Schnee ihn langsam bedeckte. Wenn er zehn, fünfzehn Minuten so stehen blieb, würde er sich trotz des Fellmantels in einen Eisblock verwandeln, und sein Herz würde aufhören zu schlagen. Das wäre eine gute Lösung, dachte er. Aber wenn meine Henker noch nicht die Absicht hegen, mich umzubringen, sagte er sich, werde ich ihnen damit nicht zuvorkommen. Von Maya geführt, ging er die wenigen Meter zurück zur Baracke. Lew Dawidowitsch wusste, dass noch immer Leben auf ihn wartete. Und auch Kugeln, um ihn zu erschießen.
Natalia Sedowa, Lew Sedow und Lew Dawidowitsch hatten sich hingesetzt, um einen letzten Tee zu trinken, und warteten auf die Polizisten, die sie außer Landes bringen sollten. Im Schlafzimmer standen die Kisten mit den Papieren und Büchern bereit, nachdem sie vorher alles auch nur halbwegs Entbehrliche zur Seite gelegt hatten. In aller Frühe war einer der Polizisten gekommen und hatte die aussortierten Bücher vor der Baracke mit Petroleum übergossen und verbrannt.
Um elf kam Dreitser. Wie üblich trat er, ohne anzuklopfen, ein, um ihnen mitzuteilen, dass sich die Abreise wegen des Schneesturms verzögere. Natalia Sedowa, eine äußerst praktisch veranlagte Frau, fragte ihn, warum er glaube, dass der Sturm am nächsten Tag nachlassen werde; der Chef der Wachmannschaft antwortete, er habe soeben den Wetterbericht für die nächsten Tage erhalten, doch vor allem spüre er es in der Luft. Und dann sagte er, ein erneuter Beweis seiner Macht, die Hündin Maya könne nicht mit ihnen kommen.
Die Reaktion Lew Dawidowitschs war so heftig, dass sie selbst den Polizisten erschreckte: Maya gehöre zur Familie und werde mitkommen, schrie er, andernfalls werde niemand von hier fortgehen. Dreitser wies ihn darauf hin, dass er nicht in der Situation sei, Bedingungen zu stellen oder zu drohen. Lew Dawidowitsch gab ihm recht, erinnerte ihn aber daran, dass er noch immer irgendeine Dummheit machen könne, wodurch seine Karriere als Leiter der Wachmannschaft abrupt beendet wäre und man ihn zurück nach Sibirien schicken würde, allerdings nicht in sein Dorf, sondern in eins der vom GPU-Chef geleiteten Arbeitslager. Als Lew Dawidowitsch die unmittelbare Wirkung seiner Worte sah, wurde ihm plötzlich klar, unter welchem Druck der Mann stand, und er beschloss, seinen letzten Trumpf nicht auszuspielen: Wie konnte ausgerechnet ein Sibirer von jemandem verlangen, einen russischen Windhund zurückzulassen? Und er bedauerte, dass Dreitser nie gesehen hatte, wie Maya in der gefrorenen Tundra Füchse jagte. Der Polizist schlüpfte durch die Tür hinaus, die der andere ihm aufhielt, und wie um zu zeigen, wer trotz allem das Sagen hatte, beschied er: Sie könnten das Tier mitnehmen, aber nur unter der Bedingung, dass sie auch seine Scheiße wegmachten.
Mit seinem sibirischen Spürsinn hatte sich Dreitser genauso geirrt wie die Meteorologen. Der Schneesturm dachte gar nicht daran, nachzulassen, im Gegenteil, er wurde noch stärker, als der Bus Alma-Ata verließ und sich durch die Steppe vorankämpfte. Am Nachmittag (dass es Nachmittag war, wusste er nur deshalb, weil die Uhr es anzeigte), als sie das Dorf Koschmanbet erreichten, stellte Lew Dawidowitsch fest, dass sie sieben Stunden gebraucht hatten, um dreißig Kilometer auf dem vereisten Weg zurückzulegen.
Am nächsten Tag gelangte der schaukelnde Bus zur Bergstation des Kurdai-Gebirges, von wo aus sie mit sieben Autos weiterfahren sollten. Doch der Versuch, den Konvoi mit einem Traktor von der Stelle zu bewegen, scheiterte kläglich und blutig: Sieben Mitglieder der Polizeieskorte und zahlreiche Pferde erfroren. Also entschied sich Dreitser für Schlitten, auf denen sie zwei weitere Tage über Schnee und Eis bis nach Pischpek dahinglitten, wo sie in die bereitstehenden Autos umstiegen.
Frunse mit seinen Moscheen und dem Gestank nach Hammelfett, der aus den Schornsteinen aufstieg, erschien den Deportierten und Deportierenden gleichermaßen als rettende Oase. Zum ersten Mal, seit sie Alma-Ata verlassen hatten, konnten sie sich wieder waschen und in Betten schlafen, befreit von den übel riechenden, schweren Mänteln, in denen sie sich kaum bewegen konnten. Wie zum Beweis dafür, dass in der Not jede Kleinigkeit zu einem Luxus wird, bekam Lew Dawidowitsch sogar die Gelegenheit, einen wohlduftenden türkischen Kaffee zu schlürfen, der sein Herz schneller schlagen ließ.
Bevor sie zu Bett gingen, setzte sich der Soldat Igor Dreitser an diesem Abend auf einen Kaffee zu den Trotzkis und teilte ihnen mit, dass seine Mission an der Spitze der Polizeieskorte hiermit beendet sei. Trotz seines ungehobelten Benehmens hatten sie sich nach mehreren Wochen des Zusammenlebens an diesen grobschlächtigen Sibirer gewöhnt, und so wünschte Lew Dawidowitsch ihm zum Abschied viel Glück und erlaubte sich am Ende noch eine Bemerkung: Es sei egal, wer der Generalsekretär der Partei sei, ob Lenin, Stalin, Sinowjew oder er selbst. Männer wie er, Dreitser, arbeiteten für das Land, nicht für einen Führer. Daraufhin streckte Dreitser ihm die Hand hin und sagte zu seiner Verblüffung, es sei ihm trotz der widrigen Umstände eine Ehre gewesen, ihn kennengelernt zu haben. Wirklich überrascht war er jedoch, als der Polizist fast im Flüsterton hinzufügte, entgegen dem offiziellen Befehl, alle Bücher und Dokumente des zu Deportierenden zu verbrennen, habe er nur ein paar wenige dem Feuer übergeben. Kaum hatte Lew Dawidowitsch diese unerwartete Eröffnung verdaut, spürte er den festen Händedruck des Sibirers, der daraufhin rasch hinausging, um in der Dunkelheit und dem Schnee zu verschwinden.
Als die Eskorte unter der Leitung eines Polizisten namens Bulanow wieder aufbrach, hatten die Deportierten die Hoffnung, die Schleier würden sich lüften und sie endlich erfahren, wohin sie gebracht werden sollten. Doch Bulanow konnte ihnen nicht mehr sagen, als dass sie einen Sonderzug besteigen würden, ohne zu konkretisieren, wohin die Reise gehen sollte. So viel Geheimnistuerei, dachte Lew Dawidowitsch, war nur auf die Angst vor zwar unwahrscheinlichen, aber noch immer zu befürchtenden Reaktionen seiner dezimierten Anhänger in Moskau zurückzuführen. Vielleicht, so dachte er weiter, war das Ganze aber auch nur ein weiteres Manöver, um Verwirrung zu stiften und die öffentliche Meinung zu manipulieren – eine bevorzugte Taktik Stalins, der im vergangenen Jahr immer wieder Gerüchte über seine bevorstehende Ausweisung gestreut hatte. Später waren sie mehr oder weniger entschieden dementiert worden und hatten offenbar nur dazu gedient, die Bevölkerung an den Gedanken zu gewöhnen und jene Strafe vorzubereiten, von der die Öffentlichkeit erst erfahren würde, wenn sie bereits vollzogen wäre.
Während der Monate vor der Ausweisung, in denen Lew Dawidowitsch erleben musste, wie ihm durch die politische Niederlage die Hände gebunden waren, hatte er nach und nach voller Entsetzen erkennen müssen, wie geschickt Stalin die öffentliche Meinung lenkte. Zu spät wurde ihm klar, dass er die Intelligenz des ehemaligen Seminaristen aus Georgien unterschätzt und sein Talent für Intrigen und Machenschaften und seine Schamlosigkeit beim Lügen falsch beurteilt hatte. In den Katakomben des Untergrundkampfes hatte Stalin alle Möglichkeiten der Vernichtung von Gegnern kennengelernt und bediente sich ihrer nun, zum eigenen Nutzen, in Verfolgung derselben Ziele, die früher die bolschewistische Partei verfolgt hatte: der Erringung absoluter Macht. Die Art und Weise, wie er Lew Dawidowitsch entmachtet und aus dem Wege geräumt, wie er die Eitelkeit und die Ängste von Männern benutzt hatte, die von Eitelkeit und Ängsten frei zu sein schienen, der wohlüberlegte Einsatz seines Einflusses auf allen politischen Ebenen waren ein Meisterwerk geschickter Manipulation gewesen, die, um den Sieg des Georgiers zu krönen, die Blindheit und den Stolz seines Rivalen einkalkuliert hatte.
Mehr als darin, seinen Ausschluss aus der Partei und jetzt die Ausweisung aus der Sowjetunion erreicht zu haben, hatte Stalins großer Sieg darin bestanden, Trotzkis Stimme in die Inkarnation des inneren Feindes der Revolution, der nationalen Sicherheit und des Vermächtnisses Lenins verwandelt zu haben und ihn mittels der geballten Propaganda eines Systems zu vernichten, das Lew Dawidowitsch selbst geschaffen hatte und dem er sich nicht widersetzen durfte, wenn er den Fortbestand ebenjenes Systems nicht gefährden wollte. Der Kampf, auf den er sich von nun an konzentrieren musste, würde gegen einzelne Männer oder gegen eine Fraktion gerichtet sein, niemals jedoch gegen die Idee. Aber wie soll man gegen jene Männer kämpfen, wenn sie sich diese Idee angeeignet haben und sich dem Land und der Welt als die Verkörperung der proletarischen Revolution präsentieren?, fragte er sich damals wie auch nach seiner Deportation.
Nachdem sie Frunse hinter sich gelassen hatten, begann die Irrfahrt mit dem Zug. Der Schnee zwang die alte englische Lokomotive, an die vier Waggons angehängt waren, zu langsamer Fahrt. In seinen Jahren an der Spitze der Roten Armee, als Lew Dawidowitsch während des Bürgerkriegs das riesige Land durchquerte, hatte er fast das gesamte Schienennetz der Nation kennengelernt. Damals hatte er in einem Sonderzug genug Kilometer zurückgelegt, um fünfmal den Globus zu umkreisen. Als sie Frunse verließen, wusste er deshalb, dass sie auf dem Weg in den asiatischen Süden der Sowjetunion waren und ihr Ziel nur das Schwarze Meer sein konnte, wo sie über irgendeinen Hafen außer Landes gebracht werden würden. Aber wohin? Zwei Tage später, bei einem kurzen Halt auf einer abgelegenen Station mitten in der Steppe, bereitete Bulanow den Spekulationen ein Ende: In einem Telegramm aus Moskau wurde mitgeteilt, dass die Türkei bereit sei, ihn als Gast aufzunehmen, mit einem Visum wegen gesundheitlicher Probleme. Als der Deportierte die Nachricht vernahm, überlief es ihn eiskalt vor Angst. Er hatte das Gefühl, nackt auf dem Dach des Zuges zu sitzen. Von allen möglichen Zielen seiner Verbannung war die Türkei des Kemal Pascha Atatürk das am wenigsten wahrscheinliche gewesen, es sei denn, man hatte vor, ihn auf ein Schafott zu zerren und ihm einen eingefetteten Strick um den Hals zu legen. Seit dem Sieg der Oktoberrevolution war der südliche Nachbar zu einer der Basen für die russischen Exilanten geworden, die das sowjetische Regime am heftigsten bekämpften. Ihn in jenes Land zu schicken war, als sperrte man ein Kaninchen in einen Hundezwinger. Er werde auf keinen Fall in die Türkei gehen, schrie er Bulanow an, er könne sich zwar damit abfinden, des Landes verwiesen zu werden, das sie sich unter den Nagel gerissen hätten, aber der Rest der Welt gehöre ihnen nicht, genauso wenig wie sein Schicksal.
Als sie im legendären Samarkand hielten, sah Lew Dawidowitsch, wie Bulanow und zwei Offiziere aus ihrem Waggon stiegen und in dem Gebäude verschwanden, das aussah wie eine Moschee und als Bahnstation diente. Vielleicht kam Moskau ja seiner Forderung nach und würde sich in einem anderen Land um ein Visum für ihn bemühen … An jenem Tag begann das ängstliche Warten auf das Ergebnis der Beratungen, und als klar wurde, dass sich die Verhandlungen hinziehen würden, ließ man den Zug mehr als eine Stunde weiterfahren, um ihn schließlich auf einem toten Gleis mitten in der Eiswüste stehen zu lassen. Natalia Sedowa bat Bulanow, während sie auf Antwort aus Moskau warteten, ihrem Sohn Sergej Sedow und Ania, Ljowas Frau, ein Telegramm schicken zu dürfen, damit sie, wie es ihnen zugesichert worden war, ein paar Tage mit ihnen verbringen könnten, bevor sie das Land verließen.
Lew Dawidowitsch sollte niemals erfahren, ob die zwölf Tage, die sie auf jenem Gleis mitten im Nichts festsaßen, den sich hinziehenden diplomatischen Verhandlungen zu verdanken waren oder dem verheerendsten Schneesturm, den er jemals erlebt hatte und der die Thermometer auf vierzig Grad unter null sinken ließ. Eingehüllt in alle Mäntel, Mützen und Decken, derer sie habhaft werden konnten, empfingen sie den Besuch von Serjoscha und Ania, die ohne die Kinder gekommen war, da die noch zu klein waren, um solchen Temperaturen ausgesetzt zu werden. Unter den Blicken der Polizisten, die hin und wieder zu ihnen hineinschauten, hatte die Familie acht Tage lang Gelegenheit, belanglose, liebenswürdige Gespräche zu führen, erbitterte Schachpartien auszutragen und sich gegenseitig etwas vorzulesen, während sich Lew Dawidowitsch persönlich darum kümmerte, den Kaffee zuzubereiten, den Sergej mitgebracht hatte. Und trotz der Skepsis seiner Zuhörer brach sich, jedes Mal wenn die Wachen sie alleine ließen, sein grenzenloser Optimismus Bahn, und er sprach von Kampf und Rückkehr. Nachts, wenn alle anderen schliefen, hockte er sich in eine Ecke des Waggons und nutzte seine Schlaflosigkeit, um Briefe an das Zentralkomitee der bolschewistischen Partei und Programme für den oppositionellen Kampf zu schreiben. Später jedoch beschloss er, Serjoscha die kompromittierenden Schreiben nicht mitzugeben, denn sie hätten ihn ins Gefängnis bringen können.
Die Kälte war so heftig, dass man die Motoren der Lok anlassen und sie ein paar Kilometer fahren lassen musste, damit die Mechanik nicht einfror. Wegen des dichten Schneetreibens war es ihnen unmöglich, den Zug zu verlassen (Lew Dawidowitsch hätte ohnehin nie um Erlaubnis gebeten, Samarkand besuchen zu dürfen, die mythische Stadt, die Jahrhunderte zuvor über ganz Zentralasien regiert hatte), und so warteten sie auf die Zeitungen, nur um festzustellen, wie wenig ermutigend die Nachrichten nach wie vor waren. Täglich wurde über neue Verhaftungen von »antisowjetischen Konterrevolutionären« berichtet, wie man die Mitglieder der Opposition nannte. Ohnmacht, Langeweile, Gelenkschmerzen und Verdauungsprobleme wegen der Dosennahrung brachten Lew Dawidowitsch fast zur Verzweiflung.
Am zwölften Tag präsentierte Bulanow ihnen die Antworten der verschiedenen Länder: Deutschland war nicht daran interessiert, ihm ein Visum zu erteilen, auch nicht aus Krankheitsgründen; Österreich verschanzte sich hinter Ausflüchten; Norwegen verlangte unzählige Bescheinigungen; Frankreich kramte einen Gerichtsbeschluss von 1916 hervor, aufgrund dessen eine Einreise untersagt blieb, und England hatte nicht einmal geantwortet. Nur die Türkei erneuerte ihre Bereitschaft, ihn aufzunehmen … Lew Dawidowitsch gelangte zu der Überzeugung, die Welt habe sich für ihn – weil er der war, der er war, und weil er getan hatte, was er getan hatte – in einen Planeten ohne Visum verwandelt.
Auf der Fahrt nach Odessa hatte der ehemalige Kriegskommissar wieder einmal Zeit, sich über die Taten, Überzeugungen und kleineren und größeren Irrtümer seines Lebens Gedanken zu machen. Ich bereue nichts, dachte er, auch wenn sie mich zu einem Paria gemacht haben. Er stand fester denn je zu seinen Überzeugungen und war bereit, den Preis für sein Handeln und seine Träume zu bezahlen. Als der Zug durch Odessa fuhr, erinnerte er sich an die Jahre, die ihm so verdammt lange zurückzuliegen schienen, die Jahre, als er an der Universität dieser Stadt studiert und nach und nach begriffen hatte, dass seine Zukunft nicht in der Mathematik lag, sondern im Kampf gegen ein tyrannisches System. Damals hatte seine lange Laufbahn als Revolutionär begonnen. In Odessa war er auf verschiedene Widerstandsgruppen gestoßen und hatte den Südrussischen Arbeiterbund gegründet, ohne eine genaue Vorstellung von seinen politischen Zielen zu haben. Hier hatte er zum ersten Mal im Gefängnis gesessen, hatte Darwin gelesen und die Idee von der Existenz eines höheren Wesens aus seinem Hirn verbannt, dem Hirn eines Jungen, der bereits zu den Ungläubigen zählte. Hier war er zum ersten Mal vor Gericht gestellt und verurteilt worden, und auch hier war die Strafe Verbannung gewesen: Die Schergen des Zaren hatten ihn für vier Jahre nach Sibirien geschickt, und nun warfen ihn seine ehemaligen Kampfgenossen aus seinem eigenen Land hinaus, und das vielleicht für den Rest seines Lebens. Hier in Odessa hatte er den ihm wohlgesinnten Gefängniswärter kennengelernt, den Mann, der ihm Papier und Tinte besorgt und dessen wohlklingenden Namen er benutzt hatte, als er nach seiner Flucht aus Sibirien zum ersten Mal ins Exil gehen musste, und in das Namensfeld des von seinen Genossen besorgten Passes »Trotzki« geschrieben hatte, den Namen des Wärters, der ihn von nun an begleiten sollte.
Nachdem der Zug die Küste entlanggefahren war, wurde er auf ein Gleis geleitet, das zu den Piers der Hafenstadt führte. Den Reisenden bot sich ein fantastisches Schauspiel. Durch das Schneegestöber, das gegen die Abteilfenster peitschte, bewunderten sie das beeindruckende Panorama der zugefrorenen Bucht und die im Eis festsitzenden Schiffe mit ihren gebrochenen Masten.
Bulanow und weitere Tschekisten verließen den Zug und bestiegen einen Dampfer namens Kalinin,