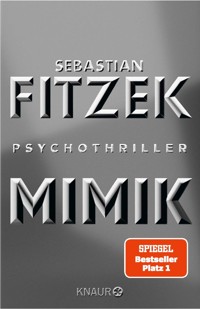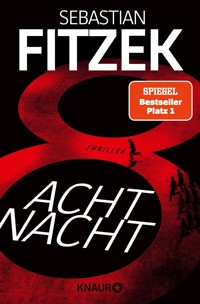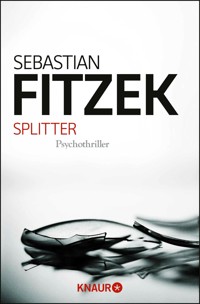9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Abstecher in die Abgründe der menschlichen Psyche – der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek! In seiner Jugend litt Leon Nader an Schlafstörungen. Als Schlafwandler wurde er während seiner nächtlichen Ausflüge sogar gewalttätig und deswegen psychiatrisch behandelt. Eigentlich glaubte er geheilt zu sein – doch eines Tages, Jahre später, verschwindet Leons Frau unter unerklärlichen Umständen aus der gemeinsamen Wohnung. Ist seine Krankheit etwa wieder ausgebrochen? Um zu erfahren, wie er sich im Schlaf verhält, befestigt Leon eine bewegungsaktive Kamera an seiner Stirn – und als er am nächsten Morgen das Video ansieht, macht er eine Entdeckung, die die Grenzen seiner Vorstellungskraft sprengt: Sein nächtliches Ich steigt durch eine ihm völlig unbekannte Tür hinab in die Dunkelheit … Spannung pur – der nervenaufreibende SPIEGEL-Bestseller des Königs des Thrills Sebastian Fitzek "Brachiale Gewalt, komatöse Extremsituationen und ein teuflischer Plot zeichnen auch Fitzeks neuesten Spannungsroman DER NACHTWANDLER aus. Mit minimalem Aufwand an Sprache, Figuren und Schauplätzen erreicht er maximalen Schauder und Thrill." - Mannheimer Morgen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Der Nachtwandler
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In seiner Jugend litt Leon Nader an Schlafstörungen. Als Schlafwandler wurde er während seiner nächtlichen Ausflüge sogar gewalttätig und deswegen psychiatrisch behandelt. Eigentlich glaubte er geheilt zu sein - doch eines Tages, Jahre später, verschwindet Leons Frau unter unerklärlichen Umständen aus der gemeinsamen Wohnung. Ist seine Krankheit wieder ausgebrochen? Um zu erfahren, wie er sich im Schlaf verhält, befestigt Leon eine bewegungsaktive Kamera an seiner Stirn – und als er am nächsten Morgen das Video ansieht, macht er eine Entdeckung, die die Grenzen seiner Vorstellungskraft sprengt: Sein nächtliches Ich steigt durch eine ihm völlig unbekannte Tür hinab in die Dunkelheit …
Inhaltsübersicht
Motto
Widmung
Prolog
Wenige Tage zuvor
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Einige Monate später
42. Kapitel
43. Kapitel
Epilog
Danksagung
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Auf Pfaden, dunkel, voller Grausen,
Wo nur böse Engel hausen,
Wo ein Dämon, Nacht genannt,
Auf schwarzem Thron die Flügel spannt –
Aus jenem letzten Thule fand
Ich jüngst erst heim in dieses Land.
Edgar Allan Poe,
Traumland
Für Manuela
Prolog
Der Patient lag noch nicht einmal eine halbe Stunde auf der Station, und schon machte er Ärger. Schwester Suzan hatte es geschmeckt, kaum dass der Rettungswagen seine Türen geöffnet hatte und die Liege herausgeschoben wurde.
Sie schmeckte es immer, wenn Probleme in die psychiatrische Abteilung rollten. Dann zog es in ihrem Mund, als kaue sie auf Alufolie, und diesen unangenehmen Effekt konnten auch Patienten auslösen, die auf den ersten Blick eher wie ein Opfer und nicht gewalttätig wirkten, so wie der Mann, der gerade in Zimmer 1310 den Alarm aktiviert hatte.
Ausgerechnet um 19.55 Uhr.
Hätte er noch fünf Minuten länger gewartet, wäre Suzan in der Pause gewesen. Jetzt musste sie mit leerem Magen den Gang heruntereilen. Nicht, dass sie abends großen Appetit gehabt hätte. Suzan achtete sehr auf ihre Linie, tatsächlich war sie nicht sehr viel dicker als einige der stationär betreuten Anorexiepatientinnen, aber der kleine Salat und das halbe Ei zählten zur abendlichen Routine – ein Paranoider mit Wahnvorstellungen leider auch, doch auf Letzteren konnte sie gut verzichten.
Der Patient war nackt, blutüberströmt und mit Schnittwunden an den Füßen im Schnee vor einem Supermarkt aufgegriffen worden, hatte verwahrlost, desorientiert und dehydriert gewirkt, aber sein Blick war wach und stetig, seine Aussprache klar gewesen, und die Zähne (Zähne waren in Suzans Augen immer ein sicheres Indiz für den Zustand der Seele) hatten keine Anzeichen von Alkohol-, Nikotin- oder Drogenmissbrauch gezeigt.
Und dennoch habe ich es geschmeckt, dachte sie, die eine Hand am Pieper, die andere am Schlüsselbund.
Suzan schloss auf und trat ein.
Das Szenario, das sich ihr bot, war so bizarr, dass sie erst nach einer Schrecksekunde den Pieper betätigte, um die für derartige Krisensituationen ausgebildeten Sicherheitskräfte zu verständigen.
»Ich kann es beweisen«, schrie der nackte Mann vor dem Fenster. Er stand in einer Lache aus Erbrochenem.
»Natürlich können Sie das«, antwortete die Schwester, wobei sie darauf achtete, Abstand zu wahren.
Ihre Worte klangen einstudiert und unehrlich, weil Suzan sie einstudiert hatte und nicht ehrlich meinte, aber sehr oft schon hatte sie mit hohlen Phrasen kostbare Zeit gewinnen können.
Nicht so dieses Mal.
Später würde eine Untersuchungskommission in ihrem Abschlussbericht festhalten, dass die Putzfrau Musik über einen MP3-Player gehört hatte, was während der Arbeit strengstens untersagt war. Als ihre Vorgesetzte unerwartet zur Hygienekontrolle kam, versteckte sie das Gerät in einem Fach neben der Dusche, wo sich die Wasserzähler befanden.
In dem Moment der Krise jedoch war es für Schwester Suzan ein Rätsel, wie der Patient in den Besitz des elektronischen Geräts gelangt war, dessen Batteriefach er aus dem Gehäuse gebrochen hatte. In der Hand hielt er eine verbogene Alkali-Batterie, deren Hülle er mit den Zähnen aufgekaut haben musste. Suzan konnte es nicht sehen, stellte sich aber vor, wie zähflüssige Batteriesäure wie Marmelade an den scharfen Kanten hervortrat.
»Alles wird wieder gut«, versuchte sie zu beschwichtigen.
»Nein, nichts wird wieder gut«, protestierte der Mann. »Hören Sie mir zu. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich habe versucht, mich zu übergeben, um ihn wieder aus meinem Magen herauszubekommen, aber vielleicht habe ich ihn schon verdaut. Bitte. Ihr müsst mich röntgen. Ihr müsst meinen Körper röntgen. Der Beweis steckt in mir drin!«
Er schrie so lange, bis endlich die alarmierten Kräfte eintrafen, um ihn zu überwältigen.
Doch sie kamen zu spät.
Als die Ärzte ins Zimmer stürmten, hatte der Patient die Batterie längst verschluckt.
Wenige Tage zuvor
Irgendwo auf der Welt.
In einer Stadt, die Sie kennen.
Vielleicht in Ihrer Nachbarschaft …
1.
Die Kakerlake kroch auf Leons Mund zu.
Nur noch wenige Zentimeter, und die langen Fühler würden seine geöffneten Lippen berühren. Schon jetzt hatte sie den Rand des Speichelflecks erreicht, den er im Schlaf auf dem Bettlaken hinterlassen hatte.
Leon versuchte, den Mund zu schließen, doch seine Muskeln waren gelähmt.
Wieder einmal.
Er konnte weder aufstehen noch die Hand heben oder wenigstens blinzeln. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Kakerlake anzustarren, die ihre Flügel aufstellte, als wollte sie ihn freundlich begrüßen:
»Hallo, Leon, da bin ich wieder. Erkennst du mich nicht?«
»Doch, natürlich. Ich weiß genau, wer du bist.«
Sie hatten sie Morphet getauft, die Riesenkakerlake aus Réunion. Er hatte vorher nicht gewusst, dass diese ekligen Dinger tatsächlich fliegen konnten. Als sie dann im Internet nachlasen, stießen sie auf wilde Diskussionen, zu denen sie von jenem Tag an einen eindeutigen Beitrag beisteuern konnten: Ja, zumindest die aus Réunion waren dazu in der Lage, und eines dieser flugfähigen Exemplare hatte Natalie offenbar vor neun Monaten aus dem Urlaub eingeschleppt. Irgendwie musste das Monstrum beim Packen in den Koffer gekrochen sein, und als sie ihn zu Hause öffnete, hatte Morphet auf der Schmutzwäsche gesessen und sich die Fühler geputzt. Natalie hatte nicht einmal mehr Luft zum Schreien holen können, da war die Kakerlake schon losgeflogen, um sich in einer unerreichbaren Ecke des Altbaus zu verstecken.
Sie hatten alles abgesucht. Jeden Winkel, von denen es unendlich viele gab in den hohen Räumen ihrer Fünfzimmerwohnung: unter den Scheuerleisten, hinter dem Wäschetrockner im Bad, zwischen Leons Architekturmodellbauten im Arbeitszimmer – sie hatten sogar die Dunkelkammer auf den Kopf gestellt, obwohl Natalie die Tür zu ihrem Fotolabor mit lichtundurchlässigem Stoff abgedichtet hatte und immer fest verschlossen hielt. Alles vergeblich. Das riesige Insekt mit den spinnenartigen Beinen und dem schmeißfliegenfarbenen Panzer war nicht wieder aufgetaucht.
In der ersten Nacht noch hatte Natalie ernsthaft erwogen, die Wohnung wieder zu verlassen, in die sie damals erst vor wenigen Monaten gezogen waren.
Um hier den Neuanfang zu wagen.
Später hatten sie miteinander geschlafen und sich danach lachend beruhigt, Morphet wäre sicher zum Fenster raus in den Park geflogen, um zu erfahren, dass seine Artgenossen in dieser Stadt um einiges kleiner und unbehaarter waren als er selbst.
Aber jetzt war er wieder da.
Morphet war so nah, dass Leon ihn riechen konnte. Das war natürlich Blödsinn, aber der Ekel vor der Kakerlake war so groß, dass Leons Sinne ihm einen Streich spielten. Er glaubte sogar die Kotreste unzähliger Hausstaubmilben an den haarigen Beinchen zu erkennen, die das Insekt im Schutz der Dunkelheit unter dem Bett aufgesammelt hatte. Noch hatten die Fühler Leons aufgeplatzte, trockene Lippen nicht berührt, doch er meinte schon das Kitzeln zu spüren. Zudem hatte er eine Vorahnung, wie es sich anfühlen würde, wenn ihm die Kakerlake in die Mundhöhle kroch. Es würde salzig schmecken und kratzen, wie Popcorn, das einem am Gaumen klebt.
Morphet würde sich langsam, aber zielstrebig in seinen Rachen hineinschieben und ihm dabei mit den Flügeln gegen die Zähne schlagen.
Und ich kann nicht einmal zubeißen.
Leon stöhnte, versuchte mit aller Kraft zu schreien.
Manchmal half es, meist aber brauchte es mehr, um sich aus der Schlaflähmung zu befreien.
Natürlich wusste er, dass die Kakerlake nicht real war. Es war früh am Morgen, wenige Tage vor Silvester. Im Schlafzimmer war es stockdunkel. Es war physikalisch unmöglich, auch nur die Hand vor Augen zu sehen, aber all diese Gewissheiten machten das Grauen nicht erträglicher. Denn Ekel, auch in seiner schlimmsten Form, war niemals real, sondern immer nur eine psychologische Reaktion auf einen äußeren Einfluss. Ob dieser eingebildet war oder tatsächlich existierte, machte für das Empfinden keinen Unterschied.
»Natalie!«
Leon versuchte den Namen seiner Frau zu schreien, und versagte kläglich. Wie schon so oft war er in einem Wachtraum gefangen, aus dem er sich ohne fremde Hilfe kaum befreien konnte.
»Menschen mit einer Ich-Schwäche sind anfällige Opfer von Schlafparalysen«, hatte Leon in einer populärpsychologischen Zeitschrift gelesen und sich zum Teil in dem Artikel wiedererkannt. Er hatte zwar keinen Minderwertigkeitskomplex, aber insgeheim bezeichnete er sich als einen »Ja, aber«-Typen: Ja, seine dunklen Haare waren voll und kräftig, aber unzählige Wirbel sorgten dafür, dass er meistens so aussah, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen. Ja, das leicht zum V abfallende Kinn verlieh seinem Gesicht etwas markant Männliches, aber sein Bartwuchs entsprach dem eines Teenagers. Ja, er hatte weiße Zähne, aber wenn er zu herzlich lachte, sah man, dass er mit den Füllungen den SUV seines Zahnarztes finanziert hatte. Und ja, er war einen Meter fünfundachtzig groß, aber er wirkte kleiner, weil er selten gerade stand. Kurz: Er sah nicht schlecht aus. Doch die Frauen, die auf ein Abenteuer aus waren, schenkten ihm vielleicht ein Lächeln, aber nicht ihre Telefonnummer. Die gaben sie eher seinem besten Freund Sven, dem im Genpoker ein Royal Flush zugespielt worden war: Haare, Zähne, Lippen, Körpergröße, Hände … alles wie bei Leon, nur eben ohne das »Aber«.
»Natalie?«, versuchte Leon sich grunzend aus der Schlaflähmung zu kämpfen. »Bitte hilf mir. Morphet kriecht mir gleich über die Zunge.«
Leon wunderte sich über die unerwarteten Laute, die er von sich gab. Auch im Traum sprach, grunzte oder weinte er grundsätzlich immer nur mit seiner eigenen Stimme. Das Wimmern, das er jetzt hörte, klang jedoch heller, höher. Eher wie das einer Frau.
»Natalie?«
Auf einmal wurde es hell.
Gott sei Dank.
Diesmal hatte er es ohne Strampeln und Schreien geschafft, sich aus der Umklammerung seines Alptraums zu reißen. Er wusste, fast jeder zweite Mensch hatte in seinem Leben ähnliche Erfahrungen erlitten wie er und war schon einmal in der Schattenwelt zwischen Schlafen und Wachen gefangen gewesen. Eine Schattenwelt, umstellt von Torwächtern, die sich nur mit äußerster Willenskraft vertreiben ließen. Oder durch eine paradoxe Störung von außen. Wenn zum Beispiel jemand mitten in der Nacht grelles Licht anschaltete, laute Musik spielte, eine Alarmanlage ansprang oder wenn … wenn jemand weinte?
Leon richtete sich auf und blinzelte.
»Natalie?«
Seine Frau kniete mit dem Rücken zu ihm vor dem Kleiderschrank gegenüber dem Bett. Sie schien etwas zwischen ihren Schuhen zu suchen.
»Sorry, hab ich dich geweckt, Süße?«
Keine Reaktion, von einem langgezogenen Schluchzer einmal abgesehen. Natalie seufzte, dann verstummte auch das Wimmern.
»Geht es dir gut?«
Sie nahm stumm ein Paar Stiefeletten aus dem Schrank und warf es in …
… in ihren Koffer?
Leon schlug seine Decke zurück und stand auf.
»Was ist denn los?« Er blickte auf die Uhr auf seinem Nachttisch. Es war erst Viertel vor sieben. So früh, dass noch nicht einmal die Beleuchtung von Natalies Aquarium angesprungen war.
»Bist du immer noch sauer?«
Sie hatten sich die ganze Woche über immer wieder gestritten, und vorgestern war es eskaliert. Beide konnten vor Arbeit kaum geradeaus sehen. Sie wegen ihrer ersten großen Fotoausstellung, er wegen des Architekturwettbewerbs. Jeder warf dem anderen vor, vernachlässigt zu werden, und jeder hielt die eigenen Termine für wichtiger als die des anderen.
Am ersten Weihnachtsfeiertag war dann zum ersten Mal das Wort »Trennung« gefallen, und auch wenn sie beide es nicht ernst gemeint hatten, war es ein alarmierendes Zeichen, wie blank ihre Nerven lagen. Gestern hatte Leon einlenken und Natalie zu einem Versöhnungsessen ausführen wollen, aber sie war wieder einmal zu spät aus der Galerie nach Hause gekommen.
»Hör mal, ich weiß, wir haben momentan unsere Probleme, aber …«
Sie drehte sich abrupt zu ihm um.
Ihr Anblick traf ihn wie eine Ohrfeige.
»Natalie, was … ?« Er blinzelte und fragte sich kurz, ob er noch immer träumte. »Was um Himmels willen ist mit deinem Gesicht passiert?«
Ihr rechtes Auge schimmerte violett, die Lider waren zugeschwollen. Sie war komplett angezogen, auch wenn alles nur hastig übergeworfen schien. Die geblümte Bluse mit den Rüschenärmeln war schief zugeknöpft, der Hose fehlte ein Gürtel, und die Laschen ihrer hochhackigen Wildlederstiefel schlackerten lose.
Sie wandte sich wieder von ihm ab. Mit ungelenken Bewegungen versuchte sie, den Koffer zu schließen, doch der alte Ledertrolley war zu klein für die Menge Sachen, die sie in ihn hineinzuquetschen versuchte. Ein roter Seidenslip, ein Schal und ihr weißer Lieblingsrock quollen an den Rändern hervor.
Leon ging auf sie zu, wollte sich zu ihr beugen, um sie beruhigend in die Arme zu schließen, doch Natalie duckte sich ängstlich von ihm weg.
»Was ist denn nur los?«, fragte er völlig verwirrt, als sie hastig nach ihrem Koffer griff. Vier ihrer Fingernägel waren schlammfarben lackiert. Der fünfte fehlte.
»Großer Gott, dein Daumen!«, rief Leon und wollte nach ihrer verletzten Hand greifen. Der Ärmel von Natalies Bluse rutschte nach oben, und er sah die Einschnitte.
Rasierklingen?
»Um Himmels willen, Natalie. Hast du wieder damit angefangen?«
Es war die erste Frage, die eine Reaktion hervorrief.
»Ich?«
In ihrem Blick lag eine Mischung aus Bestürzung, Angst und – was Leon in diesem Moment am meisten verwirrte – Mitleid. Sie hatte die Lippen nur einen schmalen Spalt geöffnet, aber der reichte aus, um zu erkennen, dass dahinter ein großer Teil eines Schneidezahns fehlte.
»Ich?«
Natalie nutzte den Moment seines Entsetzens und wehrte seine Berührungen ab. Sie griff nach ihrem Handy auf dem Bett. An ihrem Smartphone baumelte ihr Glücksbringer, eine mehrgliedrige rosa Kunstperlenkette, jede Perle mit einem Buchstaben ihres Namens versehen – Natalies Namensbändchen, das ihr nach der Geburt vor siebenundzwanzig Jahren im Krankenhaus am Handgelenk befestigt worden war. Mit dem Handy in der einen und dem Gepäck in der anderen Hand stürzte sie aus dem Schlafzimmer.
»Wo willst du hin?«, schrie er ihr hinterher, da war sie schon auf halbem Wege zur Tür. Als er ebenfalls in die Diele eilen wollte, stolperte er über eine Kiste mit Bauplänen, die er mit ins Büro nehmen wollte.
»Natalie, bitte erklär mir doch …«
Sie drehte sich nicht einmal mehr zu ihm um, als sie in das Treppenhaus rannte.
Später, in den folgenden Tagen des Grauens, war Leon sich nicht mehr sicher, aber er meinte sich zu erinnern, dass seine Frau das rechte Bein nachgezogen hatte, als sie zur Tür lief. Doch das mochte auch an dem schweren Gepäck oder an den nicht verschnürten Schuhen gelegen haben.
Als Leon sich wieder aufgerappelt hatte, war sie bereits in dem altertümlichen Fahrstuhl verschwunden und hatte die Schiebetür wie einen Schutzschild vor sich zugezogen. Das Letzte, was Leon von der Frau sah, mit der er die letzten drei Jahre seines Lebens geteilt hatte, war wieder dieser entsetzte, angsterfüllte (dieser mitleidige?) Blick: »Ich?«
Dann setzte sich die Fahrstuhlkabine in Bewegung. Nach einer Schrecksekunde rannte Leon zur Treppe.
Die breiten Holzstufen, die sich wie eine Schlange um den Fahrstuhlschacht nach unten wanden, waren mit Sisalteppich ausgelegt, dessen grobe Fasern ihm in die Fußsohlen stachen. Leon trug nichts am Leib bis auf eine weite Boxershorts, die ihm bei jedem Schritt über die schmalen Hüften zu rutschen drohte.
Auf halbem Weg hatte er bereits ein gutes Stück wettgemacht, und er ging davon aus, den Fahrstuhl spätestens im Erdgeschoss einholen zu können, wenn er weiterhin mehrere Stufen auf einmal nahm. Doch dann öffnete die alte Ivana Helsing im zweiten Stock ihre Wohnungstür, nur für einen Spalt und ohne die Sicherheitskette von innen zu lösen, aber das reichte aus, um Leon ein Bein zu stellen.
»Alba, komm zurück«, hörte Leon seine Nachbarin noch rufen, aber da war es bereits zu spät. Die schwarze Katze war aus der Wohnung ins Treppenhaus entwichen und lief ihm zwischen die Beine. Um nicht der Länge nach hinzuschlagen, musste er sich mit beiden Händen am Treppengeländer festhalten und stehen bleiben.
»Großer Gott, Leon. Haben Sie sich etwas getan?«
Er ignorierte die besorgte Stimme der Alten, die die Tür nun ganz geöffnet hatte, und drängte an ihr vorbei.
Noch war es nicht zu spät. Noch hörte er das Knarzen der Holzkabine des Fahrstuhls und das Knacken der Stahlseile, an denen sie hing.
Im Erdgeschoss angekommen, bog er um die Ecke, rutschte auf dem glatten Marmor zur Seite und kauerte schließlich auf allen vieren, keuchend und hechelnd, vor der Fahrstuhltür, hinter der sich die Kabine langsam in ihre Ruheposition senkte.
Und dann geschah … nichts.
Kein Rütteln, kein Klappern, nicht der geringste Laut, der darauf hindeutete, dass jemand aussteigen wollte.
»Natalie?«
Leon atmete tief durch, stemmte sich hoch und versuchte, etwas hinter den bunten Jugendstilglasscheiben zu erkennen, die in die Tür eingefasst waren, doch er sah nur Schatten.
Also zog er selbst die Tür von außen auf. Und starrte in sein eigenes Gesicht.
Die verspiegelte Kabine war leer, Natalie fort. Verschwunden.
Wie ist das möglich?
Leon sah sich hilfesuchend um, und in diesem Moment betrat Dr. Michael Tareski den verwaisten Hausflur. Der Apotheker, der im vierten Stock über ihm lebte, nie grüßte und immer teilnahmslos wirkte, trug ausnahmsweise keinen Blazer zu weißen Leinenhosen, sondern einen Trainingsanzug und Sportschuhe. Eine matt glänzende Stirn und die dunklen Flecken unter den Achseln seines Sweatshirts entlarvten den Jogginglauf zu morgendlicher Stunde.
»Haben Sie Natalie gesehen?«, fragte Leon.
»Wen?«
Tareskis argwöhnischer Blick wanderte von Leons nacktem Oberkörper nach unten zu seinen Boxershorts. Vermutlich ging der Apotheker im Geiste durch, welche Medikamente für den verwirrten Zustand seines Nachbarn verantwortlich sein mochten. Oder welche ihn wieder beseitigen könnten.
»Ach, Sie meinen Ihre Frau?« Tareski wandte sich ab und ging zu der Wand mit den Hausbriefkästen, so dass Leon sein Gesicht nicht sehen konnte, als er sagte: »Die ist gerade eben mit einem Taxi weg.«
Leon kniff verstört die Augen zusammen, als würde er mit einer Taschenlampe geblendet, und ging an Tareski vorbei zur Haustür.
»Sie werden sich den Tod holen«, mahnte der Apotheker hinter ihm, und tatsächlich verkrampfte sich jeder Muskel seines Körpers, nachdem Leon die Haustür geöffnet hatte und auf die Steinstufen der zum Bürgersteig führenden Treppe trat. Das Haus lag in einer verkehrsberuhigten Zone der Altstadt, mit vielen kleinen Boutiquen, Restaurants, Cafés, Theatern und Offkinos wie dem »Celeste«, dessen kaputte Leuchtreklame im Zwielicht der Morgendämmerung am Nachbarhaus über Leons Kopf zuckte.
Die altertümlichen, Gaslaternen nachempfundenen Straßenlampen brannten noch. Es war Wochenende, und dementsprechend wenige Menschen waren unterwegs. In einiger Entfernung führte ein Mann seinen Hund aus, und der Ladenbesitzer gegenüber zog die Rollläden seines Zeitungskiosks hoch. Die meisten waren noch nicht auf den Beinen oder gar nicht mehr in der Stadt, nachdem die Weihnachtsfeiertage so günstig gelegen hatten, dass man mit nur wenigen Urlaubstagen die gesamte Zeit bis zum Neujahrsfest überbrücken konnte. Die Straßen blieben verwaist, in welche Richtung Leon auch blickte. Kein Auto, kein Taxi, keine Natalie.
Leon begann mit den Zähnen zu klappern und schlang sich die Arme um den Körper. Als er wieder in den windgeschützten Hausflur trat, war Tareski bereits mit dem Fahrstuhl verschwunden.
Er fror, war verwirrt und wollte nicht auf den Lift warten, also trat er den Rückweg über die Treppe an.
Diesmal lief ihm keine Katze über den Weg. Ivana Helsing hielt ihre Tür geschlossen, auch wenn Leon sich sicher war, dass die Alte ihn durch den Türspion beobachtete. Genau wie die Falconis im ersten Stock, das kinderlose und darüber vergrämt wirkende Pärchen, das er durch sein Gestolper und Geschrei sicher geweckt hatte.
Vermutlich würden sie sich wieder über ihn bei der Hausverwaltung beschweren, so wie sie es schon einmal getan hatten, als er im Frühjahr etwas zu laut in seinen achtundzwanzigsten Geburtstag gefeiert hatte.
Verwirrt, erschöpft und am ganzen Körper zitternd, erreichte Leon den dritten Stock, dankbar dafür, dass die Tür noch angelehnt und er nicht ausgeschlossen war.
Natalies Parfum, ein dezenter Sommerduft, hing noch in der Luft, und für einen Moment verlor er sich in der Hoffnung, er könnte das alles nur geträumt haben, und die Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte, würde in die dicken Daunendecken eingemummelt friedlich schlafen. Doch dann sah er Natalies unbenutzte Seite des Bettes und wusste, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen würde.
Er starrte in den weit aufgerissenen, durchwühlten Schrank, dessen untere Schublade offen stand und leer war, genauso wie der kleine Sekretär neben dem Fenster, auf dem bis gestern noch ihre Schminkutensilien gestanden hatten. Jetzt lag darauf der geschlossene Laptop, auf dem sie sich hin und wieder DVDs ansahen. Ein Kompromiss, da Natalie im Schlafzimmer keinen Fernseher haben wollte.
Die Uhr auf Leons Nachttisch sprang auf 7.00 Uhr, und die Leuchtstoffröhren über dem hohen Aquarium flackerten auf. Leon sah sein Spiegelbild in dem grünlich schimmernden Beckenglas. Nicht ein einziger Fisch schwamm mehr in den vierhundert Litern Süßwasser.
Vor drei Wochen waren alle Skalare an einem hartnäckigen Pilz verendet, obwohl Natalie ihren kostbaren Besitz mit größter Akribie gepflegt und täglich die Wasserqualität kontrolliert hatte. Leon bezweifelte, dass sie je wieder Fische halten würde, so niedergeschlagen war Natalie gewesen.
Die Zeitschaltuhr war nur deshalb noch aktiviert, weil sie sich über die Jahre daran gewöhnt hatten, vom Licht des Aquariums geweckt zu werden.
Leon zog wütend das Stromkabel aus der Steckdose. Das Licht erlosch, und er fühlte sich verloren.
Er setzte sich auf die Bettkante, vergrub den Kopf in beide Hände und versuchte, eine harmlose Erklärung zu finden für das, was gerade eben passiert war. Doch sosehr er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht, die Gewissheit zu verdrängen, dass trotz aller Beteuerungen der Ärzte, er wäre geheilt, die Vergangenheit ihn wieder eingeholt hatte.
Und seine Krankheit wieder ausgebrochen war.
2.
»… du musst da reinsprechen.«
»Wo?«
»Herrgott, ins Telefon.«
Der ältere Mann auf dem Band klang ungehalten, offenbar war es nicht der erste Versuch, seiner Frau zu erklären, wie man den Anrufbeantworter besprach. Es knisterte in der Leitung, dann hatte Leons Mutter offenbar den Hörer in Position gebracht.
»Sie haben den Anschluss von Klaus und Maria Nader gewählt«, sagte sie in einem Tonfall, der an eine schlechte Imitation der Ansage eines Navigationsgeräts erinnerte.
Bei der nächsten Gelegenheit bitte wenden.
»Wir sind leider nicht zu Hause.«
»Ach was«, warf sein Vater trocken aus dem Hintergrund ein.
Obwohl Leon nicht in der Stimmung war und sich den ganzen Morgen über schon kränklich und leicht benommen fühlte, musste er schmunzeln. Seine Adoptiveltern ließen keine Gelegenheit aus, sich wie die Alten auf dem Balkon in der Muppet Show aufzuführen. Ob mit oder ohne Publikum, zu Hause oder in der Öffentlichkeit – kaum ein Satz des anderen blieb unkommentiert. Unfreiwillige Zuhörer dachten oft, sie wären Zeugen der Szenen einer Ehe, die in den letzten Zügen lag. Sie hatten keine Ahnung.
»Und wir werden auch so bald nicht zurückrufen, denn wir sind auf einer Kreuzfahrt«, erklärte Maria auf dem Band.
»Erzähl am besten noch, wo die Einbrecher die Wohnungsschlüssel finden.«
»Was sollen die denn bei uns schon mitnehmen? Deine Caracho-Bahn?«
Leon lächelte.
Seine Mutter wusste natürlich, dass die Marke Carrera hieß, und sagte es mit Absicht falsch, um Klaus zu ärgern. Die Rennstrecke auf dem Dachboden war sein ganzer Stolz. Früher hatte Klaus Nader immer zu Weihnachten mit ihr gespielt, wobei Leon nur zusehen und allerhöchstens mal einen aus der Spur geflogenen Rennwagen wieder auf die Bahn setzen durfte, während sein alter Herr mit glänzenden Augen den Geschwindigkeitsregler bediente. Der Vater-Sohn-Klassiker.
Heute hatte Klaus mehr Zeit für sein Hobby, seitdem er wegen einer Fingergelenksarthrose keine Teller mehr schleppen konnte, sehr zum Leidwesen von Maria, die »den alten Zausel« jetzt den ganzen Tag zu Hause »ertragen« musste, da er seinen Job als Kellner an den Nagel gehängt hatte.
Gott, wie ich die beiden vermisse, dachte Leon wehmütig. Was hätte er darum gegeben, jetzt persönlich mit ihnen reden zu können. Für seinen Geschmack war das letzte Treffen schon wieder viel zu lange her.
Er schloss die Augen und sehnte sich zurück an das Kopfende des schmalen Holztisches in der Küche, den Logenplatz im Reiheneckhaus der Naders, von dem aus man am besten ihre liebevollen Frotzeleien verfolgen konnte. Leon sah seinen Vater förmlich vor sich: die Ärmel hochgekrempelt, die breiten Ellbogen auf dem Tisch, wie er sich nachdenklich das Kinn massierte, während er auf die Rühreier wartete, die seine Frau ihm gerade zubereitete.
»Wenn’s noch länger dauert, muss ich mich wohl noch mal rasieren gehen.«
»Gute Idee, aber vergiss diesmal den Rücken nicht.«
»Willst du etwa behaupten, ich hätte Haare am Rücken?«
»Nein. Und du hast auch kein Doppelkinn.«
»Was soll das denn jetzt? Ich habe einen faltigen Hals. Kein Doppelkinn.«
»Sag ich doch.«
»Die Reise haben wir von unserem Sohn geschenkt bekommen«, verkündete Maria stolz auf dem Band.
»Ein guter Junge«, säuselte Klaus und zitierte damit einen von Marias Lieblingskommentaren, den sie immer parat hielt, sobald jemand auf ihren Sohn zu sprechen kam.
»Ja, das ist er. Du musst gar nicht so mit den Augen rollen, du alter Affe …«
Ein Piepston schaffte das, was Klaus Nader nur selten gelang. Er schnitt Maria das Wort ab und erinnerte Leon an den Grund seines Anrufs.
»Äh, Mama, Papa?«, sagte er verwirrt. »Nette Ansage. Ich rufe nur an, weil ich …«
… fragen wollte, ob Natalie sich bei euch gemeldet hat?
Seinen Eltern war es nicht anders ergangen als ihm selbst. Sie hatten sich in Natalie verliebt, in der Sekunde, in der sie sie zum ersten Mal sahen.
»Nenn mich oberflächlich«, hatte sein Vater ihn zur Seite genommen, kurz nachdem Natalie an jenem Sommernachmittag den Gartentisch verlassen hatte, um Maria mit dem Salat in der Küche zu helfen, »aber wenn bei dieser Frau der Inhalt auch nur halb so schön ist wie die Verpackung, dann wärst du noch bekloppter als der Idiot, der gestern an der Fünfzig-Euro-Frage bei Wer wird Millionär gescheitert ist, solltest du die wieder ziehen lassen.«
Die Zuneigung beruhte auf Gegenseitigkeit, auch Natalie hatte einen Narren an dem schrulligen Ehepaar gefressen, vor allen Dingen an Maria, was auf den ersten Blick verwunderlich war, da die beiden gegensätzlicher kaum sein konnten.
Natalie wollte als Fotografin Karriere machen und als gefeierte Künstlerin die Welt bereisen, Maria war eine Hausfrau, die das Vermächtnis, das sie der Welt hinterließ, in Leon sah und nicht in einer Retrospektive im Guggenheim-Museum. Sie trug ihre Schürze so stolz wie Natalie ihre High Heels. Und während Natalie Lené in einer 20-Zimmer-Villa aufgewachsen war, hatte Maria Nader ihre Kindheit sprichwörtlich auf der Straße verbracht, in einem Wohnmobil mit ausfahrbarer Markise und Chemietoilette.
Was die unterschiedlichen Frauen einte, waren also weder ihre Vergangenheit noch ihre Zukunftspläne, sondern der Umstand, dass beide von ihrer Umwelt falsch eingeschätzt wurden. Weder war Natalie eine oberflächliche Tussi, noch war Maria ein einfältiges Heimchen. Sie waren einfach zwei Menschen, die auf einer Wellenlänge lagen; sollten doch die anderen ihre kostbare Lebenszeit damit verschwenden, sich zu fragen, wie das möglich war.
Sie vertrauten einander, und deshalb war es gut denkbar, dass Natalie sich an Maria gewandt hatte, wenn sie jemanden zum Reden brauchte. Trotzdem war Leon ohne große Erwartungen an das Telefonat herangegangen und hatte die Nummer auch erst heute, einen Tag nach ihrem fluchtartigen Auszug, gewählt.
Gestern noch hatte er Stunden damit verbracht, auf einen erlösenden Anruf zu warten, und selbst immer nur ihre Mailbox erreicht, die unzähligen Male, die er Natalies Handynummer gewählt hatte.
Heute, nachdem es immer noch kein Lebenszeichen von ihr gab, tastete er sich vorsichtig voran, indem er Menschen kontaktierte, denen er vertrauen konnte. Menschen, denen sich Natalie anvertrauen würde.
Doch hier war er in eine Sackgasse geraten. Seine Eltern waren fort. Auf hoher See. Unerreichbar.
Wie Natalie.
Leon registrierte, dass er schon eine Weile nichts mehr gesagt hatte und der Anrufbeantworter die letzten Sekunden höchstens sein Atmen aufgenommen haben konnte. Verwirrt legte er auf, ohne sich zu verabschieden.
Würden seine Eltern nach ihrer Rückkehr die unvollständige Nachricht abhören, würden sie ihn gewiss verwundert zurückrufen.
Allerdings bezweifelte Leon, dass sie dabei so verstört wären, wie er sich gerade fühlte.
Er wusste nicht, was mit Natalie passiert war und weshalb sie ihn so überstürzt verlassen hatte. Leon wusste nur eins: Was immer seine Eltern auch behaupten mochten – er hatte ihnen nie eine Kreuzfahrt geschenkt.
3.
Hab ich dich geweckt?«
»Kommt es uns Frauen auf die Länge an?«, schimpfte die schläfrige Stimme am anderen Ende. »Natürlich hast du mich geweckt, du Penner.«
»Tut mir leid«, entschuldigte sich Leon bei Anouka.
Sie war Natalies beste Freundin und damit Nummer zwei auf der Liste der zu kontaktierenden Vertrauenspersonen.
Mittlerweile war es kurz vor neun Uhr morgens, aber Anouka war dafür bekannt, die Nacht zum Tag zu machen, und ließ sich grundsätzlich nicht vor dem Mittagessen in ihrer Galerie blicken. Garantiert hatte er sie aus dem Tiefschlaf gerissen. Oder aus den Armen eines ihrer zahlreichen Liebhaber, die sie regelmäßig in den Clubs der Stadt aufriss.
Leon konnte ihren Erfolg bei Männern nicht ganz nachvollziehen, aber bekanntlich lag Schönheit im Auge des Betrachters. Die Männer, die sich von Natalies grazilem Mädchenkörper, den langen, dunklen Haaren und ihrem stets melancholischen Blick angesprochen fühlten, hatten nur wenig gemein mit den meist muskelbepackten, brustbehaarten und auf den ersten Blick etwas verlebt wirkenden Kerlen, die in einer Karaoke-Bar auf Anoukas gemachte Brüste starrten.
»Du klingst komisch«, stellte Anouka fest. Er hörte Bettwäsche rascheln, dann nackte Füße auf Parkett tapsen.
»Hast du was eingeworfen?«
»Blödsinn.«
»Ist was passiert?«
Leon zögerte. »Ich … ich hatte gehofft, das von dir zu erfahren.«
»Hä?«
»Ist Natalie bei dir?«
»Wie kommst du denn auf die Idee?«
Wenn ihn nicht alles täuschte, hörte Leon Wasser plätschern, und so wie er Natalies beste Freundin kannte, hockte sie gerade auf der Toilette und urinierte ungeniert, während sie mit ihm telefonierte.
»Es ist kompliziert. Ich bin etwas durcheinander, will aber jetzt nicht darüber sprechen, okay?«
»Du willst nicht darüber sprechen und rufst mich mitten in der Nacht an?« Anouka gelang es, ihrer Stimme gleichzeitig einen belustigten wie verärgerten Ausdruck zu verleihen. Das charakteristische Geräusch einer Klospülung donnerte durch die Leitung.
»Natalie hat gestern unsere Wohnung verlassen, und ich kann sie seitdem nicht mehr erreichen«, erklärte Leon und drehte sich zur Wohnzimmertür. Bislang war er während des Telefonats zwischen Sofa und Fensterbrett hin und her getigert, doch seine Kehle kratzte beim Sprechen, und er beschloss, sich in der Küche ein Glas Wasser zu holen.
»Habt ihr euch gestritten?«, fragte Anouka.
»Ich weiß es nicht.«
»Du weißt nicht, ob ihr Streit hattet?«
Ich weiß noch nicht einmal, ob etwas sehr viel Schlimmeres passiert ist als nur ein harmloser Streit, aber das würdest du nicht verstehen.
»Das alles muss sich sehr merkwürdig anhören, ich weiß, aber kannst du mir bitte den Gefallen tun, ihr einfach zu sagen, sie soll sich bei mir melden, wenn du sie heute in der Galerie siehst?«
Natalie und Anouka hatten sich während ihrer Zeit an der Kunsthochschule erst ein Zimmer und später eine Wohnung geteilt. Lange bevor Leon sie kennengelernt hatte, waren sie sich einig gewesen, ihren Traum von einer eigenen Fotogalerie in der Altstadt zu verwirklichen. Ein Ort, an dem sie eigene Bilder und Werke anderer junger Künstler ausstellen würden. Vor gut zwölf Monaten hatten sie diesen Traum in die Tat umgesetzt, und nach den ersten Besprechungen in der Presse war die Galerie sehr gut angelaufen.
»Das kann ich nicht«, sagte Anouka.
»Was kannst du nicht?«
»Sie bitten, sich bei dir zu melden.«
»Wie bitte?«
Er wusste, dass Anouka ihn nicht ausstehen konnte, seitdem Natalie seinetwegen aus ihrer Zweier-WG ausgezogen war. Sie hielt ihn für einen Spießer, da er als Architekt nicht künstlerisch, sondern nur kommerziell arbeitete. Bei den wenigen Zusammentreffen sprachen sie nur das Nötigste, und die Ablehnung beruhte mittlerweile auf Gegenseitigkeit, da Leon herausgefunden hatte, dass Anouka ihrer Freundin anfangs dringend von einer Beziehung mit Leon abgeraten hatte. Trotz aller Antipathie war sie ihm bis heute jedoch nie feindselig entgegengetreten, zumindest nicht so offen.
»Du willst ihr meinen Anruf nicht ausrichten?«
»Nein. Ich kann es nicht, denn ich werde sie nicht treffen, so wie es aussieht.«
»Was soll das heißen?«
»Dass deine liebe Natalie schon seit zwei Wochen nicht mehr zur Arbeit kommt. Ich schmeiße den Laden hier ganz alleine.«
Benommen, als habe Anouka ihm einen Schlag gegen die Schläfen verpasst, blieb er im Flur stehen und starrte eine Magnettafel an, die in Kopfhöhe an der geschlossenen Küchentür befestigt war. Früher hatten Natalie und er sich daran liebevolle, ironische Nachrichten hinterlassen, je nachdem, wer früher aus dem Haus gegangen war. Aber der letzte Scherz (Schatz, hatten wir gestern Sex? Tut mir leid, wenn ich dabei geschnarcht habe. Nat) war schon Monate her, und im Moment klebte nur ein Mitteilungsblatt der Hausverwaltung unter dem Magneten, in dem die Mieter darauf hingewiesen wurden, dass in wenigen Tagen mit der Renovierung des Treppenhauses begonnen werde (Stellen Sie sich auf längere Wartezeiten beim Fahrstuhl ein!).
»Aber Natalie hat mir gesagt, ihr arbeitet an einer großen Ausstellung?«
Sternenkinder.
Eine Präsentation ebenso berührender wie verstörender Bilder rund um das Thema Fehl- und Totgeburten.
Deswegen war Natalie in den letzten Tagen doch immer früh aus dem Haus gegangen und erst spät zurückgekommen.
So wie vorgestern!
Er hatte mit einer Flasche Versöhnungs-Wein im Esszimmer auf sie gewartet und sie irgendwann geöffnet, als die Stunden ins Land zogen. Nachdem sie geleert war, war er betrunken ins Bett gefallen und hatte nicht bemerkt, wie sie nach Hause gekommen war.
»Sie hat mir gesagt, ihr arbeitet auf Hochtouren, damit alles rechtzeitig fertig wird.«
»Auf Hochtouren stimmt. Aber ich muss alles alleine stemmen, Leon. Keine Ahnung, was in ihr vorgeht. Ich weiß ja, sie ist etwas unzuverlässig, aber dass sie mich nicht ein einziges Mal zurückruft, obwohl ich ihr Dutzende Nachrichten auf der Mailbox hinterlassen habe, ist schon ein starkes Stück. Ich meine, das Thema der Ausstellung war ihre Idee, aber vielleicht war es doch zu früh.«
Nein, das glaube ich nicht.
Sicher, nach der Fehlgeburt letzten Sommer war Natalie zunächst am Boden zerstört gewesen, doch sie hatte es erstaunlich gut und schnell verkraftet, vielleicht auch, weil der Abgang noch in der zehnten Woche geschah, zusammen mit ihrer Periode, ohne dass eine Ausschabung nötig gewesen war.
Ein Sternenkind.
Wie glücklich war er gewesen, als sie ihre Tage nicht bekam. Sie selbst hatte ihm von den ersten Anzeichen, dem Ziehen in der Brust, der Geruchsempfindlichkeit am Morgen noch gar nichts erzählt, aus Angst, es könnte sich als Fehlalarm entpuppen. Doch dann hatte er einen Test gekauft, und die wenigen Tage nach dem positiven Ergebnis waren die schönsten seines Lebens gewesen.
Dann kam der Morgen, an dem sie das Blut im Slip entdeckte und die Zukunftspläne sich mit der Vorfreude in Luft auflösten. Es war schrecklich gewesen, doch irgendwie, nach einer kurzen, aber intensiven Phase der Trauer, hatte sie der Vorfall am Ende noch enger zusammengeschweißt. Wenn er dieses Gefühl nicht gehabt hätte, hätte er ihr vor zwei Monaten doch nicht den Antrag gemacht.
Und sie hatte ja gesagt!
Die Hochzeit war etwas unorthodox gewesen, ohne Trauzeugen, Fotograf oder Blumenmädchen, einfach zum nächstbesten Termin, der beim Standesamt verfügbar gewesen war. Viele Freunde hatten überrascht, einige verärgert reagiert, aber wieso hätten sie nicht genau so heiraten sollen, wie sie sich verliebt hatten, Hals über Kopf?
»Sie war über den Berg«, sagte Leon mehr zu sich selbst als zu Anouka.
Dann erinnerte er sich an das Glas Wasser, öffnete die Küchentür und musste husten.
Irgendetwas in der Luft machte ihm das Eintreten schier unmöglich. Es fühlte sich an wie dichter Qualm, aber der Rauch, der seine Kehle reizte und ihm in Sekundenschnelle die Tränen in die Augen trieb, war komplett unsichtbar.
»Was hast du gesagt?«, fragte Anouka.
»Nichts«, hustete er, eilte mit vor den Mund gepresster Hand zum Küchenfenster und riss es auf. Erleichtert sog er die kalte, klare Luft in die Lungen.
»Wie dem auch sei, Leon. Es geht mich ja eigentlich auch nichts an, was bei euch zu Hause los ist. Ich hatte eigentlich gehofft, du würdest mich anrufen, um mir zu erklären, weshalb Natalie in letzter Zeit so durch den Wind ist.«
Leon rieb sich die Augen, während er sich umdrehte und nach der Quelle des Reizstoffs suchte. Sein Blick fiel auf die Mikrowelle, deren Anzeige blinkte.
»Ich meine, ausgerechnet jetzt streicht sie die Segel. Wir stehen noch ganz am Anfang, haben letzten Monat zum ersten Mal ein Plus gemacht, und Natalie haut in den Sack. Ich versteh’s nicht.«
Ich auch nicht, dachte Leon, öffnete die Mikrowelle und musste wieder husten. Er hatte den Ursprung des beißenden Geruchs gefunden.
»Alles okay bei dir?«, erkundigte sich Anouka.
Nein. Ganz und gar nichts ist okay bei mir.
Mit spitzen Fingern griff er nach den Sportschuhen in der Mikrowelle, konnte sie aber nicht anheben. Die Gummisohlen waren mit dem Unterteller verschmolzen, und dieser Anblick weckte eine weitere Erinnerung an eine Phase, die Leon bislang für die schlimmste in seinem Leben gehalten hatte.
Ohne sich zu verabschieden, drückte er Anouka weg und eilte aus der Küche durch den Flur in sein Arbeitszimmer. Er musste das Pappmodell des Kinderkrankenhauses, mit dem ihr Architekturbüro an der Ausschreibung des Neubaus teilnehmen wollte, etwas anheben, um die oberste Schreibtischschublade zu öffnen. Nach einigem Wühlen fand er ein abgegriffenes Notizbuch, in dem er früher die wichtigsten Telefonnummern notiert hatte. Er hoffte, dass sich der Anschluss nicht geändert hatte. Immerhin hatte er die Nummer das letzte Mal vor über fünfzehn Jahren gewählt.
Es klingelte eine Ewigkeit, bevor der Teilnehmer abnahm.
»Dr. Volwarth?«
»Ja. Mit wem spreche ich bitte?«
»Ich bin’s. Leon Nader. Ich glaube, es geht wieder los.«
4.
Danke, dass Sie so schnell gekommen sind.«
Dr. Samuel Volwarth quittierte Leons Gesprächsauftakt mit einem nachsichtigen Lächeln und lehnte sich entspannt im Sofa zurück. »Hausbesuche gehören nicht zu meiner Tagesroutine, aber ich muss zugeben, Sie haben mich neugierig gemacht. Wieder einmal.«
Leon hatte den Psychiater auf dem Sprung erreicht. Dr. Volwarth wollte gerade zu einem Kongress nach Tokio aufbrechen und hatte auf dem Weg zum Flughafen einen Umweg in Kauf genommen, um bei seinem ehemaligen Patienten eine Stippvisite einzulegen.
Während sie jetzt im Wohnzimmer saßen, wartete das Taxi unten im Halteverbot. Dennoch wirkte Volwarth völlig entspannt und aufgeräumt, genauso wie Leon ihn in Erinnerung hatte. Es war ein eigentümliches Gefühl, ihm heute, nach so langer Zeit, wieder gegenüberzusitzen.
Der Psychiater schien keinen Tag älter geworden zu sein. Wie früher trug er das Haar ungewöhnlich lang und zu einem grauen Pferdeschwanz gebunden. Anscheinend gab er sich noch immer die größte Mühe, aus dem Rahmen zu fallen. Was allerdings zu Leons Kindertagen noch ein Skandal gewesen war, galt heute allenfalls als extrovertiert: Volwarths Lederhosen, seine Cowboystiefel, die Schwalbentätowierung am Hals. Auf der Suche nach Zeichen der Zeit wurde Leon nur in Details fündig: Die Mundwinkel hingen etwas tiefer, die Ringe unter den Augen waren eine Nuance dunkler. Und der Arzt hatte den Perlenohrring durch einen dezenten Silberstecker ersetzt.
»Verdammt lang her, was? Ist ein halber Strand durch die Sanduhr gerauscht, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben.«
Leon nickte. Vor knapp siebzehn Jahren hatten seine besorgten Eltern ihn zum ersten Mal zu Volwarths Privatklinik gefahren.
Wobei er Klaus und Maria damals noch nicht als seine Eltern bezeichnet hatte. Die ersten Jahre nach dem Unfall wäre es ihm wie ein Verrat an seinen leiblichen Eltern erschienen, die er im Alter von zehn Jahren durch einen Lebensmüden verloren hatte. Ein depressiver Alkoholiker hatte sich mit Absicht die falsche Auffahrt der Autobahn ausgesucht, um schneller aus dem Leben zu scheiden. Der ungebremste Frontalaufprall hatte drei Todesopfer gefordert. Nur zwei Insassen überlebten: Leon, der sich noch daran erinnern konnte, wie er und seine Schwester zu Yellow Submarine im Radio gesungen hatten, als plötzlich die Lichter vor ihnen auftauchten. Und der Geisterfahrer, der mit einem gebrochenen Schlüsselbein davongekommen war. Eine Ironie des Schicksals, über die vermutlich nur der Teufel lachen konnte.
Die ersten Tage, nachdem Leon im Krankenhaus als Waise aufgewacht war, hatte er wie unter einer Taucherglocke gelebt. Er hatte die Diagnosen der Ärzte, die Ratschläge des Kinderpsychologen und die Erläuterungen der Dame vom Jugendamt gehört, sie aber nicht verstanden. Die Lippen derer, die ihn untersuchten, pflegten und am Ende zu Ersatzeltern abschieben wollten, hatten sich bewegt und Laute erzeugt, die keinen Sinn ergaben.
»Schön haben Sie es hier«, sagte der Psychiater nun, fast zwei Jahrzehnte später, den Blick auf die stuckverzierte Zimmerdecke gerichtet. »Altbau mit Fahrstuhl und Parkett. Südbalkon, sechs Zimmer, schätze ich. Wird nicht leicht gewesen sein, so etwas in dieser Gegend zu finden.«
»Es sind fünf Zimmer. Aber ja. Es war die Stecknadel im Heuhaufen.«
Natalie hatte die Anzeige durch Zufall beim Spazierengehen entdeckt und den Vermieter angeschrieben, ohne sich große Hoffnungen zu machen. Sie hatten sogar an einen Scherz gedacht, denn ein derartiges Filetstück fand man eher in den Hochglanzprospekten der Luxusmakler als an dem Mast einer Straßenlaterne.