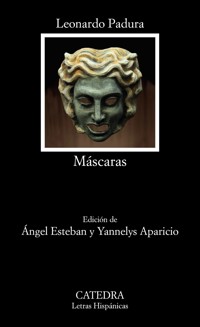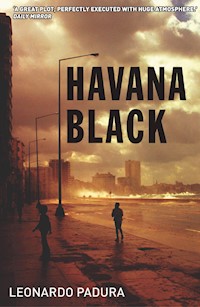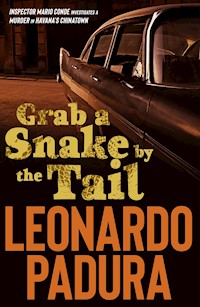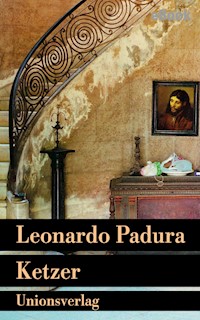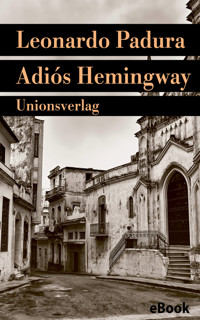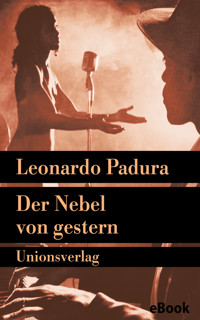
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Not macht erfinderisch. Auch Mario Conde, der sich als Antiquar durchs Leben schlägt - kein schlechtes Geschäft in Zeiten, in denen viele Kubaner ihre Bücher zu Geld machen müssen. Eines Tages stößt Conde auf eine außerordentlich wertvolle, seit vierzig Jahren vergessene Bibliothek. All seine Geldsorgen scheinen mit einem Schlag gelöst. Doch dann entdeckt er zwischen den bibliophilen Kostbarkeiten eine Zeitschrift aus den Fünfzigerjahren mit dem Porträt der Bolerosängerin Violeta del Río. Ihr Bild und die einzige Schallplatte, die sie vor ihrem rätselhaften Tod aufgenommen hat, verzaubern ihn. Er macht sich auf die Suche nach ihr und dringt vor in das Havanna von gestern, in die wilden Jahre der Boleros und der Mafia, aber auch in das zerfallende, melancholische Havanna der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Mario Conde entdeckt zwischen den Büchern einer alten Bibliothek das Porträt einer Bolerosängerin aus den Fünfzigerjahren. Ihre Schönheit – und ihr rätselhafter Tod – lassen ihn nicht mehr los, und so dringt er vor in das Havanna von gestern, in die wilden Jahre der Boleros und der Mafia, aber auch in das melancholische Havanna der Gegenwart.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Leonardo Padura (*1955) zählt zu den meistgelesenen kubanischen Autoren. Sein Werk umfasst Romane, Erzählbände, literaturwissenschaftliche Studien und Reportagen. International bekannt wurde er mit dem Kriminalromanzyklus Das Havanna-Quartett. Er erhielt u. a. den Prinzessin-von-Asturien-Preis.
Zur Webseite von Leonardo Padura.
Hans-Joachim Hartstein (*1949) übersetzt seit 1980 französisch- und spanischsprachige Literatur. Er hat u. a. Werke von Georges Simenon, Léo Malet, Luis Goytisolo, Juan Madrid, Marina Mayoral, Leonardo Padura und Ernesto Che Guevara ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Hans-Joachim Hartstein.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Leonardo Padura
Der Nebel von gestern
Mario Conde ermittelt in Havanna
Roman
Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 4 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel La neblina del ayer bei Tusquets Editores, Barcelona.
Originaltitel: La neblina del ayer (2005)
© by Leonardo Padura Fuentes 2005
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Nick White/Getty Images
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30484-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 12:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER NEBEL VON GESTERN
A-Seite — Geh fort von mir1 – Die Symptome kamen ganz plötzlich, wie die gefräßige …2 – Was zum Teufel tue ich hier? El Conde …3 – Inzwischen konnte Mario Conde an seine Jahre als …4 – Mario Conde öffnete die Augen. Er fühlte sich …B-Seite — Du wirst dich an mich erinnern1 – Die Schläge hallten im Haus wider wie der …2 – Die Calzada de Monte und eine auf den …3 – 8. JanuarMein Geliebter,ich hatte mir vorgenommen, mit einem …4 – Mario Conde verzichtete auf eine offizielle Anzeige …5 – Er stieg mit dem Gefühl aus dem Bett …6 – Der Schmerz hinter den Augen war bleischwer …7 – Wie eine enthauptete Schlange fiel die Polizeibanderole schlaff …Nachbemerkung und DankMehr über dieses Buch
Über Leonardo Padura
Leonardo Padura: »Die Welt der kubanischen Literatur begann sich zu drehen«
Leonardo Padura: »In Kuba geht alles einen anderen Gang«
Leonardo Padura: »Ich möchte nicht das Gebäude des kubanischen Systems einreißen und dann auf der Straße stehen.«
Leonardo Padura: »Eine Chronik des kubanischen Lebens der letzten vierzig Jahre«
Über Hans-Joachim Hartstein
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Leonardo Padura
Zum Thema Kuba
Zum Thema Lateinamerika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Musik
Zum Thema Karibik
Wieder einmal, so wie es sein muss:Für Lucía, mit Liebe und …
Es gibt nur eine wichtige Zeit für dich, zu erwachen;und diese Zeit ist jetzt.
Buddha
Die Zukunft ist Gottes, die Vergangenheit jedoch gehörtder Geschichte. Gott hat keinen Einfluss mehr auf die Geschichte,der Mensch dagegen kann sie noch schreiben und verändern.
Juste Dion
A-Seite
Geh fort von mir
Ich werde in deinem Leben das Beste seindes Nebels von gestern,wenn du es schaffst, mich zu vergessen,so wie der beste Vers der ist,an den wir uns nicht mehr erinnern.
Virgilio und Homero Expósito,Geh fort von mir
1
Die Symptome kamen ganz plötzlich, wie die gefräßige Welle, die am friedlichen Strand das Kind erfasst und mit sich in die Tiefen des Meeres reißt: der Salto mortale im Magen, das Taubheitsgefühl in den Beinen, das sie beinahe wegknicken ließ, der kalte Schweiß auf den Handflächen und vor allem der stechende Schmerz in der linken Brust, der sich mit seinen Vorahnungen jeweils meldete.
Kaum hatten sich die Türflügel der Bibliothek geöffnet, schlug ihm der faszinierende Geruch von altem Papier entgegen, der aus jedem Raum ein Heiligtum macht. In seiner längst vergangenen Zeit als Ermittler hatte Mario Conde gelernt, die hilfreichen Körpersignale zu deuten, und fragte sich jetzt unwillkürlich, ob er schon jemals ein derart überwältigendes Glücksgefühl erlebt hatte.
Zuerst versuchte er sich einzureden, der pure Zufall habe ihn in diesen düsteren alten Kasten im Vedado geführt, ein unerwarteter Wink des Schicksals, das endlich einmal sein Schielauge auf ihn zu richten geruht hatte. Einige Tage später jedoch waren so viele alte und neue Leichen aus ihren Gräbern auferstanden, dass El Conde zur Überzeugung gelangte, dass das Zufällige in seinem Leben keinen Platz hatte und alles auf dramatische Weise vom Schicksal vorherbestimmt war. Wie auf einer Bühne, auf der alles vorbereitet war und bloß darauf wartete, dass er durch seinen Auftritt das Startsignal gab.
Vor mehr als dreizehn Jahren hatte El Conde seine Arbeit bei der Kripo aufgegeben und sich mit Leib und Seele dem launischen Geschäft des An- und Verkaufs alter Bücher verschrieben. Trotz ramponiertem Leib und ausgelaugter Seele war es ihm gelungen, einen Raubtierinstinkt zu entwickeln, um die Beute aufzuspüren, die bisweilen mit überraschender Großzügigkeit sein leibliches und alkoholisches Überleben sicherte. Zu seinem Glück oder Unglück – das hätte er selbst nicht so genau zu sagen gewusst – fielen sein Austritt aus dem Polizeidienst und sein notgedrungener Eintritt in die Geschäftswelt mit der offiziellen Ankündigung der Krise auf der Insel zusammen. Und so galoppierend entwickelte sich diese Krise, dass sie bald alle vorangegangenen vor Neid erblassen ließ, jene üblichen, ewigen Krisen, die El Conde und seine Landsleute jahrzehntelang durchgemacht hatten. An die früheren, immer wiederkehrenden Perioden des namenlosen, schlichten Mangels erinnerte man sich nun, vergesslich und die Erinnerung schönfärbend, wie an eine »gute alte Zeit« bar jeden Schreckens.
Wie durch einen bösen Fluch war der Mangel fast schlagartig zum Dauerzustand geworden. So gut wie alle Dinge und menschlichen Bedürfnisse fielen ihm zum Opfer. Jeder Gegenstand, jede Dienstleistung bekam einen nie gekannten Wert und verwandelte sich in der allgemeinen Unsicherheit in etwas völlig Neues – ob Streichholz oder Aspirin, ob ein Paar Schuhe oder eine Avocado, vom Sex bis hin zu den Träumen und Fantasien. Und die Beichtstühle der Kirchen und die Warteräume der Wunderheiler, Spiritisten, Kartenleger, Hellseher und babalaos füllten sich mit Rat und Trost Suchenden.
Die Not war so groß und allumfassend, dass selbst die ehrwürdige Welt der Bücher nicht verschont blieb. Die Zahl der Veröffentlichungen sank im freien Fall. Spinnweben überzogen die Regale der düster gewordenen Buchhandlungen – die Angestellten hatten die letzten noch glimmenden Glühbirnen mitgehen lassen, auch wenn sie angesichts endloser Stromausfälle praktisch nichts damit anfangen konnten. Hunderte von Privatbibliotheken – einst Hort von Bildung, Weisheit, bibliophilem Stolz und tausend Erinnerungen an glücklichere Zeiten – verwandelten sich nach und nach in vulgäres Papier einer anderen Art, in stinkende, rettende Geldscheine. Generationen alter Bibliotheken von unschätzbarem Wert ebenso wie zufällig zusammengekaufte Büchersammlungen, Spezialbibliotheken zu den ausgefallensten und tiefgründigsten Themen ebenso wie Bücherschränke, die bloß mit Geschenken zu Geburts- und Hochzeitstagen gefüllt waren – alle wurden sie von ihren Besitzern erbarmungslos geopfert und geplündert angesichts der ständig wachsenden Geldnot, die fast alle Bewohner des Landes nun auszehrte.
Meter-, regal- oder kistenweise kam das, was in einem oder mehreren Leben zusammengetragen worden war, zum Verkauf und förderte bei Verkäufern und Ankäufern sehr unterschiedliche Emotionen zutage. Die einen bestanden darauf, dass das, wovon sie sich nun trennten, durchwegs bibliophile Juwelen waren. Sie hofften auf Erlöse, die nicht nur die Not lindern sollten, sondern auch ihr Schuldgefühl, denn schließlich trennten sie sich von Begleitern ihrer Lebensreise, die ihnen ans Herz gewachsen waren. Die anderen aber entwickelten einen Geschäftssinn, den man längst von der Insel verbannt geglaubt hatte. Die Kunst des geschickten Kaufens, des guten Geschäfts und der Spekulation auf einen ordentlichen Gewinn wurde fleißig geübt, und der Blick für den wahren Wert eines Produkts und sein kommerzielles Potenzial schärfte sich.
Während der ersten Zeit in seinem neuen Beruf versuchte Mario Conde, sich den Geschichten der Bibliotheken, die ihm in die Hände fielen, zu verweigern. All die Jahre, in denen er sich als Ermittler tagtäglich mit traurigen Schicksalen hatte herumschlagen müssen, hatten es jedoch nicht geschafft, seine Seele ganz und gar unempfindlich zu machen. Und so musste er, auf eigenen Wunsch aus dem Polizeidienst ausgeschieden, die schmerzliche Entdeckung machen, dass ihm die dunklen Seiten des Lebens hartnäckig auf den Fersen blieben. Jede zum Verkauf angebotene Bibliothek war immer auch ein Liebesroman mit tragischem Ende, dessen Dramatik nicht nur von der Menge und Qualität der geopferten Bücher abhing, sondern mehr noch von den Wegen, auf denen diese in ein bestimmtes Haus gelangt waren, und den tragischen Gründen, aus denen sie nun zu Markte getragen wurden. Deshalb lernte El Conde schon bald, dass Zuhören ein wesentlicher Teil seines Geschäfts war, verspürten die meisten Kunden doch unverkennbar das Bedürfnis, die Gründe für ihren verzweifelten Schritt darzulegen, und sei es nur, um sich damit von Schuld freizusprechen. Während die einen sich bemühten, ihrem Entschluss einen möglichst edelmütigen Anstrich zu verleihen, legten die anderen umso schonungsloser ihre Motive dar, als ginge es darum, in einem Akt der Beichte wenigstens einen Rest ihrer vom Hunger bezwungenen Ehre zu retten.
Und als die Wunden allmählich vernarbten, entdeckte El Conde, wie romantisch es sein konnte, stets »für alles ein offenes Ohr zu haben«, wie er selbst es gerne ausdrückte. Er fing an, die literarischen Möglichkeiten der Schilderungen seiner Kunden auszuloten, sie als Material für seine immer wieder hintangestellten Schreibübungen zu benutzen. Dabei schärfte sich sein Blick, und bald war er in der Lage zu erkennen, wann ein Erzähler aufrichtig war und wann ein erbärmlicher Lügner, der es nötig hatte, andere und sich selbst hinters Licht zu führen, sei es, um sich besser zu fühlen, oder sei es auch nur, um zu versuchen, die eigene Ware attraktiver erscheinen zu lassen.
In dem Maße, in dem Mario Conde zu den Geheimnissen des Buchhandels vordrang, wurde ihm bewusst, dass es ihm lieber war, Bücher zu kaufen, als sie später wieder zu verkaufen. Das Erworbene in einem Hauseingang, auf einer Parkbank oder einem vielversprechenden Bürgersteigabschnitt feilzuhalten, nagte an den Resten seines ohnehin schon ramponierten Stolzes; wirklich hart war jedoch, wenn er sich von einem Buch trennen musste, das er sich gerne selbst ins Regal gestellt hätte. Deshalb übernahm immer mehr die Rolle eines Spürhundes, der die Bestände anderer Straßenhändler mit seiner Beute anreicherte, auch wenn sein eigener Verdienst dadurch geringer ausfiel.
Auf den Streifzügen, die ihm neue Bücherminen erschließen sollten, verfolgte El Conde drei sich ergänzende, in gewisser Weise jedoch einander widersprechende Taktiken: Die herkömmlichste bestand darin, zu jemandem zu gehen, der um seinen Besuch gebeten hatte, weil Conde in dem Ruf stand, ein fairer Käufer zu sein; beschämend, ja geradezu mittelalterlich kam es ihm dagegen vor, lauthals rufend durch die Straßen zu laufen: »Kaufe alte Bücher!«, »Leute, hier kommt einer, der eure alten Bücher kauft!« Außerdem gab es noch die aggressiven Methoden: einfach an die Haustüren klopfen und mit beflissenem Gesicht den, der öffnete, fragen, ob er daran interessiert sei, ein paar gebrauchte Bücher zu verkaufen. Die zweite der Geschäftstaktiken erwies sich als besonders effizient in den Außenbezirken, in den seit eh und je armen und für seinen Handel im Allgemeinen wenig einträglichen – wenn auch von Überraschungen nicht freien – Vierteln, in denen die Kunst des Kaufens und Verkaufens von allem Möglichen und Unmöglichen jahrelang Tausenden von Menschen das Überleben gesichert hatte. Dagegen empfahl sich das System, die Häuser der Nase nach auszuwählen, in den ehemals vornehmen Vierteln El Vedado, Miramar und Kohly sowie in einigen Straßen von Santos Suárez, Casino Deportivo und El Cerro, wo sich die Bewohner trotz des Elends bemühten, einen gewissen wenn auch inzwischen überholten Lebensstil zu wahren.
Das Besondere an dem düsteren alten Kasten im Vedado mit dem neoklassizistischen Anspruch hinter der todmüden Fassade war, dass El Conde ihn nicht der Nase nach ausgewählt und noch weniger seinen Ausruferkünsten zu verdanken hatte. Er befand sich damals mitten in einer Phase, die man als lupenreine Pechsträhne bezeichnen konnte – ungefähr so wie der alte Fischer Santiago in einem einst von ihm sehr bewunderten Buch –, und war schon fast überzeugt, an einer unaufhaltsamen Verkümmerung seines Geruchssinns zu leiden. Drei Stunden eines glutheißen kubanischen Septembernachmittags hatte er damit zugebracht, an Türen zu hämmern und abschlägige Antworten auf seine Frage nach alten Büchern zu erhalten, manchmal einfach bloß deshalb, weil ein glücklicherer Kollege ihm zuvorgekommen war. Verschwitzt und enttäuscht, den ängstlichen Blick auf die nahe Küste gerichtet, über der sich immer schneller zusammenziehende schwarze Wolken ein baldiges Gewitter ankündigten, hatte El Conde sich angeschickt, den Arbeitstag zu beenden und die unwiederbringlich verlorene Zeit abzuschreiben, als er aus keinem genauer bestimmten Grund beschloss, durch eine Seitenstraße zu der Avenida zu gehen, wo die Aussicht bestand, einen Mietwagen aufzutreiben. Gefiel ihm der schattige Gehsteig? Meinte er, es sei eine Abkürzung? Oder folgte er, wenn auch unbewusst, dem Ruf des Schicksals? Kaum war er um die Ecke gebogen, sah er das heruntergekommene Haus vor sich, verriegelt und verrammelt und umgeben von einer Atmosphäre völliger Verwahrlosung. Im ersten Moment kam ihm der Gedanke, dass dieser Kasten, so wie er aussah, bestimmt schon von anderen Kollegen aufgesucht worden war. Solche Bruchbuden versprachen nämlich im Allgemeinen ein profitables Geschäft: Der vergangene Glanz ließ auf eine Bibliothek voller in Leder gebundener Bücher schließen, das gegenwärtige Elend auf Hunger und Verzweiflung. Eine Rechnung, die für den Käufer alter Bücher meistens aufging. Trotz seiner Pechsträhne und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Konkurrenz bereits vor ihm hier gewesen war, gehorchte El Conde dem fast irrationalen Impuls, der ihn veranlasste, das Türchen aufzustoßen, den in einen überlebenswichtigen Nutzgarten verwandelten, mit Bananen, mickrigem Mais und dem alles verschlingenden Gestrüpp der Süßkartoffeln bepflanzten Vorgarten zu durchqueren, die fünf Stufen zu dem kühlen Hauseingang hochzusteigen und, ohne weiter nachzudenken, den grün angelaufenen bronzenen Türklopfer zu heben und auf die unverwüstliche Mahagonitür fallen zu lassen, die wahrscheinlich noch vor der Entdeckung des Penizillins zum letzten Mal schwarz lackiert worden war.
»Guten Tag«, sagte er, als sich die Tür öffnete, und lächelte höflich, so wie es das Handbuch für ambulante Buchhändler vorschrieb.
Die Frau, der Mario Conde einen Platz auf dem absteigenden Ast zwischen sechzig und siebzig Jahren zuwies, ließ sich nicht dazu herab, seinen Gruß zu erwidern, sondern sah ihn bloß mit strengem Blick an. Bestimmt vermutete sie in dem Besucher genau das Gegenteil dessen, was er war: ein Verkäufer. Sie war in einen grauen, mit prähistorischen Fettspritzern übersäten Morgenmantel gehüllt, hatte farblos graues, schuppenbesprenkeltes Haar, eine beinahe transparente, von bleichen Venen durchzogene Haut und ungeheuer traurige Augen.
»Entschuldigen Sie die Störung. Ich kaufe Bücher aus zweiter Hand«, begann Conde, wobei er das Wort »alt« vermied. »Ich möchte Sie fragen, ob Sie eventuell von jemandem wissen …«
Das war die goldene Regel: »Ihnen selbst kann es niemals so dreckig gehen, dass Sie gezwungen wären, Ihre Bibliothek zu verkaufen oder die Ihres Vaters, eines ehemaligen Anwalts mit berühmter Kanzlei und Lehrstuhl an der Universität, oder die Ihres Großvaters, eines Senators der Republik möglicherweise oder vielleicht sogar eines Veteranen der Unabhängigkeitskriege. Aber eventuell wissen Sie von jemandem, der, nicht wahr …«
Die Frau, offenbar gegen jede Gefühlsregung immun, zeigte sich von den Worten des Besuchers nicht überrascht. Sie sah ihn lange an, gelassen, abwartend. Mario Conde wartete seinerseits ab – die Erfahrung sagte ihm, dass sich in dem angerosteten, von wenigen Fetten und Proteinen mühsam in Gang gehaltenen Hirn der Frau eine bedeutungsvolle Entscheidung Bahn brach.
»Nun ja«, sagte sie schließlich, »ehrlich gesagt, nein, ich meine, ich weiß nicht, ob … Mein Bruder und ich hatten schon darüber nachgedacht … Hat Dionisio Ihnen gesagt, Sie sollten vorbeikommen?«
Conde sah einen Hoffnungsschimmer am Horizont und versuchte sich eine Antwort zurechtzulegen. Hatte er am Ende ins Schwarze getroffen?
»Nein, nein … Dionisio?«
»Mein Bruder«, erklärte die Frau. »Wir haben nämlich eine Bibliothek hier … Sehr wertvoll, wissen Sie? Aber kommen Sie doch herein … Setzen Sie sich. Ein Momentchen …« El Conde glaubte aus ihrer Stimme eine Entschlossenheit herauszuhören, die imstande war, den härtesten Katastrophen des Lebens zu trotzen.
Durch eine Art Torbogen, der auf zwei blank polierten, von grünen Adern durchzogenen schwarzen toskanischen Marmorsäulen ruhte, verschwand die Frau im Innern des Hauses. El Conde beklagte seine mangelhaften Kenntnisse der vor Langem vertriebenen kreolischen Aristokratie, eine Bildungslücke, die dafür verantwortlich war, dass er nicht wusste, ja nicht einmal Vermutungen darüber anstellen konnte, wer die ursprünglichen Eigentümer dieser ehrwürdigen Hallen gewesen und ob die jetzigen Bewohner deren Nachkommen oder lediglich die Nutznießer ihrer nachrevolutionären Flucht waren. Der Salon mit den feuchten, rissigen Wänden, von denen der Putz bröckelte, machte keinen besseren Eindruck als das Äußere des Hauses, hatte sich jedoch eine Atmosphäre vornehmer Eleganz bewahren können, die lebhafte Erinnerung daran, welcher Reichtum einstmals zwischen diesen jetzt kahlen Wänden geherrscht hatte. Die hohen Decken mit den bedrohlich aufgequollenen Stuckleisten und den inzwischen verblassten Sockelstreifen mussten das Werk eines Meisters seines Fachs gewesen sein, ebenso wie die langen Fenster mit den wundersamerweise unversehrt gebliebenen Scheiben, auf denen romantische Ritterszenen abgebildet waren, wahrscheinlich in Europa hergestellt und dazu bestimmt, das pralle Licht des tropischen Sommers zu dämpfen und bunt zu färben. Die immer noch soliden Möbel, mehr zusammengesucht als einem besonderen Stil verpflichtet, mehr verwohnt als verschlissen, schwitzten ihre Altersschwäche aus – was man auch riechen konnte –, wohingegen der Boden aus weißen und schwarzen Marmorfliesen, der an ein riesiges Schachbrett erinnerte, vor Freude über die kürzlich vorgenommene Reinigung strahlte. Die beiden Flügel der sehr hohen Tür auf einer Seite des Salons waren von ehemals geschliffenen Spiegeln in dunklen Holzrahmen bedeckt, deren blind gewordener, fleckiger Belag den desolaten Zustand des Gebäudes widerspiegelte.
In diesem Moment wurde dem Besucher klar, warum er beim Betreten des Salons gespürt hatte, dass hier etwas nicht stimmte: Weder an den Wänden noch auf den Tischen oder den Konsolen oder an der Decke gab es irgendwelchen Schmuck, kein Bild, nirgends, nichts, was die entsetzliche Leere durchbrochen hätte. Er vermutete, dass das edle Porzellan, das gediegene Silber, die Kristalllüster, die geschliffenen Gläser und vielleicht auch die Gemälde mit dunklen Jagdszenen und überladenen Stillleben, die früher einmal für ein ausgewogenes, harmonisches Ambiente gesorgt haben mochten, höchstwahrscheinlich bereits von hier fortgebracht worden waren, um Lebensmittel zu beschaffen, genau so, wie es nun, wenn das Glück mitspielte, mit der als »sehr wertvoll« bezeichneten Bibliothek geschehen sollte.
Das von der Frau angekündigte »Momentchen« wuchs sich zu einer viertelstündigen Wartezeit aus, die sich El Conde mit einer Zigarette verkürzte, deren Asche er durch eins der offenen Fenster schnippte, hinter dem die ersten Tropfen des Abendregens fielen. Schließlich kam die Hausherrin zurück, gefolgt von einem mehrere Jahre älteren Mann an der Schwelle zum Greisenalter, hager wie sie; er hätte dringend eine Rasur und, wie seine Schwester, drei Mahlzeiten pro Tag mit ausreichenden Kalorienmengen nötig gehabt.
»Mein Bruder«, sagte sie.
»Dionisio Ferrero«, stellte sich der Mann mit einer Stimme vor, die jünger war als sein Aussehen. Er reichte dem Gast eine schwielige Hand mit schmutzigen Fingernägeln.
»Mario Conde. Ich …«
»Meine Schwester hat mich bereits informiert«, unterbrach ihn der Mann, der offenbar ans herrische Befehlen gewöhnt war, was er gleich bestätigte, indem er mehr anordnete als bat: »Kommen Sie mit.«
Dionisio Ferrero ging zu der hohen Tür, und El Conde folgte ihm. Zwischen den blinden Flecken des Spiegels musste er feststellen, wie gut sein eigenes, von den dunklen Holzrahmen eingefasstes Bild zu den skelettartigen Gestalten der Geschwister Ferrero passte. Seine von vielen Nächten mit zu viel Rum und zu wenig Schlaf ausgezehrten Gesichtszüge und seine mitleiderregende Magerkeit erweckten den Eindruck, seine Kleider seien ihm mindestens eine Nummer zu groß. Unvermutet kraftvoll stieß Dionisio die Tür auf, und El Conde verlor sein Spiegelbild aus den Augen. Sogleich verspürte er einen heftig stechenden Schmerz in der Brust, denn vor seinen Augen erhoben sich prachtvolle, von Glastüren geschützte, bis zur hohen Decke reichende Holzregale, in denen Hunderte, Tausende von Büchern ruhten, auf deren dunklen Rücken goldene Buchstaben leuchteten. Sieger über die bösartige Feuchtigkeit der Insel und die unbarmherzig verstreichende Zeit.
Gebannt von diesem Wunder fragte sich der schwer atmende Besucher, ob er überhaupt die Kraft haben werde, den Raum zu betreten. Doch dann wagte er drei vorsichtige Schritte. Als er über die Schwelle trat, sah er, jetzt vollkommen überwältigt, dass sich die mit Büchern vollgestopften Regale über sämtliche Wände der etwa fünf mal sieben Meter großen Bibliothek erstreckten. Und genau in diesem Moment wurde er, durch die mehr als gerechtfertigte Erregung und Fassungslosigkeit bereits wehrlos gemacht, von den stürmischen Symptomen der Vorahnung überrascht, jenem Gefühl, das nichts mit der bis dahin empfundenen Bewunderung des Büchernarren und Händlers zu tun hatte, sondern der Gewissheit gleichkam, dass sich vor ihm etwas ganz Außergewöhnliches verbarg, das lauthals nach ihm verlangte.
»Was sagen Sie dazu?«
Wie hypnotisiert hörte El Conde die Frage von Dionisio Ferrero gar nicht.
»Nun, was sagen Sie dazu?«, wiederholte der Mann und trat in das Gesichtsfeld des Besuchers.
»Unglaublich«, brachte dieser schließlich hervor. Ohne jeden Zweifel hatte er eine der außergewöhnlichen Goldadern vor sich, nach denen man sein ganzes Leben auf der Suche ist. Seine Erfahrung rief ihm zu, dass dort unvorstellbare Überraschungen seiner harrten. Denn wenn auch nur fünf Prozent dieser Bücher von besonderem Wert sein sollten, stand er vor zwanzig, dreißig möglichen bibliophilen Schätzen, die ganz allein imstande waren, den Hunger der Geschwister Ferrero und dazu seinen eigenen zu stillen – oder zumindest für eine ziemlich lange Zeit zu betäuben.
Als Mario Conde meinte, sich wieder sicher bewegen zu können, näherte er sich dem Regal, das sich direkt vor ihm befand, und öffnete, ohne um Erlaubnis zu bitten, die Glastüren. Er schaute auf die Rücken der Bücher, die in Augenhöhe standen, und entdeckte den dunkelroten Ledereinband der Chroniken der Kubanischen Kriege von Miró Argenter, in der Erstausgabe von 1911. Er wischte sich den Schweiß von den Händen und nahm das Buch heraus, schlug es auf und sah die Widmung des Schriftstellers und Kriegsteilnehmers: »Meinem Freund und innigst geliebten Sargento Serafín Montes de Oca«. Neben den Chroniken von Miró standen die beiden dicken Bände des begehrten Werkes Alphabetisches Verzeichnis der Angehörigen und der Gefallenen der Kubanischen Befreiungsarmee von Mayor General Carlos Roloff, in der seltenen und einzigartigen Havanna-Ausgabe von 1901. Mit zitternden Händen wagte sich Mario Conde nun an die gleich danebenstehenden Bände der Anmerkungen zur Geschichte der Geisteswissenschaften und staatlichen Erziehung der Insel Kuba, den Klassiker von Antonio Bachiller y Morales, herausgegeben in Havanna zwischen 1859 und 1861. Sein immer langsamer werdender Zeigefinger strich über den schmalen Rücken des Romans Die Kaffeepflanzung von Domingo Malpica de la Barca, hergestellt in der Druckerei Los Niños Huérfanos in Havanna, 1890, und über die massigen, angenehm weichen Lederrücken der fünfbändigen Geschichte der Sklaverei von José Antonio Saco, in der Ausgabe der Druckerei Alfa von 1936, bis er schließlich, wie ein Besessener, ein Buch herausfischte, auf dem lediglich die Initialen C.V. eingestanzt waren. Als er es aufschlug, spürte er, dass er weiche Knie bekam, handelte es sich doch tatsächlich um die erste Ausgabe von Das Mädchen mit dem Goldenen Pfeil, dem Roman von Cirilo Villaverde, und zwar um die legendäre Erstausgabe von 1842 aus der berühmten Druckerei Oliva in Havanna.
El Conde hatte das Gefühl, sich in einem von der Zeit vergessenen Heiligtum zu befinden, und zum ersten Mal kam ihm der Gedanke, ob das, was er gerade tat, nicht ein Akt der Entweihung war. Behutsam stellte er die Bücher zurück und atmete den intensiven Geruch ein, den der geöffnete Schrank verströmte. Er pumpte sich die Lungen voll, und erst als er sich daran berauscht hatte, schloss er die Glastüren. Bemüht, seine Gemütserregung zu verbergen, drehte er sich zu den Ferreros um, in deren Augen er ein Fünkchen Hoffnung aufblitzen sah, sichtbares Zeichen ihrer Auflehnung gegen die Katastrophen des Lebens.
»Warum wollen Sie diese Bücher verkaufen?«, fragte er schließlich, entgegen seiner Gewohnheit, und befand sich damit bereits auf dem Weg zur Geschichte dieser mehr als außergewöhnlichen Bibliothek. Niemand trennte sich einfach so, bewusst und unvermittelt, von einem Schatz wie diesem (von dem er lediglich ein paar verheißungsvolle Prachtstücke gesehen hatte), es sei denn, es gab außer dem Hunger noch einen anderen Grund, und El Conde spürte, dass es ihn drängte, diesen Grund zu erfahren.
»Das ist eine lange Geschichte, lang und …« Zum ersten Mal seit der kurzen Zeit, die El Conde ihn kannte, geriet Dionisio Ferrero ins Stocken, doch sogleich fand er seinen fast martialischen Ton wieder: »Noch wissen wir nicht, ob wir sie verkaufen wollen. Das hängt davon ab, was Sie uns dafür bieten. Im Antiquitätenhandel wimmelt es von Banditen, wissen Sie. Neulich waren zwei hier. Wollten uns die Glasfenster abkaufen, diese Halunken, für dreihundert Dollar das Stück. Die halten einen für Idioten oder meinen, man sei am Verhungern.«
»Ja, natürlich, es gibt viele, die die Situation ausnutzen. Aber ich würde gerne wissen, warum Sie sich gerade jetzt entschlossen haben, die Bücher zu verkaufen.«
Dionisio sah seine Schwester an, als verstünde er die Frage nicht. War der Kerl denn völlig blöd? El Conde begriff sofort, lächelte und machte einen dritten Anlauf, um seine Neugier zu befriedigen: »Warum haben Sie nicht schon früher daran gedacht?«
Jetzt war es die Frau, die, wohl weil der Hunger sie bedrängte, hastig antwortete: »Wegen Mama … unserer Mutter«, erklärte sie. »Sie hat sich vor langer Zeit dazu verpflichtet, sich um die Bücher zu kümmern.«
El Conde merkte sofort, dass er unsicheres Terrain betrat, doch es blieb ihm nichts anderes übrig, als weiterzufragen: »Und Ihre Mutter, ist sie …?«
»Nein, sie ist nicht gestorben. Aber sie ist sehr alt. Dieses Jahr wird sie einundneunzig, und die Ärmste ist …«
Mario wagte nicht, sie zu drängen. Der erste Teil der Offenbarung war auf den Weg gebracht, und nun wartete er schweigend ab. Der Rest musste von selbst kommen.
»Die alte Frau ist nicht ganz … Nun ja, mit ihren Nerven stand es schon lange nicht mehr zum Besten. Und … ehrlich gesagt, wir brauchen Geld«, platzte Dionisio heraus und wies mit der Hand auf die Bücher. »Sie wissen doch, wie die Dinge stehen, die Rente reicht hinten und vorne nicht.«
El Conde nickte. Ja, er wusste, wie die Dinge standen. Sein Blick folgte der Hand des Mannes zu den prallvollen Bücherschränken, und er stellte fest, dass sein Gefühl, vor etwas wirklich Außergewöhnlichem zu stehen, ihn nicht verlassen hatte. Es war immer noch da, unerschütterlich, versetzte ihm Stiche in der Brust, ließ seine Hände feucht werden. Er fragte sich, warum das Gefühl so heftig war. Er wusste doch jetzt, dass er wertvolle Bücher vor sich hatte, was war es also, das ihn so nachhaltig alarmierte? War möglicherweise ein ganz und gar unerwartetes Buch darunter? Stand es dort, vergessen und glücklich, das sensationelle Buch, das jeder Bibliophile irgendwann zu finden hofft? Das musste es wohl sein, es kann nur so sein, sagte er sich, und wenn es so war, blieb ihm nichts anderes übrig, als sämtliche Regale von oben bis unten durchzusehen.
»Verzeihen Sie meine Neugier, aber … Wann hat zuletzt jemand diese Bibliothek angerührt?«, fragte er.
»Vor vierzig … dreiundvierzig Jahren«, sagte die Frau. El Conde schüttelte ungläubig den Kopf.
»In der ganzen Zeit hat keins der Bücher den Raum verlassen, und keines ist hinzugekommen?«
»Nicht eines«, bestätigte Dionisio, überzeugt, dass die Bibliothek dadurch noch wertvoller wurde. »Mama hat uns angewiesen, einmal im Monat zu lüften und den Staub zu entfernen, mit einem Staubwedel, so, ganz vorsichtig …«
»Sehen Sie, ich will offen mit Ihnen reden«, wagte Mario sich vor, obwohl ihm bewusst war, dass er damit die heiligsten Gesetze seines Berufes verletzte. »Ich habe das Gefühl … ach, was sage ich da … Ich bin mir sicher, dass einige der Bücher, die hier stehen, viel Geld wert sind, vielleicht so wertvoll, dass man sie nicht verkaufen kann … oder darf. Mit anderen Worten: Bücher, vor allem kubanische Bücher, die Kuba nicht verlassen sollten und die so gut wie niemand in Kuba bezahlen kann, jedenfalls nicht das, was sie wirklich wert sind. Und schon gar nicht die Nationalbibliothek. Was ich Ihnen jetzt sage, läuft meinen geschäftlichen Interessen zuwider, aber ich glaube, es wäre ein Verbrechen, sie irgendeinem Ausländer zu verkaufen, der sie dann außer Landes bringt. Ich sage bewusst ›Verbrechen‹, denn es wäre nicht nur unverzeihlich, sondern tatsächlich eine Straftat, aber das ist im Moment nicht so wichtig. Wenn Sie einverstanden sind, sprechen wir über die verkäuflichen Bücher, und wenn Sie später auch die anderen, ganz besonders wertvollen Bücher verkaufen wollen, können Sie das tun, aber da halte ich mich dann raus.«
Dionisio sah ihn sehr aufmerksam an.
»Wie, sagten Sie, war Ihr Name?«
»Mario Conde.«
»Mario Conde …« Er sprach den Namen ganz langsam aus, als gäbe ihm jeder einzelne Buchstabe die Würde zurück, nach der sein stolzes Blut in diesem Moment verlangte. »Meine Schwester und ich, wir haben uns für dieses Land abgeschuftet, jawohl, so wahr wir hier stehen. Ich habe sogar mein Leben riskiert, hier und in Afrika. Aber selbst wenn ich verhungern sollte, so etwas werde ich nicht tun … nicht für tausend und auch nicht für zehntausend Pesos!« Wieder sah er seine Schwester an, so als wollte er sich seines Stolzes versichern. »Nicht wahr, Amalia?«
»Selbstverständlich, Dionisio«, versicherte sie.
»Ich sehe, wir verstehen uns«, bemerkte El Conde, gerührt von der Naivität des heldenhaften Dionisio, der an Tausende von Pesos dachte, während Mario mit ähnlichen Zahlen kalkulierte, allerdings in Dollarbeträgen. »Wir machen jetzt Folgendes: Ich suche zwanzig oder dreißig Bücher heraus, die sich gut verkaufen lassen, auch wenn sie nicht besonders wertvoll sind. Ich sortiere sie aus, und morgen komme ich dann mit dem Geld und hole sie ab. Danach möchte ich die gesamte Bibliothek durchsehen, damit ich Ihnen sagen kann, was ich gerne mitnehmen würde, welche Bücher bestimmt keinen Käufer finden werden und welche nicht verkauft werden können oder, besser gesagt, nicht verkauft werden sollten. Einverstanden? Aber vorher würde ich gerne ihre vollständige Geschichte hören, ich meine, wenn es Ihnen recht ist. Verzeihen Sie, dass ich noch einmal davon anfange, aber eine Bibliothek mit Büchern wie denen, die ich soeben in der Hand gehalten habe und die seit dreiundvierzig Jahren niemand mehr angefasst hat …«
Dionisio Ferrero sah seine Schwester an, und die farblose Frau hielt seinem Blick stand, wobei sie ununterbrochen an der Nagelhaut ihrer Finger knabberte. Dann wandte sie sich Mario Conde zu: »Was für eine Geschichte? Die der Bibliothek oder die, wegen der wir sie zum jetzigen Zeitpunkt verkaufen wollen?«
»Ist das nicht Anfang und Ende derselben Geschichte?«
Als die Familie Montes de Oca aus Kuba fortging, blieben Mama und ich in diesem Haus zurück, das eins der elegantesten im Vedado war, wie man heute noch sieht, trotz der Zeit, die inzwischen vergangen ist. Zuerst sympathisierte Señor Alcides Montes de Oca mit der Revolution, doch bald wurde ihm klar, dass sich die Dinge grundlegender veränderten, als er sich vorgestellt hatte. Im September 1960, als die Intervention der amerikanischen Truppen begann, ging er mit den beiden Kindern in den Norden, nach Miami. Seine Frau war vier oder fünf Jahre zuvor gestorben, und er hatte nicht wieder geheiratet. Auch wenn seine Geschäfte unter Batista nicht gut gegangen waren, hatte Señor Alcides immer noch viel Geld, richtig viel Geld, sein eigenes und das aus der Erbschaft seiner verstorbenen Frau Alba Margarita, einer Méndez-Figueredo, der zwei Zuckerfabriken in Las Villas gehört hatten und wer weiß was sonst noch … Damals machte er Mama und mir den Vorschlag, mit ihm fortzugehen. Sie müssen wissen, Mama war seine rechte Hand bei allen seinen Geschäften, und außerdem war sie so etwas wie eine Schwester für ihn, sie wurde sogar in diesem Hause geboren, ich meine, in dem Haus, das die Montes de Ocas in El Cerro besaßen, bevor sie das neue bauen ließen, denn Mama wurde 1912 geboren, und dieses Haus hier wurde 1922 fertiggestellt, nach dem Krieg, als die Montes de Ocas noch viel mehr Geld hatten. Deswegen konnten sie Marmor aus Italien und Belgien kommen lassen, Kacheln aus Coimbra, Holz aus Honduras, Stahl aus Chicago, Vorhangstoffe aus England, Fensterglas aus Venedig. Und Dekorateure aus Paris … Zu der Zeit arbeitete mein Großvater als Gärtner und meine Großmutter als Wäscherin für die Montes de Ocas, und da meine Mutter in dem Haus geboren wurde, wuchs sie in der Familie auf, wie eine Schwester für Señor Alcides, wie gesagt, und deswegen konnte Mama zur Schule gehen und sogar das Abitur machen. Doch als sie dann aufs Lehrerseminar gehen sollte, beschloss sie, nicht zu studieren, und bat Señora Ana, die Frau von Don Tomás – das waren die Eltern von Señor Alcides –, sie im Hause arbeiten zu lassen, als Wirtschafterin oder als Verwalterin, denn sie fühlte sich wohl dort, zwischen lauter hübschen, sauberen und teuren Dingen, wohler als in einer staatlichen Schule, wo sie sich als Lehrerin für hundert Pesos im Monat mit frechen Kindern hätte herumschlagen müssen. Mama war damals neunzehn oder zwanzig Jahre alt, und die Montes de Ocas besaßen zu der Zeit schon nicht mehr ganz so viel Geld, denn sie hatten 1929 durch die Weltwirtschaftskrise viel verloren, und Don Serafín, der im Unabhängigkeitskrieg gekämpft hatte, und sein Sohn Don Tomás, ein bekannter Anwalt, wollten nichts mit Machado zu tun haben, der sich zu einem Diktator und Mörder entwickelt hatte. Machado und seine Leute machten ihnen das Leben unmöglich. Sie verdarben ihnen viele Geschäfte, genau so, wie es später Batista mit Señor Alcides machen sollte, nur dass Señor Alcides vor Batistas Staatsstreich durch verschiedene Geschäfte im Krieg ein Vermögen gemacht hatte, und deshalb konnte es ihm fast egal sein, dass er von dem Kuchen, den dieser Bastard verteilte, nichts abkriegte. Ach, ich schweife immer ab. Jedenfalls war Mama für Señor Alcides eine große Hilfe, sie erledigte den ganzen Papierkram, die Rechnungen, Steuererklärungen, sie war ihm Sekretärin und Vertraute, und als seine Frau starb, Señora Alba Margarita, kümmerte sich Mama auch um die Kinder. Deswegen schlug Señor Alcides meiner Mutter vor, mit ihm fortzugehen, aber sie bat ihn um etwas Bedenkzeit. Sie war sich nicht sicher, ob wir gehen oder bleiben sollten, denn Dionisio, der schon als junger Mann in den Untergrund gegangen war, um Batista zu stürzen, hatte sich mit Haut und Haaren der Revolution verschrieben. Er war in den Osten Kubas gegangen, um an der Alphabetisierungskampagne in den Bergen teilzunehmen, und Mama wollte ihn nicht alleine zurücklassen. Wie alt warst du damals, Dionisio? Vierundzwanzig? Aber genauso wenig wollte sich Mama von Jorgito und Anita trennen, Señor Alcides’ Kindern, sie hatte sie praktisch großgezogen, und außerdem wusste sie, dass sie Señor Alcides bei seinen neuen Geschäften da im Norden sehr fehlen würde. Mama befand sich in einem furchtbaren Gewissenskonflikt. Señor Alcides sagte, sie solle es sich in aller Ruhe überlegen, und wenn sie sich entschieden habe, stehe uns sein Haus, welches auch immer, wo auch immer, stets offen, und wir könnten zu ihm kommen, wann wir wollten. Und wenn wir in Kuba bleiben wollten, könnten wir hier in dem Haus wohnen, er bitte uns nur um einen Gefallen: uns um das Haus zu kümmern, vor allem um die Bibliothek und die beiden Vasen aus Sèvresporzellan, die seine Großmutter, Doña Marina Azcárate, in Paris gekauft hatte, denn die könne er nicht mitnehmen. Er gehörte nämlich zu denen, die glaubten, die Revolution werde scheitern, und wenn das geschehe, werde er zurückkommen zu seinem Haus und seinen Geschäften hier in Kuba. Für den Fall jedoch, dass die Revolution siegen und wir hierbleiben würden, bitte er uns ebenfalls darum, uns um das Haus zu kümmern, bis er, und wenn nicht er, dann sein Sohn Jorgito oder seine Tochter Anita eines Tages kommen und die Bücher und die Vasen holen könnte, um sie dorthin zu bringen, wo die Familie lebe. Natürlich versprach ihm Mama, dass er sich darauf verlassen könne, alles an seinem Platz zu finden, wenn er wiederkäme. Sie schwor es ihm, und das Versprechen war ihr heilig.
Ich habe nie erfahren, was Mama in jenem Moment wirklich dachte, ob sie bereits beschlossen hatte zu bleiben oder ob sie lediglich abwarten wollte, bis sich Señor Alcides im Norden niedergelassen hatte und wie es mit Dionisio hier weiterging. Zwei- oder dreimal habe ich sie danach gefragt, aber sie sagte mir immer dasselbe: Sie sei sich vollkommen unsicher, was sie tun solle, brauche noch Zeit, es sei eine schwere Entscheidung. Aber eine Frau wie sie musste doch bestimmt wissen, was sie wollte, so unsicher sie auch war … Richtig kompliziert wurde es sieben Monate später, im März 1961, als Señor Alcides völlig betrunken mit seinem Wagen verunglückte und starb. Wir erhielten die Nachricht etwa eine Woche später. Nachdem Mama, die auch so schon deprimiert genug war, den Telefonhörer aufgelegt hatte, schloss sie sich eine Woche in ihrem Zimmer ein und wollte niemanden sehen. Und als ich endlich zu ihr durfte, fand ich eine völlig veränderte Frau vor. Das war nicht mehr meine Mama, und wir wussten sofort, dass der Schmerz und das Schuldgefühl, das sie quälte, weil sie nicht mit Señor Alcides fortgegangen war, ihre Sinne verwirrt hatten.
Ich glaube, in dem Moment begann ich zu verstehen, was die Familie Montes de Oca für sie bedeutet hatte, die Tatsache, für Don Alcides gearbeitet zu haben, das Gefühl, für den einflussreichen Mann, der nun nicht mehr lebte, wichtig gewesen zu sein. Nach so vielen Jahren konnte sie sich nicht vorstellen, dass Don Alcides nicht mehr da war, um ihr Anweisungen zu geben und sie um Rat zu fragen. Arme Mama, sie hatte ihr ganzes Leben auf diesen Mann ausgerichtet, und jetzt hatte sie die Orientierung verloren. Sie schloss sich also in ihrem Zimmer ein, war wie versteinert. Falls sie daran gedacht hatte, irgendwann einmal zu Señor Alcides nach Miami zu gehen, um sich um seine Kinder und seine Geschäfte zu kümmern, dann war das jetzt gegenstandslos geworden. Jorgito und Anita lebten nun bei ihrer Tante Eva, die Kuba ebenfalls verlassen hatte, und sein Versprechen, uns in sein Haus aufzunehmen, hatte Señor Alcides mit ins Grab genommen … Während sie die Tage in ihrem Zimmer verbrachte und sich, von Schmerz gebeugt, treiben ließ, versuchten Dionisio und ich, unser Leben zu leben. Bedenken Sie, ich war damals einundzwanzig Jahre alt und hatte Arbeit in einer Bank gefunden, wurde zuerst Parteimitglied und dann Milizionärin; Dionisio ging zur Armee, nachdem er von der Alphabetisierungskampagne zurückgekehrt war, und wurde kurz darauf Sargento. Wir fingen an, unser Leben zu leben, auf unsere Art, ich weiß nicht, anders, für uns selbst, ohne an die Montes de Ocas zu denken, ohne von ihnen abhängig zu sein, wie es meine Familie fast hundert Jahre gewesen war … und Mama, seit sie denken konnte … Aber, auch wenn Dionisio vielleicht das Gegenteil behauptet, es war nur eine Illusion, denn das Gespenst der Montes de Ocas geisterte noch immer im Haus umher. Die krankhafte Zurückgezogenheit von Mama, die schließlich ihren Verstand verlor, das Geschirr, die Bibliothek, die Vasen aus Sèvresporzellan, die Möbel, viel Schmuck und zwei oder drei Gemälde, die Señor Alcides nicht hatte mitnehmen wollen – alles blieb so, wie es war, wie in einem Museum, als wartete es auf Señor Alcides, der nicht mehr zurückkommen würde, und auf seine beiden Kinder, die niemals hierherkamen und sich nicht dafür interessierten. Mehrere Jahre lang stand ich mit Señorita Eva in Briefkontakt. Sie war nach New Jersey gezogen, erinnere ich mich, in ein Dorf oder eine Stadt, die Rutherford hieß. Wir schrieben uns weiter, wenn auch nur ein-, zweimal im Jahr. 1968 aber zog Señorita Eva wieder um, ein paar meiner Briefe kamen mit dem Vermerk »Adressat unbekannt« zurück, und jahrelang hörten wir nichts mehr von ihr. Ich befürchtete schon das Schlimmste, schrieb an Leute, die auch dort lebten, vielleicht wussten sie, wo die Montes de Ocas geblieben waren, aber es vergingen ungefähr zehn Jahre, bis wir Nachricht von ihnen bekamen. Eine Freundin der Familie kam nach Kuba, und wir erfuhren, dass sie nach San Francisco gegangen waren, wo Señorita Eva schließlich an Krebs gestorben war. Aber da waren ja noch die Kinder, und aus Respekt vor Mamas Versprechen wartete ich weiterhin darauf, dass sie sich eines Tages an das Porzellan und die Bücher erinnern würden, und beschloss, alles wie bisher aufzubewahren. Die ältesten Bücher hatten fast alle Don Serafín gehört, dem Vater von Señor Tomás, der ebenfalls viele Bücher gekauft hatte, denn er war ein sehr gebildeter Mann gewesen, Anwalt und Rechtsprofessor an der Universität. Er hatte wie sein Vater die Manie gehabt, jedes Buch zu kaufen, das ihn interessierte, egal, wie teuer es war, und seinen Enkeln und seinen Freunden hatte er zum Geburtstag ausschließlich Bücher geschenkt. Die Vasen hatte die Familie bereits im 19. Jahrhundert erworben, als die Azcárates und die Montes de Ocas nach Frankreich ins Exil gegangen waren, um dort den zweiten Krieg gegen Spanien abzuwarten. Die Bücher und die Vasen waren, wie dieses Haus, Teil der Vergangenheit der Familie, und da Mama sich wie eine Montes de Oca fühlte – man hatte sie ja auch wie eine solche behandelt –, besaß all das für sie einen symbolischen Wert, und wir mussten ihr Versprechen respektieren, auch wenn von den Montes de Ocas praktisch nichts mehr geblieben war. Niemand erinnerte sich an sie, und die Bibliothek und die Vasen und die anderen Dinge waren ihre einzige Verbindung zur Vergangenheit und zu diesem Land. Die Jahre vergingen, und alles blieb so, wie es war. Ich verdiente gut, außerdem gab Dionisio mir immer etwas Geld für Mama, und so kamen wir sehr gut zurecht und dachten nie daran, irgendetwas zu verkaufen, denn wir hatten ja genug zum Leben. Aber in den Jahren 1990 und 1991 entwickelten sich die Dinge zum Schlechten. Dazu bekam Dionisio einen Herzinfarkt, er wurde aus dem Militärdienst entlassen, dann trennte er sich von seiner Frau. Ein Jahr nach seiner Entlassung fing Dionisio an, in einer Kooperative zu arbeiten, die die Armee belieferte. Er bekam zwar das gleiche Gehalt wie vorher, aber ehrlich gesagt, das, was wir zusammen verdienten, reichte plötzlich hinten und vorne nicht mehr. Es gab kaum Essen zu kaufen, und das, was es gab, na ja, Sie wissen ja, um es kaufen zu können, hätte man so reich sein müssen wie die Montes de Ocas. Zu allem Unglück hörte Dionisio bei der Kooperative auf, und damit fiel auch das Mittag- und Abendessen dort für ihn weg. Nein, ich schäme mich nicht, es zu sagen, denn Sie haben ja bestimmt dasselbe erlebt: Die Dinge standen so schlimm, dass mein Bruder und ich so manche Nacht nur mit Zuckerwasser im Magen zu Bett gingen oder mit einem Gebräu aus Orangenblättern oder Minze, denn das wenige Essen, das wir hatten, gaben wir Mama, und selbst für sie reichte es manchmal nicht. Da fing ich an, darüber nachzudenken, die Schmuckgegenstände, die Bilder, das Porzellan und die Bücher zu Geld zu machen, das Einzige von Wert, was wir besaßen. Es ging um Leben und Tod, ich schwöre es Ihnen. Monatelang zögerten wir noch, bis ich schließlich zu der Einsicht gelangte, dass wir verhungern würden, wenn wir so weitermachten wie bisher, dass wir buchstäblich verhungern würden, weil wir nichts zu essen hatten. Man musste sich nur Dionisio ansehen, wie dünn er war; er, der früher Mayor gewesen war und im Krieg in Angola das Kommando über viele Männer gehabt hatte, er war jetzt gezwungen, im Garten Bananen und Yucca anzupflanzen und eine Arbeit als Nachtwächter anzunehmen, um ein paar Pesos dazuzuverdienen. Eines Tages hörten wir auf, darüber nachzudenken, und fassten den Entschluss, zuerst das Geschirr zu verkaufen, dann die Schmuckgegenstände und die Gemälde. Nichts Besonderes, aber wir mussten sie fast verschenken, denn wir fanden niemanden, der das zahlen konnte, was sie vermutlich wert waren. Danach verkauften wir ein paar Möbel und Lampen, was uns ein hübsches Sümmchen einbrachte, das können Sie mir glauben. Aber es zerrann uns zwischen den Fingern, und vor vier Jahren entschlossen wir uns dann endlich, auch die Vasen aus Sèvresporzellan zu verkaufen, an einen Franzosen, der hier in Kuba lebt und Geschäfte mit der Regierung macht, ein seriöser Mann, das versichere ich Ihnen. Mit dem Geld, das wir für die Vasen bekommen haben – die waren so groß, stellen Sie sich mal vor, handbemalt –, mit dem Geld sind wir bis jetzt einigermaßen zurechtgekommen. Ehrlich gesagt, die Vasen haben uns das Leben gerettet. Aber mit den Jahren, bei diesen Preisen … Seit einiger Zeit nun denken Dionisio und ich darüber nach, dass jetzt die Stunde gekommen ist, die Bücher zu verkaufen. Na ja, Dionisio hat erst jetzt angefangen, darüber nachzudenken, ich wollte das nämlich schon seit Langem. Jedes Mal, wenn ich die Bibliothek betrat, um sauber zu machen, dachte ich dasselbe. Wo doch niemand mehr in den Büchern liest und sich keiner für sie interessiert, nicht wahr? Außerdem habe ich immer so etwas wie, ich weiß nicht, Widerwillen gegen sie empfunden, nicht gegen die Bücher an sich, sondern gegen das, was sie bedeuten, was sie bedeutet haben. Sie halten den Geist der Montes de Ocas wach, die Erinnerung an das, was sie waren, sie und andere wie sie, die sich für die Herren des Landes hielten. Allein das Betreten der Bibliothek erfüllt mich mit Unbehagen, der Ort lehnt mich ab, und ich lehne ihn ab.
Also, das ist die Geschichte. Ich weiß, dass es heutzutage Leute gibt, denen es nicht mehr so schlecht geht wie vor fünf oder zehn Jahren, und dass manche sogar sehr gut leben, aber wir, das können Sie sich ja ausrechnen, mit zwei Renten und ohne irgendjemanden, der uns Dollars schickt, nun ja, uns geht es so schlecht wie eh und je, oder noch schlechter, ich weiß nicht. Immerhin hat das Leben selbst es am Ende so eingerichtet, dass es nicht ganz so schwer für uns ist, mit all den Dingen, die wir verkaufen konnten. Aber jetzt haben wir keine Alternative mehr, und mein Bruder weiß das: Entweder wir verkaufen die Bücher, oder wir verhungern ganz langsam, wir alle, auch unsere arme Mama, die sich glücklicherweise von der Realität vollkommen verabschiedet hat. Denn vielleicht würde sie es uns ja noch verzeihen, dass wir alles andere verkauft haben, sogar die Vasen; aber wenn sie mitkriegen würde, was wir mit der Privatbibliothek vorhaben, ich glaube, sie wäre imstande, uns beide umzubringen und sich selbst zu Tode zu hungern.
El Conde hatte Amalias Worte verschlungen. Er saß auf der Kante des abgewetzten Sofas und rauchte, wobei er seine Hand als Aschenbecher benutzte, bis Dionisio hinausging und mit einem Dessertteller zurückkam, dessen Goldrand stumpf geworden war, und ihn dem Raucher mit entschuldigender Geste reichte. Doch diese Geste blieb von Mario unbemerkt, gerührt wie er war von der Chronik einer beinahe irrationalen Treue. Allerdings schaffte es die Rührung nicht, seinen kritischen Verstand zu vernebeln. Die automatische Alarmvorrichtung, die er sich während seiner Zeit als Polizist zugelegt hatte, sagte ihm, dass dies nur ein Teil der Geschichte war, wenn auch vielleicht der liebenswerteste oder dramatischste; aber für den Augenblick musste er sich mit dem Gehörten begnügen.
»Also dann, wenn Sie sich entschieden haben … Ich komme morgen wieder …«
»Und heute wollen Sie kein Buch mitnehmen?«, fragte Amalia in fast bittendem Ton.
»Offen gesagt, ich habe nicht genug Geld bei mir …«
Amalia sah zu ihrem Bruder hinüber und wagte sich vor: »Hören Sie, man sieht, dass Sie seriös sind, ein anständiger Mensch …«
»Das habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört«, unterbrach El Conde sie. »Ein anständiger Mensch …«
»Ja, das sieht man«, bekräftigte die zerbrechliche Frau. »Können Sie sich vorstellen, mit wie vielen Banditen wir gesprochen haben, um die Vasen und das andere zu verkaufen? Wie oft hat man uns mit ein paar Pesos abspeisen wollen, für Dinge, die ihren Wert haben! Hören Sie, machen Sie uns ein Angebot und nehmen Sie jetzt gleich ein paar Bücher mit … und zahlen Sie uns, was Sie können. Einverstanden? Morgen dann kommen Sie wieder, machen Ihre Inventur und nehmen mit, was Sie außerdem noch kaufen wollen.«
Während Amalia sprach, hatte El Conde beobachtet, wie Dionisio eine fast abwehrende Handbewegung machte, als wollte er sich vor dem schützen, was er hörte. Unauffällig war sein Blick zur Bibliothek gewandert, deren Spiegeltüren offen standen, wie um den Besucher einzuladen, hinüberzugehen und sich an dem prachtvoll gedeckten Tisch gütlich zu tun.
»Ich habe nur fünfhundert Pesos bei mir … Vierhundertneunzig, genauer gesagt. Wenn ich nämlich jetzt gleich einige Bücher mitnehme, muss ich mir ein Auto mieten, und das kostet zehn Pesos.«
»Ja, in Ordnung, dann vierhundertneunzig …«, sagte Amalia. Sie konnte ihre Gier weder zügeln noch verbergen.
El Conde beeilte sich, in die Bibliothek zu gehen, um nicht Amalia und noch weniger Dionisio wieder in die Augen sehen zu müssen. Diese Verzweiflung war imstande, die Reste eines alten Versprechens und jegliches Empfinden für Stolz auszulöschen. Sie war wohl die letzte Stufe einer von den Schicksalsschlägen des Lebens zugrunde gerichteten Würde. Wie schon so oft beklagte Mario die schäbige Seite seines Berufes, doch dann lenkte ihn die Suche nach leicht verkäuflicher Ware von seinen Gewissensbissen ab. Zwei Bände mit dem Verzeichnis der vor 1940 vorgenommenen Volkszählungen, die ein Italiener suchte, ein Kunde seines Freundes Yoyi El Palomo, wurden als Erstes zur Seite gelegt; dann folgten drei Erstausgaben der Werke von Fernando Ortiz, die man bei denen, die auf der Suche nach den Geheimnissen der afrikanischen Welt Kubas waren, immer leicht loswerden konnte, sowie eine Erstausgabe des Romans Der Sklavenhändler von Lino Novás Calvo; und nachdem er ein paar Bücher aus dem 19. Jahrhundert aussortiert hatte, deren Wert er noch genauer feststellen musste, steckte er auch noch mehrere historische Monografien in seine Tasche, die in den Zwanziger- und Dreißigerjahren in Havanna, Madrid und Barcelona veröffentlicht worden waren – nicht besonders wertvoll, aber sehr begehrt bei den ausländischen Käufern, die sich an den Bücherständen Havannas herumtrieben. Als er schon seine Tasche zumachen und Bilanz ziehen wollte, sah er vor sich auf dem Regalbrett ein Buch, das ihn beinahe anflehte, mitgenommen zu werden. Es war ein solides, unversehrtes, prachtvolles, wohlbeleibtes Exemplar von Schmeckt es? mit dem Untertitel Kulinarisches Handbuch … notwendig und hilfreich, aus der Druckerei von Úcar und García, 1956, illustriert von dem großen Karikaturisten Conrado Massaguer. Seit El Conde dieses Buch zum ersten Mal gesehen hatte – in den Händen eines Mannes, der zur Zeit des größten Mangels mit einem privaten Restaurant reich geworden war und wahllos Kochbücher kaufte –, jagte er ihm hinterher, fasziniert von der herrlichen Rezeptsammlung kreolischer und internationaler Speisen, die dazu bestimmt gewesen war, die aristokratischsten Küchen einer Epoche zu bereichern, in der es auf Kuba noch aristokratische Küchen gab. Marios Verfolgungsjagd hatte jedoch keine bibliophilen und noch weniger kaufmännische Motive, sondern das äußerst generöse, aber nicht gänzlich selbstlose Ziel, jenes Wunderwerk der alten Josefina zu schenken, der einzigen ihm bekannten Person mit der magischen Fähigkeit, die dort beschriebenen traumhaften Speisen auch in Krisenzeiten in eine essbare und verdauliche Realität zu verwandeln.
Mit seiner Tasche über der Schulter und einem leeren Magen, der vor Vorfreude Luftsprünge machte, ging Mario Conde zurück in den Salon, wo ihm die Geschwister Ferrero ernst und erwartungsvoll entgegensahen. Sein Blick fiel in dem Moment auf Amalias Hände, als sie sie am Morgenmantel abwischte; ihre geröteten Finger waren an den Rändern verschrumpelt, wahrscheinlich durch die unschöne Angewohnheit, an den Fingernägeln und der Nagelhaut herumzuknabbern.
»Also, diese sechzehn Bücher möchte ich jetzt gleich mitnehmen. Eins davon ist außergewöhnlich, ein kubanisches Kochbuch, allerdings ohne besonderen Verkaufswert. Aber ich will es für mich. Sind Sie mit fünfhundert Pesos für den Stapel einverstanden?«
Dionisios Augen suchten die seiner Schwester, und die beiden sahen sich eine Weile an. Dann wandten sie sich langsam wieder El Conde zu, der, um einem möglichen Vorwurf zuvorzukommen, verlegen fragte: »Erscheint Ihnen das zu wenig?«
»Nein, nein«, antwortete Dionisio schnell, »wirklich nicht. Ich glaube, das geht in Ordnung so.«
El Conde lächelte erleichtert.
»Es ist nicht sehr viel, aber fair. In dem Preis ist mein Gewinn und der desjenigen enthalten, der die Bücher weiterverkauft, nach Abzug für Standgebühren und Steuern … Sie bekommen rund dreißig Prozent des möglichen Endpreises. Bei den leicht verkäuflichen Büchern kalkulieren wir immer so, ein Gewinn von drei zu eins.«
»So wenig?«, konnte Amalia sich doch nicht enthalten zu fragen.
»Das ist nicht wenig, Sie können davon überzeugt sein, dass ich Sie nicht betrüge. Ich bin ein ehrlicher Mensch, und wenn wir weiter im Geschäft bleiben, werde ich Ihnen noch viele Bücher zu einem guten Preis abkaufen«, sagte El Conde lächelnd, in dem Glauben, der Konflikt sei beigelegt, und bevor die Geschwister eine andere Rechnung aufmachen konnten, gab er ihnen die genannte Summe.
Draußen auf der Straße empfing ihn der feuchte Dunst des Abends, der noch einmal von der Sonne durchbrochen wurde, nachdem ein kurzer, heftiger Platzregen niedergegangen war. Das angekündigte Gewitter hatte sich entladen, was jedoch nur dazu geführt hatte, dass die Luft noch feuchter geworden war. Sogleich fiel El Conde der Temperaturunterschied auf: Das Haus der Ferreros, einstmals das der steinreichen Familie Montes de Oca, besaß die Fähigkeit, sich über Havannas Sommer hinwegzusetzen. Einen Moment lang war Mario versucht, sich umzuwenden und einen Blick auf die kühle Villa zu werfen. Doch sein sechster Sinn warnte ihn davor, noch einmal zurückzuschauen, denn wenn er es getan hätte, hätte er höchstwahrscheinlich versteinert beobachten müssen, wie einer der beiden Bewohner zum nächstgelegenen Markt eilte, um noch vor fünf Uhr zu den Ständen zu kommen, wo es das Fleisch, das Gemüse, die Kartoffeln und die Yuccaknollen gab, die sie heute Abend von dem ewigen Reis mit schwarzen Bohnen erlösen sollten, der erzwungenen Diät, die sie tagein, tagaus mit mehreren Millionen ihrer Landsleute teilten.
Während El Conde sich auf die Suche nach einem Mietwagen machte, stellte er fest, dass einige der Symptome zwar nachgelassen hatten, seine Vorahnung aber nach wie vor in ihm bohrte, sich unterhalb seiner linken Brustwarze festsaugte wie ein gefräßiger Blutegel.
Yoyi, genannt El Palomo – der Täuberich –, unter dem wohlklingenden Namen Jorge Reutilio Casamayor Riquelmes ins Zivilregister eingetragen und katholisch getauft, war achtundzwanzig Jahre alt, hatte einen stark gewölbten Brustkorb, dem er seinen Spitznamen verdankte, und einen unbezähmbaren Hang zu verbalen Ausfällen. Darüber hinaus war er Schnelldenker und konnte in Windeseile die kompliziertesten Rechenaufgaben lösen, was ihm durch das Ingenieursdiplom akademisch bestätigt worden war, das hinter Glas, eingefasst von einem geschmackvoll schlichten Bronzerahmen, im Wohnzimmer seines Hauses in Víbora Park hing. Es warte geduldig darauf, sagte der so ausgezeichnete Ingenieur, dass das Toilettenpapier noch knapper werde und man auf das knackige Universitätspergament zurückgreifen müsse, das ihm kaum gesellschaftliche Anerkennung und keinerlei finanziellen Nutzen eingebracht habe. Obwohl er zwanzig Jahre jünger war als El Conde, musste dieser neidvoll anerkennen, dass Yoyi einen unschlagbaren Zynismus und eine große pragmatische Lebensweisheit besaß – Eigenschaften, über die er, Mario Conde, nie verfügt hatte und, wie es aussah, auch niemals verfügen würde, auch wenn sie für den Überlebenskampf im kreolischen Dschungel des dritten Jahrtausends immer unverzichtbarer wurden.
Seit Mario vor drei, vier Jahren zu einem der zahlreichen Zulieferer von El Palomo geworden war, hatten sich seine Gewinne im Buchgeschäft zufriedenstellend vervielfacht. Neben anderen wirtschaftlichen Aktivitäten – dem Handel mit Schmuck, Antiquitäten und Kunstwerken sowie dem Besitz zweier Autos, die als Taxis herumfuhren, und fünfundzwanzig Prozent der Aktien einer kleinen, total illegalen Baufirma – besaß Yoyi, sozusagen zur Beruhigung der Behörden, die Lizenz für einen Bücherstand auf der Plaza de Armas, der in Wirklichkeit von einem Onkel mütterlicherseits betrieben wurde. Er selbst ließ sich ein paarmal in der Woche dort blicken, um neue alte Bücher vorbeizubringen und sich von der Gesundheit des Geschäfts, das ihm als Fassade diente, zu überzeugen. El Conde war der Meinung, dass Yoyis angeborenes Verkaufstalent, seine Fähigkeit, die Kundschaft zum Kauf zu überreden – man muss aus Prinzip immer versuchen, sie zu bescheißen, pflegte er zu sagen –, nur das Resultat des genetischen Erbes sein konnte, das er, genauso wie den Namen Reutilio, seinem spanischen Großvater verdankte, der einen Lebensmittelladen betrieben hatte. Denn Yoyi war in einem Land des Mangels und der Not aufgewachsen, aus dem mehrere Jahrzehnte zuvor die hohe Kunst des Kaufens und Verkaufens verbannt worden war. Die Leute verkauften aus Not und kauften aus demselben Grund; die einen verkauften, was sie hatten, und die anderen kauften, was ihre leeren Taschen hergaben, ohne großes Feilschen und vor allem ohne die Qual der Wahl: Nimm es oder lass es, dies oder nichts, mach schnell, sonst ist es weg, kauf, was gerade da ist, auch wenn du es im Moment nicht brauchst. Bei Yoyi war das anders. Er war ein wahrer Meister in der Kunst, Luxusgüter zu Fantasiepreisen loszuschlagen, und El Conde zweifelte nicht daran, dass, falls es Yoyi irgendwann gelingen sollte, seinen Traum zu verwirklichen und die Insel zu verlassen – »irgendwohin, und wenns Madagaskar ist« –, er es auch dort zu einem erfolgreichen Geschäftsmann bringen werde.
Als sie sich kennenlernten, hatte sich El Conde anfangs von dem jungen Mann abgestoßen gefühlt, diesem Angeber, der sich an Händen, Armen und Hals mit Schmuck behängte und ungeniert seinen Körper zur Schau stellte. Dennoch hatte die ursprünglich rein geschäftliche Beziehung der beiden Männer die hohen Hürden der Vorurteile des Älteren überwinden können und sich nach und nach in Freundschaft verwandelt, möglicherweise aufgrund der Charakterfehler der beiden Männer, die sich gegenseitig aufs Schönste ergänzten. Der erbarmungslose Geschäftssinn des Jüngeren und die überholte Romantik des Älteren, die gefährliche Schnelligkeit des einen und die Skepsis und die Skrupel des anderen, El Palomos manchmal unüberlegte Heftigkeit und El Condes Zurückhaltung, die ihn seine bösen Erfahrungen während der Jahre als Polizist gelehrt hatten, all das stellte ein ganz eigenes Gleichgewicht zwischen ihnen her.
Ihre Freundschaft hatte sich an einem Tag vor drei Jahren endgültig gefestigt, als Mario unter dem Vorwand bei El Palomo aufgetaucht war, eine Bücherlieferung für den nächsten Tag anzukündigen; in Wirklichkeit war er darauf aus gewesen, eine Tasse des exzellenten Kaffees zu bekommen, den die Mutter des Jungen zuzubereiten verstand. An dem Tag hatte El Conde seinen Geschäftspartner mit den Falkenaugen davor bewahrt, um sein Geld – wenn nicht um etwas noch viel Wertvolleres – gebracht zu werden.