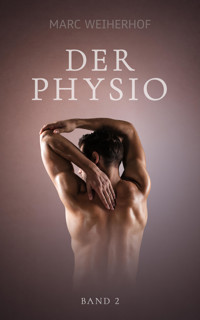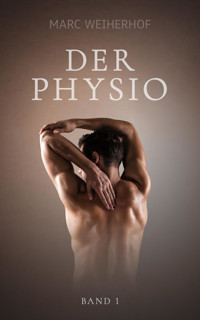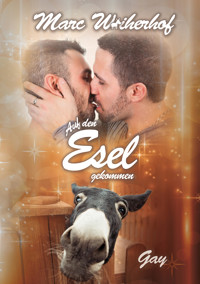9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Himmelstürmer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das instabile Kartenhaus aus Geld, Macht und Ansehen bricht über dem Kopf von Xaver McJohnson zusammen, als sein Vater auf grausamste Art und Weise getötet wird. Die Beweise, die dieser über eine geheime Organisation (PAWS) gesammelt hat, sind - im wahrsten Sinne des Wortes - tödlich. Die Entscheidungsträger von PAWS wollen nicht, dass die Informationen an die Öffentlichkeit gelangen und starten eine schonungslose Verfolgungsjagd, die Xaver an den Rand seiner Kräfte und seiner Gesundheit treibt. Der junge, ahnungslose Mann fühlt sich anfangs einsam und verloren. Doch ein Bodyguard und ein FBI-Spezialagent helfen ihm auf seinem beschwerlichen Weg und wollen die Verbrecher überführen. Xaver entwickelt Gefühle für beide Männer, weiß aber nicht, dass einer von ihnen ein falsches Spiel treibt. Bald muss er sich zwischen einem der beiden entscheiden. Wird Xaver McJohnson rechtzeitig erkennen, wer sein wahrer Verbündeter ist? Kann er sich gegen den mächtigen Geheimpakt durchsetzen?
Das E-Book können Sie in einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützt:
Veröffentlichungsjahr: 2015