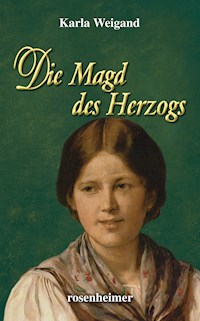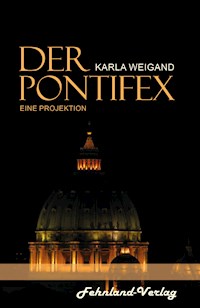
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fehnland-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahre des Herren 2039. Zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche wird ein Afrikaner zum Papst gewählt. Ein äußerlich sehr anziehender und charmanter Mann, der sich auf seinen zahlreichen Auslandsreisen gerade in die ärmsten Gegenden der Welt begibt und sich dort als Freund der Mühseligen und Beladenen geriert. Andersgläubige und sogar Atheisten erliegen reihenweise seinem Charme. Doch in Wahrheit ist er von Hass getrieben und folgt einem persönlichen Racheplan. Als Europa kurz darauf durch eine Reihe terroristischer Anschläge auf christliche und islamische Gotteshäuser erschüttert wird, gibt es neben ihm nur eine einzige Person, die weiß, wer dahintersteckt, die all diese Pläne kennt und vereiteln könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karla Weigand
Der Pontifex
Eine Projektion
Weigand, Karla: Der Pontifex. Hamburg, Fehnland Verlag 2021
Originalausgabe
EPUB-ISBN: 978-3-96971-165-1
Der Titel ist auch als Print zu beziehen:
Print-ISBN: 978-3-96971-164-4
Korrektorat: Emilia Endler, Sophia Krämer, Denise Nadler
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Fehnland Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Fehnland Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg und Mitglied der Verlags-WG:
https://www.verlags-wg.de
© Fehnland Verlag, Hamburg 2021
Alle Rechte vorbehalten.
https://fehnland-verlag.de/
Für meinen lieben Mann Jörg, dem ich so vieles verdanke!
„Gott ist kein Christ.“
(Desmond Tutu; anglikanischer Theologe, 1986–96 Erzbischof
von Kapstadt und erstes schwarzafrikanisches Oberhaupt der
anglikanischen Kirche in Südafrika; Friedensnobelpreis 1984)
„Plus ça change, plus c’est la même chose.“
„Je mehr sich ändert, desto mehr bleibt es das Gleiche.“
(Französisches Sprichwort)
ZEITUNGSBERICHT
Am 25. September 2042 ist als Aufmacher auf der ersten Seite der
New York Times unter der reißerischen Schlagzeile: „Frau im Central Park grausam ermordet“, zu lesen:
„Dunkelhäutige, etwa 35 bis 40 Jahre alte, zirka 1,75 m große, schlanke Frau in den frühen Morgenstunden, in einem abgelegenen Teil des Central Parks ermordet aufgefunden. Der blauweißen Sportkleidung und den weißen Laufschuhen nach zu urteilen, handelt es sich um eine Joggerin, die laut Polizeiarzt bereits am vorhergehenden Abend zwischen 18 und 19 Uhr zwei Schussverletzungen in Brust und Kopf erlegen ist.
Bisher ist nicht bekannt, ob sich die Frau, bei der weder Schmuck, Smartphone, Armbanduhr, Geldbörse, Schlüssel noch Ausweispapiere gefunden wurden und deren Identifizierung durch eine bewusste Zerstörung ihres Gesichts zusätzlich erschwert wird, allein oder in Begleitung in dem normalerweise kaum frequentierten Teil des Parks aufhielt.
Sachdienliche Hinweise in Bezug auf die getötete Person, ihren Wohnsitz, ihren Umgang et cetera, beziehungsweise über ungewöhnliche Vorkommnisse am gestrigen Abend, die mit der Mordtat im Central Park in Verbindung stehen könnten, bittet die Kriminalpolizei an die zuständige Dienststelle des NYPD zu richten; auf Wunsch auch vertraulich.“
Darunter sind die Kontaktdaten der betreffenden Dienststelle und verschiedener Polizeireviere vermerkt.
PROLOG
„Selig die Friedfertigen, denn sie werden Gott schauen!“
(Matthäus, 5–7: aus den sogenannten „Seligpreisungen“ der „Bergpredigt“, einer – nach einer älteren Quelle – aus Sprüchen Jesu zusammengestellten Rede auf einem Hügel im Heiligen Land.)
„Gerade ist meine Maschine in Rom gelandet, Chérie! Drück’ mir die Daumen, dass alles so läuft, wie ich es mir wünsche. Eigentlich bin ich ja sehr zuversichtlich, dir schon bald das Startzeichen zum Umzug nach Rom geben zu können, mein Schatz!“
Nichts in seinem Äußeren deutet darauf hin, dass es sich bei dem zweiundfünfzigjährigen, hochgewachsenen und körperlich durchtrainierten Herrn in grauem Maßanzug mit hellblauem Seidenhemd nicht um einen angesehenen Geschäftsmann oder hohen Politiker vom Schwarzen Kontinent handelt, der an diesem 30. März 2039 italienischen Boden betreten hat.
Wie ein Kirchenmann sieht er jedenfalls nicht unbedingt aus – was ihm ganz recht ist. Weder ein Kreuz, noch ein weißer Priesterkragen verraten den Stand eines Klerikers.
Kardinal Maurice Obembe plaudert an diesem wunderschönen Frühlingstag wohlgelaunt per Smartphone mit Schwester Monique, einer rund zehn Jahre jüngeren schwarzen Nonne vom Orden der Kleinen Schwestern Jesu, die ihm seit etwa fünfundzwanzig Jahren nicht nur den Haushalt führt, sondern in erster Linie sein Bett wärmt. Genaugenommen, seit er einst in einer Gemeinde im ostafrikanischen Staat Ghanumbia seine kirchliche Laufbahn als selbständiger Pfarrer einer katholischen Gemeinde gestartet hat.
Auf einmal fühlt der hohe Kirchenmann sich beobachtet. Er muss sich gar nicht erst umdrehen, so etwas hat er im Gefühl …
Um etwaige unerwünschte Lauscher in die Irre zu führen, fügt er schnell ein herzliches „Danke für deine guten Wünsche, Papa!“ und „Gelobt sei der Herr!“ hinzu und beendet umgehend das Gespräch, um sich seinem Diener und „Mädchen für alles“, Patrick „Paddy“ Lumboa, zuzuwenden. Ihn hat er als Begleiter und Helfer im Konklave mitgenommen: gilt es doch, einen neuen Papst zu wählen.
„Ich werde mich jetzt um das Gepäck kümmern, Eure Eminenz!“
Der schwarze Bedienstete des Kardinals grinst bis über beide Ohren, ahnt er doch, mit wem sein Herr gerade so vertrauliche Worte gewechselt hat. Er weiß schließlich alles über Maurice Obembe und Schwester Monique: Er ist bei ihm immerhin ebenso lange als Adlatus beschäftigt, wie die schöne schwarze Nonne als Haushälterin. Aber um Privates, gar Intimes über seinen Herrn auszuplaudern, müsste Paddy Lumboa schon gehäutet und gevierteilt werden.
Als ihn jetzt der eiskalte Blick des Kardinals trifft, friert sein frivoles Grinsen augenblicklich ein; devot senkt Lumboa seinen Krauskopf, um eilig seinen Pflichten nachzukommen, während der Geistliche, einer von über einhundertfünfzig wahlberechtigten Kardinälen, sich gemächlich zubewegt auf den Infoschalter des internationalen Flughafens Leonardo da Vinci in der Seebad- und Hafenstadt Fiumicino in Latium, Provinz Rom.
Er möchte sich nach der bestsortierten Buchhandlung im Flughafengebäude erkundigen, um den neuesten Vatikanführer und ein ganz spezielles Buch über die Malereien in der Sixtinischen Kapelle zu erwerben, während sein Diener sich um den vorbestellten Wagen samt Chauffeur sowie um das umfangreiche Gepäck seines Herrn kümmern wird.
Maurice Obembe ist sich jetzt, nach mehrmaligem Umschauen, sicher, dass ihm – zumindest im Augenblick – niemand folgt. Sein Vater hat ihm schon oft im Scherz vorgeworfen, er litte an Verfolgungswahn.
Die Dame, mit der der Kardinal soeben kurz gesprochen hat, ist in der Tat Schwester Monique gewesen, seine langjährige Geliebte, die eigentlich Monica Mbeke heißt und nur sehr entfernt mit ihm verwandt ist. Ihren Familiennamen hat sie längst in Obembe umgewandelt hat, um das Märchen ihres Bruder-Schwester-Verhältnisses glaubhaft zu machen.
Sie freut sich für Maurice, der vermutlich kurz vor dem Ziel seiner Träume steht. Zumindest ist er davon überzeugt. Im Augenblick hält sich die schöne Nonne noch im Kardinalspalais in Daressalam auf und sitzt sozusagen auf gepackten Koffern. Sie wartet nur noch auf das endgültige Startzeichen ihres geistlichen Liebhabers.
Wenn nur nicht diese grässliche Unrast in ihr wäre, mit der sie am heutigen Morgen aufgewacht ist! Sie weiß, dass diese Unruhe mit einem verrückten und beängstigenden Traum zu tun hat, an den sie sich leider nicht mehr im Einzelnen entsinnen kann; immerhin hat sie verstanden, dass er sie vor Gefahren, vor Unheil und einer großen Katastrophe warnen wollte.
Und zwar vor einem Desaster, das nicht sie selbst direkt betreffen, aber doch indirekt mit ihr verbunden sein wird; denn das Unglück würde eng mit dem Mann verknüpft sein, den sie über alles liebt und nach dessen Wünschen sie ihr ganzes bisheriges Leben ausgerichtet hat.
„Reiß dich zusammen!“, befiehlt sie sich streng. „Es handelt sich nur um einen ganz dummen Traum. Ich tue besser daran, noch einmal mein Gepäck und die Reisedokumente zu überprüfen. Ich sollte dankbar sein, dass Mère Sophie, meine Oberin, mir die Erlaubnis erteilt hat, praktisch mein restliches Leben im Vatikan zu verbringen, sollte Kardinal Obembe zum Papst gewählt werden.“
Allzu viel wird sie zwar nicht mitnehmen – in Rom gibt es bekanntlich alles Nötige zu kaufen. Aber es gibt Dinge, die eng mit ihrer afrikanischen Lebensart verbunden sind und die sie in der Fremde schmerzlich vermissen würde. Außerdem sind auch Sachen dabei, die ihr helfen sollen, das nagende Heimweh, vor dem ihr regelrecht graut, etwas leichter zu ertragen.
„Denn wir haben hier keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir.“
(Hebräer, 13, 14)
Keine Aktion im Vatikan ist aufregender als die Wahl eines neuen Pontifex. Trotz aller Verweltlichung und des um sich greifenden Unglaubens vermag sie die Menschen immer noch zu faszinieren und großes Interesse zu wecken – und beileibe nicht nur bei Katholiken.
Offenbaren sich hier doch nicht allein die frommen Wünsche und Hoffnungen für das Wohl der Kirche, sondern auch die ganz profanen Bestrebungen der Kurialen sowie ganz nebenbei die oft nicht minder bedenklichen Charakterzüge von so manch angeblich geeignetem Aspiranten.
Wie immer anlässlich eines solchen Ereignisses zeigt sich der Vatikan als Hort der Intrigen und des Ämterschachers, da die einzelnen Gruppierungen bereits kurz nach dem letzten Atemzug eines verblichenen Heiligen Vaters damit beginnen, allerlei Ränke zu schmieden, um ihren eigenen Kandidaten in Stellung zu bringen, damit dieser den Stuhl Petri besetzen kann.
In diesem Falle hat das unwürdige Gemauschel schon vor längerer Zeit begonnen, weil der Tod des letzten Papstes infolge seiner schweren Krankheit absehbar schien. Mit wahrem Feuereifer haben sich die Prälaten ins Getümmel gestürzt.
Insider wissen, dass man dabei durchaus nicht zimperlich verfährt, sondern, wie keineswegs unüblich, zu Überredung, Verleumdung und Bestechung greift; oder, wenn dies nicht fruchtet, dazu übergeht, kaltschnäuzig und erpresserisch einen Gefallen einzufordern, auf den man glaubt, aufgrund einstiger erwiesener Wohltaten ein Anrecht zu besitzen.
„Do ut des“ ist eine Masche, die sich allgemein, nicht erst seit Anbeginn der Kirche, großer Beliebtheit erfreut.
„Das Schachern und Feilschen wie auf einem arabischen Basar ist im Konklave seit jeher üblich“, geben die Beteiligten untereinander auch ungeniert zu. „Die Anhänger der einzelnen Kandidaten sondieren, debattieren, agitieren und intrigieren, was das Zeug hält, um den Gewünschten auf den Papstthron zu hieven; was, nebenbei bemerkt, immer ein Spiel mit offenem Ausgang ist. Jede Neuwahl eines Pontifex ist für eine Überraschung gut“, behauptet mit bemerkenswerter Ehrlichkeit ein sogenannter Insider, der seit dreißig Jahren im Vatikan residiert.
Und das Verhandeln zieht sich hin. Aber damit rechnet sowieso ein jeder, der sich ins Konklave in die Sixtina begibt, die Privatkapelle des jeweiligen Heiligen Vaters.
Kardinal Obembe ist nicht bange, als sich herausstellt, dass im Konklave augenblicklich eine Art Wettrennen anhebt zwischen den Anwärtern von Manila und Myanmar, letzteres ein überwiegend buddhistisches Land mit etwa fünf Prozent Christen, wobei der Anteil an Katholiken geringer ist als der an Protestanten.
Vor jedem Wahlgang bemühen sich die jeweiligen Anhänger der ostasiatischen Kardinäle, bei möglichst vielen Konzilsvätern auf Stimmenfang zu gehen. Aber das haben Obembe und seine wenigen Getreuen von vornherein einkalkuliert.
Den beiden Geistlichen hat man weltweit im Vorfeld die größten Chancen eingeräumt, neuer Papst zu werden.
Grund dafür ist der Zustand der Kirche, vor allem in Europa, der sich besorgniserregend bis katastrophal zeigt. Massenweise Kirchenaustritte, vor allem nachdem zahlreiche sexuelle Missbrauchsvorfälle an Kindern und Jugendlichen für Aufsehen sorgten, kaum Priesternachwuchs, so gut wie keine Täuflinge, Gleichgültigkeit gegenüber kirchlichen Geboten. Kurz gesagt: die Kirche spielt selbst im alltäglichen Leben von Katholiken kaum noch eine Rolle. Religiöses Brauchtum gilt bestenfalls noch als „folkloristische Zutat“.
„Der moderne Mensch hat offenbar keine Bindung mehr an Mutter Kirche; vor allem in der westlichen Welt ist dies ein trauriger Fakt“, hat auch der verstorbene Heilige Vater bei jeder Gelegenheit bedauert. Dass die Kirche selbst den größten Anteil an dieser Misere hat, hat er dabei wie viele andere Kirchenobere verschämt verschwiegen, als da waren: Kungeln mit den Mächtigen auf Kosten der Unterprivilegierten, schamlose Anhäufung geradezu wahnwitziger Vermögenswerte, Sex- und Missbrauchsskandale (kaum waren die „alten“ in den Zwanzigerjahren dieses Jahrhunderts einigermaßen aufgearbeitet, kamen in den Dreißigern schon wieder neue hinzu) – und das bei einer nach wie vor rigiden, inhumanen, von den Gläubigen als indiskutabel abgelehnten „Sexualmoral“.
So scheint im Konklave von Anfang an eine stillschweigende Übereinkunft zu herrschen, dass es dieses Mal ein Papst von einem „farbigen“ Kontinent sein müsse, um das leckgeschlagene Boot Sancta Ecclesia wieder einigermaßen flott zu bekommen und in ruhigeres Fahrwasser zu steuern.
Da ist zum einen der Anwärter aus Manila – Hauptstadt der Philippinen mit achtzig Prozent Katholiken und fünf Prozent Moslems – ein kleiner rundlicher Filipino, Typ „Teddybär“, mit einem Dauerlächeln im breitflächigen Gesicht, das über seine nur Eingeweihten bekannte Gefühlskälte bestens hinwegtäuscht. Ihn hat man insgeheim schon als künftigen Papst gesehen. Zumindest solange, bis sich die Fraktion des Kardinals aus Myanmar ganz stark in Stellung brachte …
Als einer der Anhänger Obembes, ein Kardinal aus Südafrika, der sich selbst keine Chancen ausrechnet, glaubt, ihm Mut zusprechen zu müssen, winkt dieser lächelnd ab: „Gewiss, Bruder, an Kandidaten, die man als papabile einschätzt, mangelt es nicht. Aber keine Sorge, mein Freund! Auch ich kenne das römische Sprichwort: ‚Wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus.’ Meine Stunde kommt noch.“
Der hochgewachsene attraktive Mann vom Schwarzen Kontinent, aus Ghanumbia, beweist damit beinahe römische Gelassenheit und Pragmatismus. Eine Haltung, die ihm schon als junger Priester, der eine Zeitlang in Italien, auch in Rom, seinen kirchlichen Dienst versehen hat, mächtig imponiert hat und die er sich sofort zu eigen gemacht hatte, etwa: „Morto un Papa, se ne fa un altro!“, übersetzt: „Wenn ein Papst stirbt, macht man eben einen anderen!“
Auch Obembes Unterstützer sind keineswegs untätig.
Je verbissener der Kampf zwischen den beiden „Gelben“ aufflammt, desto eifriger bemühen sich die „Schwarzen“ um Stimmen für ihren Kandidaten, der bis jetzt für die meisten asiatischen und europäischen Anwesenden noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist.
Eine Tatsache, die ihn nebenbei bemerkt deutlich von Patrice Obembe unterscheidet, seinem dreiundsiebzig Jahre alten Vater, seit etwa vier Jahrzehnten unangefochtener Präsident von Ghanumbia, einem nicht ganz unwichtigen Staat in Ostafrika, in dem über neunzig Prozent der Bevölkerung dem katholischen Glauben angehören. Dazu kommen etwa vier Prozent Protestanten und der Rest sind Animisten.
Den schlauen alten Fuchs kennt längst alle Welt. Hat er es doch in den letzten fünfundzwanzig Jahren verstanden, sein Land geradezu in einen afrikanischen Musterstaat zu verwandeln.
Was in den New York Times erst kürzlich auf der ersten Seite zu lesen war, hat den Kardinal mit großem Stolz auf seinen Erzeuger erfüllt: „Die Bewohner Ghanumbias sind mit ihrer Regierung sehr zufrieden; niemand strebt offenbar einen Wechsel an der Staatsspitze an, denn ‚Papa Patrice’ sorgt nicht nur für Frieden mit den Nachbarstaaten, sondern auch für Arbeitsplätze und einigermaßen Wohlstand für die Bevölkerung.
Die Löhne, die den Arbeitern gezahlt werden, erlauben ihnen zwar keine Anhäufung von Reichtümern, aber garantieren ihnen und ihren Familien ein menschenwürdiges Auskommen. Selbst die Meinungsäußerungen in den Medien können sich relativ frei entfalten.
Es gibt sogar freie Wahlen, die alle fünf Jahre stattfinden. Wozu der Präsident stets Beobachter von außerhalb nach Ghanumbia einlädt, die sich ungestört davon überzeugen sollen, dass in seinem Land alles mit rechten Dingen zugeht.“
Wie üblich hatten sich unisono andere wichtige westliche und sogar arabische Presseorgane dieser Meinung angeschlossen und Maurice Obembe glaubt mit einem gewissen Recht, sich im Glanz seines Vaters sonnen zu können und dass ihm das auch bei seiner Wahl zum Papst zugutekommen wird: „Zumindest wird mir Papas Ansehen nicht schaden!“
„Se non è vero, è ben trovato!“
(Italienisches Sprichwort, dem Sinne nach: „Wenn’s auch nicht der Wahrheit entspricht, ist’s immerhin gut erfunden!“)
Was der Kardinal mit Sicherheit weiß, ist, dass ihm auch sein Vater wünscht, dass er sein von Jugend an selbstgestecktes Ziel, den höchsten Posten im Vatikan, erreichen kann.
Als Kardinal Obembe noch ein ganz junger Priester gewesen war, hatte sein Vater ihm erklärt: „Weißt du, mein Sohn, gut zu regieren ist gar nicht so furchtbar schwer! Die meisten Regierungschefs afrikanischer Staaten scheitern an ihrer rücksichtslosen und maßlosen Gier. Wobei sie sich kein bisschen von unseren ehemaligen weißen Kolonialherren unterscheiden, die auch nur zu uns gekommen sind, um sich an uns zu bereichern und um uns auszuplündern.
Das schwarze Pack der herrschenden Oberschichten sollte sich schämen!“, hatte Patrice Obembe sich ereifert. „Es kriegt den Hals nicht voll, plündert die Ressourcen ihrer eigenen Territorien, lässt die eigene Bevölkerung ausbluten, bereichert sich selbst in geradezu obszönem Ausmaß – und wundert sich dann, wenn andauernd Unruhen ausbrechen und jahrelange Bürgerkriege ihr Land verheeren.
Und die Welt schaut zu und lässt diese Schweine gewähren! Anstatt die unfähigen Regierungschefs zum Teufel zu jagen, wenn es sein muss, auch mit Gewalt, nehmen die Europäer die in Scharen ihre Heimatländer verlassenden Afrikaner bei sich auf, anstatt ihnen ernstlich nahezulegen, sich endlich aufzuraffen und Revolutionen anzuzetteln.
Verstehe einer diese Weißen! Sie müssten es doch eigentlich besser wissen! Mussten sie sich doch ihre bürgerlichen Freiheiten ebenfalls gegen ihre Adelscliquen blutig erkämpfen. So wird sich nie etwas ändern. Ich vermute, viele Europäer möchten damit irgendwie ihr schlechtes Gewissen, das sie insgeheim gegenüber Afrikanern empfinden, übertünchen!“
Nach einer Weile hatte er vertraulich hinzugefügt: „Hör zu, Maurice! Ich bin wahrlich kein Heiliger! Deswegen aber auch kein Idiot und vor allem kein Verbrecher, der sein Volk ausplündert! Ich weiß einfach, wann es genug ist. Das Vermögen, das ich für unsere Sippe beiseiteschaffen werde, wird sich sehen lassen können. Es wird für jeden Einzelnen reichen und auch noch für etliche Generationen.“
„Weshalb dich sehr viele bewundern, Papa, ist die Tatsache, dass in unserem Land Frieden herrscht und es relativen Wohlstand für alle gibt, seitdem du vor etlichen Jahren das Ruder in Ghanumbia übernommen hast“, hatte ihm damals der junge Kaplan Maurice Obembe geantwortet. „Es werden mittlerweile sogar Stimmen laut, die dir den nächsten Friedensnobelpreis zuerkennen möchten!“
Darauf hatte Präsident Obembe herzlich gelacht und dabei sein bewundernswert makelloses Gebiss präsentiert, über das er auch heute noch, als alter Mann, verfügt: „Ich würde den Preis glatt annehmen! Aber“, fügte er verschmitzt hinzu, „man möge mit der Ehrung bitte noch ein wenig warten. Ich bin nämlich mit meinen Plänen noch lange nicht am Ende!“
Worum es sich dabei handeln würde, wollte „Landesvater Patrice“ damals noch nicht verraten – nicht einmal seinem geweihten Priestersohn. Der hatte auch nicht weiter insistiert und im Laufe der Zeit schien diese „Überraschung“ in Vergessenheit geraten.
„Gott wohnt auch im Tiger; aber das ist kein Grund, den Tiger zu umarmen.“
(Ramakrishna Paramahamsa, bedeutender hinduistischer Mystiker, 1836 – 1886)
Seit Jahren schon treibt Maurice Obembe selbst so Einiges um, das für gewaltigen Wirbel sorgen könnte. Jetzt steht er kurz davor! Ist er endlich Papst, kann er die Dinge angehen.
‚Ach, was heißt Wirbel?’, denkt er, vor Vorfreude ganz außer sich, denn er zweifelt keinen Augenblick an einem, für ihn, positiven Wahlausgang. ‚Ein Erdbeben plus Tsunami wird es sein; und zwar von einem Ausmaß, wie man es noch bei keiner Religionsgemeinschaft jemals erlebt hat!’
Vorher wird er allerdings auf keinen Fall darüber sprechen. Und sobald er es tun wird, dann auch nur mit ganz wenigen Auserwählten, die er unbedingt zur Verwirklichung braucht und deren Loyalität er sich absolut sicher sein kann; denn seine Absichten kann man beim besten Willen nicht als „lauter“ bezeichnen …
Oh, nein! Seit langem schon brennt in seinem Herzen die heiße Flamme der Rachsucht und die schmerzliche Sehnsucht nach gnadenloser Vergeltung. Immer wieder hat er im Laufe seines Erwachsenenlebens die akribischen Aufzeichnungen eines Urahnen über das schreckliche Schicksal seiner Familie und seines Volkes und die nie gebüßte Schuld der Verursacher nachgelesen. Er kennt sie mittlerweile beinah auswendig. Und hin und wieder träumt er sogar davon; so auch in der vergangenen Nacht.
Der sechsjährige Junge, genannt Maurice, zitterte vor Angst und Schwäche. Im Juni des Jahres 1894 befand sich eine kleine Gruppe, bestehend aus einigen älteren Frauen und jungen Müttern mit ihren Kindern, etliche davon noch Säuglinge, sowie aus ein paar heranwachsenden Mädchen, schon seit zwei Tagen auf der Flucht durch das unwegsame, verbuschte Gelände, das sich unmittelbar an die Pflanzung des gefürchteten weißen Bwanas, nahe der Stadt Bagamojo am Fluss Ruwu Kirigani, im Osten Afrikas, anschloss.
Die Frauen waren übersät mit Abschürfungen und frischen blauen Flecken, die dem verwilderten Gelände, das sie durchquerten, geschuldet waren; dazu waren sie gezeichnet von Hinweisen auf länger zurückliegende Faust- und Peitschenhiebe, verabreicht als Strafe für angebliche „Faulheit“ oder weil sie versucht hatten, sich gegen die ausufernde sexuelle Gewalt der schwarzen Aufseher ihres weißen „Herrn“ zur Wehr zu setzen.
Der Bwana ließ den Kerlen das meiste ihrer Übergriffe ohne Sanktionen durchgehen, weil er sie brauchte und auf ihre Loyalität angewiesen war. Eine Situation, die die Aufseher weidlich ausnutzten. Auf diese Weise konnten sie sich den weiblichen Feld- und Haussklaven überlegen fühlen und vergessen, dass sie selbst auch bloß Dreck in den Augen des deutschen Plantagenbesitzers waren.
Ein ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind, vermochte vor Schmerzen kaum mehr zu laufen; immer wieder lief ihm ein dünner Blutfaden zwischen den mageren Oberschenkeln herab. Ein betrunkener Besucher ihres „Besitzers“ aus Potsdam war in der Nacht vor der Flucht mit äußerster Brutalität gegen das noch unberührte Mädchen vorgegangen.
Der hässliche Vorfall reihte sich ein in eine ganze Serie dieser, inzwischen alltäglichen, Missbrauchsvergehen gegen schwarze Frauen. Kinder und jedes weibliche Wesen bis zu einem gewissen Alter hatten ständig damit zu rechnen, dass ein weißer „Herr“ sein „Recht“ einforderte, die „Sklavinnen“ und deren Nachwuchs, selbst kleine Jungen, missbrauchen zu dürfen.
Auf vielen Pflanzungen besaß dieses „Recht“ auch für die schwarzen Wächter stillschweigende Geltung, um sich ihrer Ergebenheit zu versichern.
Widersetzlichkeit der Rechtlosen wurde im Allgemeinen mit Prügeln geahndet. Wobei diese Art der Bestrafung nicht nur dem Herrn zustand, sondern auch seinen Söhnen oder Freunden, die zu Besuch weilten sowie den bereits erwähnten weißen und schwarzen Aufsehern.
Ältere Eingeborene und kleinere Kinder waren nicht selten von Unterernährung betroffen. Wer nicht mehr oder noch nicht die volle Arbeitsleistung auf einer Plantage erbrachte, hatte mitunter mit drastischer Reduzierung der zugeteilten Essensrationen zu rechnen; ganz nach dem Motto: „Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen!“
* * *
Es war bereits später Nachmittag. Die letzte Mahlzeit, ihm und seinen kleineren Geschwistern von ihrer Mutter Elisa zugeteilt, hatte Maurice am vergangenen Abend zu sich genommen. Es hatte sich um fette schwarze Raupen einer großen blauschillernden Käferart gehandelt, die sie und die anderen Frauen im nahezu undurchdringlichen Gebüsch am Rande des größtenteils überwucherten Dschungelpfads gesammelt hatten.
Sein Hunger war größer gewesen als der Ekel und er hatte das auf einer Lichtung über einem kleinen Feuerchen geröstete Viehzeug mit Todesverachtung in den Mund gesteckt und ohne viel zu kauen, heruntergeschluckt. Im Augenblick konnte sich der kleine Junge vor Hunger nur noch mühsam aufrecht halten; die von Insekten zerstochenen dünnen Beine, die in kurzen Hosen steckten, drohten dem Sechsjährigen den Dienst zu versagen.
Seit Stunden marschierten sie auch am zweiten Tag, jeweils zu zweien und hintereinander, schweigend im Gänsemarsch einen gewundenen schmalen Pfad entlang, der kein Ende zu nehmen schien. Die Vorausgehenden bedienten sich ihrer Macheten, um das Dickicht zu lichten und lösten einander dabei regelmäßig ab. Das Tempo war auch am Ende dieses Tages noch zügig und duldete keinerlei unnötige Verzögerung.
Maurice, beinahe im Halbschlaf, erinnerte sich an frühere Buschwanderungen, um ihre Nachbardörfer zu besuchen. Das war vor zwei Jahren gewesen, zu einer Zeit, als alles noch gut zu sein schien und er und seine Familie freie Menschen in ihrem eigenen Dorf gewesen waren. Da hatte man unterwegs gescherzt und gelacht und, um sich die Zeit zu vertreiben, während des Marschierens fröhliche Lieder gesungen.
Eines hatte er ganz besonders geliebt. Es handelte von einer Riesenschlange und ihrem Feind, dem Leoparden, der sie fressen wollte. Aber die listige Schlange wartete ab, bis die Raubkatze eingeschlafen war und erwürgte sie dann im Schlaf. Zur Strafe wurde das Kriechtier dann von einem tembo, einer hier lebenden Waldelefantenart, zertrampelt …
An diesem Tag jedoch sang niemand; man war auf der Flucht und es galt, unbedingte Ruhe walten zu lassen. „Keinen Laut, Freunde!“, hatte seine Mutter Elisa alle, aber besonders die kleineren Kinder ermahnt.
„Sonst findet uns der böse weiße Mann und bestraft uns hart, weil wir ihn unerlaubt verlassen haben! Unsere einstige Freiheit haben wir längst verloren, meine Lieben“, wiederholte sie für die Erwachsenen. „Für uns gilt:
‚Deus dedit, Deus obstulit!’ – ‚Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen!’“, zitierte Elisa einen Spruch des Hiob aus dem Alten Testament, den sie von einem weißen Missionsbenediktiner gelernt hatte, der sie und ihre Kinder neulich getauft hatte.
Diese Taufe war zwar nicht ausdrücklich gegen ihren Willen erfolgt – zu ernsthaftem Widerstand hatte ihr in ihrer Lage der Mut gefehlt. Aber als Christin empfand sich die schöne stolze Frau vom Stamm der Wahehe ihr ganzes Leben lang nicht.
„Wer, wie wir, auf der Flucht ist, muss sich sputen und darf dem Feind keine Gelegenheit zum Einholen bieten“, hatte die Mutter all jenen eingeschärft, die entschlossen waren, mit ihr zu gehen und heimlich die Plantage des weißen Mannes, dessen „Schützlinge“ sie allesamt waren, zu verlassen.
Einer der vornehmsten Häuptlingsfamilien des Landes entstammend und vor kurzem noch die Ehefrau, jetzt aber die Witwe Mkwas, des tapferen Wahehe-Oberhäuptlings, genoss Elisa den Respekt und das Vertrauen der anderen Schwarzen.
Mtaga, so ihr ursprünglicher Name, später nach der heiligen Elisabeth „Elisa“getauft, war es auch gewesen, die eine Gelegenheit gesucht und gefunden hatte, die schwarzen Wachtposten auf der Farm auszutricksen und der Knechtschaft zu entkommen – bis jetzt jedenfalls.
Maurice registrierte trotz seines Alters sehr genau, dass die Gruppe es sorgsam vermied, auch nur in die Reichweite von weißen Kolonisatoren oder katholischen Missionsstationen zu gelangen, weil nach Elisas Erfahrung die Mönche und Nonnen meistens mit den deutschen Kolonialherren kollaborierten.
Die Deutschen selbst, Offiziere und Siedler, nannten ihr Vorgehen dreist „Inobhutnahme“ oder „Schutzhaft“, welche sie der „heidnischen“ und „geistig und kulturell zurückgebliebenen Ureinwohnerschaft“ angedeihen ließen, während die frommen Missionare es vorzogen, beschönigend von „barmherziger Fürsorge im Geiste Jesu Christi“ zu sprechen …
Als Maurice hilfesuchend nach der Hand seiner neben ihm ausschreitenden Mutter Elisa greifen wollte, wurde ihm bewusst, dass er ausnahmsweise von ihr keine Unterstützung erhoffen durfte. Die stolze junge Frau, wie selbstverständlich die Anführerin der Flüchtigen, trug nicht nur ihr vor sieben Monaten geborenes Baby, das noch gestillt werden musste, in einem Tragetuch auf dem Rücken; sie schleppte außerdem neben einem schäbigen Bündel mit dem spärlichen Gepäck der Familie noch seine zwei Jahre alte Schwester auf der Hüfte.
Sein jüngstes Kind hatte Maurices Vater Mkwa Obembe gezeugt, nachdem es ihm gelungen war, nachts heimlich seine bereits in Obhut genommene, sprich versklavte Frau Mtaga in einer Arbeiterhütte auf der Plantage aufzusuchen, ehe er sich erneut mit seinen Kriegern in den Kampf gegen die deutschen Okkupanten gestürzt hatte. Es sollte sein letzter Waffengang werden.
Gestorben war der Vater des Jungen als Heide, da er sich noch unter dem Galgen standhaft gegen die von einem Priester penetrant „empfohlene“ Taufe zur Wehr gesetzt hatte. Es war ihm sogar gelungen, zu fliehen, während die übrigen gefangenen Kämpfer sich widerspruchslos in ihr Schicksal gefügt hatten, als Christen hingerichtet zu werden.
Genützt hatte ihm die Flucht allerdings nichts, da man ihn bald wieder aufgespürt und kurzen Prozess mit ihm gemacht hatte.
Trotz seiner Erschöpfung bekam Maurice mit, dass Elisa sehr aufmerksam auf ihre Umgebung achtete, soweit das undurchdringliche Laubwerk des den Pfad säumenden Gesträuchs dies zuließ. Vor allem hatte sie ein scharfes Auge auf ihren zweiten Sohn Heinrich, genannt Henri, der am vergangenen Tag seinen vierten Geburtstag begangen hatte. Ihn ließ Elisa ein paar Schritte vor sich herlaufen, um jederzeit beobachten zu können, wie es dem Kleinen erging.
Den sperrigen Namen hatte man dem Jungen in der katholischen Missionsstation verpasst, wo er getauft worden war, genau wie Elisa, Maurice und seine jüngeren Geschwister.
Maurices zweijährige Schwester Margarethe hörte auf den Namen Greta und das Baby, Andreas getauft, würde später als Andi durchs Leben gehen, während er den Namen Mauritz erhalten hatte und von allen Maurice gerufen wurde, weil es sich leichter aussprechen ließ.
Henri war nicht ganz gesund. Schon vor der Flucht hatte er wochenlang gekränkelt; er litt an Halsweh und hatte geschwollene Rachenmandeln.
Maurice, 1888 als Erbe und Nachfolger des stolzen Häuptlings Mkwa Obembe im Dorf Tangwelule in Ghanumbia geboren, einem großen, von den Weißen zwar eroberten, aber noch immer ziemlich unerforschten Land im Osten des riesigen Kontinents Afrika, schämte sich plötzlich.
‚Mein Bruder Henri ist zwei Jahre jünger als ich. Er ist krank, hat ein bisschen Fieber, sagt Mama, und er ist sehr schwach. Er muss Bauchschmerzen haben vor lauter Hunger, denn er hat sich gestern geweigert, diese ekligen Raupen zu essen. Und trotzdem: Er beklagt sich nicht, jammert nicht einmal, sondern stapft einfach tapfer weiter. Ich, als sein großer Bruder, müsste ihm eigentlich ein Vorbild sein!’
„Soll ich dir Andi eine Weile abnehmen, Mama?“, fragte er schüchtern und schaute seiner Mutter, einer hochgewachsenen schönen Wahehe-Frau, in die großen, ausdrucksstarken, schwarzen Augen. Ihr erschöpfter und tieftrauriger Ausdruck rührte ihn um ein Haar zu Tränen, weshalb ihn nicht zum ersten Mal ein Gefühl unbändigen Hasses auf die weißen Eroberer aus Europa erfasste.
‚Sobald ich groß bin und ein starker Mann’, schwor er sich, ‚werde ich, als Nachfolger meines Vaters, Anführer von tapferen Wahehe-Kriegern sein und alle weißen Teufel aus unserem Land jagen! Viele von ihnen werde ich töten zur Strafe, weil sie meinen Vater ermordet, unser Dorf zerstört und meine Mama, mich und unsere ganze Sippe zu Sklaven gemacht haben!’
„Der Kleine ist zu schwer für dich, mein Sohn! Aber bis zu unserem nächsten Rastplatz könntest du das Bündel übernehmen, das unsere Kleidung und noch anderes Wichtige enthält, Maurice! Das wäre sehr lieb von dir!“
Damit reichte sie ihm, ohne im Gehen innezuhalten, ein buntes Tuch, das, zusammengeknotet, eine Stofftasche bildete, in der sich die wenigen Habseligkeiten der einst wohlhabenden Häuptlingsfamilie befanden.
Maurice hängte sich das Ding um den Hals und ging beinahe in die Knie infolge des Gewichts, welches man dem Bündel äußerlich gar nicht ansah. Er würde wohl noch langsamer gehen müssen.
‚Hoffentlich verliere ich nicht den Anschluss an die Gruppe’, machte der kleine Junge sich Sorgen, als ein Flüchtiger nach dem anderen ihn auf dem mit Gras überwucherten und für ihn beinahe unsichtbaren Dschungelpfad überholte.
Nur Elisa vermochte unbeirrt mit sicherem Instinkt den richtigen Weg durch diese grüne, bereits dämmrig-dunkle, feuchtheiße Hölle zu erkennen. Ohne Zweifel war sie die beste und erfahrenste Fährtenleserin. Hier in der Gegend sollte es immerhin wilde Tiere geben neben den allgegenwärtigen giftigen Schlangen und Skorpionen …
‚Gut, dass mein Vater uns nicht mehr sehen kann’, überlegte Maurice nach einer Weile, während er den Schleim in seiner Nase hochzog. In der vergangenen Nacht im Freien hatte er sich einen Schnupfen geholt. Nach Sonnenuntergang konnte es nämlich empfindlich kalt werden.
‚Unsere stolze Familie, seit fast einem Jahrhundert Herrscher über die Wahehes, auf der Flucht vor den weißen Eroberern: Was für eine Schmach!’
Bitterer Groll erfüllte den kleinen Jungen.
* * *
Den Aufenthalt in der Sixtinischen Kapelle scheint Kardinal Obembe außerordentlich zu genießen. Obwohl er die päpstliche Hauskapelle im Vatikan, erbaut von Papst Sixtus IV. von 1473 bis 1481, nicht zum ersten Mal besucht, ist er genau wie einst als junger Priester bezaubert von dem einmaligen Kunstgenuss.
Ihn stört nicht, dass bereits sechzehn Wahlgänge abgehalten worden sind und in Kürze der siebzehnte Urnengang ansteht. Er könnte an diesem Ort gerne noch eine lange Zeit verweilen, nur um in aller Ruhe die grandiosen Fresken zu Themen des Alten und des Neuen Testamentes zu bewundern von so bedeutenden Künstlern wie Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Ghirlandaio, Rosselli und Signorelli an den Längswänden sowie die Fresken Michelangelos:
Schöpfungsgeschichte, Propheten, Sybillen et cetera an der gewölbten Decke und natürlich das Nonplusultra, das Jüngste Gericht an der Altarwand. Auch die imposante Architektur der weiträumigen Kapelle lässt er mit Genuss auf sich einwirken.
‚Meine Kapelle’, jubelt es in seinem Inneren und wieder wandert der entzückte Blick des Kardinals hinauf zu Michelangelos „Erschaffung des Adam“.
Dass sowohl der Schöpfer der Welt wie sein Geschöpf, das er angeblich nach seinem eigenen Bild geschaffen hatte, der weißen Rasse angehören, belustigt ihn nur. Ist man sich doch seit längerem sicher, dass die Menschwerdung in Wahrheit in Afrika stattgefunden hat … Dem begnadeten Künstler nimmt er es nicht übel: Der konnte das damals, als er sein Werk schuf, nicht wissen.
‚Im Übrigen sollen sich die Weißen bloß nicht so überheben’, denkt er bei sich. ‚Einer vor zwei Jahrzehnten durchgeführten Studie zufolge sind die Nordeuropäer länger dunkelhäutig gewesen, als sie bis dahin für möglich gehalten haben – und als ihnen lieb ist.’
Obembe hatte diese Studie sehr aufmerksam gelesen.
Den Sachverhalt legte eine DNA-Analyse nahe, durchgeführt von Londoner Wissenschaftlern an Resten eines 10 000 Jahre alten männlichen Skeletts aus Großbritannien. Die Knochen waren bereits im Jahr 1903 im Südwesten Englands gefunden worden. DNA-Analysten des britischen Naturhistorischen Museums und des University College of London befassten sich allerdings erst 2018 damit und „seien überrascht gewesen, dass ein Bewohner der britischen Insel damals zwar blaue Augen, aber dazu richtig dunkle Haut haben konnte.“
Zu Kardinal Obembes großer Freude fand man noch mehr heraus: Der Stamm dieses Mannes war am Ende der letzten Eiszeit auf die Insel gezogen. Die Forscher konnten die DNA des Skeletts mit menschlichen Relikten aus Ungarn, Luxemburg und Überresten aus Spanien in Verbindung setzen.
Vor zwanzig Jahren eine Nachricht, die nicht nur Maurice Obembe, sondern auch viele andere gebildete Afrikaner mit Genugtuung erfüllt hatte. In europäischen Ländern machte man hingegen keinerlei Aufhebens davon; es war leider bloß ein Fall für Anthropologen und Naturhistoriker geblieben.
„Anscheinend passte die Entdeckung nicht ins ‚weiße’ Weltbild“, sagt sich der Kardinal mit einem zynischen Lächeln.
Wie ein x-beliebiger Rom-Tourist hatte er sich am Flughafen den neuesten Führer der Sixtina gekauft. Den blättert er durch, während der nächste Wahlgang vorbereitet wird. Er weiß jetzt zum Beispiel, dass sie exakt über die gleichen Maße verfügt wie der im Alten Testament erwähnte Tempel König Salomons mit einer Länge von 40,23 m, einer Breite von 13,41 m und einer beeindruckenden Höhe von immerhin 20,70 m.
Eigentlich eine Information, die die wenigsten, die das Büchlein durchblättern, interessieren wird. Aber für den Kardinal bedeutet sie schlichtweg alles: sieht er die Sixtina mittlerweile doch längst als „seine“ Kapelle an.
„Ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold.“
(1. Petrusbrief, 1, 6–7)
Innerlich frohlockend, aber äußerlich gelassen, sieht Maurice Obembe zwei Kardinäle auf sich zu kommen. Mit offenem Blick und freundlichem Lächeln kommt er ihnen, die mindestens fünfzehn bis zwanzig Jahre älter sind als er, ein paar Schritte entgegen. Einen von beiden, einen umgänglichen Spanier, kennt er ziemlich gut; der andere, ein etwas gebückt gehender Franzose, gilt allgemein als streng und verschlossen, ein Hardliner, wie er im Buche steht.
Was die Herren von ihm wissen möchten, erfüllt den Geistlichen aus Ghanumbia mit stiller Genugtuung und lässt sein Herz insgeheim höherschlagen.
„Verehrter Bruder in Christo, nur mal so zu unserer Information“, beginnt der französische Kirchenmann betont lässig, während der spanische sein farbiges Gegenüber wohlwollend mustert: „Einmal angenommen, die verehrte Wählergemeinde wäre des Patts zwischen den beiden asiatischen Kandidaten müde und zeigte sich bereit, ihre Gunst möglicherweise einem schwarzen Mitbruder zu gewähren: Wären Sie in diesem Falle bereit, die Wahl zum Heiligen Vater anzunehmen?“
„Falls dem nicht so wäre, zögern Sie bitte nicht, uns das mitzuteilen, damit wir nicht noch mehr unnütze Zeit vergeuden!“, fügt der Spanier, ein hochgewachsener, sich betont aufrecht haltender Andalusier mit unleugbar maurischem Einschlag, mit einem gewinnenden Lächeln hinzu.
Der Angesprochene verfügt über genügend schauspielerisches Talent und hat keine Mühe, sein Triumphgefühl zu verbergen. Ehrfurchtsvoll neigt er seinen glattrasierten Schädel vor den älteren Kardinälen.
„Es wäre mir eine überaus große Ehre, von meinen hochverehrten Brüdern in Christo für würdig erachtet zu werden, Mutter Kirche als Oberhaupt der Gläubigen in Demut und größter Verantwortung zu dienen. Selbstverständlich würde ich mich in diesem Fall dem Votum des erlauchten Gremiums nicht verweigern!“
Mit Erfolg bemüht Obembe sich, den zwei hohen Geistlichen nicht mit triumphierender Miene hinterherzuschauen, als sie sich zu den anderen Konklave-Teilnehmern zurückbegeben. Für ihn besteht in diesem Moment nicht mehr der geringste Zweifel: Er hat es geschafft! Natürlich weiß er auch, dass unangenehme Überraschungen nie ausgeschlossen sind; dennoch fühlt er sich so gut wie am Ziel.
Im Laufe der Zeit haben sich die Wahlmodalitäten stark verändert. Anders als früher muss nicht mehr krampfhaft wochen- oder gar monatelang nach einem Kompromisskandidaten gesucht werden. Hat nach dreißig Wahlgängen immer noch kein Kandidat die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht, kann die absolute Mehrheit die Entscheidung bringen.
‚Und die wird dann auf alle Fälle mit meinem Namen verbunden sein!’ Freilich hofft er insgeheim, dass es etwas schneller gehen wird. Es würde sein Ansehen erhöhen …
Nach längerer Zeit schweifen seine Gedanken ab zu seiner Geliebten Monique, die sicher schon ungeduldig auf sein Startzeichen wartet, den Flug nach Rom antreten zu können. Natürlich freut er sich auf ihr Kommen – obwohl er sich zu seiner eigenen Verblüffung eingestehen muss, sie bisher nicht allzu sehr vermisst zu haben.
‚Sollte ich mich ihr womöglich ein wenig entfremdet haben?’, fragt sich der Kardinal insgeheim. Allerdings verwirft er den Gedanken sofort als völlig absurd. Er mag viele Fehler haben – Untreue gehört definitiv nicht dazu. Seit er mit der schönen Monique zusammen ist, hat er keine andere Frau mehr angesehen, geschweige denn angerührt.
„Die Zeit kommt aus der Zukunft, die nicht existiert, in die Gegenwart, die keine Dauer hat und geht in die Vergangenheit, die aufgehört hat, zu bestehen.“
(Kirchenvater Augustinus)
Im siebzehnten Wahlgang taucht tatsächlich erstmals ein „Kardinal Maurice Obembe“ mit einer stattlichen Anzahl von Unterstützerstimmen auf, während die Nominierungen der beiden asiatischen Kandidaten drastisch schrumpfen. Auch die weißen Anwärter, in der Hauptsache Italiener aus Mailand, Venedig, Padua und Palermo, haben Stimmanteile eingebüßt.
Der Kirchenmann aus Ostafrika mag ja bisher ein relativ unbeschriebenes Blatt sein – aber immerhin hat er dadurch auch noch keine Möglichkeit gehabt, sich im Kardinalskollegium unbeliebt zu machen oder sich im Vatikan persönliche Feinde zu schaffen.
Dass ihn einige auch weiterhin ablehnen werden, wird also hauptsächlich seiner dunklen Hautfarbe geschuldet sein – aber damit kann er mittlerweile gut leben. In seinem Inneren weiß er es: „Da ist sie, die von mir erhoffte und sehnlichst erwartete Wende!“
Ursprünglich rechneten die meisten Teilnehmer mit einem nur kurz andauernden Konklave; hatten doch im Voraus „gut unterrichtete Kreise“ in Rom verlauten lassen, dieses Mal werde man sehr schnell zu einer Einigung gelangen, weil man sich einig sei, einen Asiaten, den Kardinal von Manila, zum Pontifex zu küren. Was sich dann allerdings als Irrtum herausstellt. Von „Einigkeit“ unter den Wahlberechtigten kann keine Rede sein.
Plötzlich werden immer mehr von ihnen auf den bisher kaum in Erscheinung getretenen Schwarzafrikaner aufmerksam.
„Warum eigentlich nicht?“, mag sich manch einer der hohen geistlichen Herren fragen. „Ein farbiger Papst wird dieses Mal sowieso von aller Welt gewünscht. Und dieses Kriterium erfüllt der Mann aus Afrika ja nun weiß Gott!“
Einige, Neider und Missgünstige, werden später zwar, bar jeder Logik und entgegen der Wahrheit, behaupten, die „geheime“ Wahl dieses Kandidaten sei von Anfang an mehr oder weniger eine Farce gewesen, weil das gewünschte Ergebnis im Grunde von Anfang an festgestanden habe.
Richtig ist zwar, dass dieser Kardinal, der die Wahl, so sie denn auf ihn fiele, auch anzunehmen versprach, die „richtige“ Hautfarbe besaß, jedoch keinesfalls als glücklicher Zufall anzusehen war, sondern es ist quasi eine Art conditio sine qua non gewesen. Galt es doch längst als überfällig, endlich einem Farbigen das höchste Amt, das die Kirchenhierarchie zu vergeben hat, zuteilwerden zu lassen. Aber über Obembes Person waren im Vorfeld nun wirklich keinerlei Festlegungen getroffen worden.
Zweifellos war es wichtig, die Kirche aus ihrer bedrohlichen Schieflage zu befreien. Wobei man allerdings stillschweigend davon ausgegangen war, einen Ostasiaten zum Pontifex zu küren. Aber ein Schwarzer war letztendlich auch nicht schlecht.
* * *
„Und dass die Kirche gerettet werden muss, das sehen die Gläubigen anscheinend – der Himmel mag wissen warum! – durch einen Papst der Dritten Welt am ehesten gewährleistet“, soll sich später in kleinem Kreis einer der enttäuschten italienischen Papstanwärter spöttisch geäußert haben; wofür er mehr oder weniger verärgerte Zustimmung erntete.
Diejenigen, die sich über das Wahlergebnis mokierten, ließen dabei, ob bewusst oder unbewusst, ganz außer Acht, dass sie damit ja den Heiligen Geist desavouierten, der doch angeblich jede Papstwahl dominierte …
Das Häuflein weißer Kardinäle, allesamt Italiener, die sich selbst Chancen auf den Papstthron ausgerechnet haben, begründen ihren Standpunkt folgendermaßen: „Gerade weil Mutter Kirche sich in großer Not befindet, hätte man im jetzigen Augenblick Kontinuität bewahren müssen!“
Offenbar trauen sie einem Schwarzen die Herkulesaufgabe nicht zu, der Kirche ein Revivalzu ermöglichen. Was allerdings nach der Wahl keiner mehr laut ausspricht – zumindest nicht, wenn einer mithören kann, der mit Sicherheit „den Neger“ gewählt hat.
„Mimikama!“soll der neue Heilige Vater leise auf Suaheli gemurmelt haben, was „Gefällt mir!“ bedeutet, nachdem die Stimmen nach dem neunzehnten und letzten Wahlgang ausgezählt waren und das positive Ergebnis – immerhin fünfundachtzig Prozent! – den wahlberechtigten Kardinälen bekannt gegeben wurde. Das will zumindest ein kenianischer, etwas geschwätziger Teilnehmer gehört und sofort ausgeplaudert haben.
Natürlich nahm der Gewählte ohne das geringste Zögern das schwere Amt an.
I. BUCH
INTROITUS
„Willkommen im Hause des Herrn!
Die Gemeinde versammelt sich, getreu dem Worte Jesu: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen.“
Die Schar der Frommen und hauptsächlich der Neugierigen, die sich auf dem Petersplatz versammelt hat, ist aufs höchste gespannt, kaum dass der ranghöchste Kardinal von der über dem Mittelportal des Petersdoms gelegenen Benediktionsloggia aus, die ersehnte Nachricht verkündet:
„Habemus Papam!“
Darauf bricht an diesem Frühlingstag des Jahres 2039 der übliche Jubel los, der sich allerdings im Augenblick des Erscheinens des neuen Heiligen Vaters abrupt abschwächt – um unmittelbar darauf, gewissermaßen nach einer Schrecksekunde – sogar völlig zu versiegen.
Ach, du gütiger Himmel! Ein Schwarzer! Oh, Gott!
Ein unüberhörbares Raunen geht durch die Menge. Mit einem Chinesen oder Ähnlichem haben die Leute ja insgeheim gerechnet. Und jetzt ist es also ein Schwarzafrikaner geworden …
Nach kurzem Zögern bricht erneut donnernder Jubel los, als die Menschen die imposante Gestalt genauer ins Auge gefasst haben. Das geradezu hysterische Geschrei, das die recht überschaubare Anzahl an Besuchern aus dem In- und Ausland veranstaltet, soll vermutlich darüber hinwegtäuschen, dass das Ereignis dieses Mal nicht übermäßig viele Zuschauer nach Rom gelockt hat.
Wenn früher anlässlich einer Papstwahl der Petersplatz schier aus allen Nähten platzte, weil er die Menschenmassen kaum noch zu fassen vermochte, ist am heutigen Tag die Zahl der Jubler bestenfalls ausreichend. Die meisten werden diesen Eventvermutlich bequem am Bildschirm verfolgen – wenn überhaupt.
Der hochgewachsene, breitschultrige Kardinal, zweiundfünfzig Jahre alt, viel jünger aussehend, kerngesund und körperlich topfit, ist sichtlich zufrieden, als er sich den auf dem Platz Ausharrenden auf dem dafür vorgesehenen Ehrenbalkon des Petersdoms präsentiert. Im Fernsehen und auf sämtlichen Fotodokumenten heben sich die weißen Augäpfel sowie kräftige, gesunde, weiße Zähne von einem stolzen, geradezu aristokratisch anmutenden Gesicht, schwarz wie Ebenholz, deutlich ab.
Wer in seiner unmittelbaren Nähe stünde und explizit darauf achten könnte, dem würde möglicherweise auffallen, wie stereotyp dieses breite Lächeln ist und dass es seine schönen schwarzen Augen mit den langen Wimpern keineswegs erreicht … Wie ein siegreicher Feldherr erhebt er kurz darauf beide Arme gen Himmel und erteilt, wie es für Päpste Sitte ist, dem unten auf dem Platz frenetisch jubelnden Häuflein der Gläubigen den Segen „urbi et orbi“.
Nachdem viele niederknieten und alle sich bekreuzigten, lässt man den frisch Gekürten, der sich Leo nennt, erneut mit freudigem Beifall hochleben. Wer kann in diesem Augenblick ahnen, was in dem schwarzen Mann mit den edlen Gesichtszügen vorgeht?
Kardinal Obembe, der die Wahl wie versprochen ohne einen Augenblick des Bedenkens annahm, genießt seinen Sieg. Hat er doch sein ganzes bisheriges Leben auf dieses eine Ziel hin bewusst und hartnäckig ausgerichtet, auch großen, vor allem inneren Widerständen zum Trotz – und zwar von frühester Jugend an.
„Wer einen Fluss überquert, muss die eine Seite verlassen!“
(Mahatma Ghandi)
Dass diese Weisheit ihre Berechtigung hat, weiß der neue Heilige Vater nur zu gut. Auf vieles hat er verzichtet; so auch auf einen Beruf, der ihm tatsächlich zugesagt hätte …
Der neue Papst wählte für sich nach kurzem Überlegen – Liberius oder Gregor hätte ihm auch gut gefallen – den Namen Leo.
Seine Begründung lautet, seinen Vorgänger gleichen Namens, der immerhin von 1878 bis zum Jahre 1903 den Kirchenstaat viele Jahre kraftvoll regiert habe, überaus hoch zu schätzen und als Vorbild zu verehren.
Kardinal Maurice Obembe wird demnach der vierzehnte Papst mit dem Namen Leo sein. Die Geschichte Leos XIII. kennt er ganz genau.
Er weiß um den „Kulturkampf“, der in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts in Deutschland zwischen Reichskanzler Otto von Bismarck und Papst Pius IX., Vorgänger Leos XIII., mit erbitterter Härte geführt worden war. Im katholischen Rheinland etwa, das zu Preußen gehörte, wurden sogar fünf von elf Bischöfen ins Gefängnis gesteckt und über Monate gefangen gehalten. Ein Skandal ohnegleichen!
Der Reichskanzler war entschlossen, den Einfluss der katholischen Kirche zu vernichten, was 1874 unter anderem zur Einführung der Zivilehe führte, nachdem man in Preußen zwei Jahre zuvor Ordensangehörige vom Lehrberuf in öffentlichen Schulen ausgeschlossen hatte. Sogar der mächtige Jesuitenorden war aufgelöst worden.
Papst Pius erklärte seinerseits die preußischen Gesetze für ungültig und belegte alle, die sich an ihrer Durchführung beteiligten, mit der Exkommunikation.
Nach dem Tode Pius IX. verhandelte der Reichskanzler direkt mit dem neu inthronisierten Leo XIII., einem intelligenten und harten Verhandlungsgegner. Kompromissbereitschaft der Deutschen war mittlerweile angesagt, denn die Zeiten hatten sich geändert: Bismarck wollte mit dem katholischen Österreich ein Bündnis schließen und im eigenen Land war die „Arbeiterbewegung“ zu einer gefährlichen Bedrohung geworden, so dass man sich den Luxus eines Zerwürfnisses mit Rom nicht mehr leisten konnte.
Mit den Friedensgesetzen von 1886 und 1887 fand der „Kulturkampf“ formell sein Ende; die kirchenfeindlichen Gesetze wurden zum Teil zurückgenommen.
Auch in Frankreich waren seit 1871 antikirchliche Gesetze erlassen worden. Das Parlament vollzog im Jahr 1905 die Trennung von Kirche und Staat. Ähnlich prekär war das Verhältnis zu den Wissenschaften: lag doch Charles Darwins Abstammungslehre der Kirche bleischwer im Magen, weil Darwin dadurch die biblische, zugegebenermaßen kindlich-naive Version von der Erschaffung des Menschen infrage stellte.
Leo XIII. lehnte den „Darwinismus“, der die Evolution der Rassen, auch der menschlichen, propagierte, strikt ab, während er für die sozialen Fragen der neuen Zeit durchaus aufgeschlossen war. Er verfasste auch eine Bulle mit dem Titel „Rerum Novarum“, in der ein Ausgleich zwischen Armen und Reichen gefordert wurde und worin der Papst anmahnte, sich hauptsächlich der Bedürftigen anzunehmen. Damit hatte Leo XIII. immerhin die katholische Soziallehre begründet.
„Gegen die Nacht können wir nichts tun, aber wir können ein Licht anzünden!“
(Franz von Assisi)
Am nächsten Tag ist im Osservatore Romano zu lesen:
„Ausgerechnet diesen sozial gesinnten, starken und durchsetzungsfreudigen Papst wählt der neue Heilige Vater, Leo XIV. zu seinem Vorbild! Damit steht ihm eine Aufgabe bevor, die ihresgleichen sucht: Niemals war die Kluft zwischen den Superreichen und den Habenichtsen so groß wie heute, obwohl man diese Schieflage schon seit vielen Jahrzehnten wortreich beklagt und Besserunganmahnt – bisher vergeblich. Seiner Heiligkeit dafür Gottes Segen!“
Von denen, die über Kirchengeschichte in neuerer Zeit Bescheid wissen, unter anderem die hohen Kleriker in Rom – mag sich manch einer fragen, ob Leo XIV. einerseits die gebotene Standfestigkeit besitzen, andererseits die nötige Unterstützung für sein ambitioniertes Projekt erhalten wird.
Dass er ehrgeizige Pläne hat, schließt man daraus, dass er den letzten Leo als großes Vorbild benennt und ihm nacheifern möchte.
Gerade vom gerechteren Verteilen immenser Vermögen unter unsagbar Armen und Verelendeten kann derzeit nirgendwo auf der Welt auch nur im Ansatz die Rede sein. Ein schlechtes Beispiel dafür ist ausgerechnet die kommunistische Volksrepublik China, die zwar den einst bekämpften Kapitalismus verinnerlicht zu haben scheint – aber eben nur für die Oberschicht, Parteibonzen und ähnliches. Für die Millionen von Wanderarbeitern interessiert sich nach wie vor niemand.
Aber auch der angeblich sozial fortschrittliche, demokratische Westen lässt in dieser Hinsicht mehr als zu wünschen übrig. Überall sind soziale Kälte und rücksichtsloses Gewinnstreben vorherrschend oder auf dem Vormarsch.
So ist es nur verständlich, dass sich nicht nur die Augen katholischer Gläubiger voll Erwartung und Hoffnung auf den neuen Papst richten. Er hat zwar „keine Armeen zur Verfügung“, wie mal jemand treffend festgestellt hat, aber ein mahnendes Wort von ihm als einer moralischen Instanz gilt immer noch etwas – hofft man zumindest.
„Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer noch Geschrei noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen.“
(Johannes, Offenbarung 21, 4)
„Immerhin fünf der mir vorausgegangenen Päpste mit dem Namen Leo zählen zum Kreise der Heiligen, die ich ganz besonders verehre“, betont der Heilige Vater in seiner allerersten Stellungnahme vor laufenden Fernsehkameras.
Die katholische Welt, sofern sie noch existiert, ist begeistert! Der Neue schaut nicht nur fantastisch und für seine immerhin zweiundfünfzig Lebensjahre noch sehr jugendlich aus, er wirkt auffallend athletisch und es steht zu erwarten, dass dieser schwarze Diener Gottes über Jahrzehnte hinweg den irritierten Gläubigen den rechten Weg weisen wird in eine Zukunft voll Frieden und Gerechtigkeit. Auf ihm ruhen im Augenblick die Hoffnungen vieler, in die Jahre gekommener Kardinäle ebenso wie die junger Laienkatholiken. Hoffnungen auf eine Erneuerung, die diesen Namen auch verdient, und auf eine Wiederbelebung einer über zweitausend Jahre alten Institution, die mittlerweile längst bedenklich an Strahlkraft und vor allem massiv an Autorität eingebüßt hat.
Einige seiner letzten Vorgänger auf dem Stuhle Petri, allesamt glühende Marienverehrer, sind zwar darauf bedacht gewesen, besonders die Jugend für die Kirche und ihre Ideale zu gewinnen und zu begeistern. Letzten Endes sind sie gescheitert, die Kirche erneut zu jenem Erfolgsmodell werden zu lassen, welches sie einst (jeglicher berechtigten Kritik zum Trotz) über Jahrhunderte gewesen ist.
Papst Leo XIV., bisher als Kardinal Maurice Obembe, zumindest in Europa nach außen hin sehr unauffällig, gilt offiziell als gemäßigt, auf ehrlichen Ausgleich mit anderen christlichen Glaubensbrüdern bedacht und vor allem als absolut tolerant gegenüber Anhängern anderer Religionen. Ob und wieweit dieser Ruf der Wahrheit entspricht, wird die Zukunft zeigen.
DEMÜTIGE KNIEBEUGE
„Wenn der Gerechte ruft, so hört ihn der Herr.“
(Psalm 34, 18)
Seine Heiligkeit, seit seiner Jugend unter Schlaflosigkeit leidend, vermag auch in den ersten Tagen nach seiner Wahl zum Pontifex in den Nächten keine Ruhe zu finden. Ruhelos und innerlich aufgewühlt wandert er in seinem Schlafzimmer umher, einem Raum, der ihm keineswegs zusagt. Die Größe mag ja noch angehen, aber das Mobiliar? Da wird er schleunigst für eine ihm genehme Ausstattung sorgen.
„Warum nicht mein afrikanisches Erbe betonen?“, fragt er sich laut, während er schon zum zehnten Mal die Strecke von der Tür bis zu den bodenlangen Fenstern durchmisst. Er hat es schon immer gemocht, laut mit sich selbst zu sprechen und gedenkt nicht, dies noch zu ändern. Außerdem ist er allein; abgesehen von Paddy, seinem Leibdiener. Aber der gehört ja gewissermaßen zum Inventar.
„Das ist das Angenehme daran: Vor ihm brauche ich mich nicht zu verstellen und muss mir keinerlei Hemmungen auferlegen.“
Leo XIV. klatscht in die Hände vor Vergnügen, als er überlegt, dass es nun an ihm liegt, das über Generationen gepflegte Gelübde, das alle jeweils ältesten Söhne der Obembe-Familie seit den „Tagen des Elends“ abgelegt haben, zu erfüllen: Vergeltung zu üben für die Schmach, die die Kolonialmacht Deutschland ihnen zugefügt hatte.
Wie hatte es Elisa, die Frau seines Ururgroßvaters, Mkwa Obembe, und Mutter des kleinen Maurice, seines Urgroßvaters, kurz vor ihrem Entweichen aus dem Sklavenquartier ihres weißen Bwanas ausgedrückt? Der Heilige Vater fühlt sich zeitlich zurückversetzt, ganz so, als wäre er selbst jener Knabe. Er kann das so oft Gelesene frei aus dem Gedächtnis heraus zitieren:
„Die Weißen haben uns alles genommen: unsere Freiheit, unser fruchtbares Land, unser Vieh, unsere Leute, sogar unsere Religion – und letztlich auch unseren Stolz!
Und was haben sie uns stattdessen „großzügig“ gebracht? Karge Wüstenlandschaften, in denen nichts wächst, demütigende Almosen, ihre Gier nach dem Fleisch junger schwarzer Frauen und das Gefühl tiefster Erniedrigung – sowie ihren angeblichen „Sohn Gottes“, diesen Jesus, der sich selbst nicht retten konnte und elendiglich, an ein Kreuz genagelt, krepieren musste. Fluch und Schande über sie! Vergiss das niemals, mein Sohn, und traue unter keinen Umständen einem Weißen!“
Eindringlich hatte Elisa dabei ihren Ältesten, der damals erst sechs Jahre alt war, angesehen und fest umarmt, ehe sie weitersprach.
„Irgendwann wird der Tag der Abrechnung kommen. Versäume ihn nicht! Falls du dennoch aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein solltest, ihn wahrzunehmen, schwöre mir bei deiner Seele, dass du mein Vermächtnis genauso an deinen Erstgeborenen weitergeben wirst, damit er an deiner statt Rache üben kann.“
Dem kleinen Jungen war seine Mutter wie eine große Prophetin erschienen, noch viel mächtiger als Setuba, die uralte Seherin ihres Volkes, die dem Dolchstoß eines deutschen Offiziers beim Angriff auf ihr Dorf zum Opfer gefallen war. Weil sie ihn lauthals verflucht hatte, hatte der Eindringling die weise alte Frau niedergestochen …
„Irgendwann in der Zukunft wird die Unterdrückung unseres Volkes ein Ende haben und einer aus dem Volk der Wahehe und unserer Familie der Obembes wird die unsägliche Erniedrigung tilgen, die die weißen Teufel über uns gebracht haben!“
Zwar hatte der sechsjährige Maurice nicht alles verstanden; aber den feierlichen Ernst, mit dem Elisa ihn ermahnt hatte, sowie das brennende Feuer in ihren schwarzen Augen vermochte er niemals zu vergessen.
Zeitlebens hatte Elisa es den deutschen Okkupanten nicht verziehen, ihr den Mann und ihren Kindern den Vater genommen zu haben. Sie hatten Mkwa nach der letzten von drei kriegerischen Auseinandersetzungen, nachdem es ihnen endlich aufgrund ihrer hundertfach überlegenen Bewaffnung gelungen war, ihn zu besiegen, wie einen tollwütigen Hund erschlagen. Er hatte es nämlich geschafft, sich der unwürdigen Bestrafung durch Hängen im allerletzten Augenblick durch Flucht zu entziehen …
Der Heilige Vater weiß, wie es weitergeht im Tagebuch seines Vorfahren Maurice, jenes Jungen, der als Erwachsener seine Erlebnisse schriftlich festgehalten hatte:
„Drei Tage lang hatten sie meinen Vater durch den Busch verfolgt und wie ein Tier gehetzt, ehe sie den verletzten und halb verhungerten Häuptling unter Zuhilfenahme von schwarzen Askaris, die Bluthunde mit sich führten, stellten und auf der Stelle erschlugen, aus Angst, der noch erstaunlich kräftige Krieger könnte ihnen erneut entwischen.“
„Um seine Leiche für immer verschwinden zu lassen, mein Sohn“, hatte ihm Elisa noch eindringlich vor Augen geführt, „und seinen Anhängern damit die Möglichkeit zu rauben, ihn ehrenvoll zu bestatten und sein Grab zu einer Gedenkstätte werden zu lassen, haben sie anschließend seinen zerschundenen Körper ihren halbwilden Hunden zum Fraß vorgeworfen.“
Das Wissen um diese Gräueltat hatte in Maurice, dessen Namen – nomen est omen? – der neue Papst im zivilen Leben trägt, das lodernde Feuer der Rachsucht entflammt. Allerdings sollte sich ihm die Gelegenheit, die Feinde für diese ruchlose Tat und ihre anderen Verbrechen gegen sein Volk büßen zu lassen, niemals bieten.
Schweratmend unterbricht der Heilige Vater seine Wanderung durch das Zimmer.
„Aber er hat Elisas Auftrag getreulich erfüllt und an seinen Sohn Charles, meinen Großvater, weitergegeben. Der wiederum sah sich gleichfalls außerstande, Rache zu nehmen und übergab folglich die Verpflichtung dazu meinem Vater Patrice. Der seinerseits hat die Last aus politischem Kalkül auf meinen Schultern abgeladen, als ich gerade einmal zwölf Jahre alt gewesen bin. So ist schließlich nach etlichen Generationen der Vergeltungsschwur bis zu meiner Person gelangt.“
Leo muss lachen. „Ausgerechnet zu mir, dem höchsten Mann der Kirche! Einer Person, der man am allerwenigsten die Befriedigung von Rachegelüsten zutrauen wird …
Auf wie vieles habe ich verzichtet“, sinniert der Heilige Vater zum wohl hundertsten Mal, „zuvorderst auf eine Lebensaufgabe, die mir wirklich zugesagt hätte! Priester bin ich nicht etwa geworden aus Berufung, sondern um meine ganz persönliche Vergeltung zu üben, die längst überfällig ist!“
In der Tat hat er sich bis zum heutigen Tag peu à peu ein paar potente Mitstreiter gesucht und soweit es ihm möglich war, diplomatische, kirchliche Kanäle genutzt, um insgeheim in aller Stille jahrzehntelang stetig und mit allen Mitteln, auch denen der Heuchelei, Bestechung und Erpressung, auf diesen einen großen, erhebenden Augenblick einer für ihn günstig ausgehenden Papstwahl hinzuarbeiten.
Und beileibe nicht nur er allein: Hinter ihm steht ein kleines, aber recht solides Netzwerk: eine nicht ganz einflusslose Gruppierung, die die Anonymität über alles schätzt und die keinen Wert darauf legt, öffentlich in Erscheinung zu treten. Der erste Schritt ist getan: Maurice Obembe ist Papst!
* * *
„Ausgerechnet diesen starken und durchsetzungsfreudigen Papst Leo XIII. möchte der ‚Neue’ nachahmen!“, spötteln viele altgediente Prälaten in Rom und anderswo. Es ist deutlich herauszuhören, dass sie förmlich danach gieren, das Scheitern dieses Mannes aus Schwarzafrika mitzuerleben.
Wer würde denn schon hinter ihm stehen und ihn unterstützen? Der Ausgewogenheit stehen in erster Linie Egoismus und Habgier der Besitzenden entgegen, die keineswegs bereit sind, freiwillig auch nur auf ein Jota ihres angeblichen „Rechts“ auf Anhäufung geradezu grotesk anmutender Reichtümer auf Kosten der weniger Privilegierten oder gar der Besitzlosen, zu verzichten (bestes Beispiel bietet die Kirche selbst!).
Die Last der Verantwortung, die in ihn gesetzten Erwartungen zu erfüllen, wird schwer auf den Schultern des Papstes ruhen.
„Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer noch Geschrei noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen.“
(Johannes, Offenbarung 21, 4)
Wer könnte das Offensichtliche leugnen? Der endgültige Niedergang der Sancta Ecclesia scheint absehbar. Die Kirchenaustritte sind alarmierend, und nicht nur in den „reichen“ Staaten, auch in den sogenannten Entwicklungsländern; die Anzahl der Eltern, die für ihren Nachwuchs auf die Taufe verzichten, wächst unaufhörlich.
„Kaum zum Kardinal ernannt, hatte der um die Menschheit und ihr Wohlergehen zutiefst besorgte Geistliche Maurice Obembe längst ein ausgearbeitetes Konzept in der Schublade liegen, worin er fein säuberlich ausgearbeitet hatte, wie es mit unserer heiligen katholischen Kirche weitergehen müsse.“
Das behauptet zumindest der Sprecher des Vatikans, ein hoher Prälat der „alten Garde“ unmittelbar nach der Papstwahl. Womit er natürlich die Neugier beträchtlich anheizt. Noch wimmelt es im Vatikan von Altgedienten. Mit dem Auswechseln des vatikanischen Personals würde der Heilige Vater in Kürze beginnen.
Jetzt ist man erst einmal gespannt auf das, was Leo XIV. aus der Schublade hervorzaubern wird. Etliches sickert bereits durch. In der Hauptsache das, was diejenigen, die dem Heiligen Vater vorgreifen, sich vermutlich selbst am meisten wünschen. Was zur Folge hat, dass es zweifelhaft ist, ob sich die hochgespannten Erwartungen auch erfüllen werden …
* * *
Leo XIV. ist immer noch wie im Rausch. Seit Jahrzehnten hat er auf diesen Augenblick mit wahrer Inbrunst hingearbeitet. Aber als es dann Wirklichkeit ist und er tatsächlich als Papst Einzug gehalten hat im Vatikan, tut er sich noch schwer, das Ganze auch für wahr zu halten. Eine ganze Nacht lang hat er über seiner „Antrittsrede“ gebrütet, die unter anderem bei seiner ersten Predigt im Petersdom weltweit sein „Konzept“ sowohl den Gläubigen wie den Ungläubigen verkünden soll.
Der Heilige Vater ist nervös und fahrig. Beim Anlegen der Prunkgewänder will er sich nicht helfen lassen, verheddert sich in den weiten Ärmeln und muss dann doch die Hilfe seines Dieners Paddy Lumboa, den er, was sehr selten vorkommt, barsch anfährt, in Anspruch nehmen.
Betroffenheit, zumindest Verwunderung, macht sich nach seiner Predigt bei vielen seiner Zuhörer breit.
Dieser Heilige Vater mit dem Ruf des sozial Engagierten, des Besonnenen und um Ausgleich Besorgten, verfolgt anscheinend ganz andere Ziele. Strebt er in Wahrheit nicht nach Balance? An Versöhnung scheint ihm auch nicht besonders viel zu liegen; dafür umso mehr an Kampf und Auseinandersetzung!
Wie war das noch gleich? Er werde sich nicht davor scheuen, echte Streiter des Glaubens, wahreKrieger für den Katholizismus heranzuziehen und ausbilden zu lassen, kündigte er an. Vokabeln, die nicht gerade für Sanftmut und Güte zu sprechen scheinen …
„Die Welt muss endlich aufgerüttelt werden! Schluss muss sein mit erbärmlicher Weinerlichkeit und ratlosem Gewährenlassen!“, verrät Leo der staunenden Zuhörerschaft im Petersdom. Nicht den Forderungen der „Lauen“ dürfe die Kirche derzeit nachgeben, sondern sie müsse beherzt zu ihren allzeit gültigen Anforderungen stehen, falls sie überleben wolle! Christsein, ein Auserwählter sein, das gäbe es nicht zum Nulltarif, sondern müsse zumeist mühsam errungen werden.
„Auf in den Kampf für Christus und seine heilige Kirche! Opfere notfalls freudig dein Leben für den Herrn Jesus und dein ewiges Heil!“, lautet einer der Schlusssätze von Leos erster Predigt als frischgewählter Pontifex.
Dies wird in Kürze als Botschaft vom Vatikan aus rund um den Globus gehen. Für sehr viele eine veritable Enttäuschung. Auch das Folgende wird nicht bei allen so schnell dem Vergessen anheimfallen:
„Zur Hölle mit dem verweichlichten Gesäusel von Frieden und Ausgleich! Das andauernde Zurückweichen, die berechtigten Ansprüche an die Gläubigen betreffend, hat die Kirche nicht gestärkt, sondern sie im Gegenteil an den Rand des Abgrunds geführt! Es lebe die harte Konfrontation mit Irrglauben und Unglauben!“
‚O je’, mögen sich viele kopfschüttelnd denken. ‚Gegen die Ungläubigen, die es vorziehen, zu wissen, anstatt zu glauben, ist er ohnehin machtlos; aber der Heilige Vater sucht offenbar die Konfrontation mit dem Islam und anderen nichtkatholischen Religionsgemeinschaften! Und gewiss auch mit denLauen, die der Herr ausspeien wird aus seinem Munde, weilderen Rede nicht auf kraftvolles und überzeugtes ‚ja, ja’ oder ‚nein, nein’ hinausläuft, sondern nur hilfloses Gestammel zuwege bringt: ‚Herr, Herr!’’
So steht es ja auch in der Heiligen Schrift. Und der Heilige Vater legte noch einiges an Leidenschaftlichkeit nach: „Wer behauptet, Christ zu sein, der beweise es!“, rief Leo XIV. in Sankt Peter mit Inbrunst aus. „Nicht der Beter im stillen Kämmerlein wird die bedrohte und verfolgte Sancta Ecclesia retten, sondern derjenige, der sich nicht scheut, Blut und Leben für die allein seligmachende heilige Kirche zu vergießen und zu opfern!“
Da zuckten einige regelrecht zusammen. Was meinte der Heilige Vater damit? Redete er etwa einem neuen Kreuzzug das Wort, bei dem das Blut der Ungläubigen vergossen werden soll?
Aber bereits der nächste Satz aus Leos Mund ließ die meisten Aufgeschreckten ziemlich beruhigt auf ihre Sitze zurücksinken. Hatte der Papst, (der allerdings ein fantastisches Italienisch spricht), in heiligem Eifer womöglich nur die falschen Begriffe gewählt, als er so pathetisch die Floskel vom „Blutvergießen“ in den Mund nahm?