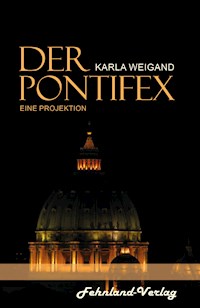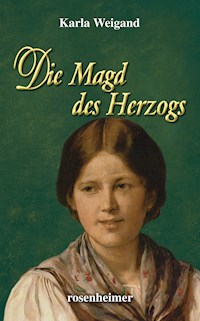Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kommissar Lavalles zweiter Kriminalfall während der Französischen Revolution: Eine Serie brutaler Morde an jungen Frauen verunsichert Paris. Kommissar Lavalle tappt lange im Dunklen. Obendrein beginnt er eine Affäre, die seine Liebe zu seiner Frau Ginette bedrohen könnte. Kommt er dem Täter auf die Spur und gelingt es ihm, seine Ehe zu retten? Meisterhaft schildert die Autorin die erste Phase der Revolution, die von politischen Reformen und der Einführung einer konstitutionellen Monarchie geprägt war. Tauchen Sie ein in den zweiten spannenden Krimi und in die Atmosphäre einer Epoche, die die Welt verändert hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karla Weigand
Kommissar Lavalle
und die toten Mädchen von Paris
Historischer Kriminalroman aus der Zeit
der Französischen Revolution – nach wahren Fällen
Karla Weigand
Kommissar Lavalle und die toten Mädchen von Paris
Historischer Kriminalroman aus der Zeit der
Französischen Revolution – nach wahren Fällen
Zwischen den Stühlen 13
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: September 2024
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Titelbild: Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1735–1813), The Demolition of the Fortress of the Bastille, July 14th, 1789
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 423 6
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 717 6
Prolog
27. Dezember 1789
»Ich bin nicht sicher, wie lange wir das freche Ding noch bei uns beherbergen sollen!«
Die Dame des Hauses echauffierte sich über ein junges Mädchen, das, nackt vor ihr auf dem Steinboden kniend, schluchzend und die Hände schützend vor den Busen haltend, zu der Zürnenden aufsah.
Die Dame hielt die Reitgerte noch in der Hand, mit der sie das hübsche, blonde und ziemlich magere Geschöpf soeben gezüchtigt hatte. Angeblich hatte die Kleine sich einer »Verfehlung« schuldig gemacht, die streng bestraft werden musste.
Die Worte richteten sich an den gut gekleideten Herrn, der neben der Hausherrin stand. Seine Miene verriet, dass er die Strenge nicht ganz verstand, mit welcher das Vergehen des Mädchens geahndet wurde. Man sah ihm an, dass er eher für Milde plädiert hätte. Er wagte es jedoch nicht, das Urteil seiner in einen prächtigen, aus schwerer Seide gefertigten Morgenrock gekleideten Gemahlin infrage zu stellen.
Selbst als diese ankündigte, genug Geduld mit der Undankbaren gezeigt zu haben, und sich ernsthaft überlege, ob sie das junge Ding nicht umgehend dem »Vollstrecker« überlassen solle, kam keine Widerrede über seine Lippen.
27. Dezember 1789
Das wütende Gekreische einer Frau im Erdgeschoss eines respektablen Pariser Bürgerhauses, gelegen am Rive droite, dem rechten Ufer der Seine im noblen Stadtteil Saint-Honoré, war bis auf die Straße hinaus zu hören.
Die an der Magdalenen-Kirche beschäftigten Handwerker – der Bau zog sich bereits sechsundzwanzig Jahre lang hin – unterbrachen kurzzeitig ihre jeweiligen Tätigkeiten, sahen einander vielsagend an, schüttelten missbilligend die Köpfe und zuckten ratlos mit den Schultern, um sich dann erneut ihren unterschiedlichen Arbeiten zu widmen.
Das Geschrei ertönte nicht zum ersten Mal. Hoch und schrill war die Stimme; offensichtlich machte die Hausherrin ihrem Unmut gegenüber einer weiblichen Angestellten wieder einmal gehörig Luft – und keineswegs nur verbal.
Das nahmen die Männer zumindest an, denn dem zornigen Ausbruch pflegte in aller Regel lautes Wimmern zu folgen, wie man es nur von geprügelten Weibern oder Kindern hören konnte.
Von Kindern fand sich in diesem Haushalt allerdings keine Spur. Der Hausherr, ein, wie man sich erzählte, sehr vermögender Kaufmann mit besten Verbindungen zum Hof und nach Übersee, hatte vor einigen Monaten mit bereits Ende fünfzig eine um fünfunddreißig Jahre jüngere, kinderlose Frau mit Namen Estelle geheiratet, die bisher noch keine Anzeichen einer Schwangerschaft zeigte.
»Vielleicht ist der feinen Madame das Leben mit ihrem Alten zu fad – vor allem die Nächte – und sie lässt deshalb ihre miese Laune an einer Magd aus«, mutmaßte ein Steineklopfer leise zu einem Kollegen, der fleißig Mörtel anrührte. Er redete mit gedämpfter Stimme, denn der Vorarbeiter reagierte ausgesprochen unwirsch, sobald er seine Leute beim »Getratsche« erwischte. Er war im Stande und ließ den Betreffenden den ohnehin nicht allzu üppigen Lohn zur Strafe noch mehr kürzen.
Die junge, rotblonde und auffallend kurvenreiche Kaufmannsgattin war vor etwa einem halben Jahr in das wunderschöne Haus eingezogen. Niemand kannte sie oder wusste, woher genau sie stammte. Jedenfalls schien Madame Estelle selbst nicht ganz unvermögend gewesen zu sein.
Immerhin besaß sie eine eigene leichte Kalesche mit Faltverdeck, die sie an warmen sonnigen Tagen zum Ausfahren benützte, sowie eine protzige Kutsche samt zwei Pferden. Zudem hatte sie ihren eigenen Kutscher in die Ehe eingebracht, der ihr auch als »Leibdiener« zu Diensten war, ein Bursche Mitte zwanzig, ein Riese namens Hassan mit »maurischem Aussehen«; dazu eine hässliche alte Frau als engste Vertraute und Zofe. Gerüchten zufolge sollte es sich um ihre ehemalige Amme handeln.
Außenstehende bekamen Hassan kaum zu Gesicht; gerüchteweise sollte er allerdings eine tiefschwarze Hautfarbe haben …
Genaues wusste niemand so recht, auch nicht die Hausdiener, denn der Bursche trug nicht nur einen riesigen Turban auf dem Kopf, der möglicherweise sein Kraushaar verdeckte, sondern verbarg sein Gesicht stets hinter einem Seidentuch, passend zu seinem jeweiligen Anzug. Ob das eventuell entstellenden Pockennarben, Verätzungen, Schnittverletzungen oder der Hautfarbe geschuldet war, vermochte niemand zu sagen.
Hassan sprach kein Französisch – und auch sonst keine Sprache, da er angeblich von Geburt an stumm war. Womit er unter den anderen Bediensteten hervorstach, war auch seine Kleidung. Madame Estelle schien viel daran zu liegen, ihren Leibdiener mit seidenen Wämsern und Pluderhosen in grellleuchtenden Farben auszustaffieren …
Bald nach Madame Estelle Didiers spektakulärem Einzug hatte das allwöchentliche zänkische Geschrei seinen Anfang genommen, das jeweils mit dem verzweifelten Schluchzen einer jungen weiblichen Person endete.
»Nimmt mich wunder, dass es bei der schrecklichen Hexe überhaupt noch eine Dienstmagd aushält«, murmelte einer der älteren Maurer, der bereits seit Baubeginn der Sainte-Madeleine-Kirche zu den Beschäftigten auf der Großbaustelle gehörte.
»Das ist gar nicht so verwunderlich«, widersprach ein anderer. »Jetzt, wo nach dem Sturm auf die Bastille so viele Adelsfamilien das Weite suchen, stehen plötzlich haufenweise Domestiken auf der Straße, ohne Anstellung, ohne Unterkunft und Brot. Welches junge Ding kündigt da schon freiwillig? Besser hin und wieder Prügel einstecken, als auf den Strich zu gehen oder auf der Straße an Hunger zu verrecken!«
Dem war schwerlich etwas entgegenzuhalten.
»Mir ist aufgefallen«, warf ein Dritter nachdenklich ein, nachdem er sich erst umgesehen hatte, ob sich womöglich der Polier in der Nähe aufhielt, »dass das Wutgeschrei der Bürgerin Didier und das anschließende Gejammer der Gescholtenen nur zu hören sind, wenn der Hausherr nicht daheim ist!«
»Wahrscheinlich verträgt der Alte den Krach und das Gekeife seiner Frau nicht mehr!« Damit hatte der Mörtelrührer die Lacher auf seiner Seite.
Ein anderer Arbeiter widersprach. »Nein, nein, Leute! Irrtum! Ich hab’ schon öfters eine Weibsperson laut weinen gehört und da war der vornehme Herr garantiert daheim!«
»Wer weiß schon, was bei den reichen Leuten so abgeht? Wenn wir es wüssten, wären wir vermutlich schockiert!«, fügte ein weiterer Handwerker hinzu. »Geld allein macht bekanntlich weder glücklich, noch verbessert es den Charakter!«
Entree
In der Osterfastenzeit 1790
»Jetzt ist aber mal gut, Monsieur le Commissaire! Drei, ja, sogar vier Weibsbilder kümmern sich im Augenblick um Ihre Ginette! Das wird ja wohl reichen für einbébé, das jetzt das Licht der Welt erblicken wird! Glauben Sie mir, wir Kerle stören dabei nur. Bei vier eigenen Kindern weiß ich, wovon ich rede!«
Den letzten Satz hat der Hausherr, Hubert Aubriacs Onkel, der Bauer Jacques Carrière, deutlich weniger brummig geäußert als die Bemerkungen zuvor. Mit den »Weibsbildern« meinte er die Dorfhebamme, Madame Huguette, eindeutig die wichtigste des Quartetts, ferner Ginettes Großmutter Céléstine Madrier, dann seine eigene Frau Claire, Huberts Tante, sowie Marie Aubriac, Huberts Frau und beste Freundin der in den Wehen liegenden Ginette Lavalle.
Marie war selbst vor gar nicht langer Zeit Mutter eines kleinen Jungen geworden, der nach seinem Großonkel »Jacques« getauft worden war, aber von der Familie »Jacquot« genannt wurde.
Mit »störenden Kerlen« meinte er sich selbst, seinen Neffen Hubert, aber vor allem den werdenden Vater, Armand Lavalle, Kriminalkommissar, vor Kurzem befördert zum »CommissaireSupérieur de la Police de la Commune de Paris« – und Huberts bester Freund.
Nie würde Onkel Jacques es wagen, Armand Lavalle, »diesen extrem wichtigen Mann« zu duzen, obwohl Armand ihm schon Dutzende Male angeboten hatte, ihn bei seinem Vornamen anzusprechen und die Förmlichkeiten beiseitezulassen. Der Respekt des schlichten Landmannes war einfach zu groß. Selbst dessen Frau Ginette hatte er vom ersten Augenblick ihrer Begegnung an nur mit »Madame Lavalle« tituliert.
Jacques Frau Claire sah das entschieden lockerer. Sie war eine kleine rundliche Bauersfrau mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Mehr noch als die etwas betuliche Wehmutter Madame Huguette, verstand sie es beispielsweise, Ginette, der Erstgebärenden, die Angst vor der Geburt zu nehmen.
»Klar, es wird saumäßig wehtun, Schätzchen«, sagte sie ihr unverblümt. »Da will ich dir gar nichts vormachen! Aber du bist jung, gesund und stark, Kindchen. Umbringen wird’s dich sicher nicht. Die Schmerzen gehen vorüber. Und wenn das Kleine endlich draußen ist, hast du auch schon vergessen, wie hundsgemein die Wehen sich angefühlt haben. Da geb’ ich dir meine Hand drauf, Kleines!
Was will man machen«, hatte sie dann noch beinah philosophisch hinzugefügt, »keiner von uns weiß, was der Herrgott sich wohl dabei gedacht hat, dass die Kinder durchs selbe enge Loch hinausschlüpfen müssen, durch das sie neun Monate zuvor hineingekommen sind!«
Als es dann richtig »ernst geworden war«, hatte Huberts Tante Claire für Ginette noch den guten Rat gehabt, sich bloß nicht davor zu genieren, laut zu brüllen. »Es ist der größte Blödsinn, wenn die Weiber meinen, vor lauter falsch verstandener Tapferkeit das Schreien unterdrücken zu müssen!«
Dieses Mal nickte Madame Huguette ganz nachdrücklich. »Ganz recht, mein liebes Kind! Wer das Plärren gewaltsam unterdrückt, verkrampft sich bloß. Und das ist gerade das Gegenteil von dem, was bei einer Entbindung so wichtig ist: Entspannung aller Muskeln im Unterleib!«
Noch war Ginette recht guter Dinge. »Wird schon schief gehen«, meinte sie burschikos. Und speziell an ihren vor Nervosität zappeligen Ehemann Armand gewandt: »Vergiss nicht, chéri, ich bin schließlich nicht die erste Frau, die niederkommt!«
Bauer Jacques Carrière packte Armand Lavalle resolut am Ärmel und zog ihn aus der Kammer. »Lassen Sie uns zusammen mit meinem Neffen Hubert in der Dorfkneipe was trinken gehen und die Frauen in Ruhe! Die schaffen das schon!«
Wer auf politische Entspannung gehofft hatte, nachdem der Hof im Spätherbst samt Königspaar und Nationalversammlung von Versailles in die Hauptstadt Paris übergesiedelt war, wurde arg enttäuscht.
Dass Ludwig XVI. praktisch »vom französischen Volk« zur Rückkehr gezwungen worden war, wurde blumig umschrieben mit: Seine Majestät, der König, habe sich auf Bitten seines geliebten Volkes dazu entschlossen …
Das war nichts als gut gemeinte Schönfärberei. Die Wahrheit sah ganz anders aus.
Des Königs Umzug aus dem idyllisch gelegenen Versailles ins brodelnde Paris war alles andere als angenehm gewesen. Das pure Gegenteil war der Fall. Für alle Beteiligten hatte es sich um blanken Horror gehandelt. Unterwegs hatte ständig die Gefahr bestanden, aufgehetzten und aufs Äußerste erbosten Rebellenhaufen könnte es gelingen, die königliche Karosse anzugreifen und den in ihren Augen für die Misere verantwortlichen Monarchen gewaltsam aus dem Gefährt zu zerren und »zur Verantwortung für das Elend des Volkes zu ziehen« … Stundenlanges Gebrüll und Getöse hatten an den Nerven der Majestäten und der königlichen Entourage gezerrt.
Die verängstigte und um ihre Sicherheit zu Recht besorgte Königin Marie Antoinette war außer sich, dass ihr Gemahl nicht auf sie gehört und in Versailles geblieben war. Aber das nutzte ihr jetzt nichts mehr. Der demütigende Spießrutenlauf zog sich über viele Stunden hin, weil es immer wieder durch aufgebrachte Volkshaufen zu Störmanövern kam. Erschwerend kam hinzu, dass Seine Majestät verboten hatte, auf das Volk zu schießen …
Auch nachdem Ludwig XVI. in der Hauptstadt angekommen war, rebellierte »das Volk« munter weiter. Die Aufrührer, die die Leute zu massiven Straftaten animierten, waren dieselben, die zuvor die Anwesenheit des Königs so lautstark gefordert hatten. Aus unerfindlichen Gründen ließ man sie ungestraft gewähren.
Der König in seiner Naivität glaubte nämlich, der Aufruhr würde sich bald von selbst legen; so sei es am klügsten, den momentanen Unruhen möglichst wenig Beachtung zu schenken.
Verschiedene Hetzblätter, allen voran Jean-Paul Marats »Ami duPeuple«, sowie J. R. Héberts »Pére Duchesne«, verspritzten nach wie vor ihr ätzendes Gift und die Polizei war weitgehend machtlos. Sie wurde zur rechten Zeit lächerlich gemacht durch Veröffentlichungen von Szenarien, bei denen Ordnungshüter sich vor der »Übermacht des Volkes« zurückziehen und tatenlos Plünderungen, Gebäude- und Sachbeschädigungen und massiven Beleidigungen hatten zusehen müssen; ja, auch Körperverletzungen und sogar (angeblich) »politisch motivierte« Morde hatte die Polizei nicht zu verhindern vermocht.
Stammte doch von Seiner Majestät höchst persönlich die Parole: »Niemand vergreife sich mit Waffengewalt an einem französischen Bürger!«
Unter diesen Umständen war es kein Wunder, dass der Überdruss unter Lavalles Kollegen immer größer wurde.
»Wir sollen uns nicht mal wehren dürfen, wenn uns der Pöbel mit Steinen und Holzprügeln angreift! Sind wir Polizisten etwa keine französischen Bürger? Verdienen wir vielleicht keinen Schutz?«
Diese Frage war selbstverständlich rein rhetorisch gemeint. Die Ordnungshüter scherten sich in aller Regel keinen Deut um Ludwigs unverständliche Anweisung und lieferten sich manch heftiges Gefecht mit dem rebellischen Mob.
Wobei sie allerdings immer häufiger den Kürzeren zogen – weil ihre Anzahl im Vergleich zu der ihrer Angreifer viel zu gering war. Meist zog sich die Polizei nach einiger Zeit zurück, wobei sie allzu oft schwer verletzte Kameraden mitzuschleppen hatte …
Ginettes Niederkunft sollte um den 15. März herum stattfinden, weshalb Lavalles Urlaubsbeginn Ende Februar goldrichtig gewesen war. Eigentlich hätten er und Aubriac die Reise bereits Mitte Februar antreten dürfen, aber sie hatten diese um zwei Wochen nach hinten verschoben, um Lavalle nach Ginettes Niederkunft noch mehr Zeit gemeinsam mit Frau und Kind zu verschaffen. Am 28. Februar 1790 hatte der Kommissar sich mit seinem Freund Hubert Aubriac nach Mussidan im Périgord aufgemacht.
Beide Männer hatten große Sehnsucht empfunden. Hubert nach seiner Frau Marie und seinem kleinen Sohn Jacquot und Armand nach Ginette, die bald ihrem ersten gemeinsamen Kind das Leben schenken sollte.
Der Kommissar hatte inständig gehofft, rechtzeitig zur Geburt vor Ort zu sein.
»Was ist, wenn das bébé früher kommt?«, hatte er daheim in Paris seinen Freund Hubert wohl schon Hunderte Male genervt.
»Verlass’ dich drauf, mon Ami, die Hebamme wird den Geburtstermin schon richtig berechnet haben! Diese Wehmütter verstehen ihr Geschäft. Auch diejenigen auf dem Dorf!«, hatte Hubert, Premier Sécrétaire beim Commandant Général, Guy Laroche, dem obersten Chef der Pariser Polizeibehörde, seinen Freund immer wieder mit bemerkenswerter Geduld beruhigt.
Eigentlich konnten die jungen Männer ihr Glück immer noch nicht recht fassen, dass Laroche, ein strammer bürgerlicher Parteigänger der Bourbonen, trotz des ihm vorauseilenden Rufes, ein gefühlloser Leuteschinder zu sein, ihnen einen vierwöchigen Urlaub – noch dazu an einem Stück! – bewilligt hatte. Der schlechten Zeiten und der üblen Vorkommnisse zum Trotz, die sich tagtäglich auf den Straßen der Hauptstadt ereigneten.
»Das ist allein dein Verdienst, Armand!«, behauptete Hubert Aubriac auch jetzt noch. »Du hast schließlich so bravourös den Fall des widerlichen ›Seine-Mörders‹ gelöst! Da war es ein Akt der verdienten Anerkennung, weil du diesem Aristokratenschwein, dem Comte de Montmorency, auf die Schliche gekommen bist, dass dir Laroche die freien Tage nach mehr als zwei Jahren Dienst an einem Stück gegönnt hat!«
Armand Lavalle wehrte das Lob seines Freundes dann immer als übertrieben ab – aber insgeheim freute es ihn doch und machte ihn auch ein wenig stolz. Es stimmte ja, leicht war es nicht gewesen, dem Haushofmeister des Königs, Monsieur Alphonse, dem Schlächter armer, vom Hunger geplagter Handwerksburschen und zahlloser arbeitsloser junger Kerle, das Handwerk zu legen. Immerhin war Lavalle sogar so weit gegangen, sich dem Täter selbst als »Opfer« anzubieten …
Während der gemächlichen Reise hatte Armand seinem Freund einen Vorschlag gemacht. Der Kutschwagen hatte eine Fuhre an Töpferwaren, Flechtkörben und eine Riesenmenge an Trüffeln für die königliche Küche nach Paris geschafft und war jetzt auf der Leerfahrt zurück ins Périgord.
Der Kutscher, ein recht fideler Bursche, war froh darüber gewesen, zwei »Herren der Polizei« befördern zu dürfen. So hatte er sich gleich um vieles sicherer gefühlt. Schließlich hatte er eine ansehnliche Summe an Geld mit sich geführt, den Erlös für die in die Hauptstadt gelieferten Waren. In diesen schlechten Zeiten war ständig mit Überfällen zu rechnen …
Armands Vorschlag war folgender gewesen:
»Wir wollen während des Aufenthalts bei deinen Verwandten kein Wort mehr über die miesen Zustände in Paris, in ganz Frankreich und vor allem nicht über unsere Arbeit verlieren! Wir wollen uns nur ganz ungestört unseren Liebsten widmen und unser Glück als Ehemänner und junge Väter genießen! Hand drauf!«
»Einverstanden, mein Lieber. Hand drauf!«
Auch Aubriac war es ernst gewesen mit dem Versprechen – wenn er auch bezweifelt hatte, ob sie es würden einhalten können. Er kannte doch seine Tante und vor allem seinen Onkel! Die Dörfler waren neugierig und würden natürlich ganz genau wissen wollen, wie es in der Hauptstadt zuging. Gerüchte über die katastrophalen Zustände waren auch bis ins Périgord gedrungen.
Insgeheim war auch Lavalle klar gewesen, dass er sich der Wissbegier von Huberts bäuerlichen Verwandten nicht so ohne Weiteres würde entziehen können: Immerhin war die Familie Carrière so liebenswürdig gewesen und hatte neben ihrer angeheirateten Nichte Marie Aubriac und ihrem Söhnchen Jacques auch seine schwangere Ginette und Grandmère Céléstine Madrier, die alte, aber immer noch sehr rüstige Pariser Blumenfrau, bei sich aufgenommen.
Lavalle war fest entschlossen, sich dafür mit einem ansehnlichen Betrag erkenntlich zu zeigen – und zwar mit »richtigem« Münzgeld und nicht mit den sogenannten »Assignaten«, diesem windigen Papiergeld, das Monsieur Necker, des Königs schweizerisches »Finanzgenie«, neuerdings in Umlauf gebracht hatte – und das kein anständiger Kaufmann annehmen wollte.
Er war heilfroh, seine geliebte Ginette bei anständigen Leuten auf dem Land zu wissen, wo es doch um vieles humaner und zivilisierter zuging als im derzeit komplett verrückt gewordenen Paris.
Etwa zwei Wochen nach Ginettes Niederkunft wollten die Freunde Armand und Hubert dann wieder zurück an ihre Arbeitsstätte reisen, um der zunehmend komplizierter werdenden Polizeiarbeit nachzugehen. Ihre Frauen und Kinder, auch Ginettes Großmutter sollten noch auf dem Bauernhof bleiben, »bis die Lage in Paris sich gebessert hätte«.
So jedenfalls hatte der wohldurchdachte Plan ausgesehen.
Anfang März 1790
Das Wiedersehen der beiden Ehepaare Lavalle und Aubriac hatte sich erwartungsgemäß ausgesprochen glücklich gestaltet, ja, geradezu überschwänglich. Und äußerst tränenreich. Letzteres war jedoch nicht etwa der Trauer, sondern nur der übergroßen Freude geschuldet gewesen.
Der Besuch ihrer Ehemänner war sowohl für Marie Aubriac, als auch für Régine Lavalle, gänzlich überraschend erfolgt. Die Frauen hatten keineswegs damit gerechnet, dass man in diesen Zeiten ihren Männern Urlaub gewähren würde. Das großartige Ereignis hatte sich für alle Beteiligten angefühlt »wie Ostern und Weihnachten zusammen«.
Selbst Großmutter Céléstine, im Normalfall mitnichten zu Sentimentalitäten neigend, hatte sich immer wieder über die nassen Augen gewischt. Und als sie gehört hatte, dass ihr einziger Enkelsohn Luc, von Hause aus ziemlich faul und orientierungslos, jetzt tatsächlich eine Lehre bei einem angesehenen Rechtsanwalt und Notar, nämlich Maître Philippe Danube, in Aussicht hatte, hatte ihre Erleichterung keine Grenzen gekannt.
Armand, total verlegen, hatte es partout nicht vermocht, die alte Frau davon abzuhalten, ihm vor Dankbarkeit die Hände zu küssen. Er war gar nicht dazu gekommen, damit herauszurücken, dass Luc das Angebot gar nicht gleich annehmen, sondern stattdessen noch einmal versuchen wollte, als königlicher Gärtnerbursche anheuern zu können. Nachdem sein Schwager den Massenmörder junger Männer aus dem Verkehr gezogen hatte, sah er keinen Grund mehr, sich bedroht zu fühlen. Und die Arbeit als Gärtner erschien ihm weniger aufreibend, als sich in komplizierte Gesetze und Vorschriften einzuarbeiten …
»Gott segne dich, Armand! Dir ist es zu verdanken, dass unser Faulpelz und Tagträumer Luc endlich Vernunft angenommen hat und sich bemühen will, etwas aus seinem Leben zu machen! Merci tausendmal, mein Lieber!«
In seinem Innersten war Lavalle skeptisch, ob der bald Fünfzehnjährige das nötige Durchhaltevermögen aufbringen und nicht schon bald »den Krempel hinschmeißen« würde, weil ihm »die Anstrengung« in den königlichen Gärten viel zu groß war. Aber immerhin hatte er dem Jungen, bildlich gesprochen, schon ziemlich kräftig »in den Arsch getreten«, damit der ja nicht glauben sollte, er könne sein Leben lang erst seiner Großmutter und anschließend seiner älteren Schwester Ginette – und damit auch ihm selbst! – auf der Tasche liegen.
Aber jetzt war der Kommissar hauptsächlich am Zustand seiner Liebsten interessiert. Die schob mittlerweile einen gewaltigen Kugelbauch vor sich her; ihre Brüste waren auch um etliches größer geworden; Ginettes Gang war behäbig und ihre Bewegungen um einiges weniger flink als früher, sondern eher gemächlich. Sogar ihr schönes schmales Gesicht war nun voller und ihre Augen strahlten förmlich mit der Sonne um die Wette, als sie ihren Mann nach vielen Wochen wieder umarmte.
»Mir geht es ausgezeichnet, chéri!«, hatte die werdende Mutter bereits zum x-ten Mal wiederholt und »glaub’ mir, Schatz, mir fehlt es hier an nichts. Nur du fehlst mir natürlich«, hinzugefügt. »Aber jetzt bist du ja da! Nie hätte ich mir träumen lassen, dass dein Vorgesetzter dir so lange Urlaub gewährt: einen ganzen Monat! Unglaublich großzügig von ihm!«
Auch Marie Aubriac, deren kleines Söhnchen in der Landluft prächtig gedieh, hatte sich unbändig gefreut, endlich wieder ihren Hubert bei sich zu haben.
Wie seit Monaten würden Ginette und Marie die Nächte nicht mehr gemeinsam in einer Kammer, zusammen in einem großen Bett, verbringen. Jede sollte mit ihrem Liebsten in einem Bett – und in einem eigenen kleinen Zimmer schlafen. Dafür hatte Huberts Tante Claire gesorgt, die kurzerhand Grandmère Céléstine zu einer ganz jungen Magd in eine Dienstbotenkammer umquartiert hatte.
Ein Arrangement, das alle Beteiligten sichtlich zufriedenstellte. Sogar Grandmère war damit einverstanden gewesen: »Die Liebe hat immer Vorrang«, verkündete die alte Blumenhändlerin vom Pariser Marché aux Fleurs mit verschmitztem Augenzwinkern.
Die Pariser Hebamme, Madame Héloise, aus dem Quartier in dem der Kommissar und Ginette wohnten, hatte den Tag von Ginettes Niederkunft auf etwa Mitte des Monats März festgelegt. Madame Huguette, die Dorfwehmutter, hatte diesen Termin auch im Großen und Ganzen bestätigt.
»Am 15. März, plusminus ein oder zwei Tage, wird es so weit sein«, prophezeite sie bei der üblichen Untersuchung der werdenden Mutter.
»Es sind bloß noch etwa zwei Wochen bis dahin, chérie. Meinst du wirklich, wir können es wagen, uns zu lieben?«, erkundigte Armand sich ängstlich, als beide endlich, eng umschlungen, auf der weichen Matratze lagen. Er hatte große Bedenken, seiner Liebsten »zu nahe« zu kommen … Aber Ginette gelang es ohne Weiteres, seine diesbezüglichen Bedenken zu zerstreuen.
»Ich habe mit Madame Huguette darüber gesprochen, Schatz! Natürlich darfst du dich nicht auf meinen Bauch legen! Aber wenn wir auf der Seite liegen und du von hinten zu mir kommst, und nicht allzu wild zustößt, kann eigentlich nichts schiefgehen«, erklärte sie ihm ganz sachlich. »Glaub’ mir, es wird uns beiden ungeheuer guttun!«
Armands Zweifel hatten sich im Nu in Luft aufgelöst; diesem Argument konnte und wollte er sich nicht verschließen.
Entspannt, glücklich und zufrieden waren beide anschließend dicht aneinander gekuschelt eingeschlafen.
Endlich hatte das nervige Warten ein Ende. Am 17. März 1790 schenkte Régine Lavalle ihrem Mann ein gesundes, bezauberndes Töchterchen. Kaum tat der Winzling seinen ersten Schrei, stürzte der Kommissar, der es nicht lange im Dorfgasthaus – wohin man ihn hatte verbannen wollen – ausgehalten hatte, von der Küche in die Schlafkammer der Carrières.
Die war großzügig von der Bauersfrau Claire für die Niederkunft zur Verfügung gestellt worden. Allerdings wurde der frischgebackene Vater von der Wehmutter bereits an der Schlafstubentür energisch hinauskomplimentiert. Zuerst galt es, die Mutter zu waschen und frisch einzukleiden und das Kind, nach einer genauen Inspektion, »ob alles seine Ordnung hat«, zu säubern, zu wickeln, das Bett frisch zu beziehen und – vor allem – den mit allerlei schlechten Gerüchen geschwängerten Raum gründlich zu lüften.
Nach altem Brauch, dem man vor allem auf dem Land immer noch huldigte, unterblieb Letzteres während des gesamten Geburtsvorgangs, um »bösen Geistern keinen Einlass zu gewähren« … Da eine Entbindung sich häufig über viele Stunden hinzog, war der Gestank zuletzt kaum mehr erträglich.
»Wartet bitte, Monsieur, bis ich Sie rufen lasse!« verlangte die Hebamme von dem ungeduldigen Kommissar. »Verraten kann ich Ihnen aber schon vorab, dass alles gut gegangen ist. Mutter und Tochter sind gesund. Ich beglückwünsche Sie von ganzem Herzen, Monsieur le Commissaire Supérieur. Aber haben Sie bitte noch ein wenig Geduld!«
Dass alles gut verlaufen war, das hatte Lavalle vor allem hören wollen. Seinetwegen konnten sich die Damen jetzt ruhig alle Zeit der Welt nehmen, um Ginette und sein bébé »präsentabel« herzurichten. Wie immer wunderte er sich ein bisschen, dass auf dem Land offenbar immer noch die verpönte Anrede Madame und Monsieur üblich war und nicht wie in der Hauptstadt »Bürger« oder »Bürgerin«.
Teil 1
23. März 1790
Der gewährte Sonderurlaub war leider schneller vorbei als gedacht. Überraschend, nämlich eine ganze Woche früher als geplant, erreichte Lavalle das schriftliche Ersuchen seines obersten Vorgesetzten, »so schnell es nur irgendwie geht, ins Kommissariat zurückzukehren. Gewisse Umstände, bla, bla, bla …«
Wie gewünscht war der Kommissar schnellstens auf seinen Posten zurückgekehrt. Auch sein Freund war selbstverständlich mit ihm nach Paris zurückgereist. Beide hatten ihre Familien bei Huberts Verwandten auf dem Dorf zurückgelassen. Dort erschien es ihnen um vieles sicherer zu sein als in der Hauptstadt. Die Freunde waren sich einig, dass Paris derzeit für junge Frauen und Kinder ein viel zu gefährliches Pflaster war.
Der Kommissar, mittlerweile Vater einer entzückenden kleinen Tochter, Lucille Marie, schwebte nach wie vor in den Wolken und der Abschied von Frau und Kind war ihm wahrlich nicht leicht gefallen.
Auch Ginettes Großmutter, Céléstine Madrier, war wieder zurück in Paris. Lavalle hätte es zwar viel lieber gesehen, wenn Céléstine noch bei den freundlichen Bauersleuten auf dem Land geblieben wäre. Aber die alte Frau hatte ihren eigenen Kopf und konnte entsetzlich hartnäckig sein.
Um keinen Preis der Welt wollte sie noch länger in Mussidan verweilen. Sie vermisste ihren Stand und ihre Arbeit als Blumenhändlerin auf dem Marché aux Fleurs, die vielen Menschen (selbst wenn sie mittlerweile die meisten von ihnen geradezu verabscheute!), die heimeligen Gassen und verwunschenen Plätze von Paris, die wunderbaren Kirchen – vor allem »Notre Dame« – und natürlich »Les Halles«, die berühmten Markthallen samt ihrer legendären Auswahl an Fisch, Obst, Wein, Gemüse, Fleisch- und Backwaren. Auch wenn das Sortiment inzwischen jämmerlich geschrumpft war und die gelieferten Mengen von Tag zu Tag kärglicher ausfielen.
Sogar die penetranten Rauchschwaden aus den unzähligen Kaminen vermisste Céléstine, ebenso wie in der wärmeren Jahreszeit den Gestank der Seine, die nicht selten für jede Art von Unrat als Kloake herhalten musste– häufig für tote Tiere oder sogar für menschliche Leichen.
Armand hatte Ginette beim tränenreichen Abschied versprechen müssen, ein Auge auf ihre geliebte Grandmaman zu haben, genauso wie auf ihren »kleinen« Bruder Luc.
Nachdem der »Grand Maître de la Maison du Roi«, Monsieur Alphonse, Conte de Montmorency, ein überführter Massenmörder von rund sechzig jungen Männern, glücklicherweise nicht mehr existierte, hatte Luc während Lavalles Abwesenheit tatsächlich einen erneuten Vorstoß gewagt und sich erneut als königlicher Gärtnergehilfe für die Tuileriengärten beworben.
Und dieses Mal sogar mit Erfolg!
Aber bereits nach wenigen Tagen hatte er von der anstrengenden Arbeit die Nase voll gehabt – genau wie Lavalle es vorausgeahnt hatte.
»Das ewige Hacken, Unkrautzupfen, Gießen, Verpflanzen und Bäume- und Sträucherstutzen ist nichts für mich«, hatte der Junge in wehleidigem Ton seinem Schwager Armand mitgeteilt; zugleich mit der Nachricht, er habe mit sofortiger Wirkung den »anödenden« Dienst beim zuständigen Hofbeamten aufgekündigt.
Um Lavalles zorniger Reaktion zuvorzukommen, hatte er den Kommissar gebührend mit der Ankündigung überrascht, er wolle jetzt doch gerne dessen Angebot annehmen, sich für ihn bei einem renommierten Juristen um eine Anstellung als Gehilfe und Lehrling zu verwenden.
Und siehe da! Jetzt bewährte er sich bereits seit einigen Tagen in der Ausbildung bei Maître Philippe Danube, der dem Kommissar seit Längerem noch einen Gefallen geschuldet und sich bereit erklärt hatte, probeweise den jungen Burschen als Auszubildenden und Notarsgehilfen anzunehmen.
Als Armand nach seiner Rückkehr nach Paris erneut mit Ginettes Bruder, der künftig bei seinem Lehrherrn ganz allein ein winziges Kämmerchen unterm Dach würde bewohnen dürfen, zusammentraf, verkündete der Junge, er habe durch einen glücklichen Zufall die Bekanntschaft mit einem gewissen André de Junot gemacht! Der wäre ausgesprochen nett; außerdem Page Seiner Majestät des Königs. »Wir sind schon gute Freunde geworden!«, konnte er Lavalle berichten.
Über diese Entwicklung war der Kommissar mehr als erfreut. Er kannte André ja sehr gut und hielt eine Menge von dem jungen Adelssprössling. Wie der junge Mann sich trotz des Missbrauchs durch seinen Vorgesetzten, den »Grand Maître«, zu einem grundanständigen, »normalen« jungen Menschen entwickelt hatte, imponierte Lucs Schwager ungemein.
›Wenigstens läuft es im Augenblick in meinem privaten Umfeld recht gut‹, dachte Armand Lavalle mit Erleichterung. Was er vom Beruflichen derzeit leider nicht behaupten konnte …
Gleich nach seiner und Huberts Ankunft im Kommissariat – ein früheres königliches Palais – hatte sie ihr oberster Vorgesetzter, Guy Laroche, Commandant Général de Police, bürgerlicher Nachfolger des zurückgetretenen Comte de Belfort, gemeinsam zu sich beordert. Bekanntlich hatte der Comte als Adliger noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und sich aufs Land und ins Privatleben zurückgezogen …
Laroche genoss leider immer noch bei vielen Kollegen den Ruf eines gnadenlosen Ausbeuters – ein sehr ungerechtes Urteil, das mittlerweile jedoch weder Lavalle noch Aubriac bestätigen konnten. Auch Laroches deutliche Sympathie für die Bourbonen war keineswegs fanatisch blind. Er sah durchaus, wo es hakte …
Genau genommen hatte mit ihm im Polizeigebäude am Quai des Orfèvres eine deutlich humanere Atmosphäre Einzug gehalten, als dies jemals zuvor bei seinem Vorgänger der Fall gewesen war.
Nach der freundlichen Begrüßung der beiden »Urlauber« und den ehrlich gemeinten Glückwünschen für den zum ersten Mal Vater gewordenen Armand Lavalle, verschwand Aubriac gleich in seinem kleinen Kabuff nebenan, um sich dem inzwischen meterhoch angewachsenen Aktenberg zu widmen. Der oberste Chef wirkte angespannt, fand er. Wahrscheinlich hatte er wieder einmal einen ganz speziellen Fall für seinen Freund Armand auf Lager …
»Mein Lieber«, hatte Laroche den Kommissar in der Tat gleich überfallen, »es gibt einen weiteren Mordfall! Deswegen habe ich Sie aber nicht vorzeitig aus Ihrem Urlaub zurückgebeten. Morde passieren ja ständig. Aber dieses Mal handelt es sich um ein ganz abscheuliches Verbrechen an einem noch sehr jungen Mädchen. Über die Tote ist uns leider bisher noch nichts bekannt.
Das zu ändern, könnte aus mehreren Gründen ziemlich schwierig werden: Die nackte Leiche hat man nämlich gewaltsam zusammengestaucht, indem man ihre Hals- und Lendenwirbelsäule, sowie vor allem die Oberschenkelknochen durch Axthiebe durchtrennt und zerstückelt hat, was bedauerlicherweise schon eine Aussage über ihre Körpergröße erschwert.
Anschließend hat der Täter den Körper in einen Ledersack eingenäht, nachdem er zuvor die einzelnen Teile der Leiche mit einem Strick fest verschnürt hat. Die Kopf- und Schamhaare der Toten sind ratzekahl abrasiert; ferner wurden ihre Augäpfel, sowie Nase und Lippen verätzt. Überdies hat man ihr noch die Brüste abgeschnitten …«
Lavalle, der ja einiges an Grausamkeiten gewöhnt war, musste kräftig schlucken. O Gott! Nicht schon wieder! Tat sich hier womöglich eine Parallele zu dem perversen »Seine-Mörder« auf, der vor gar nicht langer Zeit junge Burschen grausam abgeschlachtet, gehäutet und verstümmelt hatte?
Es war Lavalle nichts anderes übrig geblieben, als in die Salpêtrière zu gehen, um die kläglichen Überreste der armen jungen Frau persönlich in Augenschein zu nehmen.
Im Keller dieses Krankenhauses wurden die Leichen Unbekannter, meist von Selbstmördern oder Mordopfern, eine Weile gelagert, bis eine entsprechende Amtsperson, in aller Regel ein extra dazu bestellter Mediziner, sie gründlich untersucht und freigegeben hatte. Gelegentlich waren es Angehörige, die die Herausgabe verlangten, um die gewaltsam zu Tode Gekommenen wenigstens anständig zu beerdigen.
Entfiel Letzteres – was meistens der Fall war – wartete auf sie ein Armengrab in einer unauffälligen Ecke des »Cimetière PèreLachaise«, einem Friedhof, auf dem auch berühmte französische Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe fanden.
Vor diesem Teil der Polizeiarbeit, der Inaugenscheinnahme von in den meisten Fällen bereits stark verwesten, oder durch Tierfraß zerstörten Körpern, fürchtete sich insgeheim jeder Ordnungshüter.
Auch Lavalle, der schon einiges in seinem Berufsleben an gräulich zugerichteten Leichen gesehen hatte, musste seinen Ekel gewaltsam unterdrücken und zugleich seine Wut auf den bis dato unbekannten Täter.
Beinahe hätte er sich übergeben beim Anblick der verstümmelten Toten. Er war heilfroh, als der Angestellte des Krankenhauses die mühsam zusammengesetzten Überreste eines ehemals lebensfrohen jungen Mädchens, das seine ganze Zukunft noch vor sich gehabt hätte, erneut mit einem grauen Laken bedeckte und so das Grauen gnädig unter dem Tuch verschwinden ließ.
Alle Befragungen, jegliches Herumstochern und sogar das oft sehr hilfreiche Fischen im Trüben bezüglich des ermordeten Mädchens blieben leider erfolglos.
Auch Mère Brassens, die ehemalige Prostituierte mit dem goldenen Herzen und einer stillen Vorliebe für Lavalle, der sie stets höflich und respektvoll behandelte, konnte dieses Mal nicht weiterhelfen. Junge Dinger verschwanden nun mal beinah regelmäßig, um bald darauf gesund und munter wieder aufzutauchen.
Aber die Alte, eine gute Bekannte Lavalles, die beste Verbindungen zur Pariser Halb- und Unterwelt pflegte, versprach, weiterhin ihr Bestes zu geben und ihre zwielichtigen Bekannten auszuhorchen.
»Ein Raubmord ist auszuschließen«, glaubte der Kommissar. »Das Mädchen besaß nichts außer ihrem hoffnungsvollen Leben, einem gewiss hübschen Gesicht und einem vermutlich wohlgeformten Körper. Und alles drei hat man der Kleinen genommen und sinnlos zerstört … Irgendein Irrer muss sich an der Ärmsten zu schaffen gemacht haben!«
Lavalle, der sich selbst gern für abgebrühter hielt, als er es tatsächlich war, war sichtlich erschüttert.
Letzteres hatte auch sein direkter Vorgesetzter, Émile Béguin, Capitaine de Police, gemerkt, als er dem Kommissar auf dessen Rückweg vom Leichenschauhaus ins Kommissariat begegnet war.
»Welcher »normale« Mensch bringt so etwas schon fertig? Allerdings verheißt das nichts Gutes, mein Lieber! Im Allgemeinen hören solche Kerle nach dem ersten Mal nicht auf«, prophezeite Béguin und fuhr fort: »Ohne den geringsten Anhaltspunkt bedeutet das, dass wir tatsächlich auf weitere derartige Verbrechen gefasst sein müssen. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, dass der Mörder einen Fehler begeht, anhand dessen Sie seiner schnellstens habhaft werden können!«
Tief in ungute Gedanken verstrickt, war Lavalle nach seinem Besuch in der Salpêtrière ins Kommissariat zurückgekehrt. Als er die steinernen Stufen des Aufgangs hinaufgehen wollte, stieß er beinah mit Jean-Baptiste Morlais zusammen. Er schien Lavalle abgepasst zu haben; offensichtlich wollte er den Kommissar dringend unter vier Augen sprechen. Lavalle wunderte sich zwar, aber weil er Jean-Baptiste als fähigen Polizistenkollegen schätzte, war er einverstanden.
»Was hast du mir Wichtiges zu sagen, Jean-Baptiste?«, erkundigte er sich, nachdem er den anderen in sein schlichtes Büro gebeten hatte. »Ich habe zwar nicht viel Zeit, weil ich …«
»Ich weiß, Herr Kommissar! Genau darum geht es!«
Lavalle forderte den jungen Mann auf, sich zu setzen. Vorher hatte er noch die Tür geschlossen, die normalerweise für jedermann offen stand.
»Was kann ich für dich tun, mon Ami?«
»Ich habe eine Idee«, platzte Jean-Baptiste heraus. Es kostete ihn offensichtlich all seinen Mut, damit herauszurücken. Er traute sich auch nur, weil er inzwischen wusste, dass Lavalle einiges von ihm hielt und ihn fördern wollte, um ihm den letzten Schliff eines »richtigen« Kriminalbeamten zu verpassen.
Deswegen nahm er ihn auch häufig mit auf seinen Streifzügen und oft genug zu besonders heiklen Einsätzen. Schon mehrmals hatte er ihm zu verstehen gegeben, dass er dessen bisherige Stellung als einfacher Gendarm als weit unterbewertet empfand.
»Jetzt lass’ schon hören«, forderte Lavalle ihn auf und lächelte sein nervöses Gegenüber aufmunternd an.
»Könnten Sie mich vielleicht mitnehmen in die Salpêtrière, damit ich mir auch die Leiche der ermordeten jungen Frau ansehen kann, monCommissaire?«, platzte der junge Polizist heraus.
»Oh, da bist du leider etwas zu spät dran, Jean-Baptiste! Da komme ich nämlich gerade her. Und es war kein schöner Anblick, das kann ich dir garantieren!«
»Im Kommissariat spricht man von nichts anderem! Haben Sie vielleicht etwas entdeckt, was uns eventuell weiterhelfen könnte?«
»Aufgefallen ist mir nichts!« Lavalle klang resigniert. »Jedenfalls nichts, was zur Identifikation der jungen Frau beitragen könnte. Nicht einmal die Haarfarbe ist sicher, da der Täter ihr den Schädel ratzekahl geschoren hat.
Die Achselhaare deuten darauf hin, dass das Opfer dunkelhaarig gewesen sein könnte. Aber ob nun dunkelblond, braun oder gar schwarz – keine Ahnung. Die Farbe ihrer Augen ist auch ungewiss, weil der Täter Säure benützt hat, um die Augäpfel zu zerstören.«
»Ich habe schon gehört, dass man der Ärmsten die Augen verätzt hat«, murmelte Jean-Baptiste Morlais betroffen. »Man kann nur hoffen, dass das der Mörder erst nach ihrem Tod gemacht hat!«
»Verrate mir, was würdest du dir denn davon versprechen, wenn du sie sie dir persönlich anschauen könntest, mein Lieber?« Lavalle war jetzt neugierig geworden. Einen anderen Kollegen hätte er vielleicht abblitzen lassen; aber gerade bei diesem jungen Mann machte er gern mal eine Ausnahme.
»Ich denke da an ein bestimmtes Muttermal, das eine gewisse frühere, noch ganz junge Gelegenheitshure, die im Augenblick als vermisst gilt, an einer delikaten Körperstelle hat! Vielleicht ist sie es und …«
Er verstummte, um erst einmal Lavalles Reaktion abzuwarten.
»Natürlich! Jetzt erinnere ich mich auch an den Fall, der kurz vor meiner Abreise nach Mussidan gemeldet worden ist!« Der Kommissar schlug sich die Hand vor die Stirn. »Du redest gewiss von Sophie Labadé, achtzehn Jahre, bildhübsch und die ein wenig schwierige Tochter einer verwitweten Gemüsehändlerin in den Hallen!
Ohne Vater aufgewachsen, ist offenbar einiges bei ihrer Erziehung schiefgelaufen. Ich habe gehört, sie ging hin und wieder auf den Strich, um sich zusätzliches Geld zu verdienen. Die Arbeit bei ihrer Mutter war wohl nicht so ihre Sache!«
Der Kommissar fühlte auf einmal das altbekannte Kribbeln im Kreuz, sobald es sich darum handelte, in einem komplizierteren Fall der Lösung ein kleines Stück näher zu kommen.
»Erst kürzlich hat die Bürgerin Labadé Vermisstenanzeige erstattet, weil ihre Sophie seit Tagen schon verschwunden war«, fuhr Lavalle fort. »Ich geb’s zu, bei der Suche nach dem jungen Ding haben sich meine Leute nicht gerade ein Bein ausgerissen.
Sie dachten vermutlich – wie ich übrigens auch – das Mädel hätte einen reichen Kerl aufgetan und wäre mit ihm durchgebrannt. Sobald der Freier genug von ihr hätte, würde sie schon wieder bei ihrer Frau Mama in den Hallen angekrochen kommen.
Meine Frage ist nun: Was hast denn du mit dieser Sophie zu tun, Jean-Baptiste?«
Jetzt war der junge Polizist doch sichtlich verlegen. »Ich habe mit ihr überhaupt nichts zu tun, mon Commissaire!«, verwahrte er sich sofort. »Aber ein Bekannter von mir, Pierre Dupont, der früher nicht viel getaugt hat, aber jetzt auf einmal ›anständig‹ werden möchte, der kennt Sophie recht gut. Er hat …«
Armand Lavalle unterbrach ihn. »Ah! Ich habe schon von diesem Pierre Dupont gehört! Ich weiß noch nicht recht, was ich von ihm halten soll. Aber sprich nur weiter, mon Ami!«
»Nun, Sophies Mutter meinte zwar auch, es wäre gut möglich, dass ihre Tochter sich mit irgendeinem gut betuchten Typen davon gemacht haben könnte. Aber ich habe mittlerweile von Pierre selbst erfahren, dass Sophie vor einiger Zeit mit ihm eine ernsthafte Liebesbeziehung eingegangen ist und sich von anderen Männern strikt fernhält.
Die beiden wollten für immer zusammenbleiben und ›anständige und gesetzestreue Bürger‹ werden. Und dass Pierre ihr nichts angetan hat – und so etwas Abscheuliches schon gar nicht – dafür lege ich meine Hand ins Feuer! Auch Pierre macht sich die größten Sorgen über Sophies Verbleib.
Und um Ihre Frage zu beantworten, mon Commissaire: Von Pierre Dupont weiß ich auch, dass seine Liebste auf ihrer rechten Pobacke ein schwarzes herzförmiges Muttermal hat. Und falls die Frauenleiche in der Salpêtrière …«
»Verstehe, mon Ami. Komm’ lass’ uns sofort noch einmal losgehen, Jean-Baptiste!«
Der Kommissar hatte es auf einmal sehr eilig. Hoffentlich hatten die Krankenhausärzte das Mordopfer in der Zwischenzeit nicht schon vom Totengräber abholen lassen, um es gleich anschließend in einem städtischen Armengrab zu verscharren.
Sie hatten sozusagen doppeltes Glück: Die Leiche war noch da und besagtes auffälliges Muttermal befand sich tatsächlich auf Sophies rechter Gesäßhälfte.
Falls der Wärter sich gewundert hatte, erneut den Kommissar zu der unbekannten Toten ins Kellergewölbe begleiten zu müssen, hatte er es sich jedenfalls nicht anmerken lassen. Der Bursche war ein wenig einfältig und mochte sich vielleicht gedacht haben, der Kriminalbeamte habe so großen Gefallen an der Leiche gefunden, dass er sie unbedingt seinem jungen Kollegen zeigen wollte. Chacun à son goût! … Jeder nach seinem Geschmack. Ihm war’s egal.
Ehe sich Lavalle und Morlais wieder auf den Rückweg ins Kommissariat machen konnten, fiel dem Wärter noch etwas ein.
»Ach ja, eh ich es vergesse, der ärztliche Gutachter hat gemeint, es könnte gut sein, dass man die Frau vor dem Gemetzel, das man mit ihr veranstaltet hat, vergiftet hat! Aber ob das stimmt und was für ein Gift es gewesen sein könnte, das kann er nicht genau sagen. Aber er vermutet, dass es sich um Arsenik gehandelt hat.«
10. April 1790
Morde an sich ereigneten sich derzeit andauernd und waren kaum noch groß des Erwähnens wert. Bei der Bevölkerung, die sich eher um ihre eigenen existenziellen Bedürfnisse zu kümmern hatte, rief diese Art von Verbrechen so gut wie keine besonderen Reaktionen mehr hervor. Außer die Taten erwiesen sich als besonders grausam oder pervers. Dann waren die »Vorkommnisse« geeignet, bei den Leuten Aufmerksamkeit und vor allem Angst zu erzeugen.
Am königlichen Hof mit seinem Prunk und Protz und bei all seinen von den üblichen Lustbarkeiten geradezu übersättigten Hofleuten, verhielt es sich genauso: Ein Toter oder eine Tote mehr oder weniger, wen scherte es schon?
Aber dieses Mal war es anders. Weniger die Tat an sich war es, die für Aufmerksamkeit sorgte, sondern die näheren Umstände, die mit diesem Mord in Verbindung standen. Dass ein Täter sich einer verhassten Person auf drastische Art entledigte, war eine Sache. Totschlag aus rasender Wut oder als Rache für erlittenes Unrecht – das vermochte man immerhin nachzuvollziehen. Aber die grässlichen Verstümmelungen, quasi als Dreingabe, verstanden die wenigsten. Was musste das für ein perverses Schwein sein?
Die Nachricht über die Umstände des grausigen Verbrechens gelangte auch bis zu König Ludwig XVI. Im Grunde hatte der Monarch ein weiches Gemüt, dessen er sich allerdings schämte, und das er vor seiner Familie tunlichst zu verbergen suchte, um nicht für unmännlich gehalten zu werden. Diese schreckliche Tat an einem jungen Mädchen ging ihm allerdings ganz besonders zu Herzen.
Leider verhielt es sich auch in diesem Falle so, dass der König glaubte, sich »Gefühle« und »Sentimentalitäten« vor Publikum nicht erlauben zu dürfen. Er erlag dem Irrtum, die Untertanen könnten ihm das als Schwäche auslegen und das sah Seine Majestät auf keinen Fall vereinbar mit seiner royalen Würde.
Betont uninteressiert reagierte er daher auf die unerfreulichen »Neuigkeiten« seines Kammerdieners und anderer Domestiken, die ständig um ihn waren.
»Ach ja? Welch’ eine bedauerliche Tragödie!«, raffte er sich zu einem betont kühlen Kommentar auf. »Wir hoffen, dass Unsere Ordnungsmacht den Täter bald aus dem Verkehr zieht. Wir schätzen es gar nicht, mit solch unappetitlichen Ereignissen konfrontiert und belästigt zu werden!«
Ähnlich die Reaktion seiner Gemahlin, Königin Marie Antoinette. Als ihre geschwätzige Lieblingszofe ihr den betreffenden Artikel aus Marats »Ami du Peuple« am Nachmittag vorlas, zuckte sie zwar schmerzlich zusammen, war jedoch sofort um Contenance, oder was sie dafür hielt, bemüht.
»O wie abscheulich! Wie garstig! Was unternimmt unsere Polizei dagegen? Das arme Ding!«
Ehe ihre Zofe fortfahren konnte, wurde sie von ihrer königlichen Herrin unterbrochen: »Was meinen Sie, Mademoiselle Giselle, soll ich zum Ball heute Abend die gelbe Robe mit dem weißen Spitzenkragen anziehen oder würden Sie mir eher die purpurfarbene mit der dazugehörigen Stola empfehlen?«
Die Königin verlor kein weiteres Wort mehr über das bizarre Verbrechen.
Armand Lavalle war nicht nur angewidert, sondern in höchstem Maße alarmiert und besorgt.
»Dieser grausige Fall könnte tatsächlich wiederum, wie unser Commandant Général es ja vorausgesagt hat, der Anfang einer hässlichen Mordserie werden«, vertraute er mit Sorgenfalten im Gesicht seinem Freund Hubert an. »Leider habe auch ich die dunkle Vorahnung, dass es sich bei dieser Tat um keinen Einzelfall handeln wird.«
»Nun mal um Himmels willen nicht gleich den Teufel an die Wand«, wehrte Aubriac ab. »Es muss ja nicht gleich zum Schlimmsten kommen! Jedenfalls tust du mir leid, dass du schon wieder so eine Scheiße am Hals hast. Wenn du mich brauchen solltest, weißt du, dass du jederzeit auf mich zählen kannst; nicht wahr?
Um dir zu helfen, lasse ich alles andere stehen und liegen. Meistens handelt es sich ja doch bloß um langweiligen Papierkram, der meines Erachtens nicht so wichtig ist. Sobald du mich rufst, mon Ami, erzähle ich unserem Chef irgendeinen Quark, um mich vor dem stumpfsinnigen Schreibkram zu drücken. Es gibt auch noch ein paar andere hier, die er dafür einsetzen kann und die lieber als ich auf ihrem Arsch sitzen bleiben und stumpfsinnige Arbeit erledigen.
Aber«, und das klang jetzt durchaus ein kleines bisschen stolz, »mein Chef Laroche sagt immer, dass er am liebsten mit mir zusammenarbeitet, weil ich nicht auf den Kopf gefallen und gewissenhaft bin – und außerdem auch heikle Schriftsätze gut formulieren kann und sie mit einer ausgesprochen schönen Handschrift zu Papier zu bringen weiß!«
Lavalle bedankte sich ehrlichen Herzens für Huberts Angebot. Bei der kürzlich erfolgten Ergreifung des »Seine-Mörders« hatte sein Freund ja schon deutlich bewiesen, was in ihm steckte: eher ein tatkräftiger Polizist als ein – wenn auch noch so gewissenhafter und fähiger – Schreibtischhocker.
Jedenfalls war dieser Mordfall wiederum ein gefundenes Fressen für Jean Paul Marat, den Zeitungsverleger vom »Ami du Peuple«, dem wüsten, antimonarchistischen Hetzblatt. Wieder einmal bezeichnete Marat die Pariser Ordnungshüter als »lahme Enten«, als total unfähig und möglicherweise sogar korrupt.
»Er deutet auch ganz unverblümt an, der Täter könne sich ja vielleicht erneut im Palais Seiner Majestät, des Königs, verbergen«, brachte Lavalle seine arg geschrumpfte Mannschaft auf den neuesten Stand.
»Wir stehen ganz am Anfang unserer Ermittlungen, obwohl wir nun, dank unseres Kollegen Morlais, wissen, um wen es sich bei der Ermordeten handelt. Aber wir haben nicht die geringste Ahnung, wo diese Untat sich denn nun ereignet hat und warum und von wem das arme Mädchen so zugerichtet wurde.
Ein Ledersack mit der geschändeten Leiche wurde von Fischern in einem Weidengebüsch unten an der Seine, mitten in der Stadt, gefunden. Der eigentliche Tatort kann allerdings überall sein.
Uns fehlt nicht nur der Täter, sondern auch ein Motiv. Ein Raubmord kann es kaum gewesen sein; das Mädchen besaß ja so gut wie nichts. Die Art, wie man Sophie Labadé verstümmelt hat, diente vermutlich nicht nur dazu, sie unkenntlich zu machen, sondern spricht meiner Ansicht nach dafür, dass der Täter einen furchtbaren Hass gegen sie empfunden haben muss. Vielleicht geschah die Tat aus Eifersucht? Richten Sie sich also darauf ein: Dieser Fall wird wieder einmal die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen werden, meine lieben Kollegen!«
Reichlich deprimiert, immer noch die halbverrotteten Leichenteile mit dem haar- und augenlosen Kopf der jungen Frau vor Augen, kam Lavalle an diesem Abend in seiner Wohnung an, wo er überraschend seinen Schwager Luc antraf, der noch einen Schlüssel dazu besaß.
Was der Junge ihm zu berichten hatte, lenkte ihn ein klein wenig von seinem Trübsinn ab. Luc behauptete, mit seiner Arbeit und der Ausbildung bei Maître Philippe Danube sehr zufrieden zu sein.
›Vielleicht wird doch noch etwas aus Luc?‹, überlegte der Kommissar hoffnungsvoll. ›Warum eigentlich nicht? Immerhin ist er doch verwandt mit meiner großartigen Ginette …‹
Das Nächste, was er dann von dem jungen Burschen zu hören bekam, war allerdings nicht dazu angetan, Lavalle besonders froh zu stimmen.
»Denk dir, Schwager, durch einen weiteren glücklichen Zufall bin ich der Freund von Pierre Dupont geworden!«
»Dupont? Dupont?«, murmelte der Kommissar. »In jüngster Zeit habe ich diesen Namen schon mal gehört!«
Gleich darauf ging ihm ein Licht auf. »Ist die Großmutter dieses Tunichtguts etwa Mireille Dupont, die abgetakelte Hure, die trotz ihres Alters immer noch ihrem Gewerbe rund um die Hallen nachgeht?«, fragte er den Jungen geradeheraus.
Der nickte ein bisschen betreten. »Ja, das stimmt, Schwager. Pierre war bis vor Kurzem ein Herumtreiber und will aber jetzt, seit er achtzehn geworden ist, anständig werden! Er hatte sich mit der ermordeten Sophie zusammengetan, die auch mit der Hurerei hat aufhören wollen. Ich und André de Junot wollen Pierre dabei helfen, dass er das mit dem Anständigwerden auch wirklich hinbekommt!«
»Klingt ja sehr ehrenwert, Junge«, rang Lavalle sich zu einem halbherzigen Lob durch. Freude bereitete ihm dieser Umgang seines jugendlichen Schwagers, der gerade mal fünfzehn Jahre alt war, nicht unbedingt. Dessen Freundschaft mit dem königlichen Pagen, dem Gascogner André de Junot, begrüßte er hingegen sehr.
Insgeheim nahm der Kommissar sich vor, künftig auf diesen Pierre Dupont ein ganz besonders waches Auge zu haben.
›Notfalls werde ich das Bürschchen schon Mores lehren.‹
Lavalle seufzte im Stillen. Als hätte er nicht schon genug anderes am Hals …
Er beschloss, die traurige Pflicht auf sich zu nehmen und am nächsten Tag der Gemüsefrau Labadé die Nachricht vom gewaltsamen Tod ihres einzigen Kindes zu überbringen. Er hasste diese Momente, wenn die Angehörigen, erstarrt vor Entsetzen und Gram, zu keiner Reaktion mehr fähig waren.
Manche verhielten sich auch geradezu verrückt. Einige begannen nach einer Weile, sobald ihre anfängliche Erstarrung sich gelöst hatte, zu brüllen und zu toben und Gott zu verfluchen, der das Unsägliche zugelassen habe. Andere verdammten und beschimpften die »Ordnungshüter« aufs Übelste, weil sie das Verbrechen nicht verhindert hatten.
Manche wiederum blieben stumm oder gaben vor, sie hätten das Gehörte gar nicht verstanden. Sie gebärdeten sich, als rechneten sie damit, der oder die Ermordete würde jeden Moment zur Tür hereinspazieren …
Lavalle nahm sich vor, der Mutter nicht coram publico, an ihrem Arbeitsplatz, den Markthallen, vom tragischen Schicksal ihrer Tochter zu berichten. Er würde sie abends allein in ihrem Zuhause aufsuchen. Die Adresse ihrer schlichten Wohnung in einem der Außenbezirke von Paris hatte ihm Jean-Baptiste Morlais besorgt.
Noch Tage danach war Lavalle erschüttert, sobald die Rede auf Sophie Labadés Ermordung kam und wie ihre Mutter auf die Nachricht reagiert hatte.
»Ich glaube, das unendliche Leid dieser Frau hat mich so ergriffen, dass ich an diesem Tag um Jahre gealtert bin«, vertraute er seinem Schwager Luc an. Ginettes Bruder, der sich in unregelmäßigen Abständen bei ihm blicken ließ, zeigte sich ebenso betroffen; hatte er das hübsche lebenslustige Ding doch selbst recht gut gekannt.
»Ich bin so froh, dass meine Schwester noch auf dem Land, fern von Paris, lebt«, meinte der Junge. »Sie sollte solche grausigen Dinge gar nicht erfahren müssen! Ich sage das, obwohl ich Ginette jeden Tag mehr vermisse. Außerdem bin ich neugierig auf meine kleine Nichte, Lucille Marie. Trotzdem bin ich dafür, dass sie und euer Kind noch für eine Weile der Hauptstadt fern bleiben.
Du tust mir von Herzen leid, Schwager; für dich ist es bestimmt am allerschlimmsten«, fügte er treuherzig hinzu. »Herrgott noch mal!«, entfuhr es Luc dann temperamentvoll. »Irgendwann muss es doch wieder normal werden bei uns!«
Der Kommissar nickte. Er unterließ es, nachzufragen, was der junge Bursche unter »normal« eigentlich verstand. Der Sinngehalt dieses Begriffs verflüchtigte sich für Lavalle von Tag zu Tag mehr.
Natürlich war Lucs Hoffnung pure Illusion. Gar nichts verbesserte sich und von beginnender Normalität konnte erst recht keine Rede sein. Im Gegenteil. Die Zustände in der Hauptstadt und im Land insgesamt verschlimmerten sich permanent.
Für die Pariser Bevölkerung hatte sich auch durch die von großer Hoffnung begleitete Anwesenheit des königlichen Hofes und der Nationalversammlung kaum etwas zum Guten verändert. Die Lage war nach wie vor äußerst angespannt.
Größte Unsicherheit herrschte auf den Straßen, vor allem nachts. Elend und Not regierten in den meisten der primitiven Behausungen. Gewalttätigkeiten in den ärmeren Familien, wo aufgrund des fehlenden Geldes erbittert gestritten wurde, waren an der Tagesordnung.
Überfälle und Einbrüche häuften sich, um an Geld oder wertvolle Güter heranzukommen, denn Arbeitsplätze waren entschieden rar geworden durch die deutlich spürbare Abwanderung von Adelsfamilien. Neuerdings sparten auch gut betuchte Bürgerliche an Bedienungspersonal und reduzierten es rigoros. Lieber sparten sie das Geld für noch schlechtere Zeiten auf.
Bisher anständige Mädchen gingen plötzlich in großer Zahl auf den Strich, um ihre Familien finanziell zu unterstützen. Nicht wenige von ihnen wurden durch ihre Angehörigen förmlich zur Prostitution gedrängt; oft genug auch brutal gezwungen.
»Die meisten Vornehmen haben es satt, sich auf Schritt und Tritt in aller Öffentlichkeit vom Mob anpöbeln oder gar körperlich attackieren zu lassen«, stellte Lavalle beinah jeden Tag fest. »Wer es sich leisten kann, lässt sich von einem bewaffneten Burschen begleiten; manche wagen sich nur noch umgeben von einer Schar martialisch ausgerüsteter Leibwächter auf die Straße.«
Nachdem der König mitsamt seinem riesigen Hofstaat in den Louvre und die Tuilerien zurückgekehrt war, war der massenhafte Exodus der Aristokraten zwar kurzzeitig gestoppt worden. Aber diese Entwicklung hatte nur kurz angehalten.
»Obwohl es bei Hofe trotz der zunehmenden Verelendung der Bevölkerung hoch hergehen soll«, wie Jean Paul Marats »Ami du Peuple« und J. R. Héberts »Père Duchesne«unisono süffisant berichteten, »ziehen die Häupter der adligen Familien es doch vor, sich die meiste Zeit feige auf ihre Güter auf dem Land zu flüchten und die Armen in der Stadt sich selbst zu überlassen!«
»Wenn sie nicht gleich ganz aus Frankreich verschwinden und sich über den Rhein hinüber verziehen oder nach England gehen«, fügte Lavalles Freund Hubert bitter hinzu.
»Verdenken kann man es im Grunde eigentlich niemandem. Auch denen nicht, die zunehmend ihr Heil in Übersee suchen. Wir leben augenblicklich in einem Scheißland, ohne jede Hoffnung auf Besserung. Niemals hätte ich gedacht, dass ich jemals so über mein geliebtes Vaterland sprechen würde«, gestand er bekümmert.
»Das Angebot an Lebensmitteln, die auch die ärmeren Schichten der Bevölkerung sich leisten können, nimmt immer weiter ab. Fleisch ist bereits ein wahres Luxusgut geworden und wir werden bald erleben, dass es sich bei Brot auf Dauer genauso entwickeln wird! Alles leider schon mal da gewesen!«
Das war auch dem Kommissar nur allzu sehr bewusst. Es verging schließlich kein Tag, an dem ihm Grandmère Céléstine nicht in den Ohren lag.
»Die paar Blumensträuße und Gebinde, die ich am Tag noch verkaufe, retten mich kaum vor dem Verhungern!«, pflegte die rüstige alte Frau zu jammern. »Was ich verdiene, reicht kaum zum Überleben, weil jeden Tag die Preise für Lebensmittel und andere notwendige Güter steigen!«
Das war zwar schamlos übertrieben, denn in Wahrheit jammerte die alte Frau auf ziemlich hohem Niveau; immerhin lebte Ginettes Großmutter mit ihm noch unter einem Dach und konnte sich dadurch die Miete sparen. Aber Armand Lavalle wollte sich mit der alten Céléstine, die angeblich angestrengt nach einer eigenen Bleibe suchte, nicht streiten.
Zufällig wusste er allerdings recht gut, dass sie und ihresgleichen sich über mangelnden Kundenzuspruch nicht zu beklagen hatten. Mittlerweile sahen es die Hofleute und damit alle anderen Adelsfamilien, die in Paris geblieben waren, sowie die begüterten Bürgerlichen als »unbedingt notwendig« und »geziemend« an, täglich üppigen Blumenschmuck bei Céléstine Madrier auf dem »Marché aux Fleurs« zu erstehen …
27. April 1790
»Ich hoffe, mein Lieber, dass es dieses Mal ebenso gut klappt wie neulich! Während der dunkelsten Nachtstunden, weit nach Mitternacht, gegen Morgen, wenn die meisten noch im Tiefschlaf liegen, müsste es möglich sein, das gute Stück, das keiner mehr braucht, auf unspektakuläre Weise loszuwerden. Du musst nur schnell machen und dich von keinem beobachten lassen!«
»Keine Sorge, Madame!« Der Angesprochene lachte und seine weißen Zähne blitzten. »Mich erwischt niemand! Ich war von jeher gut darin, Abfall zu entsorgen – auch an Stellen, wo das eigentlich verboten ist. Aber die Seine hat schon so viel Müll geschluckt und ihr Ufer verfügt über so viel Platz – da kommt es auf ein bisschen mehr Unrat auch nicht an! Und sollte mir ein Neugieriger in die Quere kommen, weiß ich ja, was ich zu tun habe, Madame!«
Seit Neuestem verging wiederum kein Tag – und warum sollte es an diesem 27. April anders sein? – ohne dass betrunkene Horden grölend durch die Stadt zogen, allerhand Zerstörungen an Wohnhäusern, Läden und in privaten Gärten anrichteten, Kutschen demolierten, harmlose Passanten beleidigten und verprügelten, »Liberté, Égalité« und (neuerdings) auch »Fraternité« plärrten, drohend ihre Fäuste schwangen oder mit Piken Furcht einflößend herumfuchtelten.
Nun, kein vernünftiger Mensch konnte ernsthaft gegen »Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit« Einwände erheben; aber, wie Armands Freund Hubert es zwar sehr derb, aber treffend ausdrückte: »Sobald diese hehren Ziele allerdings von einer zügellosen Meute besoffener krimineller Dummbeutel reklamiert werden, hat das nichts mehr mit Recht und Vernunft zu tun, sondern ist bloß noch blanker Terror – und somit gequirlte Scheiße!«
Und Grandmère Céléstine behauptete: »Wer, mit einigermaßen Hirnschmalz im Kopf, möchte denn wirklich der ›Bruder‹ von solch nichtswürdigen Individuen sein? Was diese grölende Bande unter ›Freiheit‹ versteht, nämlich stehlen, rauben, randalieren, Leute überfallen und umbringen, davor kann ein anständiger Bürger bloß ausspucken! Und ›Gleichheit‹ mit diesem Pack? Non, merci!«