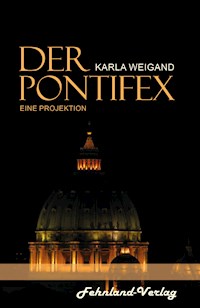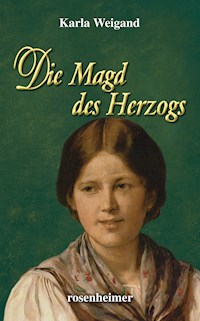6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Kriminalroman aus der Zeit der Französischen Revolution: Ein Massenmörder verunsichert Paris. Wird Kommissar Lavalle den Täter zur Strecke bringen? Ist der Täter gar ein Adliger am Hofe des Königs? Meisterhaft skizziert die Autorin das Leben in Paris vor dem Sturm auf die Bastille bis wenige Monate danach mit besonderem Blick auf die Spannungen und Konflikte zwischen Volk und Königshaus. Der Leser spürt den Geist des Aufbruchs ebenso wie erste Vorboten auf die kommende Schreckensherrschaft der Jakobiner. Tauchen Sie ein in einen spannenden Krimi und in die Atmosphäre einer Epoche, die die Welt verändert hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Karla Weigand
Kommissar Lavalle und der Seinemörder
Historischer Roman aus der Zeit Ludwigs, des 16., nach einem wahren Kriminalfall
Karla Weigand
KOMMISSAR LAVALLE UND DER SEINEMÖRDER
Historischer Roman aus der Zeit Ludwigs, des XVI., nach einem wahren Kriminalfall
Zwischen den Stühlen 2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: April 2022
Zwischen den Stühlen @ p.machinery
Kai Beisswenger & Michael Haitel
Titelbild: Jean-Pierre Louis Laurent Houël (1735–1813), La Prise de la Bastille (Sturm auf die Bastille), 1789
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Kai Beisswenger
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Zwischen den Stühlen
im Verlag der p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.zds.li
ISBN des Softcovers: 978 3 95765 273 7
ISBN des Hardcovers: 978 3 95765 274 4
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 825 8
Prolog, 29. Mai 1789
Schon seit Tagen fühlte er sich unwohl. Erneut hatte die gewohnte Unrast von ihm Besitz ergriffen; eine Unrast, die es ihm beinahe unmöglich machte, seinen vielfältigen Aufgaben nachzukommen. Wie gefesselt, wie geknebelt kam er sich vor. Es erschien ihm fast unmöglich, es auch noch einen Augenblick länger in seinem gewohnten Umfeld auszuhalten. Mit aller Macht drängte es ihn hinaus, ins Freie, in die Anonymität der Stadt, unter Menschen! Und nicht etwa, weil es ihm in seiner gewohnten Umgebung an solchen gemangelt hätte.
Aus gewissen Gründen kam jedoch keiner von denen für ihn infrage. Auf dem vertrauten Terrain, auf dem er zwar souverän die Spielregeln bestimmte, war es unmöglich, jemanden zu finden, der seine Vorgaben auch nur annähernd erfüllte. Und selbst wenn – es wäre viel zu riskant gewesen.
»Geschmackloses junges Gemüse, oder verdorbenes altes Unkraut«, dachte er verächtlich. »Nichts, das auch nur halbwegs in der Lage wäre, meinen Ansprüchen auch nur ansatzweise zu genügen.«
Erschwerend gesellte sich die Tatsache hinzu, dass er sich in seinem gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld keinen Fehler erlauben durfte. Viel zu sehr stand er im Fokus zahlreicher hochgestellter Persönlichkeiten; und was die Domestiken anbetraf, so mochten sie in seinen Augen zwar alberne Tröpfe sein – unterschätzen durfte er sie keineswegs.
Zunehmend litt er Höllenqualen. Am liebsten hätte er alles hinter sich gelassen; wäre einfach wieder für eine gewisse Zeit in seine andere Rolle geschlüpft, um sich von der nahezu unerträglichen Spannung zu befreien, die ihm mehr und mehr das Blut vergiftete und den Verstand vernebelte. Da seine Konzentration nachließ, unterliefen ihm bereits kleinere Missgeschicke – etwas, das er sich selbst am allerwenigsten verzieh.
Das Einzige, was ihn stets aufs Neue betroffen machte –, wenn auch immer erst »danach« –, war der Zwang, sich für die Erlangung seines Seelenfriedens mit Individuen abgeben zu müssen, die weit unter seinem intellektuellen und gesellschaftlichen Niveau rangierten. Trotz seiner tiefen Verachtung der Unterschicht war er stets aufs Neue gezwungen, jeweils für eine gewisse Zeit einzutauchen in jene dumpfe, bar jeglichen geistigen Anspruchs, gleichsam tierisch anmutende Lebensweise des Pariser Pöbels.
Dessen ungeachtet und vollkommen paradox: Er genoss diese Erniedrigung ungeheuer! Jedenfalls so lange, wie er befreit zu atmen vermochte. Der euphorische Zustand dauerte jeweils an bis zum nächsten Mal …
Er beschloss, sich innerhalb der kommenden Woche von allen Verpflichtungen frei zu machen, um den Überdruck abzubauen, der sich in seinem Inneren bis zur Unerträglichkeit anstaute. Sich davon zu befreien, hatte er im Laufe der Jahre perfektioniert. Er war sich sicher, jede Vorsichtsmaßnahme zu bedenken, sich keiner Nachlässigkeit schuldig zu machen – und daher niemals ertappt zu werden.
Wer nur den Hauch eines Gespürs für Veränderungen hatte, dem konnte nicht verborgen bleiben, dass es in Frankreich seit längerem heftig gärte. In Kürze würde das Pulverfass explodieren; es war nur zu hoffen, dass die sprühenden Funken sich nicht zu gewaltigen Feuergarben entwickelten, die niemand mehr zu löschen vermochte. Allzu viel hatte sich mittlerweile im Volk der Franzosen aufgestaut an Enttäuschung, Wut und Verzweiflung. Was im Einzelnen im Argen lag, wussten alle – auch diejenigen, die das Dilemma zu verantworten hatten.
Aber weder die Aristokratie noch die Geistlichkeit, die im Lande das Sagen hatten, dachten nur einen Augenblick daran, den Armen, Unterdrückten, Gedemütigten und Ausgebeuteten auch nur andeutungsweise entgegenzukommen. Im Gegenteil! Immer stärker drehte die Regierung Seiner Majestät, König Ludwigs XVI., an der Steuerschraube, immer höher wurden die Belastungen, die auf die Rücken der ohnehin schwer Gebeutelten aufgesattelt wurden. Wer einmal in der Schuldenfalle eines adligen Grundbesitzers saß, verfügte nie mehr auch nur über die allergeringste Aussicht, je wieder herauszufinden.
Das Proletariat wuchs beständig; ehemals biedere Handwerker verarmten und gesellten sich mehr und mehr zur besitzlosen Unterschicht. In ihrer Aussichtslosigkeit, irgendwann erneut auf die Beine zu kommen, ergaben sich viele der Trunksucht, wurden haltlos, sanken herab zu Bettlern und Dirnen.
Wer über mehr Energie verfügte, rutschte gewöhnlich schnell ab ins kriminelle Milieu. Es war eine Schraube, die sich unablässig nach unten drehte – so lange, bis der Boden erreicht war, der in den meisten Fällen den Hungertod oder das Ende am Galgen bedeutete.
Obwohl das schöne Frankreich in Dekadenz, maßloser Verschwendungssucht und kaum zu überbietender Menschenverachtung der herrschenden Klasse versank und nur noch Gier nach Prunk, minderwertigem Vergnügen und billiger Zerstreuung den Sinn des Daseins bestimmte: Die königliche Justiz funktionierte immer noch.
Teil 1: Ein Verbrecher fühlt sich sicher
3. Juni 1789
Armand Lavalle, aus Fontenay-le-Comte im Poitou stammend, und seit nunmehr zehn Jahren Commissaire de Police Royale in Paris, marschierte ins Arbeitszimmer seines obersten Vorgesetzten, Monsieur Pierre de Bricasson, Comte de Belfort. Der bekleidete die Stellung des Commandant Général de Police Royale de Paris und wurde üblicherweise mit »Monsieur le Président« angesprochen.
Lavalle, grauäugig, hochgewachsen, stämmig und mit dichtem dunkelbraunem Haarschopf, war Anfang dreißig und erhoffte sich seit Längerem eine Beförderung zum Commissaire Supérieur, zum Oberkommissar.
Von dem dürftigen Gehalt, das er im Augenblick bezog, konnte er keine Familie ernähren und seine Dauerverlobte, Régine Madrier, wurde allmählich ungeduldig. Sie war es leid, auf dem Pariser Marché aux Fleurs Sträuße zu binden und Kränze zu flechten. Sie wollte das, was alle jungen Frauen sich wünschten: Endlich heiraten und Kinder bekommen.
Armand Lavalle war ziemlich erschöpft von der soeben – leider erfolglos – gebliebenen Jagd nach einem seit längerem gesuchten Einbrecher, der die Adelspalais’ und Bürgerhäuser auf der Île de la Cité, mit mehreren Komplizen unsicher machte.
Nach dem sorgfältigen Ausspähen des Objekts ihrer Begierde, schlugen die Kerle jeweils während der dunkelsten Nachtstunden zu; brachen entweder durch ein ungenügend gesichertes Fenster im Untergeschoss ein oder öffneten gewaltsam einen Nebeneingang des Gebäudes, gingen mit schlafwandlerischer Sicherheit zu den Stellen, wo das meiste an Schmuck, Geld oder wertvollen Gemälden und Teppichen zu stehlen war – und verschwanden für gewöhnlich wieder so schnell, wie sie gekommen waren.
Im Volksmund nannte man sie bereits anerkennend »die Blitzdiebe«. Lavalle vermutete, dass die Einbrecher jeweils einen Informanten innerhalb der bestohlenen Häuser haben mussten – daher ihre verblüffende Ortskenntnis.
Ein Informant des Kommissars hatte ihm einen Tipp gegeben, wo der Kopf der Einbrecherbande sich angeblich aufhielt und er war letzte Nacht zusammen mit vier Polizisten dieser Spur nachgegangen, um den Mann zu verhaften. Das Ganze hatte sich zu einer geradezu abenteuerlichen Jagd durch die Pariser Altstadt, rund um die Kirche von Saint-Sulpice, ausgewachsen.
Die winzigen Häuschen – eigentlich aneinander gebaute, sich gegenseitig vor dem Zusammenbruch stützende Hütten – waren elende verwinkelte Schlupflöcher, die enorme Menschenmassen beherbergten und so ineinander verschachtelt waren, dass sich in dem Gewirr nur ein dort seit Längerem Hausender zurecht finden konnte. Lavalle und seine Kameraden gehörten jedenfalls nicht dazu. Die Suche war von vorneherein aussichtslos gewesen. Die übrigen Bewohner des Quartiers – überwiegend auch sie »gute alte Bekannte« der Ordnungsmacht – weigerten sich zudem hartnäckig, der ungeliebten Obrigkeit auch nur den geringsten Hinweis auf die Flüchtigen zu geben.
Vor allem die Weiber gebärdeten sich höchst feindselig gegen die Beamten. Sie kreischten ihnen Beleidigungen und Beschimpfungen entgegen in einer Lautstärke, dass Lavalle die Ohren klingelten. Eine leerte rein »zufällig« über dem Kopf des Kommissars eine Schüssel mit Waschwasser aus. Er durfte noch froh sein, dass es nicht das Nachtgeschirr gewesen war …
Einem seiner Polizeikollegen, der eine wacklige Treppe hinaufkeuchte, wurde von oben von einem feixenden Jugendlichen ein Hocker entgegengeworfen. Ein zweiter handelte sich bei einem Gerangel mit einem Betrunkenen ein blaues Auge ein.
Als Lavalle einen Mann dabei beobachtete, wie dieser über die Dächer verschwand und er Anstalten machte, dem Flüchtigen über ein Fenster nachzusetzen, wusste dies eine verkommene Alte zu vereiteln, indem sie aus einer höher gelegenen Luke einen Krug schwenkte, um einen Schwall Seifenwasser über die Ziegel zu kippen. Damit war das ohnehin abschüssige Dach so rutschig geworden, dass eine Verfolgung lebensgefährlich gewesen wäre …
Nach zwei Stunden hatte Lavalle wütend die vergebliche Aktion abgeblasen.
Der Kommissar war beinahe sicher, dass sein Chef einiges mit ihm vorhatte, als er dem wissenden Blick seines Freundes, Hubert Aubriac – Bricassons Premier Secrétaire – begegnete, als dieser ihn zu seinem Herrn beorderte. Was sonst könnte so wichtig sein, dass der Commandant Général persönlich sich die Mühe machte, einem kleinen Commissaire Audienz zu gewähren?
Normalerweise erhielt Armand seine Befehle von seinem direkten Vorgesetzten, Capitaine de Police, Émile Béguin. Der Comte de Belfort war im Allgemeinen für Beförderungen zuständig – oder für Entlassungen. Letzteres schloss Lavalle allerdings kategorisch aus, denn für gewöhnlich leistete er sehr gute Arbeit. Und dass sein Einsatz gestern gescheitert war, konnte man ihm doch nicht so sehr ankreiden.
»Kannst du mir vielleicht verraten, Hubert, weshalb ›Le Président‹ mich so dringend zu sprechen wünscht?«, versuchte Armand seinen Freund, den Sekretär des Comte, aus der Reserve zu locken. Beide Männer liefen im Gleichschritt nebeneinander her auf dem breiten Flur des Polizeigebäudes am Quai des Orfèvres.
Der ehrwürdige Bau war ein einstiger Königspalast. Zahlreiche niedere Chargen, die mit Akten geschäftig auf dem Gang hin und her wieselten, wichen ihnen respektvoll aus – galt Hubert Aubriac doch als die rechte Hand des »Allerhöchsten«.
Armand wagte es ausnahmsweise, diese Frage zu stellen, weil er hoffte, sein Freund, der im Dienst normalerweise verschlossen wie eine Auster zu sein pflegte, habe heute besonders gute Laune. Hubert hatte so ein vergnügtes Funkeln im Blick … Meist war das Gegenteil der Fall. Die Ursache der miesen Dauerstimmung des Sekretärs – die sich außerhalb des Kommissariats jedoch schlagartig aufhellte – war nur ganz wenigen bekannt. Armand gehörte natürlich zu den Eingeweihten.
Hubert Aubriac hasste die Monarchie und er hasste den Comte de Belfort, seinen Chef. Eigentlich verabscheute er jeden, der von adeliger Geburt war – oder ein höheres kirchliches Amt bekleidete. Natürlich war es nicht ganz leicht für ihn, sich seinen Widerwillen während des Dienstes – den er im Übrigen tadellos verrichtete – nicht anmerken zu lassen.
»Das kann ich leider nicht, mon ami.«
Bedauernd zuckte der Sekretär mit den Schultern. »Wie kommst du darauf, dass ich ausgerechnet heute etwas verraten würde, was ›Le Président‹ dir gleich selbst unter vier Augen zu sagen wünscht?«, fragte er und musterte Lavalle neugierig.
»Ich dachte, du habest ausnahmsweise mal gute Laune und daher …«
»Ja! Ausgezeichnet beobachtet, mein Lieber. Ich bin in der Tat heute Morgen ausnehmend gut gelaunt! Und errätst du auch, weshalb, mein Freund?«
»Keinen blassen Schimmer, mon Cher. Aber du wirst es mir sicher gleich verraten.«
Aubriac verlangsamte sein Schritttempo auf der Treppe nach oben und Armand passte sich ihm automatisch an.
»Na?«
Der Kommissar war neugierig, was seinen im Dienst stets griesgrämigen Kameraden so froh stimmte. Hubert Aubriac beugte sich während des Gehens so nahe zu Armand hinüber, dass seine Lippen beinahe dessen Ohr streiften, und begann, nachdem er sich noch schnell umgesehen hatte, zu flüstern.
»Kurz nach Mitternacht ist in Meudon endlich der sieche Dauphin krepiert. Wieder einer weniger aus dieser verfluchten Bourbonensippschaft, die nur auf unsere Kosten lebt!«
»Ach?«
Armand war unangenehm berührt. Er störte sich stets an den Ausfälligkeiten seines Freundes, sobald dieser begann, über die Monarchie und den Adel herzuziehen. Obwohl er ihm in Vielem recht gab, hielt er dessen gehässige Ablehnung doch für maßlos überzogen.
»Hat es der arme Junge also doch nicht mehr geschafft? Die Hofärzte behaupteten doch, die gute Luft in Meudon vermöchte Wunder zu wirken.« In der Stimme des Kommissars schwang eindeutig Bedauern mit.
»Na, hör mal, mein Freund! Wieso nennst du ihn ›armer Junge‹?
War doch Zeit, dass der kleine Krüppel endlich den Abflug – wohin auch immer – gemacht hat!
Der Tod ist in unserem glorreichen Land der Einzige, der noch einigermaßen für Gerechtigkeit sorgt: Er holt auch die Reichen und Mächtigen. Trauer ist in diesem Fall wohl nicht angebracht: Der Kleine war ein Kretin seit dem Tag seiner Geburt. So einer verdient kein Mitleid; für den war das Sterben eine Erlösung!«
Aubriac sprach immer noch mit gedämpfter Stimme.
»Trotzdem! Er war doch noch ein unschuldiger Knabe«, widersprach der Kommissar ebenso leise.
»Ha! Was heißt hier unschuldig? Er wäre immerhin der nächste König geworden! Das genügt mir, um ihn zu verabscheuen. Jetzt haben unser fetter Louis und seine aufgetakelte Metze Marie Antoinette schon das zweite Balg verloren! Am neunzehnten Juni vor zwei Jahren war es ihre Tochter Sophie, die ins Gras gebissen hat. Zwei von ihrer Brut sind noch übrig; von mir aus können die auch noch verre…«
»Pssst! Nicht so laut«, zischte Armand warnend, obwohl kein Mensch in ihrer Nähe war. Er mochte es einfach nicht, wenn sich sein Freund so despektierlich über die Königsfamilie ausließ.
Nicht, dass er den derzeitigen trägen Monarchen und seine verschwenderische Gemahlin besonders geliebt hätte – aber immerhin war Ludwig XVI. einst in Reims regulär gekrönt und gesalbt worden. Und bei seiner Einstellung als Polizist hatte Armand immerhin seinen Amtseid ebenfalls auf den König geschworen …
Sie standen vor der Bürotür von Pierre de Bricasson.
»Ich drück’ dir die Daumen«, versprach Hubert und klopfte seinem Freund auf die Schulter, als dieser sich anschickte, diskret an die Bürotür von Commandant de Bricasson zu pochen.
Das »Herein« seines obersten Vorgesetzten klang sehr gedämpft. Armand hatte nichts anderes erwartet. Monsieur »Le Président« pflegte stets sehr leise zu sprechen; nicht etwa, weil seine Stimmbänder schwach entwickelt gewesen wären. Der Commandant war durchaus imstande, zu brüllen wie ein Stier, wenn er es für angebracht hielt.
Nein, der Comte hielt es nicht für der Mühe wert, seine Stimme zu erheben, wenn er gezwungen war, das Wort an Untergebene zu richten. Sollten die faulen Kerle ruhig ihre Ohren spitzen, wenn sie verstehen wollten, was er ihnen zu verkünden hatte …
Als Armand vor dem Schreibtisch des Comte de Belfort strammstand und salutierte, fielen ihm wie stets dessen aufgedunsenes Gesicht und der feiste Hals auf. Die Speckwülste quollen über den engen Kragen seiner schwarzen, mit Seidenstickereien versehenen Uniformjacke.
›Er hat tatsächlich noch weiter zugenommen, seit ich ihn das letzte Mal sah‹, dachte er leicht angewidert. Zum Glück hatte er nur selten die Gelegenheit, dem Comte Auge in Auge gegenübertreten zu müssen. Seine Befehle erhielt er üblicherweise von Capitaine Émile Béguin, seinem direkten Vorgesetzten.
Träge erhob der oberste Ordnungshüter von Paris seine geröteten Augenlider zu dem Ankömmling in der schlichten, braungrün karierten Jacke und den dünnen, bereits etwas schäbigen schwarzen Hosen mit den grünen Seitenstreifen.
»Stehe Er bequem, Commissaire«, begann der Comte die Unterredung. Dass er ihn wie einen Domestiken anredete, stieß Armand wie immer sauer auf; wurde er sich dabei doch seines ärmlichen Gewands angesichts der prächtigen Kleidung des Comte noch deutlicher bewusst. Bricasson sah immer aus wie aus dem Ei gepellt; ganz so, als stünde er im Begriff, zu einem Empfang bei Hofe zu gehen.
›Aber vielleicht ist gerade mein schäbiger Aufzug geeignet, ihn daran zu erinnern, meine kümmerliche Besoldung endlich aufzustocken‹, dachte er dann gewohnt pragmatisch. Immerhin mussten Kommissare selbst für ihre Zivilkleidung sorgen – im Gegensatz zu den einfachen Polizisten, die im Dienst der Regierung kostenlos einheitliche Uniformen erhielten.
›Soll der edle Herr ruhig sehen, wie armselig und schäbig die Ordnungsmacht Seiner Majestät herumlaufen muss, weil das Gehalt hinten und vorne nicht ausreicht.‹
Die Unterredung begann damit, dass der Comte Armand Lavalle Mitteilung vom Ableben des Thronfolgers machte, von der »unsäglichen Tragödie«, wie er es nannte. Lang und breit ließ er sich dabei über das »entsetzliche Leid« der Königsfamilie aus und über deren »maßlosen Schmerz«.
Die übertriebene Art und Weise, wie er das tat, war geeignet, in Armand ein gewisses Verständnis für Huberts Sichtweise zu wecken. Ein Knabe, der weder gehen noch stehen konnte, ja, der den Kopf nicht mehr vom Kissen zu heben vermochte, der dazu beständig unter beinahe unerträglichen Schmerzen litt, so ein Kind war im Himmel gewiss besser aufgehoben; man sollte dem Kleinen seinen ewigen Frieden gönnen …
Armand Lavalle gab nicht zu erkennen, dass er über den »schrecklichen Verlust« bereits Bescheid wusste, sondern ließ seinen obersten Vorgesetzten in den mannigfaltigsten Adjektiven schwelgen, die diesem zum Tod des Dauphins einfielen.
Wann würde Monsieur de Bricasson zum Eigentlichen kommen? Noch war es offenbar nicht so weit. Armand trat bereits ungeduldig von einem Fuß auf den anderen …
Als Nächstes gefiel es seinem Chef, sich über die schlimmen Zeiten auszulassen, die über das arme Vaterland hereingebrochen waren. Womit er jedoch keineswegs die unhaltbaren Zustände meinte, mit denen das gemeine Volk zu kämpfen hatte. Dass etwa ein nicht geringer Teil der Franzosen den vergangenen Winter nicht überlebt hatte, sondern an Kälte und Hunger gestorben war, darüber verlor er kein einziges Wort.
Auch davon war nicht die Rede, dass die Menschenmassen neuerdings vor den Bäckereien Schlange standen, um wenigstens einen kleinen Laib Brot für ihre hungernden Kinder zu ergattern. Den Bäckern mangelte es an Mehl, weil die Mühlen stillstanden. Das wiederum war eine Folge der verheerenden Ernteausfälle im vergangenen Jahr: Die Regierung hatte es schlicht versäumt, aus dem Ausland genügend Getreide einzukaufen.
Dass das Elend der Leute die Kriminalität sprunghaft anwachsen ließ und den Hass auf die Regierung und den König nährte, darüber sprach »Le Président« ebenfalls nicht. Obwohl gerade die Polizeibehörde ein Lied von Raub, Mord, Diebstahl und Überfällen durch die Darbenden singen konnte …
Der Comte beklagte sich dagegen bitter über die »Aufrührer« in der Nationalversammlung, wie sich neuerdings die Angehörigen des »Dritten Standes« in der von Ludwig XVI. im Jahr 1788 einberufenen Generalständeversammlung nannten. Es handelte sich in seinen Augen um überwiegend respektlose bürgerliche Rebellen, die mit ihrer ständigen Kritik dem Adel und der Kirche das Leben schwer machten.
»Was mir unbegreiflich erscheint, ist, dass sogar Angehörige edelster Familien sich nicht scheuen, sich mit dem Dritten Stand zu solidarisieren!«
Armand sah mit Interesse den angeekelten Gesichtsausdruck seines obersten Vorgesetzten. Er wusste genau, auf wen der Commandant abzielte: Auf Graf Mirabeau natürlich, einen Mann mit außerordentlichem Charisma, der zwar aus altem Adel stammte, sich aber dennoch als Abgeordneter des Dritten Standes, der Bürgerlichen also, in der Nationalversammlung hatte aufstellen lassen.
Sprunghaft wechselte Le Président das Thema. Gottergeben verlagerte Armand sein Körpergewicht wiederum auf das andere Bein.
Nun ging es dem Comte um ein Verbrechen, das bereits seit etwa zehn Jahren die Polizeibehörde beschäftigte. Pro Jahr waren im Schnitt etwa vier oder fünf junge Männer betroffen gewesen, jedoch in jüngster Zeit häuften sich die Morde; die Intervalle zwischen den Taten verkürzten sich geradezu dramatisch; etwa alle vier Wochen war jetzt ein männliches Opfer zu beklagen. Die Vorgehensweise des Täters war seit zehn Jahren in etwa immer die gleiche geblieben.
Armand fühlte sich sehr unwohl, als sein oberster Vorgesetzter jetzt davon anfing; glaubte er doch irgendwie dafür verantwortlich zu sein, dass es der Polizei noch immer nicht gelungen war, den Verbrecher zur Strecke zu bringen. Er empfand es persönlich als einen großen Makel in seiner Laufbahn, dass es ihm trotz aller Anstrengungen noch nicht gelungen war, diesen widerwärtigen Fall zu lösen.
Obwohl beileibe nicht nur er auf diesen ganz speziellen Mörder angesetzt war, fühlte er sich gleichwohl mitschuldig an jeder einzelnen Untat, die der abscheuliche Triebtäter beging. Es musste sich um einen hochintelligenten Mann handeln, der es wie kein zweiter immer aufs Neue verstand, seine Spuren peinlichst zu verwischen.
Armand Lavalle erinnerte sich nur allzu gut: Kurz nach seiner Ankunft in Paris war er als blutjunger Ermittlungsbeamter mit zwei Hilfspolizisten an eine Stelle des Seineufers im Südosten der Stadt gerufen worden, wo Männer an einer der Schleusen eine grausige Entdeckung gemacht hatten …
Städtische Angestellte im Arbeiterviertel Faubourg Saint Antoine am Stadtrand, verantwortlich für das Pariser Flusswesen, hatten bei ihrer regelmäßig durchgeführten Inspektion und Reinigung des Auffanggitters, am Stauwehr mit ihrem Fangnetz eine Leiche aus der Seine herausgefischt.
»Himmel, Arsch und Zwirn! Nicht schon wieder! Allmählich reicht’s mir!«, hatte einer der Männer geknurrt und mit aller Kraft an dem Netz gezogen, dessen schwergewichtiger Inhalt sich offenbar in den Maschen verhakt hatte. »He, hilf mir mal!«, forderte er seinen Kameraden auf. Zu zweit schafften sie es schließlich, den nackten männlichen Kadaver mit ihren vorne mit einem Eisenhaken versehenen Stangen aus dem Wasser zu hieven.
Als die Arbeiter sich ihren grausigen Fund näher anschauten, mussten sich beide übergeben. Die Ursache ihrer plötzlichen Übelkeit lag nun keineswegs darin, dass die Burschen besonders zart besaitet gewesen wären; das war bei dieser Art von Beschäftigung auch gar nicht möglich. Hart im Nehmen musste jeder sein, der für die Flussreinigung zuständig war.
Seit Jahrhunderten schon pflegten Unglückliche aller Altersgruppen, die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekamen, ins Wasser zu gehen; als da waren sitzen gelassene Bräute, Mägde in anderen Umständen, unglückliche Ehefrauen ebenso wie finanziell ruinierte Männer und unschuldige junge Mädchen, die man gegen ihren Willen ins Kloster zu stecken beabsichtigte.
Nicht selten waren es auch abgetriebene Bébés und sonstige Kindsleichen, überflüssige Greise, genauso wie Opfer brutaler Auseinandersetzungen, die man in der Seine verschwinden ließ.
Für gewöhnlich bestand gut die Hälfte aller Wasserleichen aus Mordopfern, wie Erschlagene und Erwürgte, Erstochene, Erschossene und Vergiftete. Warum also ausgerechnet an diesem Tag das besondere Grausen der Arbeiter?
Was den enormen Abscheu der Schleusenwärter in diesem ganz speziellen Fall hervorrief, war die Art und Weise, wie der Leichnam zugerichtet war. Auf den ersten Blick war klar: Wiederum hatte der Seinemörder zugeschlagen!
»Bei dem Kerl muss es sich offenbar um einen schwer gestörten Irren handeln«, keuchte einer der Flussinspektoren, den die Männer als Ersten an den Fundort riefen. Und zu diesem Urteil war auch Armand Lavalle bei einem kurzen Blick auf den Toten gelangt. Ehe der brutale Schlächter sein Opfer in die Seine geworfen hatte, um sich des Kadavers zu entledigen, hatte er es an Kopf und Gesicht gehäutet, aufgeschlitzt und sorgfältig ausgeweidet …
Kommissar Lavalle und die beiden ihm für diesen Fall zugeteilten Polizisten mussten schwer an sich halten, um ihr Frühstück nicht ebenfalls den Fischen zu opfern …
Ein herbeizitierter Arzt, der für die Polizei gelegentlich Untersuchungen an Toten vornahm, die vermutlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen waren, stellte fest, dass dem Unbekannten – allem Anschein nach einem noch recht jungen Mann – das Herz, die Leber, die rechte Niere, der Magen und die Gedärme fehlten.
Jedoch die Lunge, die Milz, sowie die linke Niere waren im Inneren des Körpers zurückgelassen worden. Selbst die Augen hatte der Täter dem Ermordeten ausgestochen.
»Es scheint sich um ein grausiges Ritual zu handeln«, lautete die Ansicht des sichtlich geschockten Mediziners.
Nachdem einer der Arbeiter einem Mitarbeiter von Jean-Paul Marats Zeitung »Ami du Peuple« genauestens Bericht erstattet hatte, verkündete die reißerisch aufgemachte Titelblattgeschichte des »Volksfreundes« am nächsten Tag das Folgende:
»Die Operationen hat der offenbar Geistesgestörte erneut fachgerecht ausgeführt. Nachdem der Täter der Leiche des Mannes noch die Geschlechtsteile abgetrennt hatte, legte der abartige Mörder wiederum eine Goldmünze in den Leib des Getöteten, den er anschließend mit dickem rotem Garn zunähte und ihn nackt in den Fluss warf.
Seinem bedauernswerten Opfer stach er vorher, so wie in allen vorausgegangenen Fällen auch, noch die Augen aus und zog ihm die Haut des Gesichts und des Schädels ab – wie es bei manchen Indianerstämmen Nordamerikas im Umgang mit ihren Feinden Brauch ist – was es nahezu unmöglich macht, den Ermordeten zu identifizieren.«
»Le Président« hatte seinerzeit zwar getobt, als er den Bericht in dem regierungsfeindlichen Hetzblatt zur Kenntnis nehmen musste, aber die Tatsachen hatte auch er nicht vom Tisch wischen können. Das konnte er jetzt weniger denn je. Dass so etwas Grausiges in Frankreich zum wiederholten Male möglich war, ohne dass die königliche Polizeibehörde die geringste Ahnung über den Täter hatte, war beim besten Willen nicht unter den Teppich zu kehren.
Daran hatte sich leider bis zum heutigen Tag nichts geändert. Auch vermochte keiner der seither von Armand oder anderen Kommissaren Vernommenen zu den zahlreichen, unter so grausigen Umständen ums Leben gekommenen Opfern, auch nur eine einzige, noch so geringfügig erhellende Angabe zu machen.
»Ihm ist es leider immer noch nicht gelungen, irgendeinen der rund fünfzig Ermordeten – vom Täter ganz zu schweigen – namhaft zu machen. Oder irre ich mich da, Commissaire Lavalle?«
Armand, der sich beinah wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange fühlte, nickte ziemlich eingeschüchtert.
»Jawohl, Monsieur le Président«, krächzte er. Vor Aufregung war seine Kehle ganz trocken. »Leider ist das so. Keiner der von uns Befragten konnte bisher auch nur das Geringste zur Aufklärung beitragen. Wir kennen bis dato nicht einmal die Namen der Getöteten. Der abartige Mörder richtet die Leichen absichtlich so zu, um eine Identifizierung der Betroffenen unmöglich zu machen.«
»Das ist mir bekannt, mein Lieber.«
Der Comte zwang sich zu einem sarkastischen Lächeln. »Aber dieser unhaltbare Zustand dauert nun bereits zehn Jahre lang an und allmählich reicht es mir mit Seinen Ausreden! Ich verlange jetzt endlich Ergebnisse von Ihm. Es kann nicht sein, dass dieser Verrückte die Pariser Ordnungsmacht auf Dauer der Lächerlichkeit preisgibt. Hat Er mich verstanden?«
Plötzlich fror Armand. Die Temperatur im Raum schien auf einmal beträchtlich gesunken zu sein. Das war’s also mit seiner erhofften Beförderung! Er konnte von Glück sagen, wenn ihn der Commandant Général nicht auf die Straße setzte …
Aber so leicht wollte er sich nicht geschlagen geben.
»Mon Commandant! Bedenkt, bitte, gütigst, dass es, um den Täter auf frischer Tat zu ertappen, der konsequenten und engmaschigen Überwachung bestimmter Abschnitte der Seine innerhalb, sowie außerhalb des Stadtgebietes bedürfte. Das ist personell überhaupt nicht zu schaffen!«
»Dieses Argument höre ich ebenfalls seit einem Jahrzehnt! Wie Er das letztlich anstellt, ist mir gleichgültig. Meinetwegen sollen Er und seine Kameraden sich Tag und Nacht auf die Lauer legen! Ich erwarte nur, dass mir möglichst schnell Ergebnisse vorliegen, die auf eine umgehende Verhaftung des betreffenden Massenmörders abzielen. Dieser leidige Fall ist ein Schandfleck auf meiner glänzenden Karriere und muss unbedingt vor meinem Ausscheiden aus königlichen Diensten bereinigt werden. Ist Ihm das soweit klar?«
»Naturellement, mon Commandant, naturellement! Monsieur le Président erwägen zu demissionieren?«, entfuhr es ihm gleich darauf. Armand hoffte nur, seine Frage habe nicht allzu erwartungsfroh geklungen …
»Mais oui, mon Commissaire! Ich gehe lieber freiwillig, ehe man mir den Stuhl vor die Türe setzt«, gestand der Comte de Belfort freimütig und für den Kommissar vollkommen überraschend.
Bei einigem Nachdenken war das Ganze allerdings gar nicht so unbegreiflich. Der Adel hatte im derzeitigen Paris denkbar schlechte Karten. Die Generalständeversammlung und vor allem der Dritte Stand mit seinen Schreihälsen machte sämtlichen Aristokraten das Leben schwer. Die Polizei unterstand – wenigstens dem Namen nach – dem König. Es lag gleichsam in der Luft, dass sich das in Kürze ändern könnte.
Und dann wäre für einen monarchistisch gesinnten Comte gewiss kein Platz mehr bei der staatlichen Ordnungsmacht. Da war es in der Tat klüger, sich rechtzeitig aus dem Staub zu machen – wie es nicht wenige Adlige bereits getan hatten. Paris erlebte derzeit geradezu eine Fluchtwelle des Adels, hinaus aufs Land oder gleich ganz über die Grenze …
»Also, Commissaire Lavalle, wenn Er das nächste Mal vor mir steht – was hoffentlich recht bald der Fall sein wird – erwarte ich von Ihm die Vollzugsmeldung der Festnahme dieses gefährlichen Irren. Dann können wir meinetwegen auch über Seine Beförderung sprechen, mon Cher. Au revoir, mon Commissaire!«
Mit einem hauchdünnen Lächeln war Armand entlassen. Wie vor den Kopf geschlagen fand er sich draußen auf dem Flur wieder. Sein Freund Hubert Aubriac, der auf ihn gewartet hatte, sah ihm neugierig entgegen.
»Und? Wie steht’s? Darf man zum Commissaire Supérieur gratulieren?«
»Hör mir bloß auf! Von wegen Beförderung!« Resigniert winkte Lavalle ab. »Zuerst muss ich den verrückten Seinemörder entlarven und dingfest machen. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt über meine berufliche Zukunft sprechen!
Weißt du übrigens schon, dass der Commandant sich in Kürze von der Polizei verabschieden will?«, fragte er dann mit einem leicht irritierten Seitenblick auf seinen Freund. Er hätte wetten können, dass Hubert bereits Kenntnis davon hatte.
»Wie? Nein, das ist mir wirklich neu«, behauptete Aubriac. »Zu mir hat der Fettsack kein Sterbenswort gesagt. Warum ausgerechnet zu dir? Nun, wie auch immer! Verständlich ist es schon. In unserer glorreichen Hauptstadt wird es für seinesgleichen allmählich ungemütlich! Die Luft wird für die adeligen Herrchen allmählich empfindlich dünner.«
Hubert schlug eine zynische Lache an. Aber seinem Freund Armand war nicht zum Lachen zumute. Der Seinemörder genannte Verbrecher ging ihm nicht aus dem Kopf.
»Seit zehn Jahren versuchen alle Polizisten von Paris, den Verrückten zu jagen, aber vergebens. Und jetzt soll ausgerechnet mir innerhalb kürzester Zeit der Coup gelingen? Ich soll jetzt Knall auf Fall das perverse Schwein zur Strecke bringen. Dass mir für eine konsequente Überwachung der einzelnen Abschnitte der Seine entlang die Leute fehlen, ist ›Le Président‹ gleichgültig. Er will bloß noch eines: Seine Laufbahn mit der spektakulären Aufklärung einer makabren Mordserie krönen!«
Armand seufzte schwer.
»Adieu, Beförderung! Adieu, Hochzeit! Adieu, Ginette!«
»Jetzt lass’ mal den Kopf nicht gleich hängen, Kumpel! Wer weiß, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mord, dass du den kranken Saukerl schnappst. Bald ist wieder Vollmond. Da kriechen, wie du weißt, sämtliche Geistesgestörten aus ihren Rattenlöchern.
Ich wünsche dir, dass er dir dieses Mal ins Netz geht! Und was deine Liebste anbelangt: Ich glaube nicht, dass sie dir auf einmal die Freundschaft aufkündigt. Das Mädel liebt dich doch!«
Den frommen Wunsch, die Verhaftung des Seinemörders betreffend, konnte Armand nur unterstreichen – auch wenn er keine Ahnung hatte, wie dieses Wunder vonstattengehen sollte. Dieser Kerl schien ein Genie zu sein: Noch nie hatte der Schweinehund sich auch nur den allerkleinsten Fehler geleistet.
Was allerdings Régine Madrier, seine geliebte Ginette, anbelangte, war Armand sich durchaus nicht mehr sicher. Das bildhübsche Mädchen konnte zehn Kerle an einem Finger haben. Die meisten von ihnen hätten sie mit Kusshand geheiratet. Warum sollte sie ausgerechnet auf ihn und seine längst überfällige Gehaltsaufbesserung warten?
5. Juni 1789
Gleich nach Dienstschluss machte Armand Lavalle sich auf den Weg zur Wohnung seiner Liebsten, die mit ihrem jüngeren Bruder Luc und Großmutter Céléstine – wie die meisten Pariser – in höchst beengten Wohnverhältnissen lebte.
Die engen Gassen der Altstadt waren voller Müßiggänger; statt ihnen höflich auszuweichen, drängte sich der Kommissar energisch durch die Menge, schubste wohl auch hin und wieder einen, der gar nicht weichen wollte. Wenn man ihm hinterher fluchte, war es ihm auch egal, er hatte es furchtbar eilig.
Weshalb eigentlich, fragte er sich plötzlich. Er wusste doch, dass die Blumenfrauen um diese Zeit – es war sechs Uhr abends – bereits brav zu Hause waren, um das Abendessen für sich und Luc zuzubereiten. Keine der beiden verließ mehr die Wohnung nach sieben Uhr. Es war nicht ratsam für anständige weibliche Passanten, sich abends ohne männlichen Begleiter auf der Straße zu zeigen. Übles Gesindel schoss Tag für Tag wie giftige Pilze oder Unkraut aus dem Boden.
Lavalle hatte nach dem enttäuschenden Gespräch mit seinem obersten Vorgesetzten einfach das starke Bedürfnis, sich Ginettes Zuneigung zu versichern – auch wenn es wieder nichts war mit Beförderung und mehr Gehalt und daher ihre Hochzeit noch warten musste.
Im Sturmschritt erklomm er bis zur vierten Etage die halbmarode Stiege, die er samt ihren gefährlichen Eigenheiten genauestens kannte. Er wusste über jede wacklige Stufe Bescheid und sogar die Stelle, an der – kurz vor dem dritten Absatz – eine einzelne Treppenstufe fehlte, hätte er sogar im Schlaf überspringen können.
Jedes Mal wenn Lavalle die Lücke passierte, erinnerte er sich daran, dass er Ginette längst versprochen hatte, dem Hauseigentümer Beine zu machen, dass er den Schaden endlich beheben ließ. Es bestand immerhin die Gefahr, dass irgendwann jemand durch das Loch bis ins darunter liegende Stockwerk plumpste. Aber immer kam ihm irgendetwas anderes dazwischen …
Als er die Tür aus dünnen Bohlen aufdrückte – der Riegel war nicht vorgelegt und das Schloss ohnehin ein Witz – stand er mitten in der Wohnstube, weil es keinen Flur gab. Beide Frauen blickten gleichzeitig auf.
»Ach, Ihr seid es bloß«, murmelte Céléstine, während Ginette vom Tisch, an dem sie gerade Brot aufschnitt, aufsprang und ihm entgegenlief.
»Chéri, wie schön, dass du heute kommst! Hätte ich es gewusst, hätten wir mehr Suppe gekocht! Aber ich denke, es wird trotzdem für alle reichen!«
Sie umarmte Armand stürmisch und küsste ihn zärtlich auf beide Wangen. Ihre großen grünbraunen Augen, die ihn von jeher fasziniert hatten, strahlten ihn an. Er sah das als Einladung zu einem »richtigen« Kuss, aber verschämt drehte Ginette ihren Lockenkopf zur Seite.
»Lasst euch bloß nicht stören, ihr Turteltäubchen«, grummelte die Großmutter, die seit fünfzig Jahren Blumen auf dem Pariser »Marché aux Fleurs« verkaufte. Wobei allerdings ihre wohlwollende Miene ihre Brummigkeit Lügen strafte.
Als Lavalle seine Liebste endlich freigab, entschuldigte sich die Alte bei ihm: »Ihr dürft mir die wenig freundliche Begrüßung von vorhin nicht übel nehmen, Monsieur le Commissaire; aber wir haben am heutigen Abend nicht mit Euch gerechnet. Außerdem warten wir auf Luc. Der Bengel ist seit einer geschlagenen Stunde überfällig. Weiß der Himmel, wo er sich andauernd herumtreibt!«
»Es ist ja noch lange hell draußen«, versuchte Armand Grand-mère Céléstine zu besänftigen. »Der Hunger wird ihn schon nach Hause treiben!«
»Genau das ist es ja, was mich so verärgert«, gab ihm die alte Frau zur Antwort. »Er geruht zu erscheinen, wenn ihm danach ist und nicht, weil er meinen Anordnungen gehorcht. Ich habe schließlich die Verantwortung für ihn. Zudem hört man doch immer wieder von grässlichen Verbrechen an jungen Burschen, die aus der Seine gefischt werden und die keiner mehr erkennt, weil sie so schrecklich zugerichtet sind. Wäre an der Zeit, wenn die Polizei den Mörder endlich schnappen würde!«
Der letzte Satz stocherte in der ohnehin schwärenden Wunde Lavalles. Er überhörte die Anklage und ging lieber auf das geschätzte Alter der bedauernswerten Opfer ein.
»Bisher handelte es sich nicht um Knaben, die der Seinemörder auf dem Gewissen hat, Madame Madrier, sondern stets um junge Männer von Anfang bis Mitte zwanzig.«
»So? Ist das so?«, erkundigte sich Céléstine. »Na ja, mag ja sein! Aber wirklich beruhigen kann mich das auch nicht. Ich vertrete an Luc immerhin Mutterstelle. Und wer schwört mir, dass der Mörder seinen Geschmack nicht ändern könnte?«
Darauf antwortete der Kommissar lieber nicht.
Ginettes und Lucs Eltern waren vor über zehn Jahren kurz hintereinander gestorben und die Großmutter hatte die Kinder ihres Sohnes daraufhin bei sich aufgenommen.
»Was will Luc eigentlich einmal werden?«, erkundigte sich Lavalle, um die alte Frau abzulenken. Aber dieses Thema brachte sie erst recht auf.
»Nichts! Das ist ja das Schlimme! An allem hat er etwas auszusetzen. Gerade so, als gäbe es genügend Arbeitsplätze! Luc wird uns noch lange auf der Tasche liegen, fürchte ich.«
Lavalle versprach, mit dem Jungen ernsthaft über seine Berufswahl zu sprechen. Es durfte nicht sein, dass der Bruder seiner fleißigen Ginette zu einem Tagedieb heranwuchs. Er wusste auch schon, was er ihm vorschlagen wollte.
Kurz darauf traf Luc endlich zu Hause ein. Als Entschuldigung für seine Verspätung führte er an, sich mit Freunden herumgetrieben und ganz auf die Zeit vergessen zu haben.
»Tut mir leid, Grand-maman. Wird nicht wieder vorkommen! Ich versprech’s!«
Lavalle fiel auf, wie charmant der ziemlich hübsche und älter aussehende, gerademal vierzehnjährige Junge war, der seiner Schwester sehr ähnlich sah; und wie gut er es verstand, seine Großmutter um den Finger zu wickeln. Luc war groß für sein Alter und ziemlich kräftig gebaut. Man konnte ihn gut und gerne für sechzehn oder siebzehn halten.
Das nach dem Abendbrot stattfindende »Gespräch unter Männern« – Armand nahm sich den Knaben im Nebenzimmer vor – brachte nicht sofort das vom Kommissar erhoffte Resultat.
Nein, Polizist wolle er nicht werden. »Ich hätte viel zu viel Schiss vor den Verbrechern«, gestand Luc freimütig.
»Du warst ein recht guter Schüler. Das weiß ich von deiner Schwester. Du kannst flüssig lesen, leserlich schreiben und gut rechnen, habe ich gehört. Wie wäre es mit einer Anstellung als Lehrling in einem Büro, einer Anwaltskanzlei oder einem Notariat?
Du könntest nebenher noch eine Schule besuchen, in der Recht und Gesetz gelehrt werden; mit einem guten Abschluss bekämest du bestimmt eine krisensichere Anstellung. Anwalts- und Notargehilfen werden immer gebraucht!«, versuchte Lavalle ihm den Beruf eines juristischen Mitarbeiters oder Sekretärs schmackhaft zu machen.
Aber dafür war Luc noch weniger zu begeistern.
»Ich bin kein Stubenhocker«, behauptete er. »Den ganzen Tag in einem Büro? Nix für mich!«
Seine Selbstgefälligkeit irritierte Lavalle.
»Nun, soviel ich weiß, bist du künstlerisch nicht unbedingt begabt, aber wie wäre es mit einer Ausbildung als Handwerker? Gute Maurer oder Zimmerleute sind gesucht, selbst wenn alle Aristokraten das Land verlassen würden. Dann baust du eben keine Paläste oder Schlösser, sondern Villen für das vermögende Bürgertum, das seinen Reichtum auch zeigen will!«
Dazu aber hatte Luc Madrier ebenso wenig Lust.
»Steine schleppen, auf Baugerüsten herumklettern soll ich?« Nein, das mochte er bestimmt nicht.
Allmählich wurde es Lavalle zu bunt.
»Aber du erwartest wohl nicht ernsthaft, dass deine Großmutter dich ihr Leben lang durchfüttert, oder?«, fragte er mit schärferer Stimme als beabsichtigt.
»Ginette ist ja auch noch da«, meinte der Junge lässig. Der Kommissar musste kräftig schlucken. Es lag ihm auf der Zunge zu sagen: »Sobald ich dein Schwager bin, streckst du deine Beine nicht mehr unter meinen Tisch, solange du so ein Faulenzer bist!«
Aber das Thema »Heirat« war heikel und er hielt lieber den Mund. Gerade heute, nach der Abfuhr, die ihm »Le Président« erteilt hatte, wollte er es lieber nicht zur Sprache bringen.
»Vielleicht solltest du dich als Page bei unserem König bewerben!«, schlug er stattdessen vor.
Es war nur so dahingesagt, aber Luc sprang sofort darauf an.
»He! Das wär’s! Ich in Versailles! Beim König! Das werde ich probieren!«
Lavalle schätzte Lucs Chancen zwar eher gering ein, aber er hielt sich mit Bedenken zurück; zumal Ginettes Bruder regelrecht begeistert war und etwas von einem Freund erzählte, der wiederum einen Bekannten habe, dessen Vetter angeblich eine Anstellung in Versailles gefunden habe.
»Den will ich fragen, was ich tun muss, damit sie mich nehmen!«
Der Kommissar blieb skeptisch; beglückwünschte aber den Jungen zu seinem Entschluss. »Deine Großmutter und deine Schwester wären sehr erleichtert, falls du Arbeit fändest – und dann noch eine, die dir zusagt!«
Luc versprach, gleich am nächsten Tag entsprechende Schritte zu unternehmen.
Da es Lavalle an diesem Abend nicht vergönnt war, mit seiner Liebsten allein ein paar Worte zu wechseln, verschwieg er ihr auch die traurige Mitteilung, dass er nicht auf eine Beförderung und damit auf eine Gehaltsaufbesserung rechnen konnte.
›Vielleicht ist es besser so‹, dachte er. ›Dann müssen wir auch nicht über unsere bis auf Weiteres aufgeschobene Hochzeit sprechen!‹
Er fühlte sich irgendwie erleichtert – und schämte sich deswegen.
Kurz nach dem Gespräch mit Luc verabschiedete sich der Kommissar und suchte seine eigene Wohnung auf.
Je kritischer in Frankreich die Situation für die Monarchie wurde, desto stärker war Ludwig XVI. darauf bedacht, die grandiose alte Zeit des Königtums neu zu beleben. Seine Majestät versuchte, die glanzvollen Erinnerungen an die Zeiten seines großen Vorfahren, des Sonnenkönigs, wachzurufen.
Er veranstaltete in Versailles nicht nur die berühmten Bälle, Festbankette, Empfänge und Theateraufführungen, die seine Vorgänger, Ludwig XIV. und Ludwig XV., so pompös zu zelebrieren pflegten, er ließ ferner die Tradition der »Schauessen« erneut aufleben.
Monsieur Alfonse, Comte de Montmorency, seines Zeichens »Grand Maître de la Maison du Roi« – Haushofmeister des Königs – war gehalten, sein Bestes zu geben, um die verblichenen königlichen Vorfahren detailgetreu in ihrer Prunkentfaltung nachzuahmen.
Dass diese Inszenierungen zu Zeiten, in denen große Teile des Volkes am Hungertuch nagten, höchst geschmacklos, ja, auf viele geradezu skandalös wirkten, bedachte der Monarch nicht – und wenn, war es ihm vermutlich gleichgültig. Ihm halfen sie jedenfalls dabei, die Gefahren, die seinen ererbten Thron und seinen königlichen Machtanspruch zunehmend bedrohten, wenigstens in seinen Gedanken für eine Weile auszublenden.
Monsieur Alfonse war oberster Dienstherr sämtlicher Angestellter am französischen Hof. Als solcher herrschte er unumschränkt über ein riesiges Heer von Domestiken. Als sichtbares Zeichen seines Amtes trug er stets einen mit Brillanten besetzten Stab in der Hand, den er wie ein Zepter majestätisch schwang, sooft er sich durch die Flure des Palastes bewegte.
Die Diener im königlichen Schloss lebten in großer Angst vor dem großen, schweren, ungefähr fünfzig Jahre alten Grafen. Zu Lob ließ er sich nur höchst selten hinreißen; erachtete er es doch als selbstverständlich, dass jeder Beschäftigte bei Hofe gewissenhaft seinen Aufgaben nachkam.
Umso häufiger tadelte er die Angestellten aufs Schärfste. Seinem kritischen Blick entging auch nicht der kleinste Regelverstoß. Abmahnungen sprach er im Allgemeinen nur ein einziges Mal aus; bei Wiederholung einer Verfehlung erfolgte der gnadenlose Rauswurf.
Manchmal, wenn ihn jemand besonders verdross – oder auch bloß, wenn er schlecht geschlafen hatte – entließ der Grand Maître den Betreffenden bereits nach dem ersten Fauxpas. Da die Palastangestellten bei keiner höheren Instanz protestieren konnten, verbreitete die bloße Anwesenheit des Haushofmeisters Furcht und Schrecken bei allen am Hofe Tätigen.
Sogar die Älteren der Dienerschaft befleißigten sich ihm gegenüber einer geradezu absurd devoten Unterwürfigkeit; entschied der Comte de Montmorency doch über die Schicksale ganzer Sippen. Eine Entlassung bedeutete für die meisten, die häufig aus dem nicht gerade vermögenden, aber häufig total verschuldeten Kleinadel stammten, nicht nur eine persönliche, sondern auch eine familiäre Katastrophe …
Der Grand Maître als ranghöchster Angestellter des Hofes, trug die Verantwortung dafür, dass alles reibungslos ablief; vor allem besagte Schauessen vor recht gemischtem Publikum, die der König nun wieder regelmäßig in Versailles abhielt, um seine Macht augenfällig zu demonstrieren.
Eine Macht, die Tag für Tag für jeden auch in Kleinigkeiten ersichtlich, im Schwinden begriffen war. Die Szenerie bedurfte genauester Planung und sorgfältigster Überwachung.
Während an vier Tagen der Woche alles »in geregelten Bahnen« ablief, stellte sich jeden Montag, Donnerstag und Sonnabend das glänzende Organisationstalent des Haushofmeisters in besonderer Weise aufs Neue der Kritik.
Der Monarch und seine Gemahlin saßen in prächtig bestickten und mit Gold und Silber verbrämten Seidengewändern, aufgeputzten Marionetten ähnlich, schweigend an der mit Blumengestecken, Goldgeschirr, geblümtem Porzellan und kristallenen Weinkelchen überladenen Tafel.
Um die beiden nicht vor den zahlreich im Speisesaal des Schlosses von Versailles vorüberdefilierenden Gaffern zu blamieren, musste der Grand Maître augenfällig unter Beweis stellen, wie hervorragend er seine Untergebenen im Griff hatte. Jede Bewegung eines Bediensteten bei diesen zeremoniellen Mahlzeiten ähnelte einer sorgfältig einstudierten Choreografie.
Des Grafen ganz spezielles Augenmerk galt an diesen Tagen der so genannten »Kredenz«, einem siebenstufigen, hölzernen Aufbau, umhüllt von blütenweißem Leinen, direkt hinter der Tafel.
Sie war der Blickfang schlechthin: Hier konnte der König dem ehrfürchtig staunenden Publikum, das sich in Dreierreihen –, wenn auch in gebührender Entfernung –, an der Prunktafel vorüber schob, die enormen Reichtümer der Bourbonen präsentieren.
Ob das derzeit so klug war, überlegte Seine Majestät offenbar nicht …
Ludwig schien zu glauben, seine Untertanen durch Protz und Pomp beeindrucken zu können, sodass jeder Widerstand gegen ihn und die Monarchie von selbst zum Erliegen käme.
Auf der obersten Etage der Kredenz thronten die großen schweren und prunkvoll verzierten, aus Silber und Gold getriebenen Pokale und die kunstvoll ziselierten Weinkannen. Sie dienten lediglich als Dekor, für den Gebrauch waren sie viel zu unhandlich. Das galt auch für die meisten der Schalen, Schüsseln und Platten und für die in Silber getriebenen Becken für die Säuberung der Hände.
Auf den beiden vorletzten Stufen des Möbels pflegten die Köche und Küchenjungen das Geschirr zu platzieren, das tatsächlich benutzt wurde: die riesigen Silberplatten mit den diversen Braten, die Schüsseln mit dem Gemüse und die Terrinen für Suppe und Saucen.
Das wichtigste Prunkstück wurde allerdings für gewöhnlich auf der untersten Étagère der Kredenz deponiert: Ein kunstvoll ausgeführtes und verziertes Segelschiff aus massivem Silber. Es enthielt das persönliche Besteck Ludwigs XVI., sowie seinen goldenen Trinkbecher, das goldene Salzfass und das seidene Mundtuch des Monarchen.
Mit diesem Schiff betrieb der Grand Maître einen geradezu lächerlichen Kult: Haargenau mittig hatte es auf der untersten Stufe zu stehen; der Graf duldete auch nicht die winzigste Abweichung nach links oder rechts. Sobald es der betreffende Küchenjunge an die richtige Stelle gesetzt hatte, stellte Monsieur Alfonse sich breitbeinig vor die Kredenz und beäugte die Komposition aufs Genaueste. Dabei pflegte er alternierend jeweils ein Auge zuzudrücken. Das tat er etwa ein Dutzend Mal, dabei dem bedauernswerten Burschen ständig Anweisungen zuzischend, die dieser unermüdlich ausführte.
Alle Gegenstände musste der Ärmste so lange verrücken, bis sie millimetergenau an Ort und Stelle standen, und das Gesamtarrangement dem schon zwanghaft anmutenden Symmetrieempfinden des Grand Maître genügte.
Endlich war es geschafft! Der an diesem Tag damit befasste Küchenjunge André de Junot, ein dunkelhaariges mageres Bürschchen aus dem Süden Frankreichs, wagte ein schüchternes Lächeln. Ob der strenge Haushofmeister ihm heute vielleicht ein kleines Lob aussprach? Immerhin hatten die Schüsseln, Kannen und Platten ein enormes Gewicht, von dem Segelschiff ganz zu schweigen …
»Komm nachher in den Silberputzraum, André. Ich werde dir Anweisungen geben, welche Teile des Silberbestecks zu polieren sind und wie du damit umgehen musst«, murmelte Monsieur Alfonse. Sein Gesicht blieb dabei ganz unbewegt. Nur am Glitzern seiner graublauen Augen erkannten die erfahrenen Domestiken, dass der Grand Maître wieder einmal Feuer gefangen hatte …
6. Juni 1789
Commissaire Armand Lavalle pflegte im Allgemeinen während seiner Dienststunden möglichst wenig Zeit am Schreibtisch zu verbringen.
»Langweilige Protokolle anzufertigen und Berichte zu verfassen, gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbeschäftigungen«, pflegte er zu sagen. Er zog es vor, »vor Ort« herumzustreifen, wo die Verbrechen in aller Regel auch stattzufinden pflegten.
Unerkannt, in seiner schlichten, um nicht zu sagen schäbigen Kleidung, lief er stundenlang durch die Gassen von Paris, vor allem in den sozialen Brennpunkten der Stadt. Von ihnen gab es leider mehr als genug; nicht nur in der restlos überbevölkerten Innenstadt, sondern vor allem in den in den letzten Jahren entstandenen Außenbezirken – einst selbstständige Dörfer.
Aber das war in allen anderen Hauptstädten um kein Haar anders, wie er von Berichten aus London, Sankt Petersburg oder Madrid wusste. Unverhältnismäßig überreicher Zuzug vom Land vergrößerte die besitzlose Klasse, die sich zudem überproportional stark vermehrte. Not, Elend und in ihrem Gefolge Kriminalität verbreiteten sich schneller als früher üblich.
Armand entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem Meister im Beobachten. Ertappte er einen Dieb oder Einbrecher in flagranti, nahm er ihn in aller Regel nicht sofort fest; sondern verfolgte den Täter heimlich. Für gewöhnlich führte dieser ihn zu seinem Versteck, wo er das Diebesgut lagerte, um es später gewinnbringend loszuschlagen.
Auf diese Weise fand er nicht nur die Beute, sondern der Kommissar entlarvte häufig neben dem Dieb auch dessen Mittäter und den Hehler. Handelte es sich darum, Verbrecher in Gewahrsam zu nehmen, hielt Lavalle sich für gewöhnlich gerne im Hintergrund und ließ stattdessen seine uniformierten Polizisten in Aktion treten; sah er sich doch eher als Organisator der Verhaftung, ausführen durften sie andere; das Lob dafür gönnte er den Männern.
Das verschaffte ihm immerhin den großen Vorteil, dass die Ganoven ihn auch nach zehn Jahren noch nicht wirklich kannten. Dem Namen nach war er für sie ein rotes Tuch – meist handelte es sich um Kleinkriminelle, aber hin und wieder waren auch »große Fische« darunter.
Er verhielt sich so unauffällig, dass sie ihn als Person kaum zu beschreiben vermochten. Zudem veränderte er ständig sein Aussehen, was Haar- und Barttracht anbelangte, aber auch durch die Wahl seiner Kleidung und seiner Aussprache. Er war sprachbegabt und manche schworen, er sei ein Bretone; einige behaupteten, seinem Argot nach müsse er aus dem Osten von Paris stammen, während ihn wiederum andere gar für einen Südfranzosen hielten … Nicht selten wählte er eine Verkleidung als Handwerksbursche, als Mönch, als Bettler oder Pilger; hin und wieder mimte er einen Matrosen auf Landgang oder einen Gaukler.
Was Letzteres anbelangte, hatte ihm vor Jahren ein von ihm festgenommener und anschließend wieder laufen gelassener Ganove ein paar nette Kunststückchen beigebracht, sodass er durchaus als einer vom Fahrenden Volk durchgehen konnte.
Ginette lachte oft über seine Kapriolen, die er gelegentlich im Wald, wo ihn keiner beobachten konnte, vollführte und sorgfältig übte, um sie nicht zu verlernen: Das Feuer- oder Schwertschlucken etwa, das Balancieren auf einem zwischen zwei Baumstämmen gespannten Seil, das Laufen auf den Händen oder kunstvolle Salti vor- und rückwärts in der Luft.
Ein anderer Tunichtgut hatte ihm vor Jahren etliche Kartentricks beigebracht, die es ihm erlaubten, als durchaus ernst zu nehmender Betrüger Anspruch auf den »Respekt« diverser Mitglieder der Gaunerzunft zu erheben.
Es war dies eine kluge Vorgehensweise, die es ihm ermöglichte, auch in Winkel und Ecken der allzu dicht bebauten, labyrinthartig verwinkelten Stadt vorzudringen, wohin sich andere Kommissare gar nicht erst hinein wagten.
In den einschlägigen Lokalen und Treffpunkten der Gauner saß er mitten unter ihnen und trank sein Gläschen Roten. Gelegentlich schlugen ihm die schrägen Vögel sogar vor, bei ihren Raubzügen mitzumachen. Ein paar Male hatte Armand während eines Einbruchs in die Stadtvillen von Adligen, die selbst überwiegend auf dem Lande lebten, Schmiere gestanden.
Amüsiert beobachtete er dann seine Polizeikameraden dabei, wie sie zum richtigen Zeitpunkt auftauchten und die überrumpelten Gauner allesamt in flagranti verhafteten. Von den Kollegen zum Schein gleichfalls festgenommen und ziemlich unsanft behandelt, verdächtigte ihn keiner der Strolche jemals auch nur im Geringsten …
Auch an diesem sechsten Juni drängte es ihn – immer noch als Nachwirkung der niederschmetternden Unterredung mit seinem obersten Vorgesetzten – hinaus aus dem Kommissariat und an die frische Luft. Wenngleich diese zwar keineswegs so »frisch« war, sondern geradezu geschwängert mit ekligen Gerüchen aller Art:
Moder aus den durch Mauerschwamm ruinierten Hauswänden, Rauch aus halbverfallenen Schornsteinen, verdorbenem Fett von Garküchen, schalen Wein- und Bierdünsten, die aus minderwertigen Kneipen drangen, Kohlgestank aus Rattenlöchern, die sich als »Wohnungen« bezeichneten und dem »Duft« von Exkrementen, von Bewohnern einfach aus ihren Nachtgeschirren aus den Fenstern gekippt.
›Wie im finstersten Mittelalter‹, dachte Lavalle und schüttelte sich vor Ekel. Der Gegensatz zwischen den Stadtvierteln mit Bürgerhäusern und Adelspalästen und den Quartiers, wo das arme Volk hauste, war bereits auf den Gassen abzulesen, obschon beide oft nur wenige Meter voneinander getrennt waren. Lavalle wich gerade einer Magd aus, die mit Feuereifer einen Reisigbesen schwang, um den Platz vor dem Haus ihrer Herrschaft zu reinigen, obwohl dieser bereits vor Sauberkeit glänzte.
»Und vor den Hütten in den Elendsquartieren türmt sich der Müll haushoch auf«, murmelte er vor sich hin, »da keiner sich veranlasst sieht, den Dreck wegzufegen.«
Aber auch das sollte angeblich in anderen Großstädten um kein Haar anders sein.
Paris war überfüllt mit Menschen, während die Häuser zu klein und die Straßen viel zu eng waren. Er bog in eine Gasse ein, in die noch niemals ein Sonnenstrahl bis zum Erdboden durchgedrungen war, nicht einmal im Hochsommer. Die elenden Löcher, in denen die Ärmsten hausten, waren hoffnungslos überbelegt, dumpf und feucht. An den Wänden bildete sich giftiger Schimmel und im Winter gefror das Kondenswasser zu Eis, da die Bewohner zu wenig Holz hatten zum Verfeuern.