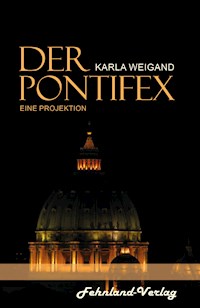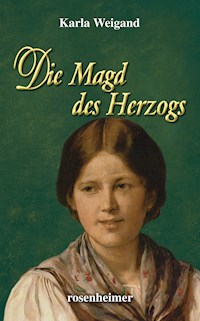6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Thomas R. P. Mielke ist als Autor zielstrebig seinen Weg vom Romanheft über das anspruchsvolle Taschenbuch bis zum Hardcover gegangen. Und man kann feststellen, dass sich die Qualität seiner Arbeit parallel dazu fast kontinuierlich gesteigert hat. Thomas R. P. Mielke hat eine beispielhafte Karriere bis hin zum Bestsellerautor hingelegt – ein Vorzeigeautor, dem hier zu seinem achtzigsten Geburtstag von Herzen gratuliert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Rainer Schorm & Jörg Weigand (Hrsg.)
VERGANGENE ZUKUNFT
Thomas R. P. Mielke zum achtzigsten Geburtstag
AndroSF 118
Rainer Schorm & Jörg Weigand (Hrsg.)
VERGANGENE ZUKUNFT
Thomas R. P. Mielke zum achtzigsten Geburtstag
AndroSF 118
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Februar 2020
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Rainer Schorm
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat: Rainer Schorm, Jörg Weigand
Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 185 3
ISBN des E-Books: 978 3 95765 900 2
Jörg Weigand: Eine beispielhafte Karriere
Der Werdegang des Bestsellerautors Thomas R. P. Mielke
Ein Vorwort
Der 1995 verstorbene Verleger Gustav H. Lübbe war angestellter Kulturredakteur einer Regionalzeitung, als er 1953 den Sprung ins Wasser wagte: Er kaufte den Miniverlag Bastei von seiner bis dato recht glücklosen Besitzerin und etablierte sich mit seinem Neustart bald darauf in Bergisch Gladbach. Dass sein neues Unternehmen Unterhaltungsromane im Format Romanheft vertrieb, das von Bürgertum wie Feuilleton mit verächtlichem Naserümpfen angesehen wurde, berührte ihn nicht. Wichtig war ihm, dass er wusste, was er wollte.
So in etwa äußerte sich der Verleger Lübbe mir gegenüber, als ich ihn im Frühjahr 1976 für die Fachzeitschrift »Medien- & Sexual-Pädagogik« interviewte. Und er vertrat folgende These: Das Romanheft hat durchaus seine Berechtigung, bringt es doch Teile der Bevölkerung zum Lesen, die sich ansonsten nichts weiter als die Boulevardpresse zu Gemüte führen würden. Der Leser bzw. die Leserin von Romanheften – gleich ob Western, Krimi oder Liebes- oder Arztroman – hat die Chance, sich »hinaufzulesen«. Genau dafür hat Bastei zusätzlich zu seinen Heftromanen noch Taschenbücher. Und der Sprung von dort zu anderen Taschenbuchreihen bzw. auch ins Hardcover ist dann nicht nur möglich, sondern eher wahrscheinlich.
Der Verleger Lübbe vertrat nicht nur mir gegenüber diese Ansicht: Wie ich heute weiß, war das seine offizielle Meinung gegenüber jedermann, die er vehement und argumentativ durchaus nachvollziehbar vertrat. Und was er über die Leser sagte, ist ebenso deutlich verfolgbar bei vielen Autoren, von Irene Rodrian über Horst Bosetzky bis Wolfgang Hohlbein und Jörg Kastner sowie vielen weiteren: Sie hatten die Möglichkeit, im Romanheft zu üben, d. h. Schreibroutine zu erwerben, und in der Folge auf dem allgemeinen Buchmarkt Karriere zu machen.
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist auch unser Jubilar Thomas R. P. Mielke, dessen Anfänge als Schriftsteller und weiterer Werdegang geradezu beispielhaft diesen Weg aufzeigen:
Es begann mit Leihbüchern, jenen Schmökern auf dickem Papier, von denen der am 12. März 1940 in Detmold geborene spätere Bestsellerautor exakt fünf Titel in den Jahren 1960/61 veröffentlichte: einen Science-Fiction-Roman sowie vier Agentenreißer, von denen zwei vereinzelte SF-Elemente enthielten.
Der junge Autor war offensichtlich mit den Möglichkeiten des Leihbuchs nicht zufrieden: bei vollem Umfang ein vergleichsweise mäßiges Honorar. Da lockte der Romanheftmarkt, gab es doch zur damaligen Zeit zumindest sechs Verlage, deren Reihen und Serien einem fleißigen Schreiber Lohn für seine Mühe versprachen: Bastei (Bergisch Gladbach), Kelter (Hamburg), Lehning (Hannover), Marken (Köln), Moewig (München), Pabel (Rastatt) und Zauberkreis (Rastatt). Der Vorteil, Romanhefte zu schreiben, bestand darin: Man akzeptierte kürzere Manuskripte und bot dazu besseres Honorar als bei den Leihbuchverlagen. Es spricht für den Geschäftssinn des jungen Autors, dass er dies erkannte.
Ab 1966 erschienen von Thomas R. P. Mielke in rascher Folge bei den Verlagen Kelter und Zauberkreis eine große Anzahl von SF-, Kriminal- bzw. Spionage- sowie Horrorromanen. Der Autor schrieb unter folgenden (Verlags-) Pseudonymen: Cliff Corner, Bert Floormann, Henry Ghost, John Taylor sowie seinem persönlichen Decknamen »Marcus T. Orban«. Allein unter letzterem Pseudonym veröffentlichte Mielke im Zauberkreis-Verlag über dreißig Titel, die zum Teil in der gleichen Reihe »Z-Science-Fiction« nachgedruckt wurden. Einzelne Titel kamen später auch noch einmal auf den Markt – als Taschenbuch bzw. sogar als Hardcover (Das Beste, Bastei-Lübbe, Schneekluth).
Die Entwicklung eines Autors – soll man es Karriere nennen? – lässt sich bei nicht wenigen in Phasen einteilen. So auch bei Thomas R. P. Mielke, bei dem es sogar etwas wie eine Gliederung gibt:
1. Veröffentlichungen im Leihbuch und im Romanheft (neben SF auch andere Spannungsliteratur [1961–1983]);
2. Science-Fiction von herausragender Güte im Taschenbuch (1980–1986);
3. mythologisch-abenteuerlich-historische bzw. historisch-biografische Romane (ab 1988).
Bei der vielseitigen schriftstellerischen Begabung dieses Autors kann es nicht überraschen, dass sich die einzelnen Phasen überlappen.
Als Mielkes erstes Science-Fiction-Taschenbuch »Grand Orientale 3301« im Jahre 1980 erschien, war seine Arbeit für das Romanheft noch keineswegs abgeschlossen. Doch der Autor strebte ganz offensichtlich nicht nur nach höheren Honoraren (das gewiss auch), sondern vor allem nach mehr Anerkennung – und das war ihm als Taschenbuchveröffentlichung eher erreichbar, denn mochten Texte noch so gut geschrieben und so flüssig lesbar sein, als Romanveröffentlichung wurde ihnen automatisch von gewissen Kritikerseiten ein schmuddeliges Image verpasst.
Mielke dazu (in einem Interview 1984): »Früher hat er [der Autor spricht von sich selbst] versucht, möglichst viele Pseudonyme zu benutzen, weil das, was er geschrieben hat, als ›Schmutz und Schund‹ galt. So hieß das damals, und ›Schundromane‹ zu schreiben, war eben die unterste Stufe der Literatur. Dass man so etwas schrieb, durfte man doch höchstens auf SF-Cons zugeben, und deswegen habe ich die auch ein paarmal besucht, bis ich dann merkte, dass da alle nur von sich selber reden, und dann bin ich nicht mehr hingegangen.«
Der Münchner Wilhelm Heyne Verlag stand in den Siebziger- und Achtzigerjahren des 20. Jahrhunderts bereits hoch in der Gunst der Leser (und der Kritiker); er war sozusagen der Vorzeigeverlag für gehobene Science-Fiction im deutschen Sprachraum. Hier zu erscheinen war gleichbedeutend mit der Verleihung eines Adelstitels im Mittelalter. Mit einem Schlag war der bis dato eher übersehene Autor »jemand«, der aufmerksame Beachtung verdiente.
Freilich, einen umfangreichen Roman zu schreiben, verlangte Zeit, viele lange Monate, in denen zahlreiche Heftromane entstanden wären. Mielke selbst hat bestätigt, dass er zur Niederschrift seines ersten Taschenbuchromans anderthalb Jahre gebraucht hat, »ein Zeitaufwand, den ich normalerweise für zehn oder sogar zwanzig Heftromane ansetze.«
Hier bleibt anzumerken, dass Mielke in jungen Jahren bei Wolf Detlef Rohr in Augsburg hospitiert hat. Der fleißige Romanschreiber, der im Leihbuch neben Science-Fiction und Kriminalthrillern auch Frauenromane (Pseudonyme bislang ungeklärt) veröffentlicht hat, betrieb im bayerischen Schwaben neben der Schreiberei auch noch eine literarische Agentur. Beide Professionen unter einen Hut zu bekommen, verlangte schnelles, marktorientiertes Schreiben – und hier lernte der junge Thomas, was es heißt, am Fließband Unterhaltungsromane zu Papier zu bringen.
Auf den Roman »Grand Orientale 3301«, der Mielke in den Mittelpunkt des Interesses stellte, folgten zwei weitere umfangreiche SF-Titel, die den Erstling qualitätsmäßig überboten: »Der Pflanzen Heiland« (1981) sowie »Das Sakriversum« (1983), in denen der Autor in vollem Umfang die Qualitäten zum Tragen brachte, die ihn in der Folge auszeichneten: originelle Ideen, geschickt platzierte Plots und sorgfältige stilistische Ausarbeitung unter Vermeidung inhaltlicher Längen (Füller).
Hier machte sich bemerkbar, wie wichtig die langjährige Übung am Heftroman für diesen Autor war. Thomas R. P. Mielke hat sich freimütig dazu selbst geäußert: »Ich sehe das als reine Lernphase an, ich kann es schließlich nicht wegdiskutieren. Ohne die Schmöker hätte ich das ›Sakriversum‹ nie geschrieben. Wenn diese Erfahrungen, diese Routine und auch dieses Unbehagen über die Routine nicht gewesen wäre, würde mir schreiberisch heute etwas fehlen.«
Diese drei umfangreichen Romane waren nicht nur eine Bereicherung der SF-Produktion beim Heyne-Verlag, sie zeigten auch, dass herausragende Originalität und Qualität deutscher Science-Fiction die erforderliche positive Resonanz beim Publikum fand. Mit anderen Worten: Das waren keinesfalls Ladenhüter. Warum also der verantwortliche SF-Herausgeber bei Heyne, Wolfgang Jeschke, einen sich innerhalb weniger Jahre derart profilierten Autor in seinen Reihen nicht weiter pflegen wollte, bleibt rätselhaft bis unverständlich. Vielleicht war ihm der unerwartete Erfolg des bisherigen »Heftel«-Schreibers unangenehm, dessen Vergangenheit peinlich?
Aufgehängt wurde Mielkes Rausschmiss aus dem Heyne-Programm an einem Manuskript, das der Autor unmittelbar nach dem »Sakriversum« eingereicht hatte: »Der Tag, an dem die Mauer brach« hieß der SF-Polit-Thriller, den Jeschke nicht akzeptierte – etwa, weil ihm das Thema allzu utopisch erschien? Oder aktuell politisch zu »heiß«? Mielke musste den Verlag wechseln; das Buch kam bei Bastei-Lübbe heraus – selten trat eine Voraussage der Science-Fiction so schnell ein, wenngleich der Roman im Jahr des Erscheinens auch bei der Kritik eher als zu spekulativ, ergo unwahrscheinlich beurteilt wurde.
Die Episode als Autor bei Bastei-Lübbe war kurz: Es erschien noch »Die Entführung des Serails« (1986) und ein Sammelband mit Nachdrucken einiger Z-SF-Romane, diesmal unter dem Realnamen. Dann begann Phase 3 in der schriftstellerischen Entwicklung von Thomas R. P. Mielke: Die Geschichte wurde zum beherrschenden Thema.
Im Schneekluth-Verlag hatte Mielke einen interessierten Multiplikator seiner ersten fünf historisch orientierten Romane und Romanbiografien gefunden. Wie schon bei der Science-Fiction, wo sich der Autor als Übergang in die Sortimentsbuchproduktion bewusst anspruchsvollen Themen gestellt hatte, ist auch Phase 3 seiner Autorentätigkeit von großen Namen geprägt: Da geht es um Gilgamesch, Karl den Großen, Karl Martell, Attila den Hunnenkönig. Kein Thema ist zu anspruchsvoll oder thematisch überfrachtet, der Autor stellt sich der Herausforderung. Und hat damit weltweiten Erfolg.
Auffällig dabei: Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen und Kolleginnen belässt er es nicht beim Historisieren. Mielke Verständnis vom historischen Roman verlangt die genaue bis pingelige Recherche. Trotz dieser Detailgenauigkeit zeichnet seine oft sehr umfangreichen Romane eine sehr gute Lesbarkeit aus – denn beides ist wichtig: Genauigkeit und gefälliger Stil. Mielke bietet beides; der Leser dankt es ihm, wie die Auflagenhöhen zeigen.
Da ich kein Spezialist für historische Romane bin, auch wenn im Hause Weigand solche sehr sorgsam geschriebenen Bücher entstehen (geschrieben von meiner Frau Karla), überlasse ich es anderen Kennern der Materie, sich weiter dazu zu äußern.
Was wichtig ist, sei hier noch einmal betont:
Thomas R. P. Mielke ist seinen Weg als Autor vom Romanheft über das anspruchsvolle Taschenbuch bis zum Hardcover zielstrebig gegangen. Und man kann feststellen, dass sich parallel dazu die Qualität seiner Arbeit fast kontinuierlich gesteigert hat.
Thomas R. P. Mielke hat eine beispielhafte Karriere bis hin zum Bestsellerautor hingelegt – ein Vorzeigeautor, dem hier zu seinem achtzigsten Geburtstag von Herzen zu gratulieren ist.
Astrid Ann Jabusch: Schreibst du über Katzen?
Zugegeben, mir sagte am Ende des letzten Jahrtausends der Name Thomas R. P. Mielke oder TERRANAUT1, wie er sich im noch jungen Internet zeitweilig nannte, noch nichts. Dabei war er längst für seine fantasiereichen Romane in verschiedenen Genres bekannt. Doch mein bevorzugtes Genre waren damals Fachbücher. Eine Freundin behauptete sogar von seinem »Das Sakriversum«, es habe Saugnäpfe und man könne es nicht eher aus der Hand legen, bis man es ausgelesen hätte.
Dass wir uns überhaupt – im damaligen AOL – kennenlernten, beruht auch auf einem Fehler meinerseits: Weil in seinem Profil neben seinem Vornamen etwas von »Autor« und »Felidae« stand, fragte ich ihn: »Schreibst du über Katzen?« Im selben Moment, in dem ich die Returntaste drückte, fiel mir ein, dass der Autor des Katzenromans, der mir gerade in den Sinn kam, mit Vornamen nicht Thomas hieß. Aber da war es zu spät.
»Nein«, antwortete er, »ich schreibe über Menschen.«
Von dem Zeitpunkt an trafen wir uns täglich im Internet und diskutierten über Gott und die Welt. Und natürlich über seine Bücher. Und so kam es, dass er mich fragte, ob ich Lust hätte seinen »Attila« probezulesen. Der kam dann auch bald per Post in zwei dicken Aktenordnern. Weil ich dazu gleich meine Anmerkungen und Kritik an den Rand schrieb, wurde ich seine Lektorin.
TRPM hatte da gerade für sich entdeckt, dass die Vergangenheit ebenso spannend ist wie die Zukunft. Haben beide doch, abgesehen von der entgegengesetzten Richtung auf der Zeitachse, erstaunlich viele Übereinstimmungen. Schon mit »Gilgamesch« und »Inanna« war TRPM in fantastisch-(prä)historische Welten getaucht, und Karl den Großen hatte er mit dem gleichnamigen Roman aus der Mottenkiste des Schulunterrichts geholt und ihm Leben eingehaucht. Nun folgte bald »Karl Martell«, der Großvater Karls des Großen.
Für diesen Roman hatte er so ausführlich recherchiert, dass für das Schreiben kaum noch Zeit blieb. Da entsann er sich früherer Zeiten, als er seine Heftromane diktiert hatte. Also schickte er mir nun jeden Tag eine Mikrokassette, ich tippte sie ab und brachte gleichzeitig meine Anmerkungen und Kritiken, wie zum Beispiel »Den kannst du nicht umbringen. Der ist schon seit zwanzig Seiten tot!« an. Auch die nächsten Manuskripte (»Colonia«, »Gold für den Kaiser« und »Orlando furioso«) diktierte er. Die Mikrokassette wurde jetzt von Tondateien, die als Mailanhänge versendet wurden, abgelöst.
Das Recherchieren machte ihm schon immer einen Riesenspaß – besonders, wenn er dabei Neues entdecken oder Widersprüche aufdecken kann. Schon beim Attila-Roman hatte er die Historiker bei Fehlern ertappt. Weil er immer alles genau wissen will, reist er zu den Handlungsorten, verbringt viele Stunden in den örtlichen Bibliotheken oder anderen Instituten, wenn er dort Antworten zu dem jeweiligen Thema erhofft.
Sprach- oder andere Barrieren gibt es dabei für ihn selten. Er geht einfach auf die Leute zu, bringt sein Anliegen vor – zur Not mit Händen und Füßen – und ist mit der nötigen Information zurück, bevor ich überhaupt nur die richtigen Vokabeln im Wörterbuch zusammengesucht habe. Dann stürzt er sich in das Getümmel von Fronleichnamsprozessionen oder rennt durch irgendwelche Gassen mit einem Ziel, das nur er kennt. Mehr als einmal hatte ich ihn bei diesen Sprints aus den Augen verloren und wartete dann, bis sein kahler Kopf irgendwann, irgendwo wieder in der Sonne aufblitzte. Hierbei erwiesen sich seine ein Meter sechsundachtzig Körpergröße als echter Vorteil.
Oft verschwindet er in unscheinbaren Hauseingängen, Kirchen, Burgen und Ruinen, weil er dort Antworten auf seine Fragen wittert. Ja, wittern ist das richtige Wort: Wie ein Jagdhund folgt er der Spur seiner Story und gibt nicht auf, ehe er am Ziel ist. TRPMs »Witterung« hat uns schon an die seltsamsten Plätze geführt.
Ein großer Verbündeter von ihm ist zudem der Zufall. Wie oft haben wir uns in der Prä-Navi-Ära verfahren und sind an interessanten Orten gelandet, die wir ansonsten nie kennengelernt hätten!
Minerve in Südfrankreich war so ein Fall: In diesiger Novemberdämmerung entdeckten wir dieses Dorf. Eine Gruppe von Häuschen drängte sich auf dem Hügelkopf zusammen. Nur eine schmale Brücke führte nach Minerve hinein. Im Dorf wurde die Straße immer schmaler und schmaler, bis wir fast mit unserem Leihwagen stecken blieben. Die Dorfbewohner schauten uns kopfschüttelnd aus ihren Fenstern zu. Es war Millimeterarbeit aus dem Gässchen heraus und wieder auf freieres Gelände zu kommen. Wir blieben drei Tage an diesem atemberaubenden Ort, an dem sich einst die Katharer verschanzt hatten.
In dieselbe Kategorie gehören aber auch Züge, die in die falsche Richtung fahren, Autoschlüssel, die wahlweise in der Havel oder im Mittelmeer versenkt werden, verpasste Flieger, weil es doch noch sooo viel Zeit bis zum Abflug ist und man doch gern noch mal eben im Meer baden könnte, vergessene Kameras und die dazugehörigen Irrfahrten, um sie wiederzubekommen mit anschließend leerem Benzintank in einsamen, tankstellenfernen Gegenden bei einbrechender Dunkelheit und ähnliche Sachen. Allein mit diesen Geschichten könnte man Bände füllen. Und dabei habe ich noch nicht mal unsere Besuche bei Thomas’ polnischem Verleger auf der Neidenburg erwähnt.
Spätestens jetzt ahnt man vielleicht: Es ist nie langweilig mit TRPM.
Eine Reise ganz nach seinem Geschmack bekam er zufällig an seinem siebzigsten Geburtstag geschenkt. An diesem Tag lud ihn nämlich das Goethe-Institut in Beirut, das seinen »Gilgamesch« ins Arabische hatte übersetzen lassen, zu einer Lesung ein. Um die Kosten zu minimieren, hängten sich das Goethe-Institut Damaskus, das in Amman und das in Ramallah an. Und um die Sache rundzumachen, kam noch eine Lesung in der evangelischen Gemeinde in Jerusalem dazu. Für uns bedeutete das: vier abenteuerliche Wochen im Orient.
Schon der Libanon überraschte mit einer Deutschen Schule und der Gastfreundschaft der Direktorin. Sie lud uns in ihr Haus in den Bergen ein, von wo man von ihrem Schwimmbad aus eine herrliche Sicht über die Bucht vor Beirut hatte. Wir fühlten uns wie in »tausendundeiner Nacht«!
Syrien kam uns wie eine exotische DDR vor. Ohne zu wissen, dass in wenigen Monaten der Syrienkrieg ausbrechen würde, spürten wir, dass etwas Ungutes in der Luft lag. Anderseits haben wir dort Freundschaften mit wunderbaren Menschen geschlossen, die bis heute anhalten. In Amman sahen wir Polizisten mit urpreußischen Pickelhauben. An der Grenze zum Westjordanland lernten wir zuerst eine israelische Soldatin kennen, der wir beide bekannt waren, weil sie zum einen von Thomas’ Avignon-Romane gelesen hatte und zum anderen ihre Mutter in Spandau – also quasi in unserer Nachbarschaft – lebte, gerieten aber alsbald unter Spionageverdacht, weil ich etwas in ein Notizbuch schrieb, obwohl doch er der Autor war. In Ramallah verpassten wir das Konzert eines Jugendchors aus dem Hochsauerland. (Warum sonst fährt man in den Nahen Osten?) In Jerusalem entführte uns ein Fahrer, jedenfalls hatten wir den Eindruck. Es stellte sich als Scherz heraus, der sich aber verdammt echt anfühlte! Und schließlich gingen wir Anfang November in Tel Aviv schwimmen.
Ich sage doch: Es würde Bände füllen. Und vielleicht tut es das auch noch einmal, denn TRPM spielt noch immer mit dem Gedanken einer Fortsetzung seiner 1980 erschienenen »Grand Orientale 3301«.
Franz Schröpf: Mike Parnell – ein Talent wird erkennbar
Thomas R. P. Mielke und sein Erstling »Unternehmen Dämmerung«
Der Bus kam schräg auf Parnell zu. Seine Reifen schabten den Schmutz von der Kante des Rinnsteins. Die farblosen Gesichter hinter den Scheiben sahen unbeteiligt geradeaus. Niemand interessierte sich für die zusteigenden Fahrgäste. (S. 3)
Doch dann kommt es zu einem folgenschweren Unfall:
Urplötzlich verwandelte sich das hohe Singen des Busses in schrilles Kreischen. Aus einer Nebenstraße schoss ein rotes Sportgiro direkt in die Hauptstraße hinein. Noch ehe Parnell begriffen hatte, stand der Fahrer des Busses auf den Bremsen. Für den Bruchteil einer Sekunde schien es Parnell, als würde er keinen Laut mehr hören, doch dann war es zu spät.
Die Masse des großen Wagens prallte gegen das Sportgiro, das wie ein roter Blitz frontal gegen ihn knallte. Ein vielstimmiger Schrei vermischte sich mit dem Quietschen der Reifen und dem Klirren der Scheiben.
Parnell wurde von der Wucht des Aufpralls gegen die massive Frontscheibe geschleudert, die seinem schweren Körper nicht standhielt und in Tausende winziger Fragmente zersprang. Seine Finger glitten über scharfe Glaskanten und verbogenes Metall. Dann wurde er herumgeworfen und landete mit einem Krach in den Trümmern des Sportgiros. Jemand schrie lang und laut. Parnell schloss den Mund und merkte, dass er selbst geschrien hatte.
Er wollte sich erheben, doch da kam die Dunkelheit wie eine Springflut über ihn, hüllte ihn ein, saugte das Bewusstsein aus seinem Körper. (S. 3)
Die Erinnerung kommt wieder: Er heißt Parnell und ist Kommandant einer Jägerstaffel, im Einsatz gegen die Gelben, die Bande unfairer Mondgesichter. Oder doch nicht? Schwebt eine Maschine wirklich so schwerelos? Kommt das Pochen tatsächlich von Maschinengewehreinschlägen? Spiralen, strahlende Reflexe tanzen vor seinen Augen.
In diesem Moment sah er das Ende. Es war der Punkt, an dem sich die Spiralen vereinigten, der Punkt, wo sie in ein anderes Universum hinüberwechselten. Es war der Punkt an sich, Endpunkt und Beginn eines neuen Raum-Zeit-Kontinuums.
Parnell sah den Punkt und wusste, dass er da nicht mit hinüber durfte. Er spannte seinen Geist bis zum Übermenschlichen an, um der Spirale, die nun strahlend hell leuchtete, zu entrinnen. Er näherte sich fast mit Lichtgeschwindigkeit dem Knotenpunkt. Es war ihm klar, dass es einen gewaltigen Schock geben würde. Doch das war zur Not zu ertragen. Er wusste, dass es seine letzte Chance war. Rasend schnell näherte sich der Übergang. Es war höchste Zeit, denn er befand sich dicht vor dem Schnittpunkt. (S. 5)
Aber nein, dahin will er nicht, und mit einer riesigen geistigen Anstrengung sammelt er seine letzten Kräfte – und ist wieder unter den Lebenden.
Wie ein leichter milchiger Nebel schwebte LE zwischen den Polen des Aufladers. Es spürte, dass die Energie der Kraftstation immer schwächer wurde. Nicht mehr lange und sie würden ohne Aufladen auskommen müssen.
Das Wesen LE materialisierte sich und platschte mit seinem weichen Fuß auf den pyrogenen Bodenbelag. Vor ihm lag das Wesen SA fast völlig zusammengesunken. Die beiden Wesen sahen sich aus ihren einzigen Augen an.
»Nun? Es scheint zu Ende zu gehen«, meinte SA resignierend.
»Ich habe dir gleich gesagt, dass wir schon zu alt sind. Wir können uns nicht mehr verjüngen. Es wird Zeit, dass wir abgelöst werden.«
»Aber wer sollte uns denn ablösen«, stöhnte LE und presste einen seiner Tentakel auf den weichen Leib. »Ich kann nicht mehr«, sagte es mit einem Ausdruck ohnmächtigen Schmerzes. Es war etwas von bitterer Hoffnungslosigkeit in den Gebärden des Wesens,
»Wir haben versagt«, meinte das Wesen SA. »Wir gaben den Menschen zu viel Freiheit, doch nun, ich kann es kaum aussprechen: Wir werden keine Erben haben! Der Schatz unseres unendlichen Wissens wird in alle Winde verstreut werden. Vielleicht wird hier und da im Weltenraum etwas unserer Errungenschaften hervortreten, doch dann wird sich niemand an uns erinnern. Das ist das Ende einer einst mächtigen und großen Zivilisation.« (S. 5 f.)
Sol 4 war von einem Kometen getroffen worden, der fast das ganze Leben auf diesem Planeten ausgelöscht und die Oberfläche unbewohnbar gemacht hatte.
Eigentlich wollten die uralten Bewohner von Sol 4 den Menschen ihr gesamtes Wissen als Vermächtnis übergeben. Aber konnte man es diesen Menschen anvertrauen, die als einzige Lebewesen des Universums sich selbst zerfleischten? Nein, da war es besser, sie durch fliegende Robotscheiben einzudämmen und sie daran zu hindern, von ihrem Planeten aus in den Weltraum vorzustoßen und dort ihr grausiges Werk fortzusetzen.
Nacheinander steckte LE seine Tentakel in die glühende Öffnung der Maschine. Der Desintegrator spie eine kurze Stichflamme durch den Raum. Dann war es vorbei. Die weichlichen Reste des Marswesens lösten sich auf in einer Wolke süßlichen Rauches. (S. 7)
Eine andere Lösung weiß LE für sich nicht mehr; SA muss die große Mission allein weiterführen.
Parnell ist mittlerweile völlig gesundet und wartet als ACC-Mann – area control centre – auf seinen nächsten Einsatz bei Nato-1. An einer Bar hat er eine unheimliche Begegnung:
Da hob der Mann den Kopf und sah Parnell an. Parnell erschrak vor diesen Augen. Es gab nichts, vor dem sich ein Marine des Jahres 1977 mehr fürchtete als vor diesen Augen. Sie waren schmal und schlitzförmig. Ein »Gelber«, durchzuckte es Parnell. (S. 9)
Ein Unbekannter stellt den Kontakt mit Parnell her: Er soll Broch 0951 anrufen, von dem er wiederum angewiesen wird, sich ins »Andromeda« zu begeben und nach Conister zu fragen, der ihm Informationen über Victor Oscar Romeo geben würde. Als Parnell feststellt, dass während seines Krankenhausaufenthalts bei ihm eingebrochen wurde und die Unterlagen seines Freundes Orwell, mit denen dieser ein wichtiges Patent anmelden wollte, gestohlen worden waren, ist für Parnell klar, dass hier der Feind am Werk ist.
In der Bar wird er hinterhältig niedergeschlagen und vor den Chef der Gangster geschleppt:
Jetzt erst merkte Parnell, dass zwei der Männer mongoloid waren. Ihre leicht gelbliche Hautfarbe war geschickt überschminkt. Auf dem Tisch lagen Sonnenbrillen, die sie in der Öffentlichkeit trugen, um nicht aufzufallen. Er war entsetzt, dass es anscheinend doch eine recht starke Unterwanderung der freien Welt gab. Nach dem Saharakrieg hatten sich alle Völker zusammengeschlossen, um gegen die Machtgier der Gelben einzuschreiten. Seit einigen Jahren befand man sich im Kriegszustand. Zwar war nie eine Kriegserklärung abgegeben worden, doch war es mehr als ein kalter Krieg. Täglich ereigneten sich Überfälle auf bedeutende Führer der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens. So war es auch nicht verwunderlich, wenn das FBI stets auf der Jagd nach Angehörigen der gelben Rasse war. Und dennoch trieben sie sich überall herum. Sie waren der Schrecken der Großstädte, das Schreckgespenst der Kinder, die heimliche Furcht der Erwachsenen. (S. 13)
Parnell ahnt, was ihm bevorsteht: Man will ihn foltern, bis er alle Informationen über VOR preisgibt. Gleichzeitig erfährt er, dass der Orkan Pepsy alias Yellow Rose, der gerade die Vereinigten Staaten von Süd nach Nord verwüstet, das Werk der Gelben ist, die offenbar im Jahr 1977 technisch schon so weit fortgeschritten sind, dass sie das Wetter beeinflussen können.
Parnell, obwohl von dem Unfall noch geschwächt, stürzt sich auf die Gangster – und verliert das Bewusstsein. Er wurde durch eine Gasbombe von drei FBI-Agenten gerettet, sodass er in einem Flugzeug mit Kurs kanadische Grenze erwacht. Die Allersympathischsten sind die FBIler allerdings auch nicht, findet jedenfalls Parnell:
Der Schönstimmige brach in gurrendes Gelächter aus.
»Er denkt, haha – hätten Sie nicht eher daran denken können, dass gerade die Fähigkeit zu denken Sie vor einigen Unannehmlichkeiten bewahrt hätte? Ja, da staunen Sie! Wenn Mister Quaker und ich nicht gerade im ›Andromeda‹ gewesen wären, wo wir die überaus interessante Aufgabe hatten, Sie ein wenig zu beobachten, dann hätten Sie Ihr Spielchen mit den Gelben nicht so angenehm über die Runden gebracht. Danken Sie Mister Quaker, wenn er in letzter Sekunde ein winziges Gasbömbchen in den Gang warf. Er meinte nämlich, wir würden Sie noch gebrauchen können, und außerdem …«
»Halt den Mund, Süßer, soviel wollte Mister Parnell gar nicht wissen. Aber wenn es Sie beruhigt, kann ich Ihnen verraten, dass Sie in der einmaligen Situation sind, mit drei braven Leuten vom FBI, die für Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen, als einziger Fluggast der Staaten dicht an der kanadischen Grenze entlang zu gondeln.«
»Und wohin wollen Sie mich bringen?«
»Ist doch Staatsgeheimnis«, sang der Schönstimmige.
»Na, dann nicht«, resignierte Parnell. »Soll schon vorgekommen sein, dass jemand ’ne Faust im Gesicht gefunden hat, aber vielleicht überlege ich mir das noch.«
Der Schönstimmige schnappte nach Luft. »Das schlägt dem Fass die Krone mitten ins Gesicht.« (S. 15 f.)
Rekapitulieren wir die Handlung der ersten fünfzehn Seiten:
Parnell betritt einen Bus, dessen Insassen durch ihre Teilnahmslosigkeit Zeugnis für den bedauerlichen Zustand der künftigen Welt abgeben.
Ein Autounfall lässt ihn das Bewusstsein verlieren.
Parnell hat Halluzinationen, die in ein psychedelisches Nahtoderlebnis münden, wobei er nur knapp vor dem Tor in die nächste Welt zurückweicht.
Uralte Marsianer beklagen nicht nur ihr eigenes trauriges Schicksal, sondern auch die Grausamkeit der Erdenmenschen gegeneinander.
Die Gelben verwüsten Nordamerika mit einem Tornado, ohne als Urheber enttarnt zu werden.
Parnell wird von den Gelben entführt und mit Folter bedroht, aber von überaus unsympathischen FBI-Agenten, einer davon möglicherweise schwul, gerettet und mit unbekanntem Ziel fortgebracht.
Doch das ist erst der Auftakt zu einer unglaublich dramatischen und ebenso fantastischen Handlung, aus der Parnell am Ende als Erbe des marsianischen Wissens mit einer Flugscheibe, begleitet von seinem Freund Mike Trapp, in die Weiten des Weltalls entschwebt.
So bizarr »Unternehmen Dämmerung« auch teilweise ist, so deutlich kann man schon an einzelnen Passagen – etwa die ausgezeichnet geschilderten Halluzinationen nach dem Unfall – spüren, dass hier ein Science-Fiction-Autor am Werk ist, der über ein deutlich größeres Talent verfügt als die Masse seiner Kollegen und der nur noch einiger Erfahrung bedarf, um seine späteren großen Romane schreiben zu können.
Parnells machohaftes Auftreten und das Gruseln vor der Gelben Gefahr scheinen aus heutiger Sicht etwas kurios, waren aber in den frühen Sechzigerjahren gängige Kost in der Unterhaltungsliteratur.
Der Held des Romans, Parnell, hat keinen Vornamen, aber wenn man den seines besten Freundes Mike Trapp hinzunimmt, ist das Pseudonym »Mike Parnell« für diesen Roman fertig.
Für die Lektüre lag mir leider das originale Leihbuch von 1961 aus dem Verlag Widukind/Gebrüder Zimmer nicht vor. Aber das Zauberkreis-Taschenheft verspricht auf der Titelseite, es handle sich um eine »ungekürzte Ausgabe«.
Mike Parnell [Thomas Rudolf Peter Mielke]:
Unternehmen Dämmerung.
Zauberkreis Exklusiv Band 107, 128 S.
Rastatt/Baden: Zauberkreis, 1961.
Sabine Frambach: Herr Lauffers Stunde
Für R. P. Mielke, der mich auf Fehlersuche schickte.
Wir haben alle Zeit der Welt.
Erst vor einigen Tagen war er angekommen in diesem Dorf, nicht weit von seiner Heimat Nürnberg entfernt. Neben seiner Schlafstelle benötigte Herr Lauffer einen Tisch, eine Feuerstelle und das Licht des hellen Tages. Nicht weit entfernt stand die Kirche, für die er die Predigtuhr schaffen sollte.
Herr Lauffer, einst als Glasbläser tätig, hatte sein Gewerbe um die Fertigung der neuen Sanduhren erweitert. Für die Prüfung hatte er eine Uhr mit vier Gläsern erstellt, gefüllt mit weißem Sand, davon das erste Glas die Viertel, das zweite die halbe, das dritte drei Viertel, und das vierte die ganze Stunde zeigte. Seither führte er den Titel geprüfter Sanduhrenmacher, und kurz danach erhielt er Aufträge.
Dieser Auftrag umfasste eine große Predigtuhr, die an der Kanzel arretiert werden sollte. Herr Lauffer hatte zwei große Glaskolben in seiner Werkstatt geblasen, sie in Stroh verpackt und mitgebracht. Achtsam holte er sie hervor. Offenbar war der Transport geglückt.
Die zweite wichtige Zutat für eine feine Sanduhr war das Sandgemisch.
In Herrn Lauffers geheime Rezeptur kamen drei Teile fein gemahlene Eierschalen, ein Teil Marmorstaub, zwei Teile Bleisand und eine Zutat, die er niemandem verriet. Die Mischung siebte er, bis sie fein rieselte, kochte sie nochmals ab, um sie zu säubern, und trocknete sie.
Während der Herr Lauffer prüfend eine Prise der Mischung zwischen seinen Fingerspitzen zerrieb, öffnete sich die Tür zu seiner provisorischen Werkstatt; ein Mädchen steckte den Kopf herein, schob sodann den Rest des Körpers durch den Spalt und starrte ihn mit großen Augen an.
»Seid Ihr der, der die Zeit bestimmt?«
Lächelnd blickte Herr Lauffer auf. Das Mädchen war reizend, und sie stellte die Frage, die er ständig hörte, seitdem er sich der Sanduhrmacherei widmete. »Nein, Kind, ich bestimme nicht. Die Zeit läuft, auch wenn keine Uhr in der Nähe ist.«
»Aber Ihr bestimmt, wie lange der Sand durch das Glas rieselt. Ist es nicht so?«
Lächelnd nickte Herr Lauffer dem Mädchen zu.
»Könnt Ihr sie bitte kürzen?«
»Was?«
»Bitte, mein Herr, ich benötige Hilfe! Jeden Tag, so besteht die Mutter darauf, habe ich drei Gebetszeiten, knie in meinem Zimmer mit dem Blick zur Wand, sie zündet eine Kerze an, und ich muss dort bleiben. Stets öffnen sich meine Augen, obwohl ich sie fest zudrücke, nur um zu sehen, wie die Flamme leuchtet. An einer Kerze kann ich nichts ausrichten. Sie leuchtet eine Stunde. Je mehr ich hoffe, es möge bald vorbei sein, desto langsamer brennt sie nieder. Wenn ich aber solch eine Sanduhr hätte, könnte ich dem Rauschen der Zeit lauschen. Bitte! Wäre es doch nur ein Löffelchen weniger Sand, eine Prise nur!«
Unwillkürlich fühlte Herr Lauffer Mitleid mit dem Mädchen, das so höflich und zugleich so verzweifelt um Hilfe bat. Achtsam zog er eine kleine Sanduhr hervor, löste am Feuer das Wachs und ließ ein Löffelchen hinauslaufen.
»Es dürfen auch zwei Löffelchen sein!«
Mit ernstem Gesicht blickte Herr Lauffer auf, legte einen Finger an den Mund und raunte: »Mehr aber nicht, es darf nicht auffallen und muss unser Geheimnis bleiben.«
Das Mädchen nickte mit glühenden Wangen, nahm die Sanduhr entgegen und bedankte sich vielmals, beteuerte, das Geheimnis niemals zu verraten, und verschwand.
Kurze Zeit später, Herr Lauffer prüfte die Glaskolben, klopfte es an der Tür. Der Pfarrer trat ein, schüttelte umständlich Herrn Lauffers Hand und betrachtete mit aufgerissenen Augen die großen Glaskolben. »Prächtig«, murmelte er. »Prächtig. Da passt eine Menge Sand hinein, oder?«
Herr Lauffer nickte. »Aber sie soll eine Stunde laufen, nicht wahr? So steht es in meinem Auftrag.«
»Ja, eine Stunde«, murmelte der Pfarrer, die Hände auf dem Rücken gefaltet, den Kopf vorgebeugt, den Blick weiterhin auf die Glaskolben gerichtet. »Die Morgenpredigt wie auch alle Predigten sollen durchaus nur eine Stunde dauern.« Nun schaute er auf, und sein Blick bekam einen bettelnden Glanz. »Nur eine Stunde! Wie schnell diese vergeht! Könnte sie doch ein wenig länger sein! Was gäbe ich darum! Die Bauern, sie schlafen, während ich predige, und bekommen kaum etwas mit!«
Schmunzelnd entgegnete Herr Lauffer: »Seid Ihr sicher, dass eine längere Predigt die Zuhörer aufwecken und nicht einschläfern würde?«
Nun richtete der Pfarrer sich auf. »Ich bin sicher. Ein wenig mehr Zeit, um nicht nur über einen Hügel zu sprechen, sondern ganze Berge zu versetzen! Ein wenig mehr Zeit. Wisst Ihr, ich habe mich gefragt, ob es nicht möglich wäre. Wenn ein klein wenig mehr Sand in dieser Uhr wäre … versteht Ihr?«
Ganz steif wurde Herr Lauffer, sein Gesicht warf Falten, und er knabberte an der unteren Lippe. »Tut mir leid, aber ich kann nichts für Euch tun. Eine Stunde sollte eine Stunde bleiben!«
Mit schlechtem Gewissen dachte er an das Mädchen, dem er ein wenig Zeit geschenkt hatte. Hoffentlich verriet sie ihn nicht.
Kaum war der Pfarrer verschwunden, klopfte es erneut an der Tür.
»Ja?«, rief Herr Lauffer, der hoffte, die verbleibende Zeit nicht nur für Gespräche, sondern auch für die Arbeit an der Sanduhr nutzen zu können.
Ein Mann trat ein, das Gesicht gerötet, die Hosen speckig. Rasch zog er die Mütze ab und hielt sie mit beiden Händen fest. »Seid Ihr der, der über die Zeit bestimmt?«
Ungeduldig seufzte Herr Lauffer, schob sein Sandgemisch zur Seite und schnaubte. »Warum? Wollt Ihr die Stunde kürzen, um nicht allzu lange der Predigt lauschen zu müssen?«
»Nein«, flüsterte der Bauer, »gewiss nicht. Wir haben darüber geredet. Könnt Ihr die Stunde länger machen? Ja, länger wäre gut.«
»Warum?«
Die Finger voll Schwielen drehten den Hut hin und her. »Die Arbeit ist schwer, der Gutsherr ist streng. Kaum liegen wir, beginnt ein neuer Tag. Nur während der Predigt dürfen wir sitzen und ruhen. Wie schön es wäre, wenn die Predigt ein klein wenig länger dauern würde.«
Tief seufzte Herr Lauffer, fühlte er doch wieder Mitleid, und doch wusste er, dass er die Zeit der Predigtuhr nicht verändern sollte. Es war ein offizieller Auftrag, und wenn einer eines Tages die Zeit nachprüfte, sollte die Sanduhr eine Stunde laufen. »Das ist nicht möglich«, antwortete Herr Lauffer. »Eine Stunde sollte eine Stunde bleiben.«
Rasch arbeitete Herr Lauffer weiter, richtete die Glaskolben aus und begann, die richtige Menge des Sandgemisches abzumessen; er bewegte seine Hände so eilig, als fürchte er, bald erneut unterbrochen zu werden.
Tatsächlich klopfte es kurze Zeit später, und der Gutsbesitzer trat ein. Einen Mantel trug er und einen Hut, er reichte Herrn Lauffer die Hand, sodass dieser erneut die Arbeit unterbrechen musste, und hieß ihn willkommen. »Ihr seid der, der die Zeit bestimmt«, sagte er und schüttelte Herrn Lauffers Hand.
Gerade wollte Herr Lauffer etwas erwidern, da sprach der Gutsbesitzer bereits weiter. »Für mich ist es sehr erfreulich, dass wir eine dieser neuen Predigtuhren bekommen. Der Pfarrer hört sich wahrlich gerne selber reden! Und während er redet, schlafen die Bauern. Und Bauern, die schlafen, arbeiten nicht.«