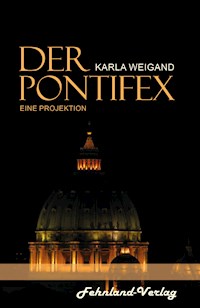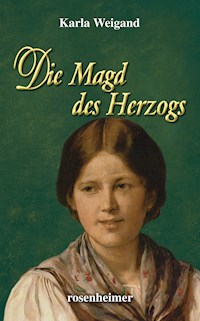Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Karla Weigands Erzählungen und Kurzgeschichten bedienen das ganze Spektrum der Fantastik: vom Märchen bis zum Horror, von der klassischen Fantastik bis zur Science-Fiction, wobei von der gefühlvollen Geschichte bis zur knallharten Story werden alle Facetten und Möglichkeiten der Kurzgeschichtenliteratur ausgeschöpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karla Weigand
Die böse Frau
Fantastische Kurzgeschichten
AndroSF 202
Karla Weigand
DIE BÖSE FRAU
Fantastische Kurzgeschichten
AndroSF 202
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: Januar 2024
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Rainer Schorm, »Transsylvanien«
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
für den Science Fiction Club Deutschland e. V., www.sfcd.eu
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 371 0
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 736 7
Davids Kosmos
Mühsam schleppte sich der alte Mann die Treppe des alten Mietshauses, erbaut in den Vierzigerjahren des letzten Jahrhunderts, die fünf Stockwerke bis zu seiner winzigen Mansardenwohnung hinauf, die er zusammen mit seinem vierzehnjährigen Enkel David bewohnte. Bewohnt hatte.
Auf jeder Etage legte er eine Pause ein. Seit Monaten war der altersschwache Aufzug kaputt, weil die Hausverwaltung die Beschwerden der Bewohner konstant ignorierte.
Schwer atmend stand der Alte schließlich vor der Wohnungstür. Den Schlüssel ins Schloss zu stecken gelang ihm erst im dritten Anlauf. Im Flur riss er sich den schwarzen Hut vom Kopf und stülpte ihn nachlässig über einen freien Garderobenhaken. Er hasste Hüte; aber der Anlass hatte es ihm angemessen erscheinen lassen, sich dazu durchzuringen, ihn aufzusetzen. Genauso, wie er seinen altmodischen dunklen Anzug und den schwarzen Mantel angezogen hatte, Kleidungsstücke, die er zuletzt vor zehn Jahren beim Begräbnis seiner Tochter getragen hatte.
Den Mantel und den schwarzen Schal deponierte er vorerst auf dem Garderobenschränkchen. Beides würde er später in seinem Kleiderschrank verstauen. Unwillig streifte er die schwarzen Lederschuhe ab, die ihm damals schon zu eng gewesen waren.
Dann betrat der alte Mann in Socken das kleine Kämmerchen, das während der vergangenen Dekade sein schwerbehinderter Enkel David bewohnt hatte – und nicht mehr hatte verlassen können.
Mit todtraurigen Augen starrte der Alte auf das zerwühlte Bett, aus dem vor drei Tagen die Männer vom Begräbnisinstitut seinen Enkelsohn abgeholt hatten. Seit dem schrecklichen Autounfall, dem Davids Mutter vor zehn Jahren zum Opfer gefallen war, hatte der Junge bei ihm gelebt. Ganz selbstverständlich hatte der alte Mann für das vierjährige Kind, das für immer körperlich und geistig behindert bleiben würde, die Verantwortung übernommen. Einen Vater gab es für David nicht, und den Jungen in ein Pflegeheim zu geben, kam für den Großvater nicht infrage.
Auf der zurückgeschlagenen Bettdecke lagen noch etliche Bücher jenes Schriftstellers, dem Davids ganze Liebe und alleiniges Interesse gegolten hatte – ohne auch nur das Geringste über den Verfasser zu wissen. Nicht einmal nach dessen Namen hatte er gefragt. Nur seine Romane, die sich um ferne Länder, Kontinente und Planeten, insbesondere um deren zukünftiges Schicksal drehten, hatten David aufs Höchste fasziniert.
Langsam wanderten die Blicke des Großvaters über die Stapel von Büchern, die im ganzen kleinen Raum verteilt waren. Da der Junge nie sein Bett hatte verlassen können, war auch der Fußboden übersät mit Büchern und Zeitschriften, die sich mit Zukunftsvisionen befassten. Nicht wenige davon waren mittlerweile keine Science-Fiction mehr; die Wissenschaft hatte deren Zukunftsvisionen inzwischen längst eingeholt.
Der Alte wandte sich den Bänden auf der Decke und der Matratze zu. Mit unsicheren Fingern griff er nach dem Band, aus dem er seinem Enkel so oft vorgelesen hatte: gefühlt bestimmt zum hundertsten Mal »20.000 Meilen unter den Meeren«.
David selbst hatte das Lesen nie erlernt.
Den Autor hatte sein Großvater niemals erwähnt. Wozu auch? Der Junge hätte ihn sich ebenso wenig merken können wie den Inhalt der Bücher. Jedes Mal bedeutete es für ihn ein ganz neues aufregendes Erlebnis (und Vergnügen), sobald sein Großvater an seinem Bett saß und ein ›neues‹ Buch aufschlug, um ihn teilhaben zu lassen, an den darin so meisterhaft geschilderten wundersamen Begebenheiten.
Dennoch hatte es bei David Präferenzen gegeben; was davon abhing, inwieweit die bunten Umschläge seinem Geschmack entsprachen. Am meisten hatte er die »Reise um den Mond« geliebt, »20.000 Meilen unter den Meeren«, »Von der Erde zum Mond«, »Reise zum Mittelpunkt der Erde«, »Reise durch das Sonnensystem«, »Reise um die Erde in 80 Tagen«, »Das Dorf in den Lüften«, »Der Einbruch des Meeres« sowie »Die Jagd nach dem Meteor«.
»Über zehn Jahre habe ich dir täglich mindestens zwei Stunden lang vorgelesen, mein Lieber«, murmelte der alte Mann. »Kein Wunder, dass ich die Inhalte beinahe auswendig kenne.« Seufzend machte er sich daran, die herumliegenden Bücher einzusammeln und in eine Holztruhe hinter der Zimmertür zu schichten. Zum Schluss kamen die Bücher auf Davids Bett an die Reihe.
Als er schließlich das letzte in der Hand hielt, aus dem er seinem Enkelsohn unmittelbar vor dessen Tod vorgelesen hatte, brach er unvermittelt in haltloses Schluchzen aus. Endlich flossen die Tränen, die der alte Mann bisher aus falscher Scham zurückgehalten hatte.
»Von der Erde zum Mond« lautete der Titel, und der Großvater erinnerte sich noch gut daran, was David zuletzt gesagt hatte. Merkwürdig, ja geradezu absurd war es dem Alten vorgekommen.
»Derjenige, der das großartige Buch geschrieben hat, hat mich letzte Nacht besucht, Opa! Und er hat mir fest versprochen, dass er mich schon bald mitnimmt auf die Reise zum Mond. Darauf freue ich mich schon sehr!«
»So, so«, hatte der Großvater verblüfft erwidert. »Weißt du denn auch, wie der Mann geheißen hat?«
»Hm. Ja. Ich glaube«, hatte David verlegen gestammelt, »ich glaube, ›Julian‹ oder ›Julius‹ ist sein Name gewesen. Du weißt ja, Opa, Namen sind nicht so mein Ding! Aber jetzt erinnere ich mich wieder: Als ›Julius Ferner‹ hat sich der nette Mann, der mich zum Mond mitnehmen will, vorgestellt!«
Der alte Mann wischte sich energisch die Tränenspuren mit einem Taschentuch vom Gesicht ab und trocknete sich die Augen, ehe er sich schweren Herzens daran machte, die restlichen Bücher in der Truhe zu verstauen. Er würde sie nie mehr öffnen und keines der Werke Jules Vernes jemals mehr aufschlagen.
Sinnfindung
Omme Hinrichs warf einen gelangweilten Blick auf den Monitor. Was dort abging, hatte er schon tausendmal gesehen; es ödete ihn mittlerweile dermaßen an, dass er allein vom Zusehen Depressionen bekam.
Man schrieb das Jahr 2100. Morgen würde er siebzig Jahre alt, dann konnte er in den Ruhestand gehen. Pah! Arbeiten tat er doch schon lange nicht mehr! Omme wandte sich seufzend zum Fenster, das auch im Sommer dicht verschlossen blieb: Feinstaubgefahr!
Davon gab es in Hamburg reichlich. Sein Großvater Marten würde trotzdem heuer seinen hundertdreißigsten Geburtstag begehen. Zäh war er, der ehemalige Heringsfischer von der nordfriesischen Insel Föhr; schon in seiner Jugendzeit war Luftverschmutzung ein Thema gewesen.
Ommes Vater Carsten, Jahrgang 1995, wurde heuer auch schon hundertfünf! Omme mit seinen immerhin fast sieben Jahrzehnten galt noch als best-ager.
Sein Vater war nicht Fischer geworden. Im Jahr 2015 wurde er als zwanzigjähriger Architekturstudent Zeuge einer Sensation im Bauwesen, als er in Amsterdam ein Praktikum auf einer der damals vermutlich spannendsten Baustellen der Welt absolvierte: Ein Grachtenhaus sollte entstehen.
Das war an sich noch keineswegs spektakulär, denn die weltberühmten Grachtenhäuser gab es bereits seit über vierhundert Jahren. Das neue würde jedoch anders sein! Keineswegs aus Stein, Mörtel und Zement, auch nicht aus Holz – man würde es aus Kunststoff drucken!
Omme erinnerte sich an die sehr plastische Schilderung seines Vaters, die er im Jahr 2040 an seinem zehnten Geburtstag zu hören bekam, nachdem er den Wunsch geäußert hatte, ebenfalls ein Häuserbauer zu werden: »Langsam drehte sich die gigantische Hohlnadel und spritzte millimeterdünn einen Strahl aus weißem Kunststoff auf den Boden, auf dem das Gebäude errichtet werden sollte. Die Masse sah aus wie eine endlos lange Spaghetto. Um ein Säulenstück von einem Meter sechzig Höhe und einem Durchmesser von dreißig Zentimetern zu drucken, dauerte es acht Stunden!«
Das brachte Omme auch heute noch zum Schmunzeln. Heute war das ein Klacks und in zehn Minuten erledigt – und die Säule wäre um etliches höher und stärker, besäße ein kunstvoll verziertes Kapitell sowie aufwendige Kanneluren: Altgriechische Architektur war derzeit wieder in.
»Vier Stockwerke sollte das Grachtenhaus haben«, hatte sein Vater damals weiter berichtet, »mit dreizehn Räumen und dem charakteristischen Treppengiebel. Doch mit einer herkömmlichen Baustelle hatte dies nichts mehr zu tun! Auf dem Gelände standen weder Kräne noch Planierraupen oder lärmende Betonmischer. Stattdessen hörte man Möwengekreisch und das leise Surren des Druckers.«
Omme grinste unwillkürlich. Heutzutage errichtete man sechzig- bis siebzigstöckige Bürohochhäuser und Wohntürme mit hundert und mehr Etagen mittels des Druckverfahrens – und zwar rund um den Globus. Bisher hatten sie jedem Orkan, Taifun oder Erdbeben standgehalten – bis neulich. Da war versehentlich ein vierhundertneunzig Meter hoher Hotelturm eingestürzt.
Herzstück des damaligen Druckers war ein umgebauter Seecontainer gewesen, den drei holländische Architekten zu einem 3-D-Drucker umfunktioniert hatten, dem Kamer-Maker.
»Drei Meter war der Zimmermacher hoch und stand auf einer Grundfläche von zwei mal zwei Metern«, hatte Ommes Vater von der aufregenden Neuheit geschwärmt. »Der Kamer-Maker wurde mit Biokunststoff gefüttert, kleinen weißen Kügelchen, die zu achtzig Prozent aus Pflanzenöl bestanden. Sie wurden erhitzt, durch eine Kanüle geleitet und auf die Grundfläche gespritzt. War eine Schicht fest, kam die nächste, Millimeter für Millimeter. Ein deutsches Unternehmen entwickelte seinerzeit den Baustoff aus Bio-Leinsaat.
Und damalige Architekten prophezeiten bereits, die 3-D-Technik werde das gesamte Bauwesen revolutionieren.«
Omme seufzte. Längst wurden Häuser heute aus dem Drucker sogar als Hilfe in Katastrophengebieten benützt. Statt Baumaterialien und teures Equipment aufwendig dorthin zu schaffen, stellte man lediglich ein paar Mega-Drucker auf und fertigte Unterkünfte aus vor Ort verfügbaren Materialien, etwa aus alten Pet-Flaschen. Schulen oder Krankenhäuser entstanden aus Kartoffelschalen oder Baumrinde … Alles war möglich.
Trotz aller Anstrengung hatten die Niederländer jedoch das Rennen um die neue Technologie verloren. Ehe damals das Grachtenhaus fertig war, stellten die Chinesen bereits zehn Bungalows pro Tag aus dem Drucker her.
Schöne neue Welt? Von wegen!
Todunglücklich war Omme Hinrichs. Trotz guter körperlicher Verfassung – ein Siebzigjähriger entsprach heutzutage einem ehemals Vierzigjährigen – fühlte er sich ausgebrannt, leer und … vollkommen überflüssig. Drei Ehen hatten mit Scheidung geendet, Kinder besaß er keine.
Als junger Mensch hatten die Ärzte bei ihm eine Disposition zu Diabetes und Depression festgestellt, und er hatte sich – gesellschaftlichem Druck gehorchend – sterilisieren lassen. Gelegentlich hatte er den Entschluss bedauert – in letzter Zeit war er jedoch froh darüber. So würde er durch den Schritt, den zu gehen er nun entschlossen war, niemandem wehtun; keiner würde ihn vermissen, denn richtige Freunde besaß er auch nicht.
Da erging es ihm übrigens wie den meisten Menschen: Die herrschenden Umstände waren kaum geeignet für engere Bindungen. Alles war rationell durchgestylt, auch das Gefühlsleben. Für tiefergehende Emotionen war kein Platz.
Die Welt war voll mit Singles, die sich in erster Linie zu Tode langweilten, waren doch alle mehr oder weniger zum Nichtstun verdammt. Herkömmliche Arbeiten erledigten Maschinen, die Menschen sollten davon entlastet sein.
Während sein Großvater noch eigenhändig sein Boot gesteuert, das Netz ausgelegt und eingeholt, die gefangenen Heringe ausgenommen und die Krabben gepult hatte, und während sein Vater immerhin noch Bauzeichnungen anfertigen und die Umsetzung seiner Entwürfe noch leibhaftig an den betreffenden Baustellen überwachen durfte, hatte er nach dem Studium so gut wie nichts mehr zu tun gehabt.
Die Pläne erstellten längst intelligente Computer – und zwar eigenständig oder nach Vorgaben anderer Computer; zur Koordination der einzelnen Schritte setzte man Roboter ein, denen nichts entging. Menschen waren fehlbar, gelegentlich unaufmerksam und übersahen hin und wieder Bedeutsames – nicht so die auf Omme in zunehmendem Maße unheimlich wirkenden Roboter.
Die Ursache für den einzigen Hochhauseinsturz würde man vermutlich einem Menschen ankreiden, der sich dummerweise eingemischt hatte, statt das Projekt nur noch durchzuwinken, wie es seit Jahrzehnten üblich war.
Roboter – menschenähnliche Konstrukte mit allerhöchster künstlicher Intelligenz und einer geradezu vorbildlichen Höflichkeit – waren auf den Baustellen tätig, wo sie die Drucker überwachten, nach Bedarf einstellten und jedes menschliche Wesen zum Teufel jagten … wenn auch mit ausgesuchter Freundlichkeit, um den ruhigen, genau berechneten Ablauf nicht zu irritieren. Sein Gehalt als Architekt bekam Omme, obwohl er die von humanoiden Apparaturen erstellten Pläne für neue Stadtviertel bloß noch abnickte.
Mittlerweile waren ganze Städte in Asien, Amerika und Europa aus dem 3-D-Drucker entstanden; bewohnt von Leuten, die notgedrungen den Müßiggang pflegten. Als Omme ein Kind war, kannte man noch den etwas zweifelhaften Begriff Spaßgesellschaft. Die war längst zum inzwischen viel gepriesenen Erfolgsmodell Glücksgesellschaft mutiert.
Omme spielte tage- und wochenlang gegen sich selber Schach oder übte sich spaßeshalber im Nordfriesischen, jener Sprache, die Großvater Marten noch beherrscht, sein Vater allerdings schon nicht mehr gelernt hatte – von ihm selbst ganz zu schweigen.
Zufällig hatte er ein altes Wurdenbuk gefunden, dazu ein föhringisches Gebetbuch sowie eine uralte Grammatik. Er lernte wie besessen, um sich mit dem einzigen Inselfriesen in Hamburg, der at fering spriik noch beherrschte, in dem alten Idiom zu unterhalten.
Niklas Haien war einer jener Föhringer, die in Hamburg eine neue Heimat gefunden hatten, nachdem es seit den 2100er-Jahren aufgrund ansteigenden Meeresspiegels für die nordfriesischen Inseln und Halligen dauerhaft »Land unter« hieß. Vor einem Jahr war Niklas gestorben.
»Ham skal a dai ei föör a inj gud het«, war Niklas’ Wahlspruch gewesen: »Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!«
Omme war nun entschlossen, der Langeweile, der inneren Leere, seiner Gewissheit, nichts von Wichtigkeit mehr verrichten zu dürfen, endgültig zu entfliehen. In einer Welt, die alles Produktive Maschinen, Apparaturen, Robotern und Computern überließ, hatte er als denkendes, fühlendes, überlegendes und abwägendes Wesen keinen Platz mehr. Bis vor einigen Jahren hatten wenigstens Künstler noch ein beschränktes Nischendasein gefristet. Heute entwarfen Androiden Opern, Symphonien und Musicals, stellten auch Gemälde am Art-Computer her. Lesen galt als bizarr, wenn nicht gar als verdächtig, und das Schreiben war mega-out. Sport hingegen wurde propagiert und gefördert.
Omme hatte sich folgenden Gag ausgedacht: Er würde die Wächterroboter überlisten und sich Zutritt zu dem gigantischen Apparat verschaffen, der die kleinen Kügelchen aus allerlei Abfallprodukten herstellte, sich oben in den Trichter mit dem ultrascharfen Mahlwerk stürzen, um fein gehäckselt zu werden. Als kleiner Bub war ihm mal ein uraltes Kinderbuch in die Hände gefallen, in dem zwei bösen Jungs genau solches zur Strafe widerfuhr …
Dann würde er zusammen mit dem Biokunststoff in den Kamer-Maker (das Ding hieß tatsächlich immer noch so!) gelangen, um von dort aus als beliebiges Bauteil – hoffentlich – sinnvolle Verwendung finden: Ein Operationssaal in einem Krankenhausneubau zu werden, davon träumte er.
Seit sein Entschluss feststand, empfand Omme ein Gefühl, das dem von Befriedigung verdammt nahekam. Er würde Nikolas’ Spruch abwandeln: Manchmal kann man einen Tag doch noch vor dem Abend gutheißen …
Frauen vom Planeten Terra
Die Spannung unter den Delta-X8N37-Bewohnern ist riesig. Bald würde ihr Raumschiff landen mit der ersehnten Fracht vom Planeten Terra aus der Nachbargalaxie …
Die kostspielige Aktion war ausführlich diskutiert und von Chief Hector organisiert worden. Scheiterte sie, konnte man sie kaum wiederholen. Vorausgegangen waren Beobachtungen, wie die Terraner Arbeit, Freizeit und last, but not least ihre Fortpflanzung managten.
Was sie schließlich an Erkenntnissen gewinnen konnten, hatte bei den Bewohnern von Delta-X8N37 erst Erstaunen, dann Bewunderung und zuletzt blanken Neid erregt, denn sie selbst als reine Männergesellschaft erzeugten ihre Nachkommenschaft durch Klonen. Das Ganze lief rein medizinisch-technisch ab, ohne Emotionen und mit null Vergnügen.
Umso frustrierter waren sie, als sie erkannten, dass man ihnen auf Terra zwar auf technologischer Ebene gewaltig hinterherhinkte, aber sichtlich großen Spaß bei der Vermehrung der eigenen Spezies empfand. Den wollten die Deltianer nun ebenfalls.
Problematisch war, dass man dazu offenbar eine andere Art von höher entwickeltem Wesen benötigte, welches die Terraner mit weiblich oder als Frau bezeichneten. Und genau daran mangelte es! Also wollten sie gleichfalls solche Geschöpfe besitzen, die es vermochten, Männer zu entzücken.
Im Laufe ihrer Beobachtungen machten die Deltianer zwar die Feststellung, dass einige dieser Frauen richtig biestig sein konnten und es sogar schafften, ihren Partnern das Leben zu vergällen, sodass nicht wenige Trost im Alkohol suchten.
»Das kommt nur davon, weil die Terra-Männer nicht wissen, wie sie ihre Liebsten behandeln müssen!«, behauptete der Erste Chief der Deltianer. »Uns wird so etwas nicht passieren! Wir werden, sobald wir im Besitz dieser Wunderwesen sind, nur Lust und Wonne mit ihnen erleben – und nebenbei Nachwuchs bekommen, der nicht bloß ein Abklatsch von uns selbst sein wird.«
Was der Chief meinte, war: Die Deltianer sahen einer so langweilig aus wie der andere. Ein wenig Vielfalt war dringend angesagt.
Heute wird sich zeigen, ob und wie viele dieser weiblichen Terraner die Crew mitbringt. Was hat sie den Frauen versprechen müssen, um sie zum Mitkommen zu bewegen? Und: Sind sie wirklich so schön, wie sie aus großer Entfernung gewirkt haben?
Noch etwas hatte man den Astronauten ans Herz gelegt: Wie verhält man sich gegenüber diesen Wesen? Macht man sie sich mit freundlichen Worten, mit Geschenken oder etwa mit Gewalt gefügig? Und wie bewerkstelligt man es, dass diese Frauen auch tatsächlich Kinder bekommen?
Auf Delta-X8N37 besitzt kein Bewohner derartige Erfahrung, geschweige denn Übung. Was Sex anbelangt, ist man bisher ganz pragmatisch, je nach individuellem Bedürfnis, vorgegangen; entweder ist man Solist oder behilft sich mit einem guten Freund …
Was man mit Frauen anstellt, müssen sie nun erst noch lernen. Um sich nicht völlig zu blamieren, hatte man der Crew allerdings aufgetragen, sich diesbezüglich auf Terra schlauzumachen.
Nach der Landung des Raumschiffs auf Delta-X8N37 entsteigen erst einmal Hector, der Kommandant, und sein Erster Offizier Achill dem Raumschiff. Allein ihre strahlenden Gesichter verheißen dem erlauchten Empfangskomitee den Erfolg der heiklen Mission.
»Verehrter Chief, geschätzte Abgeordnete«, begrüßt Hector die Wartenden. »Wir freuen uns, euch die schönsten und gefügigsten Frauen zu übergeben! Widerspruchslos sind sie uns gefolgt! Auch die Männer auf Terra hatten keine Einwendungen; sie gaben sich mit dem zufrieden, was wir ihnen im Tausch für die wertvolle Fracht anboten.
Dass sie uns Aliens nennen, hat uns übrigens nicht gestört. Alle waren sehr nett zu uns und bemüht, uns schnell wieder zu verabschieden!«
»Schön!«, unterbricht ihn Chief Xerxes. »Aber jetzt möchten wir endlich diese Wunderwesen in Augenschein nehmen!«
»Natürlich, Chief!« Hector beugt sich zu ihm hinunter und flüstert ihm ins Ohr: »Um unser Liebesleben künftig so richtig genießen zu können und um bald Vaterfreuden entgegenzusehen, habe ich außerdem kartonweise blaue Pillen mitgebracht; wahre Zauberdinger, wie man mir versichert hat!«
Hector gibt ein Zeichen, und die Deltianer verlassen das Raumschiff, jeder mit einer Frau auf dem Arm, die sie anschließend sanft neben der Landepiste ablegen, eine neben der anderen. Mehrmals eilen sie zurück, um alle herauszutragen.
Dem Chief fallen beinahe die Augen aus dem Kopf: Eine schöner als die andere! Es gibt Blonde, Braune und sogar Schwarz- und Rothaarige; auch ihre Augenfarben sind unterschiedlich. Gemeinsam ist allen ein starres, etwas dümmliches Lächeln. Sie sind superschlank, haben atemberaubend lange Beine sowie Mega-Oberweiten.
»Sie sind noch schüchtern«, erklärt Hector ihre Sprachlosigkeit, »angesichts ihrer wunderschönen neuen Heimat und der großartigen Männer.«
Das muss die Erklärung sein für ihr etwas gewöhnungsbedürftiges Benehmen, das sich auch nicht ändert, als man sie willkommen heißt und ihnen Speisen und Getränke anbietet: Nichts vermag ihnen auch nur die geringste Reaktion zu entlocken. Nicht eine erhebt sich. Wie man sie abgelegt hat, so verharren sie.
»Sie sind müde und wollen sich ausruhen«, mutmaßt der Chief. »Morgen kommen wir wieder. Sie müssen sich erst an uns gewöhnen! Lasst sie schlafen!«
Nur einem einzigen Expeditionsbegleiter, der die Terraner intensiv beobachtet hat, wird regelrecht übel angesichts der drohenden Bestrafung Chief Hectors: Den listigen Terranern ist er auf den Leim gegangen, indem er sich von ihnen beim Tausch gegen seltene Metalle wie Gold, Silber und Platin leblose Gummi-Sexpuppen hat andrehen lassen. Da werden wohl auch die blauen Wunderpillen nichts mehr verbessern …
Saint Brigand
Wie neuerdings üblich, herrschte auch an diesem Tag miese Stimmung. Der Boss hatte seine Bande zusammengetrommelt an ihrem gewohnten Treffpunkt, einer ehemaligen Unterkunftshütte für Wanderer inmitten eines verwahrlosten Waldstücks der elsässischen Gemeinde, deren Name hier nichts zur Sache tut.
Jedes Bandenmitglied war erschienen; so verschieden die Kerle waren, eines war allen gemeinsam: ungeheurer Respekt vor ihrem Chef.
Der Boss ließ scharfe Blicke über seine Getreuen schweifen: Nasen-Jupp, Triefauge, Löffel-Paule, Haifischmaul, Spatzenhirni, Wadlbeißer und Furzer-Nick.
Peter Narrenfiedler, wie der Anführer mit bürgerlichem Namen hieß (kein Wunder, dass ihn keiner so anreden durfte, sondern nur mit ›Boss‹), eröffnete die Sitzung.
»Seit Monaten haben wir nur Pech gehabt bei unseren Unternehmungen. Nix hat geklappt. Zum Teil, weil ihr euch so blöd angestellt habt, aber meistens konntet ihr gar nix dafür.«
»Genauso war’s, Boss«, fiel ihm Spatzenhirni ins Wort. Ausgerechnet er, der die wenigsten Erfolge bei ihren diversen Raubzügen zu verzeichnen hatte. Selbst wenn der Boss die Aktion genau ausgeklügelt, die Umgebung sorgfältigst ausgekundschaftet und persönlich überwacht und gesichert hatte, hatte der Bursche es geschafft, todsichere Brüche scheitern zu lassen. Seinen Spitznamen trug er nicht ohne Grund … Wie im Übrigen keiner von ihnen. Alle waren sogar stolz darauf, vom Boss mit eigenen Namen bedacht zu werden. Bloß Nasen-Jupp hatte anfangs gemault – aber nur ganz leise. Sein phänomenaler Riechkolben war ja nun wirklich nicht zu übersehen.
»Ich weiß jetzt auch, woher unsere Pechsträhne kommt.« Der Boss fasste jeden Einzelnen scharf ins Auge, und allen rutschte das Herz in die Hose. Was wollte der Boss andeuten? Gab es einen gemeinen Verräter unter ihnen? Einen verdammenswerten Saboteur? Und wen verdächtigte ihr Anführer? Davor graute jedem, selbst wenn er unschuldig war. Wichtig war, was der Chef glaubte.
»Keiner von euch ist schuld an unseren Misserfolgen«, nahm der Boss gnädig den Dampf aus dem Kessel.
Erleichtertes Aufatmen in der Gaunerrunde.
»Ich weiß jetzt, dass es mit einem Heiligenbild im Kloster Saint Severin im Nachbarort zusammenhängt. Die frommen Schwestern haben einst das alte Gemälde geschenkt bekommen. Es soll angeblich den Heiligen Christophorus darstellen. Aber meine Großtante, eine weise Frau, manche nennen sie gar eine Hexe, behauptete neulich, das wäre Unsinn. Der riesige Bursche, der das angebliche Jesuskind durch den Fluss trägt, ist in Wahrheit ein Krimineller, der vor 300 Jahren den kleinen Sohn unseres damaligen Duc de Fontanelle entführt hat, um eine Menge Geld zu erpressen. Seinen richtigen Namen weiß keiner mehr, aber in gewissen Kreisen kennt man ihn unter Saint Brigand.«
»Ein Räuber also!« Triefauge nickte begeistert.
»Ich wusste gar nicht, dass du eine Großtante hast, Boss.« Löffel-Paule wollte auch etwas beisteuern. Das hatte bisher keiner gewusst, aber der Boss überhörte den Einwurf.
»Auf jeden Fall ein Bandit. Und damit ist er unser Patron. Wir werden das Bild klauen und diesem Saint Brigand die gebührende Ehre erweisen«, kündigte der Boss an. »Die nötigen Leuchter samt Kerzen und den Weihrauch habe ich schon organisiert. Kommt Jungs!«
Ehe die Schwester Pförtnerin die Kirche abends zusperrte, hatte die Bande sich unter den Bänken und im Beichtstuhl versteckt. Kaum war sie davongeschlurft, hatten die Räuber freie Bahn. Ihr Ziel war die Seitenkapelle, wo besagtes Gemälde seit vielen Jahren hing.
Doch zu aller Überraschung war das Bild weg! Der Rahmen war leer.
»Das gibt’s nicht!«, knurrte der Boss. »Wer soll denn den hässlichen alten Schinken geklaut haben? Nicht einmal der Maler ist bekannt oder gar berühmt!«
Die Kerle glotzten den leeren Rahmen an. Da stellte sich der Boss auf die Zehenspitzen, reckte die Arme und hob den von Wurmfraß befallenen Rahmen herunter.
Das Gemälde war natürlich trotzdem weg.
»Nix da!«, stellte Spatzenhirni messerscharf fest und handelte sich damit einen giftigen Blick seines Anführers ein.
»Dreh mal den Schinken um, Boss!«, schlug jetzt Haifischmaul dem Boss vor.
Der titulierte ihn mit »Idiot!« und ätzte: »Von mir aus, bitteschön!« Mit überheblicher Miene drehte der Bandenchef das schwere Teil um.
»Na, wer sagt’s denn?«, gluckste Wadlbeißer, und Triefauge stieß einen Pfiff aus.
Da war tatsächlich etwas draufgepinselt! Allerdings kein Heiliger oder Räuber, sondern etwas Geschriebenes.
Unwillkürlich las Löffel-Paule den Text laut vor: »HÄNDE HOCH! IHR SEID UMSTELLT!«
Dazu war ein mehrfaches Klicken zu hören, wie es entsteht, sobald Pistolen entsichert werden.
Furzer-Nick machte sich vor Schreck in die Hose, und der Boss ließ den Bilderrahmen auf seine Zehen krachen, was ihm einen wilden Schmerzensschrei entlockte. Dann drehten sich alle vorsichtig um – und schauten in die Gesichter von drei uniformierten und bewaffneten Ordnungshütern.
Die Möchtegernräuber kamen nicht mehr dazu, ihre eigenen Schießeisen zu zücken. Nur Löffel-Paule versuchte, den Helden zu spielen; was ihm allerdings eine Maulschelle eines Polizisten eintrug, sodass seine Elefantenlauscher glühten und er einmal mehr seinem Spitznamen alle Ehre machte.
Die ganze Bande wanderte hinter schwedische Gardinen, und zwar für sehr lange Zeit, denn ihre Untatenliste war im Laufe ihrer Räuberkarriere ellenlang geworden.
Ein absolutes Rätsel war und blieb bis heute, dass das von der Polizei sichergestellte corpus delicti am nächsten Tag erneut, wie schon seit Jahrhunderten, den Heiligen Christophorus mit dem Christuskind zeigte. Von dem angeblichen Text auf der Rückseite war keine Spur vorhanden. Außerdem blieb ungeklärt, wer die Polizei informiert hatte, die versteckt auf die Räuber gewartet hatte.
Und als Peter Narrenfiedler vom Richter verlangte, auch seine Großtante vorzuladen – sie wäre es doch gewesen, die ihn erst auf die Idee mit dem Bilderraub gebracht hätte! –, musste er sich sagen lassen, dass die alte, angeblich weise Frau laut Sterberegister der Gemeinde schon vor über dreißig Jahren beerdigt worden war.
Bei Mutter Thick
Charles Goodfellow, genannt Little Charly, betrat mit stolzgeschwellter Brust Mutter Thicks Boardinghouse in Jefferson City, wo zahlreiche Westleute – allen voran die viel gerühmten Old Surehand und Old Firehand – sich nicht nur ihre Abenteuergeschichten zum Besten gaben, sondern auch darauf warteten, ob es dieses Mal endlich einen Jagdkönig zu küren gäbe, dem es gelungen war, den lange gesuchten weißen Kojoten zu erlegen.
Little Charly schmiss einen Sack auf den Boden vor dem Tresen. »Gentlemen! Das war’s!«, schnarrte er, und den erstaunten Zuhörern kam es beinah so vor, als sei der etwas arg kurz geratene Trapper ein ganzes Stück gewachsen, seit sie ihn das letzte Mal gesehen hatten.
»He, Charly! Sag’ bloß, dir ist geglückt, was in den vergangenen Monaten keinem von uns gelungen ist?«, erkundigte sich Old Firehand.
Die wohlbeleibte Mutter Thick stürzte sich sofort voller Neugierde auf den alten Ledersack, um ihn aufzuschnüren. »Darf man nachschauen?«, fragte sie anstandshalber.
»Aber klar!« Charly spreizte sich bereits wie ein Pfau. Um ihn, die Wirtin und das ominöse Behältnis scharten sich mittlerweile sämtliche Anwesenden.
Mutter Thick nestelte den Sack auf, hob ihn hoch und stürzte ihn, um den Inhalt auf den Bretterboden plumpsen zu lassen.
»By Jove!«, murmelte sie beeindruckt, und alle anderen schrien mehr oder weniger begeistert auf. Ausgerechnet Little Charly, dessen Augen mittlerweile so schlecht waren, dass er Gerüchten zufolge aus mehr als fünf Schritt Entfernung keinen Planwagen mehr traf, sollte den weißen Kojoten erlegt haben? Dieses Biest, das sogar Kälber anfiel und bereits Erwachsene angegriffen haben sollte!