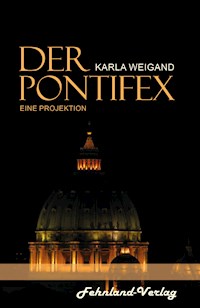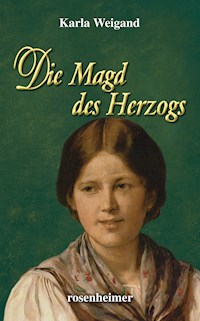5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein packendes Frauenschicksal in der rauen Insellandschaft Föhrs
Föhr, Ende des 17. Jahrhunderts: Kerrin, die Tochter des angesehenen Kommandeurs Asmussen, erkennt früh, dass sie anders ist. Durch Handauflegen kann sie heilen. Nachts zieht es sie an die sturmumtoste Küste und sie sieht Dinge, die den anderen verborgen bleiben. Als man sie der Hexerei verdächtigt, wird ihr die Gabe jedoch zum Fluch. Kerrin flieht und heuert als Schiffsärztin an. Eine gefährliche Reise beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 779
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Es ist eine karge und raue Welt, in der Kerrin Rolufsen, die Tochter eines angesehenen Walfang-Commandeurs, Ende des 17. Jahrhunderts auf Föhr aufwächst: Die Frauen der kleinen Inselgemeinschaft sind es gewohnt, sich die Hälfte des Jahres allein durchzuschlagen, denn ihre Männer müssen zur See fahren. Kerrin fügt sich schon in ihrer Jugend nicht gut in die Gemeinschaft ein. Die dicken Folianten im Studierzimmer des Inselpastors, ihres Oheims, interessieren das wissbegierige Mädchen weitaus mehr als hauswirtschaftliche Belange – und die Frage, wer einst eine gute Partie für sie sein könnte. Die Dorfbewohner fürchten und verehren sie gleichermaßen, denn ihre außergewöhnliche Gabe als Heilerin tritt früh zutage. Durch Handauflegen kann Kerrin so manches Leid kurieren. Ihr großes Wissen um die geheimen Kräfte der Heilpflanzen und ihre Angewohnheit, einsame, nächtliche Spaziergänge am Strand zu unternehmen, tun ein Übriges. Mit einem Mal ist Kerrin als Hexe verrufen und kann sich der für sie bedrohlichen Situation nur durch eine höchst ungewöhnliche Maßnahme entziehen: Sie heuert bei ihrem Vater als »Schiffsmedicus« an. Doch als der Segler im arktischen Eis stecken bleibt, sieht die Mannschaft in Kerrin die Schuldige …
Die bewegende Geschichte einer willensstarken jungen Frau, die sich in einer Welt voll Aberglauben und Vorurteilen ihren Weg erkämpft.
Die Autorin
Karla Weigand wurde 1944 in München geboren. Sie arbeitete zwanzig Jahre lang als Lehrerin, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. Sie lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Freiburg.
Lieferbare Titel
Die Kammerzofe – Die Hexengräfin – Die Heilerin des Kaisers — Im Dienste der Königin – Die Hexenadvokatin – Das Erbe der Apothekerin
Inhaltsverzeichnis
GEWIDMET
allen Föhringerinnen und Föhringern, die – ob bewusst oder unbewusst – mitgeholfen haben, dass dieses Buch entstehen konnte. Es sind zu viele, um sie alle einzeln aufzuzählen, aber ich denke, jede und jeder, die oder der gemeint ist, weiß das auch so.
Der Roman soll ein Stück weit die Geschichte eines Erdenflecks aus der Vergangenheit herausheben, der mir ganz außerordentlich ans Herz gewachsen ist. Seit vielen Jahren genieße ich den Aufenthalt auf der einzigartigen Insel Föhr und den Umgang mit seinen Bewohnern, einem ganz besonderen Völkchen, dessen Wesensart mir – obwohl aus Deutschlands tiefstem Süden stammend – ungemein entgegenkommt.
Mein ganz spezieller Dank gilt Ingrid und Kurt Knudtsen mit Sohn Peter aus Wyk, deren herzliche Gastfreundschaft mein Mann und ich schon seit Jahrzehnten jedes Jahr aufs Neue genießen. Und sobald es dann beim Abschied wieder ganz norddeutsch trocken heißt »Kiekt mol wedder in!«, dann ist das auch ehrlich so gemeint.
Klar doch! »Bi de Pump« ist immer jemand da, der uns willkommen heißt.
PROLOG
So ihre Haar’ und Augen waren rot,schlug man sie gleich als Hexe tot.Altes friesisches Sprichwort
DIE ALTEN FRIESEN WAREN seit jeher ein sehr frommes und gottesfürchtiges Volk. Sie vom alten germanischen Glauben zum Christentum zu bekehren, dauerte lange Zeit. Wer letztlich das Christentum auf die friesischen Inseln brachte, ist nicht genau bekannt. Wahrscheinlich verbreitete es sich erst unter der Regierung des Dänenkönigs Knuts des Großen (1016/1018–1035).
Aber lange noch verehrten die Friesen insgeheim die heidnischen Götter. Manche Bräuche aus uralter Zeit haben sich sogar bis in die Gegenwart erhalten. Die Macht der Päpste spielte in Friesland kaum eine Rolle. Selbst der Priesterzölibat wurde auf den Inseln nicht verwirklicht: Die Bevölkerung lehnte unverheiratete Priester kategorisch ab. Erstaunlich rasch vollzog sich einige Jahrhunderte später die Einführung der Reformation: Geradezu über Nacht wurden die Föhringer von bedingt eifrigen Katholiken zu überzeugten Protestanten.
Wer im Verdacht stand, insgeheim immer noch katholisch zu sein – etwa Heiligenbilder anzubeten oder den Papst zu verehren – , hatte es sehr schwer. Selbst Pastoren gerieten ins Visier übereifriger Lutheraner, was zu Verfolgung und Vertreibung mancher Geistlicher führte.
Ebenso unausrottbar wie die häufig geradezu fanatische Frömmigkeit erwies sich auch der Hang zum Aberglauben. Man war sich sicher, dass in jedem Haus die Unterirdischen, die Odderbantjes, das Regiment führten. Fühlten sich diese Geister gestört, rächten sie sich durch vielerlei Schabernack.
Der Glaube an die Macht der Hexen trat allerdings erst im 15. und 16. Jahrhundert auf und lag seitdem wie ein Alpdruck auf der Bevölkerung. Man war der festen Überzeugung, bestimmte Frauen stünden mit dem Teufel und mit bösen Geistern in Verbindung und setzten ihre unheilvollen Kräfte zum Schaden ihrer Mitmenschen ein.
Verursacht durch derart irrationale Ängste ereigneten sich auf der Insel Föhr grausame Hexenverfolgungen; auch auf Sylt und Amrum hatten Frauen unter diesem Wahn zu leiden. Selbst der Protestantismus änderte daran nichts. Alte Überlieferungen berichten, dass Hexen besonders zahlreich in den Föhringer Ortschaften Dunsum, Alkersum und Övenum gelebt haben sollen. Der Gegenmittel gab es unzählige – eines absurder als das andere.
FÖHR IN GANZ ALTER ZEIT
»FLUCH ÜBER EUCH nichtswürdige Mörder und Meineidige! Gott, der Herr, wird euch strafen für dieses Verbrechen an mir, einer Unschuldigen! Zur Hölle mit euch allen, die ihr dieses schändliche Urteil über mich zu verantworten habt!«
Kurz vor ihrem Tod auf dem Scheiterhaufen im August 1498 verfluchte Kaiken Mommsen, die einundzwanzigjährige Tochter des Seemanns Momme Drefsen, ihre Peiniger und alle, die dazu beigetragen hatten, sie diesem barbarischen Schicksal zu unterwerfen.
Kaiken galt in Nieblum als heil- und kräuterkundig. Wann immer einer der Dorfbewohner sich verletzte, einen Ausschlag hatte oder erkältet war, suchte er Kaiken auf, um sich von der hilfsbereiten und geschickten jungen Frau kurieren zu lassen.
Als sich im Jahr zuvor der kleine Nachbarsjunge Johann Detlefsen beim Spielen die Hand an einer scharfkantigen Muschelschale verletzte, lief seine Mutter mit ihrem Sohn zu Kaiken Mommsen, damit die sich der Sache annähme. Kaiken wusch die Wunde sorgfältig aus, gab Ringelblumensalbe darauf und verband anschließend die Hand des Kindes. Der Schnitt war allerdings sehr tief ins Fleisch gegangen und es musste sich, von Kaiken leider unbemerkt, Schmutz in der Verletzung festgesetzt haben. Die Wunde eiterte und der Schmerz begann darin zu toben, so dass der kleine Junge Tag und Nacht weinte und schließlich jämmerlich zu schreien anfing. Als man endlich nach Tagen den Verband löste, war die Hand bereits schwarz geworden.
Bei Goting, im Süden der Insel, lebte damals in Küstennähe ein alter Schäfer, der nebenbei das Geschäft eines Zahnbrechers und Knocheneinrenkers betrieb. Ihn zog nun die besorgte Familie des Kleinen zurate. Um das Leben des Jungen zu retten, blieb dem Alten nur, den abgestorbenen Arm bis zum Ellenbogen abzuschneiden.
Die Eltern gaben Kaiken die Schuld an der Verstümmelung ihres Kindes, wagten jedoch nicht, laut Anklage zu erheben, denn das Mädchen war im Dorf und in der gesamten Umgebung sehr beliebt.
Seit diesem Drama begannen sich allerdings insgeheim Gerüchte über Kaiken Mommsen zu verbreiten, die besagten, mit der jungen Frau »stimme etwas ganz und gar nicht« – die übliche Umschreibung für den lebensgefährlichen Verdacht, eine Person habe Umgang mit »bösen Mächten«. Der Same des Übels war gesät, in aller Stille sollte er keimen, sprießen und gedeihen und letztlich die unschuldige junge Frau ins Verderben reißen.
Im Jahr darauf stand im Dorf Midlum die Roggenernte an. Flirrend waberte die Augusthitze über dem Getreidefeld. Auf Föhr wurde noch nach altem germanischem Brauch Allmendewirtschaft betrieben: Felder, Wiesen und Äcker gehörten nicht einzelnen Bauern, sondern der gesamten Dorfgemeinschaft und wurden auch miteinander bestellt und gepflegt. An den Erntearbeiten beteiligten sich alle, um anschließend den Ertrag gerecht, je nach Größe ihres jeweiligen Hofes, aufzuteilen. Oftmals gehörten die bewirtschafteten Grundstücke mehreren Gemeinden zusammen. So waren jetzt auf dem Roggenfeld Frauen sowohl aus Midlum wie auch aus Alkersum und Övenum vertreten, darunter auch Kaiken Mommsen.
Körperliche Anstrengung, Staub und feuchtheiße Luft trieben den Erntehelferinnen den Schweiß auf die Stirn. Schon nach kurzer Zeit klebten ihnen die Kleider am Körper.
Eigentlich war es harte Männerarbeit, die hier verrichtet wurde; aber traditionell waren die Insel-Frauen auf sich alleine gestellt: Ehemänner, Brüder, Söhne und die meisten der unter sechzig Jahre alten Väter waren Seeleute und vom zeitigen Frühjahr an, über den ganzen Sommer hinweg, bis in den Spätherbst hinein als Heringsfänger hauptsächlich vor der Insel Helgoland unterwegs.
Die friesischen Frauen waren es gewohnt, sämtliche Tätigkeiten, die in Haus und Hof, auf Acker und Feld anfielen, selbst in Angriff zu nehmen. Dazu kamen traditionell noch der Krabben- und Rochenfang, das »Schollenpricken«, die Entenjagd und nicht zuletzt die Sorge um die Aufzucht und Erziehung der Kinder. Seit Generationen schon war das so; genauer gesagt, seit mit der Salzgewinnung und der Salzsiederei, die im 11. Jahrhundert auf der Insel ihren Anfang genommen hatten, Schluss war. Immerhin hatte dies bewirkt, dass die Friesinnen ungewöhnlich tatkräftige, selbstständige und sehr selbstbewusste Frauen waren.
Verbrachten die Männer auch meist den Winter daheim – außer sie waren auf großer mehrjähriger Handelsfahrt –, bestimmten trotzdem alleine die Frauen, was im häuslichen Umfeld zu geschehen hatte: Wie die Kinder erzogen wurden, was angeschafft werden musste und wen die Sprösslinge einmal heiraten sollten; vor allem aber, wie das Geld, das die Männer mit der Seefahrt verdienten, zu verwenden war.
»Ich will einen Teil der Heuer, die Jan im Herbst nach Hause bringt, für ein Pferd ausgeben«, tat eine der jungen Feldarbeiterinnen kund. »Ich bin es leid, den schweren Karren alleine zu ziehen oder unsere einzige Milchkuh davor zu spannen. Und auf einem Wagen zu sitzen ist allemal angenehmer, als zu Fuß zu laufen.«
Sie legte eine Pause ein, stützte sich auf ihren Rechen und wischte sich mit einem Tuch über das schweißtriefende Gesicht.
»Ich muss schließlich meinen Rücken ein wenig schonen, um meinen Jan ordentlich nach Strich und Faden zu verwöhnen – wenn er nach so langer Zeit endlich wieder daheim ist. Wenn ihr versteht, was ich damit sagen will!« Sie verdrehte bedeutungsvoll die Augen und kicherte übermütig.
Die anderen Frauen ließen die Sicheln und Rechen ruhen, grinsten verständnisvoll und manch eine stöhnte sehnsüchtig auf. Ja, die Männer! Sie vermissten sie manchmal schrecklich, vor allem in den langen Nächten …
Die Mäherinnen und Garbenbinderinnen machten Anstalten, gleichfalls die Arbeit für einen Augenblick ruhen zu lassen. Marret Ketelsen aus Alkersum, die reichste von allen und daher stillschweigend als Anführerin der Gruppe anerkannt, wusste das jedoch zu verhindern.
»Seht ihr nicht, dass die Schwüle und die schwarzen Wolken über uns ein Gewitter ankündigen? Es ist jetzt keine Zeit, um über dies und das zu klönen. Beeilt euch! Das Getreide muss noch heute ins Trockene! Wenn durch unsere Nachlässigkeit der Roggen verdirbt, werden uns unsere Männer dies bestimmt nicht danken!«
Schweigend gehorchten die Frauen. Marret hatte Recht: Der Himmel wirkte äußerst bedrohlich. Alle verdoppelten noch ihre bisherigen Anstrengungen. Aber schon nach wenigen Minuten prasselten dicke Regentropfen von oben herab und die Schnitterinnen packten Sicheln, Rechen und die Hanfseilspulen zusammen, rafften ihre langen Röcke und beeilten sich, um unter dem weit vorstehenden Dach einer nahe gelegenen großen Scheune Unterschlupf zu finden. Sie würden den Schauer abwarten und gleich danach weiterarbeiten.
Als es zu donnern und zu blitzen begann, flüchteten sich die meisten Frauen ins Innere des Unterstands; bloß ein paar ganz Mutige blieben unter dem Scheunentor stehen, um das Gewitter von sicherer Warte aus zu beobachten.
Nur Kaiken Mommsen war auf dem Feld zurückgeblieben; sie wollte erst noch ihre Getreidegarbe fertigbinden und ordentlich aufstellen. Die Sonne war mittlerweile ganz verschwunden und drohende Schwärze, unterbrochen von giftigem Schwefelgelb, überzog den Himmel, der nach dem Kreuz des Kirchturms von St. Johannis in Nieblum zu greifen schien und nach den Flügeln einer der erst kürzlich aufgestellten Bockmühlen.
»Warum kommt Kaiken denn nicht auch unters schützende Dach?«, fragte eine ältere Frau aus Övenum. »Die Ärmste muss mittlerweile völlig durchnässt sein. Aber wie es scheint, genießt sie das Unwetter regelrecht!«
Erneut war grollender Donner zu vernehmen und gleich darauf fuhren zischend mehrere Blitze dicht neben dem Feld in den Erdboden.
»Wen wundert’s?«, ließ sich spöttisch Sabbe Michelsen aus Midlum vernehmen. »Hat sie es doch selbst gemacht!«
»Was willst du damit sagen?«, fuhr Marret Sabbe unwillig an. Sie wusste – wie alle übrigen auch –, dass die beiden jungen Frauen sich einmal wegen eines gut aussehenden Matrosen in die Haare geraten waren. Die anderen der unter dem Vordach zusammengedrängten Frauen spitzten neugierig die Ohren. Das roch jetzt geradezu nach einer bösartigen Auseinandersetzung!
»Seht doch bloß, wie Kaiken ihre Arme zum Himmel reckt – so, als wolle sie zu Thor beten, dass der alte Wettergott ja ein ganz besonders fürchterliches Gewitter über unser Land kommen lassen möge!«, ereiferte sich Sabbe.
»Ich sage dir, hör auf damit, solchen Unfug zu verbreiten!«
Marret Ketelsen war nun ernsthaft zornig. Ihre blauen Augen blitzten und sie warf der Verleumderin wütende Blicke zu.
»Dummes Geschwätz dieser Art hat schon manches arme Weib ins Unglück gestürzt. Wir wissen alle, dass du Kaiken nicht leiden kannst. Aber das gibt dir noch lange nicht das Recht, schlecht über sie zu reden! Merk dir das! Im Übrigen könnte man aus deinem Gerede über den Heidengott Thor durchaus auch heraushören, du selbst glaubtest noch an ihn!«
Sabbe Michelsens Mundwinkel zuckten verächtlich, aber sie verstummte und verzog sich zu den anderen ins Innere der Scheune, die groß genug war, den gesamten gemeinschaftlichen Ernteertrag aufzunehmen.
Gleich darauf schien der Himmel zu explodieren: Hagelkörner, manche von der Größe von Hühnereiern, prasselten wie Steine hernieder und verschonten weder die noch stehenden Halme mit den schweren Getreideähren, noch die bereits abgemähten, ordentlich gebundenen und nebeneinander gleich Soldaten aufgereihten Garben.
Auch Kaiken war dem Geschosshagel ausgesetzt. Die Frauen beobachteten, wie sie vergebens versuchte, das große Kopftuch über Haare und Schultern zu ziehen und gleichzeitig ihren langen regenschweren Rock im heftigen Sturm am Hochflattern zu hindern. Ihr fruchtloses Bemühen verursachte indessen nur hektische, seltsam anmutende Verrenkungen.
Erneut stellte Sabbe sich zu den anderen Frauen ans offene Scheunentor.
»Schaut sie euch doch an! Dass sich Kaiken über unser aller Unglück freut – das kann ja jetzt wohl jede von uns sehen! Würde diese Hexe sonst mitten in dem Gewitter einen Freudentanz aufführen?«
Dieses Mal kam Marret gar nicht mehr zu Wort, obwohl sie den Versuch unternahm, die Frauen zum Beten anzuhalten. Diese, entsetzt über den Schaden, den der Hagelschlag nicht nur im Roggenfeld anrichten würde und angesteckt von einer blind machenden Hysterie, stießen auf einmal ins selbe Horn wie Sabbe. Plötzlich brach ein unglaublicher Lärm in der Scheune los. Jammergeschrei, Flüche und Verwünschungen gegen Kaiken waren zu hören.
»Die Towersche tanzt tatsächlich mitten im Unwetter!«, kreischte eine der Älteren. »Fluch über sie!«
»Ihr dummen Weiber seht doch bloß, was ihr sehen wollt und wozu euch Sabbe aufgestachelt hat!«, schrie Marret Ketelsen dagegen an, aber ihre Stimme drang nicht durch.
Als Kaiken endlich zerzaust und bis auf die Haut durchnässt in der Scheune anlangte, konnte Marret lediglich mit Mühe und Not verhindern, dass man die junge Frau gnadenlos verprügelte. Alle umringten sie mit Drohgebärden und schrien gleichzeitig wütend auf sie ein. Die Anwesenden machten allen Ernstes Kaiken für die Katastrophe, die mindestens die halbe Ernte der Insel vernichtete – auch die Gerste stand schließlich noch auf dem Halm – verantwortlich. Der Hagelschlag würde selbst die ohnehin magere Birnenernte vernichten, von den Kohlköpfen und Rüben auf dem Acker und den Haselnüssen und Holunderdolden an den vereinzelt wachsenden Sträuchern ganz zu schweigen.»Das bedeutet den Winter über grausame Hungersnot für uns alle, du Höllenbrut, du elende Hexe! Du hast das Unwetter gemacht und uns den Hagel geschickt! Verflucht sollst du sein, verdammter Troler!«
Sabbe kreischte hysterisch und riss Kaiken an den langen, blonden, jetzt von der Nässe strähnigen Haaren. Sie und andere packten die junge Frau und fesselten sie – trotz Kaikens heftigster Gegenwehr – mit dem Strick, der eigentlich zum Garbenbinden dienen sollte.
Als sie nicht aufhörte, lauthals ihre Unschuld zu beteuern, wurde Sabbe ganz ausfallend. »Halt endlich dein Maul, sonst stopfen wir es dir mit Stroh und Mist! Ich habe dich schon seit damals in Verdacht, du Drecksstück, als du deinem Nachbarsjungen die Hand hast abfaulen lassen!«
Diesen Vorwurf laut auszusprechen war ungeheuerlich. Aber alle Frauen in der Scheune schienen die bösartige Unterstellung zu billigen. Auf Marrets Stimme der Vernunft hörte schon lange keine mehr.
Man beschloss, Kaiken zu Pfarrer Martin Hornemann nach Nieblum zu schaffen, sobald das Gewitter vorüber wäre. Der Geistliche, der als Pastor an der als »Friesendom« bezeichneten St. Johanniskirche seines Amtes waltete, wüsste sicher, wie mit »so einer« zu verfahren sei.
Bis dahin vegetierte die junge Frau angekettet, bei Wasser und Brot, in einem finsteren, stinkenden Loch unterhalb des Gemeindehauses. In der winzigen Zelle war es ihr kaum möglich, aufrecht zu stehen. Zu ihrer Bewachung beorderte die Gemeinde Nieblum zwei Burschen, die zwar über kräftige Muskeln, aber über wenig Hirn und noch weniger Herz verfügten.
Vom ersten Augenblick an schikanierten diese primitiven Kerle Kaiken auf das Übelste; bald fingen sie auch an, sie schamlos zu bedrängen, indem sie ihr an die Brüste oder unter den Rock fassten. Dazu befleißigten sie sich einer Ausdrucksweise, die den Geistlichen, als er einmal zufällig Zeuge davon wurde, vor Schreck erblassen ließ.
Diese jungen Männer kannte er nur als gute Katholiken, die an keinem einzigen Sonntag die Messe versäumten! Auch zur heiligen Kommunion erschienen sie regelmäßig und sie sangen voller Inbrunst im Kirchenchor mit.
Dass sie jetzt auf einmal so sündhafte Worte gebrauchten, konnte nur die Schuld dieser gottlosen Hexe sein, welche die braven Burschen verdarb. Es wurde Zeit, dem Ganzen ein Ende zu bereiten und die Verhandlung beginnen zu lassen.
Das nächste Mal platzte der Pfarrer im Kerker mitten in eine höchst anstößige Szenerie: Kaiken kniete vor einem der beiden Wächter und befriedigte ihn mit dem Mund. Dass der Kerl ihr dabei ein Messer an die Kehle hielt, übersah Martin Hornemann …
Vom Pastor dennoch empört zur Rede gestellt, besaß dieser Mensch die Frechheit, ihm weiszumachen, die Hexe habe ihn dazu gezwungen. Auf diese Weise versuche sie regelmäßig, ihren Bewachern »die Lebenskraft« auszusaugen und diese damit zu schwächen. Auf die Waffe kam er von selbst zu sprechen, er behauptete allen Ernstes, das Messer habe er zu Hilfe genommen, um das Weibsstück abzuwehren. Dabei sah er Martin Hornemann seelenruhig, mit fast treuherzigem Augenaufschlag, ins Gesicht.
Pastor Hornemann, ein etwas naiver Zeitgenosse, legte sich nun persönlich mit Feuereifer ins Zeug: Zusammen mit den zwölf Ratsmännern, die sozusagen die »Regierung« des östlichen, zum Herzogtum Schleswig-Holstein-Gottorf gehörigen Inselteils bildeten (Westerland Föhr gehörte hingegen zum Königreich Dänemark), trug er genügend Beweise gegen die Beschuldigte zusammen. Als Erstes war da das Vorkommnis mit der abgestorbenen Hand des kleinen Johann Detlefsen; diese unselige Geschichte musste erneut aufgerollt werden. Für den Pastor bestand kein Zweifel, dass die Hexe Kaiken es zu verantworten habe, dass der Junge niemals – wie sein Vater und Großvater – ein Seemann werden konnte.
Dann war da noch die äußerst merkwürdige Sache mit dem alten Knut Olufsen, einem Witwer von zweiundachtzig Jahren, für den Kaiken hin und wieder gekocht und gewirtschaftet hatte, nachdem er alleine nicht mehr so gut zurechtkam. Knut war neulich in seiner Köögen einfach umgefallen. Als ihm eine Nachbarin zu Hilfe kommen wollte, war er schon tot gewesen – nachdem Kaiken kurz zuvor sein Haus verlassen hatte! Was brauchte es noch mehr an Beweisen für das teuflische Wirken der jungen Frau?
Es gab nun durchaus Menschen mit Herz und Vernunft auf Föhr, darunter Marret Ketelsen, die Knuts hohes Alter zu bedenken gaben.
»Ein Mann mit über achtzig kann doch durchaus vom Schlag getroffen werden. Was ist daran so außergewöhnlich, dass man dahinter Hexerei vermuten muss?«, argumentierten sie. »Eigentlich ist Kaiken doch dafür zu loben, dass sie ohne Lohn für den alten Olufsen gekocht, geputzt und gewaschen hat.«
Dem widersprach Pastor Hornemann sogleich auf das Lebhafteste.
»Der alte Knut war zwar nicht mehr der Jüngste, das will ich gar nicht leugnen. Aber er war noch kerngesund und hätte noch viele Jahre leben können, wenn dem nicht der böse Wille einer einzigen Person entgegengestanden hätte! Ihr wisst, wen ich damit meine!«
Aus Feigheit und einer gewissen verständlichen Sorge um die eigene körperliche Unversehrtheit unterließen letztlich alle Zweifler – auch Marret – ihre Einsprüche. Bekanntlich war es nicht ungefährlich, sich für Towersche einzusetzen: Ehe man sichs versah, landete man selbst vor Gericht.
Die Ratsmänner und der Geistliche scheuten sich auch nicht, uralte Geschichten aus Kaikens früher Kindheit auszugraben. Allerlei Belanglosigkeiten wurden wieder aufgewärmt, nur um sie bei der Bevölkerung noch mehr in Misskredit zu bringen.
Hatte die Beschuldigte nicht schon als Fünfjährige ihren Eltern deutlich zu verstehen gegeben, sie wolle nicht jeden Sonntag stundenlang in der Kirche beim Gottesdienst hocken, weil ihr das zu langweilig sei? Eine Ungeheuerlichkeit geradezu! Als ob die Verkündigung von Gottes Wort und das Lob des Herrn zur Volksbelustigung dienen sollten! Und hatte Kaiken nachweislich nicht immer wieder die heilige Feier durch Geplapper und dummes Lachen gestört? Hatte sie nicht ständig beim Sprechen der Gebete und beim Singen frommer Lieder respektlose Faxen gemacht und damit andere brave Kinder abgelenkt? Ohne Zweifel war Kaiken schon in jungen Jahren eine Feindin des Glaubens und ein Ärgernis der christlichen Gemeinde gewesen.
Eine halb verrückte Alte gar, der sonst niemand mehr Gehör schenkte, weil man ihren Geist als gestört erkannte, ließ man allerlei Kurioses vorbringen – alles geeignet, den Verdacht gegen Kaiken Mommsen weiter zu erhärten und damit zur Gewissheit werden zu lassen. So wollte sie die junge Frau dabei ertappt haben, als diese »Zaubersteine« in Säckchen einnähte, um sie heimlich unter den Türschwellen missliebiger Leute zu vergraben, denen dadurch Unheil widerfahren sollte.
Ein junger Mann, der viel und gerne dem Alkohol zusprach – jedenfalls häufiger und heftiger, als man es einem Burschen im Allgemeinen zugestand, und den Kaiken deshalb vor einiger Zeit als Bräutigam abgewiesen hatte –, brachte vor den zwölf Ratsmännern, die gleichzeitig als Richter fungierten, Folgendes vor:
»Als ich mich vor einem Jahr geweigert habe, sie zur Frau zu nehmen, hat Kaiken mir damit gedroht, mich mit einer schweren Krankheit zu strafen. Ich aber wollte keine Towersche heiraten. Da hat sie mich tatsächlich verhext und ich bin daraufhin schwer krank geworden. Allmählich geht es mir wieder etwas besser.«
Obwohl jedermann auf Föhr Boy Wagens als arbeitsscheuen und ungeschickten Kerl kannte, den kein Commandeur auf seinem Schiff beschäftigen wollte, schenkten ihm die Ratsmänner Glauben – alle zweifellos untadelige Leute, aber keine studierten Juristen.
Wären Kaikens Richter rechtskundig gewesen, hätte das zwar vermutlich nichts am Urteil über sie geändert. Aber zumindest hätte eine vage Chance bestanden, dass man jenes Rechtsmittel, um Geständnisse zu erpressen – die Folter nämlich – , nicht gar so bestialisch angewendet hätte, wie man es tat.
Zuerst renkten die Henkersknechte ihr die Arme aus, brachen ihr dann mehrere Rippen und die meisten Finger, rissen ihr mit Zangen die Nägel an Händen und Füßen aus, brachten ihr Brandwunden unter den Achseln und im Schambereich bei, peitschten sie aus und gossen danach heißes Öl in die Wunden. Kurzum, sie taten alles, um die Gefangene zu dem Geständnis zu bringen, es mit Luzifer auf dem Hexentanzplatz persönlich getrieben zu haben … Ihr liebster Versammlungsort mit anderen Trolern war angeblich die Sandgrube zwischen Alkersum und Övenum, wo die schamlosen Orgien mit dem Teufel, der als brünstiger Ziegenbock auftrat, stattzufinden pflegten.
Für die Tatsache, dass das Mädchen sich in ein Tier verwandeln konnte, leisteten einige Insulaner sogar einen heiligen Eid.
»Ich habe sie mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sie als schwarze Katze um die Häuser geschlichen ist! Das schwöre ich bei Gott und allen Heiligen!«, behauptete eine missgünstige Witwe. Ein anderer wollte sie gar in der Gestalt eines Hasen erkannt haben.
Keiner der Richter störte sich im Übrigen daran, dass sämtliche Ankläger irgendwie mit dem kleinen Johann verwandt waren.
Die angebliche Hexe war unwahrscheinlich tapfer und widerstand lange der Versuchung, durch ein »Geständnis« ihre Qualen zu verkürzen. Schließlich, als man »der widersetzlichen Kreatur« noch die Hüftknochen aus den Gelenkpfannen riss, war es soweit: Ihr Wille war gebrochen und Kaiken gab alles zu, was man ihr an Unsinnigkeiten und Perversitäten vorwarf.
Als Nächstes erfolgten das unter freiem Himmel stattfindende abschließende Gerichtsverfahren und die feierliche Urteilsverkündung. Dieser Prozess fand nach alter Väter Sitte auf dem Friedhof statt, vor dem Portal der St. Johanniskirche, wo sich gleichzeitig der Thingplatz befand. Es handelte sich dabei um ein Geviert – Seitenlänge dreißig Schritt –, welches seit alter Zeit als öffentliche Gerichtsstätte diente, zu der jeder freie Bürger Zutritt hatte. Das waren praktisch alle, denn Unfreie oder Sklaven kannte man in Friesland nicht.
Der Andrang der Zuschauer war riesig, es kam offenbar die halbe Inselbevölkerung. Der Kirchhof fasste bei Weitem nicht alle, so dass der Großteil der Insulaner draußen auf der Dorfstraße stehen musste.
Die Beschuldigte in einen löcherigen, grauen Fetzen gehüllt, abseits auf einer Steinplatte kniend, mit gefesselten Händen und einem Strick um den Hals, wurde pro forma zu jedem einzelnen Vorwurf noch einmal befragt. Zuvor warnten die Richter Kaiken jedoch eindringlich, die Gerichtsverhandlung mit einem Widerruf zu »stören«. Man gedenke, noch heute »zum Ende« zu gelangen …
Die gebrochene junge Frau dachte jedoch – ihres elenden Zustandes zum Trotz – nicht daran, es ihren Todfeinden allzu leicht zu machen. Jedes Mal, wenn der oberste Richter einen neuen Anklagepunkt verlas und ihre Schuld für »unzweifelhaft erwiesen« erklärte, schüttelte Kaiken ihren kraftlos gesenkten Kopf mit den aufgelösten, verfilzten Haaren und murmelte leise, aber deutlich:
»Alles, was Ihr sagt, Herr Richter, ist erlogen. Kein einziges Wort davon ist wahr. Das schwöre ich, so wahr mir Gott, der Herr, helfe!«
Und jedes Mal beschimpfte sie der erste der zwölf Richter: »Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren! So steht es in der Heiligen Schrift, du nichtswürdiges Geschöpf!«
Worauf die Angeklagte wiederum schlagfertig erwiderte: »In der Heiligen Schrift steht auch: ›Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten!‹ Das hat jedoch keinen Eurer angeblichen Zeugen von der Lüge abgehalten.«
Was den Richter dazu veranlasste, ihr wegen mangelnden Respekts vor dem Gericht jeweils zwei zusätzliche Rutenstreiche aufzuerlegen, auszuführen von einem der Knechte während der anschließenden Fahrt zum Hinrichtungsort.
Wer Kaiken nicht sehr gut kannte, wäre niemals auf den Gedanken gekommen, in dem schmutzigen, abgemagerten, offensichtlich durch schwerste Misshandlungen gefügig gemachten Krüppel die allzeit lebensfrohe, gesunde, junge Frau zu vermuten, als die sie noch vor ein paar Wochen jedermann erschienen war.
Das Gericht legte ungewöhnliche Eile an den Tag. Es hatte den Anschein, als wolle man unbedingt Prozess, Urteil und Vollstreckung noch vor der alljährlich im Herbst erfolgenden Heimkehr der ersten Schiffsmannschaften »erledigt« haben. Ein Zeichen dafür, dass man sich seiner Sache doch nicht so ganz sicher war und auf alle Fälle heftige Proteste von einflussreichen Männern – wie etwa den wohlhabenden Kapitänen – scheute und möglichen Einwänden durch die Schaffung von Tatsachen zuvorkommen wollte.
Das abschließende Urteil, das die Richter einstimmig fällten, konnte niemanden überraschen: Tod durch Verbrennen lautete der Spruch, den der oberste Richter verkündete, nachdem er den Stab über Kaiken Mommsen gebrochen hatte. Die Strafe war umgehend zu vollziehen.
Vor dem Kirchhof stand der Armesünderkarren schon bereit. Darauf wurde die verurteilte Hexe von den zwei Rohlingen verfrachtet, die der Gefangenen während ihrer Zeit im Kerker schon das Leben zur Hölle gemacht hatten. Noch am Morgen vor dem Prozess hatten beide die schwer verletzte Frau zum letzten Mal brutal vergewaltigt. Eine dürre Mähre zog den Wagen widerwillig zum Richtplatz.
Ein großer Teil der Inselbevölkerung, für die das grässliche Schauspiel eine willkommene Abwechslung im täglichen Einerlei darstellte, marschierte, betend und fromme Lieder singend, hinterher. Endpunkt der makaberen Wanderung – erst über die dürre, mit Heidekraut und Wacholderstauden bewachsene Geest und anschließend durch die mit Gras bewachsene Marsch – bildete eine Senke bei der St.-Laurentii-Kirche im Westen der Insel, nahe Süderende, mit Namen Hal Mur.
Dies war eigentlich schon dänisches Herrschaftsgebiet, aber nach altem Brauch wurden hier allgemein die Inselhexen verbrannt. Der Name war altfriesisch und erinnerte an die heidnische Unterwelts- und Totengöttin. »Moor der Hel« hieß die Gegend im Hochdeutschen. Das letzte Wegstück dorthin nannte man bezeichnenderweise Halstieg.
Dieser Pfad war sehr eng und mit Steinbrocken übersät und konnte mit Pferd und Wagen nur schwer bewältigt werden, was bedeutete, dass Kaiken absteigen und das letzte Stück ihres irdischen Wegs zu Fuß zurücklegen sollte. Mittlerweile war die Verurteilte, die zusätzlich noch mit der Peitsche traktiert worden war, und der während des gesamten Marsches von den feixenden Begleitern Flüche, Verwünschungen und Zoten zugerufen wurden, so geschwächt, dass eine der Wachen sie kurzerhand mit derben Fäusten packte, sie sich wie einen Hafersack über die Schulter warf und bis zu dem bereits aufgeschichteten Scheiterhaufen schleppte.
Der Henker mit seiner Kopf und Gesicht eng umschließenden Lederhaube, die nur Augen, Mund und Nasenlöcher freiließ, sowie sein Helfer in kurzen, schafledernen Hosen und Wollkittel standen schon bereit. Außerdem Pfarrer Martin Hornemann, der sich dazu berufen fühlte, kurz bevor die Flammen Kaikens Leib zerstörten, wenigstens ihre Seele zu retten.
»Pass bloß auf, wenn du ihr so nahe kommst, dass du ihr dabei ja nicht in die Augen schaust«, warnte den Schergen einer der drei Richter, die man ausgelost und verpflichtet hatte, als Zeugen der grausigen Hinrichtung beizuwohnen; die übrigen neun waren nach Hause gegangen. »Der Troler könnte dich sonst noch aus Rache verhexen!«
Der Bursche, froh darüber, die Verurteilte jetzt dem Henker überlassen zu dürfen, grinste insgeheim. Zum Glück wusste der Ratsmann nicht, wie nahe er erst heute Morgen der Hexe noch gekommen war …
Sämtliche Gaffer, die der Urteilsvollstreckung regelrecht entgegenfieberten, würden aller Voraussicht nach voll auf ihre Kosten kommen: Die Gnade vorheriger Erdrosselung durch den Henker war Kaiken nämlich vom Gericht ausdrücklich verweigert worden. Hatte die Verstockte sich doch bis zuletzt hartnäckig geweigert, ihre offensichtliche Schuld zuzugeben und Reue über ihren Bund mit dem Satan und all ihre Schandtaten zu zeigen.
Als Einziger schien der Henker ein gewisses Maß an Mitgefühl mit der Verurteilten zu haben: Er hatte dafür gesorgt, dass das Material des Scheiterhaufens – in Ermangelung des seltenen und daher kostbaren Holzes in der Hauptsache aus dürren Ästen und Zweigen von Haselnussstauden, Holundersträuchern und allerlei sonstigem Gestrüpp bestehend – reichlich mit Ballen feuchten Heidekrauts und nassem, klein geschnittenem Reet durchsetzt war. Erfahrungsgemäß förderte das die Rauchentwicklung und ließ die Delinquenten im Qualm schnell ersticken, was ihnen unnötig lange Qualen des Verbrennens bei lebendigem Leibe ersparte.
Einige der Zuschauer, die in unmittelbarer Nähe des lodernden und heftig qualmenden Haufens standen und Kaikens schmerzverzerrtes Antlitz erkennen konnten, erschauderten unwillkürlich. Nicht wenigen verging das Lachen, als durch das Prasseln des Feuers aus dem Mund der Sterbenden ihr Fluch über sie deutlich zu hören war.
Von einer Towerschen verflucht zu werden, war eine höchst gefährliche Angelegenheit! Zuletzt, ehe ihr Gesicht endgültig hinter dichten Rauchschwaden verschwand, schien die Unglückliche noch seherische Gaben zu entwickeln:
»In etwa zweihundert Jahren werden eure Nachfahren – genauso Wahnsinnige, wie ihr es seid – erneut darangehen, sich wiederum an einer Unschuldigen, einer Verwandten von mir, zu versündigen! Aber dieses Mal wird es ihnen, trotz aller Anstrengungen, nicht gelingen, ihren grausamen Spaß am elenden Tod einer jungen Frau zu genießen! Denn dann wird es auf Föhr aufrechte Männer und Frauen geben, die beherzt Widerstand leisten und den gemeinen Mördern Einhalt gebieten!«
Einer nach dem anderen machten die Zuschauer jetzt kehrt und verließen stillschweigend die Gegend von Hal Mur. Zuletzt waren nur noch der Henker, sein Gehilfe und einer der Ratsmänner bei den rauchenden Überresten anzutreffen. Auch der Geistliche war ohne Aufsehen verschwunden, nachdem die Delinquentin auf seine seelsorgerischen Dienste ironisch dankend verzichtet hatte.
Die Genugtuung, eine Hexe ihrer gerechten Strafe zugeführt zu haben, sowie das Vergnügen am grausigen Vollzug schienen den Gaffern auf einmal schal geworden zu sein.
Wie vom Gericht vorhergesehen, protestierten etliche der zurückkehrenden Seeleute gegen dieses – ihrer Meinung nach grundlose – Hexereiverfahren und das abschließende Urteil. Allzu viele waren es allerdings nicht – dafür sorgten schon ihre jeweiligen Ehefrauen, die nahezu unisono Kaiken Mommsen als Hexe bezeichneten.
Am meisten erregten sich natürlich Momme Drefsen, der Vater der Unglücklichen, sowie sein Kapitän, Commandeur Brar Michelsen, als sie nach langer Fahrt auf See nach Föhr zurückkehrten und von dem schrecklichen Ereignis Kenntnis erlangten.
»So etwas Unmenschliches dürfte man keinem Geschöpf Gottes zufügen – so Schlimmes es auch getan haben mag«, erklärte Michelsen mutig. »Wäre ich zu dieser Zeit auf Föhr gewesen, hätte ich alles unternommen, um dieses himmelschreiende Unrecht zu verhindern.«
Das verkündete Brar Michelsen auch öffentlich, ohne sich um die besorgten Stimmen von Freunden zu kümmern, die ihn davor warnten, »sich allzu weit aus dem Fenster hinauszulehnen«: Immerhin mache er sich dadurch die zwölf Ratsmänner und vor allem alle drei Inselpastoren zum Feind. Hatten die geistlichen Herren doch einstimmig den Urteilsspruch der Richter begrüßt.
TEIL I
EINS
Föhr, Anfang September 1687
SEIT ÜBER ZWEI TAGEN und Nächten lag die junge Frau nun schon in den Wehen, aber mit der Geburt wollte es einfach nicht vorangehen. Die siebenundzwanzigjährige Terke Rolufsen, geborene Brarens, Ehefrau eines der reichsten Föhringer Walfänger-Commandeure, Roluf Asmussen, war bereits Mutter von zwei gesunden Kindern.
Moicken Harmsen, mit fünfzig Jahren eine erfahrene Hebamme, die schon vielen Insulanern geholfen hatte, das Licht der Welt zu erblicken, rechnete bei der vor Gesundheit strotzenden Terke nicht im Geringsten mit Komplikationen. Die junge Frau freute sich geradezu närrisch auf ihr drittes Kind, von dem sie hoffte, es würde wiederum ein Knabe.
Noch bei Wehenbeginn hatte Moicken die werdende Mutter untersucht, hatte nach ihren Herzschlägen gelauscht und überprüft, ob der Säugling die richtige Lage im Leib der Gebärenden eingenommen habe, und dabei keinerlei Abweichungen von der Norm festgestellt. Auch die Herztöne des Kindes waren kräftig.
Kaum ließ sich Terke jedoch im Gebärstuhl nieder, ging in einem einzigen riesigen Schwall das gesamte Fruchtwasser ab. Somit würde es eine »trockene Geburt« werden – der absolute Alptraum jeder Wehmutter.
Im Verlauf der Zeit nahmen die Kräfte der jungen Frau dramatisch ab. Hatte sie in den Nachtstunden noch den Anweisungen Moickens willig Folge geleistet und war zwischen den einzelnen Wehen im Zimmer auf und ab spaziert, erwies sie sich jetzt als zu schwach dazu. Die Hebamme war mit ihrer Weisheit so ziemlich am Ende.
Alles, wirklich alles hatte sie versucht: Wehenstärkende Mittel, wie etwa Salbeiöl und Petersilienwurzelextrakt – beides sollte angeblich die Kontraktionen der Gebärmutter fördern –, verschiedene Tees zur Kräftigung des Herzens, zum Beispiel Weißdorn, sowie ein ständiger Wechsel der Positionen: Nichts hatte gefruchtet – egal, ob Terke auf dem Gebärstuhl mit dem halbrund ausgeschnittenen Sitz Platz nahm, fest die Arme aufstützte und die Beine gegen das Fußbrett stemmte, ob sie mit gespreizten Oberschenkeln auf einer Decke auf dem Boden kniete oder, wie im Augenblick, vom Schmerz überwältigt und wie erschlagen auf dem Wandschrankbett lag.
Auch die Helferinnen der Hebamme, ältere Frauen aus dem Dorf Nieblum und jüngere Freundinnen Terkes aus den umliegenden Ortschaften, alle selbst mehrfache Mütter, waren verzagt. Keine glaubte mehr so recht daran, dass diese Niederkunft jemals zu einem guten Abschluss käme. Aber niemand sprach laut aus, was alle dachten.
»Du schaffst das, Terke«, behauptete die Wehmutter und die anderen Frauen pflichteten ihr lebhaft bei.
»Aber natürlich!«, erklärte Terkes beste Freundin, Signe Pedersen, eine siebenundzwanzigjährige Dänin, die einen Föhringischen Kapitän geheiratet hatte, mit erzwungener Zuversicht. »Bei Anke Brodersen hat es auch drei Tage gedauert und dennoch wurde sie von einem gesunden Mädchen entbunden. Bei dir ist es ähnlich, du musst nur sehr tapfer sein!«
Die Frauen zwangen sich dazu, heitere Gelassenheit auszustrahlen und sogar zu lächeln, obwohl mehr als einer eher nach Weinen zumute war. Die Hebamme überlegte bereits im Stillen, ob sie zum stärksten ihr bekannten Mittel greifen sollte, dem Bilsenkraut. Allerdings hatte sie sich bis jetzt stets davor gescheut es anzuwenden, denn dieses Kraut war ein tödliches Gift, sobald man sich nur im Geringsten in der Dosis irrte.
Nach längerem innerem Ringen beschloss Moicken schließlich schweren Herzens, seine Verwendung zu unterlassen. Wenn es der Wille des Herrn war, dass diese junge Frau sterben sollte, dann würde es eben in Gottes Namen so geschehen.
Als Terkes Schreie, die mittlerweile an die einer Gefolterten erinnerten, ihren vorläufigen Höhepunkt erreichten, konnte eine der Geburtshelferinnen nicht mehr an sich halten. Sie wandte sich an die wie versteinert dastehende Hebamme:
»Ich hab’s geahnt, dass es so kommt, Moicken! Die Vorzeichen waren eindeutig; ich wollte sie nur nicht wahrhaben, weil unser Pastor doch immer behauptet, dass alles Unfug ist, was die Alten uns überliefert haben. Jetzt haben wir den Beweis, dass es doch stimmt!«
»Was meinst du damit, Birte?«, erkundigte sich Moicken Harmsen alarmiert. Birte Martensens dummes Geschwätz war etwas, das sie jetzt am allerwenigsten gebrauchen konnten.
Alle Anwesenden scharten sich um Birte. »Jetzt sag schon! Was meinst du mit ›Vorzeichen‹?«
Birte, der ungeteilten Aufmerksamkeit aller Anwesenden gewiss, tat recht geheimnisvoll. Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern, so dass die Frauen wegen der anhaltenden Schreie der Kreißenden sie anfangs kaum verstanden. Dann allerdings deutete sich Unglaubliches an.
Als sie geendet hatte, fuhr Moicken wie eine Furie auf Birte Martensen los.
»Du bist ja wohl völlig närrisch geworden! Du willst uns tatsächlich weismachen, eines Nachts ein Gespenst gesehen zu haben, das Unheil verkündet? Selten so einen Unsinn gehört! Das ist nichts anderes als finsterstes Heidentum. Lass bloß niemand anderen diesen Blödsinn hören. Da hört sich doch alles auf!«
Die Wehmutter war entsetzt und wütend zugleich.
Das hatte ihr gerade noch gefehlt! Behauptete Birte Martensen doch allen Ernstes, vor einigen Nächten, als sie bei Ebbe den Strandabschnitt zwischen Wyk und Goting nach Muscheln und Krabben absuchte, im Mondenschein der Witten Fru, der »Weißen Frau«, begegnet zu sein, einer Geisterfrau, die angeblich seit Jahrhunderten großes Unglück – meist den Tod einer Gebärenden – ankündigte.
»Ich weiß, was ich gesehen habe!«, wehrte sich Birte gegen Moickens Vorwürfe. »Was glaubt ihr wohl, wie ich erschrocken bin, als urplötzlich die Witte Fru an mir vorüberschwebte: Sogar den Eimer, in dem ich die Muscheln einsammeln wollte, ließ ich vor Entsetzen fallen, solche Angst hatte ich, als ich sah, wer da am Meeresufer entlangwandelte! Die Gespensterfrau war jung und wunderschön. Ihr langes, spinnwebfeines, durchscheinendes Gewand umfloss ihre schlanke Gestalt und ihre bloßen Füße schienen den Sand nicht zu berühren. Im Licht des vollen Mondes konnte ich ihre edlen Gesichtszüge und die todtraurigen Augen deutlich sehen!«
»Jetzt hör aber sofort auf mit deinen Märchen!«, befahl Moicken streng. Aber vergebens, Birte war nicht mehr zu bremsen.
»Ich habe die Ärmste nicht nur gesehen, sondern auch gehört«, spielte sie einen weiteren Trumpf aus.
»Was hast du gehört?«
»Was hat die Weiße Frau denn gesagt?«
»Nun sag schon, was hat die Geisterfrau verkündet?«
Sämtliche Geburtshelferinnen scharten sich um Birte Martensen. Es schien, als hätten sie die sich noch immer in entsetzlichen Qualen windende Terke völlig vergessen, so, als glaubten sie, man könne ihr sowieso nicht mehr helfen.
»Sie hat den Namen ihres Kindes gerufen«, flüsterte Birte. »Es klang geheimnisvoll und es ist mir richtig ans Herz gegangen, so wehmütig und todtraurig klang ihre Stimme dabei. Ich habe die Rufe deutlich gehört: Eleonora, meine Tochter, mein liebes Kind, wo bist du? Es war anrührend und schaurig zugleich.«
»Das war ohne jeden Zweifel die Witte Fru!«, riefen mehrere Helferinnen gleichzeitig durcheinander.
»Sie sucht nach ihrer im Meer ertrunkenen kleinen Tochter – und das bedeutet Unglück für eine andere Frau, die Mutter werden soll.«
»Die Meeresgöttin Ran hat ihre Tochter geraubt und die Weiße Frau sucht seit Jahrhunderten vergebens nach ihr.«
»Die Geisterfrau erscheint seit Urzeiten, wenn auf der Insel eine werdende Mutter sterben muss.«
Jetzt war das Furchtbare laut ausgesprochen und stand ebenso unheilverkündend wie scheinbar unabwendbar im Raum.
Plötzlich wurde es totenstill in der Schlafkammer.
Erst jetzt fiel den Frauen auf, dass die Schreie der werdenden Mutter aufgehört hatten.
Wohl ein Dutzend Mal hatte »Mutter Harmsen«, wie die Hebamme allgemein auf der Insel genannt wurde, mit kundiger, mit Butter eingefetteter Hand im geweiteten Geburtskanal nachgeforscht, ob die Lage des Kindes endlich die »richtige« war, ob es sich womöglich zwischenzeitlich gedreht habe. In diesem Augenblick tat sie es erneut. Dann schüttelte sie den Kopf.
»Das Kind ist einfach zu groß; es steckt im Becken fest wie in einer Schraubzwinge«, murmelte Moicken verzweifelt, zog ihre Hand zurück und wischte sie gedankenlos an dem Tuch ab, das ihr eigentlich zum Abtrocknen des Gesichts diente. Der Schweiß rann ihr mittlerweile in Strömen übers Gesicht, denn es war brütend heiß im Zimmer. Die Fenster mussten ja, wegen der umherfliegenden bösen Geister, die es auf Mutter und Kind abgesehen hatten, dicht verschlossen bleiben …
Die Hebamme resignierte und verzichtete darauf, Birte erneut zu widersprechen. Terke war in kalten Schweiß gebadet, ihr Atem ging nur mühsam und ihr Herzschlag hatte sich beängstigend verlangsamt.
»Um Jesu Christi willen! Bringt mich endlich um! Bitte, erschlagt mich doch! Ich halte diese Qualen nicht mehr länger aus!«
Die Anwesenden erschraken zu Tode.
Nach langer Zeit stieß Terke wieder verständliche Worte aus, aber die Bedeutung dessen, was sie verlangte, war einfach unglaublich! Es sollten ihre letzten Worte sein. Von nun an vernahmen die verstörte Wehmutter und die helfenden Frauen nur noch ihr grauenhaftes Stöhnen und Jammern. Und gerade dieses jämmerliche Wimmern ging allen noch sehr viel mehr zu Herzen, als die lautesten Schreie es vermocht hatten.
Von einem ungewohnten Geräusch aufgeschreckt, wandte sich Moicken, deren Nerven zum Zerreißen gespannt waren, nach dessen Ursache um.
Sie entdeckte die sechsjährige Kerrin Rolufs, die Tochter der werdenden Mutter, die mitten in der Komer stand, dem Raum mit den drei großen Schrankbetten. Eines davon belegte im Augenblick Terke – die Beine obszön weit gespreizt —, deren grotesk angeschwollener Bauch die entsetzten kindlichen Blicke magisch anzog: Vom Nabel abwärts war die Mutter nackt.
»Was hast du hier zu suchen? Du hast hier überhaupt nichts verloren! Verschwinde auf der Stelle! Geh spielen, aber pack dich augenblicklich und lass dich hier ja nicht mehr sehen!«
Äußerst barsch klangen Mutter Harmsens Worte, ihre Stimme war zudem ungewohnt schrill und überschlug sich beinahe. Die kleine Kerrin erschrak noch mehr. Was ging hier vor? Warum war die sonst durch nichts aus der Ruhe zu bringende Wehmutter so nervös, ja richtiggehend böse? Und was war mit Mama? Weshalb lag sie vor aller Augen derart schamlos da?
Moicken stapfte energisch auf das kleine Mädchen zu, das keine Anstalten machte, das Gebärzimmer, diesen geheimnisvollen Schauplatz höchst rätselhafter Ereignisse, zu verlassen. Unsanft packte sie das Kind an der Schulter und drehte es grob um sich selbst, um es zur Tür hinauszuschieben.
In diesem Augenblick kam Moicken in den Sinn, dass Kerrin Rolufs aller Wahrscheinlichkeit nach in Kürze keine Mutter mehr haben würde … Die Hebamme hielt inne; sie schluckte schwer und ihre ungehaltene Stimme wurde auf einmal weich.
»Geh nur ruhig, mein Schätzchen! Die Geburt dauert noch. Sobald dein neues Geschwisterchen da ist, werde ich dich und deinen Bruder Harre rufen. Versprochen!«
Sanft schob sie das jetzt nur noch leicht widerstrebende kleine Mädchen durch die Tür. Sicherheitshalber versperrte sie diese dann, indem sie den Riegel von innen vorlegte.
»Kleine Kinder als Zuschauer bei einer Niederkunft: Das fehlte mir gerade noch«, murmelte sie dabei. Außer Frauen, die bereits geboren hatten, duldete sie niemanden um sich, wenn es galt, neuem Leben auf die Welt zu helfen – auch keine Ehemänner.
Als sie vor fast dreißig Jahren auf Föhr als Hebamme begann, war das Erste, was sie sich ausbedungen hatte: kein Mann als Zaungast bei einer Entbindung.
»Die Kerle stören bloß, sie stehen im Weg und schnacken dummes Zeug. Es reicht, wenn sie das Geschehen vom Nebenzimmer aus mitbekommen.«
Grimmig lächelnd hatte sie hinzugefügt: »Das finde ich übrigens sogar äußerst heilsam für die Herren: Das Wehgeschrei beweist ihnen lebhaft, was sie ihren Weibern nächtens antun.«
Bei Männern, die völlig die Fassung verloren, konnte es allerdings vorkommen, dass Moicken sie vorübergehend gleich ganz ihres eigenen Hauses verwies und in den Dorfkrug schickte, bis die Geburt vorüber war.
Unwillig schob sie diese Gedanken als wenig hilfreich von sich. Hier und heute handelte es sich um keine normale Entbindung, sondern offensichtlich um eine Tragödie.
Um nicht gänzlich untätig zu erscheinen, forderte Mutter Harmsen eine Nachbarin auf, ihr dabei zu helfen, die erschöpfte Terke erneut in den Gebärstuhl zu setzen.
Unwillkürlich machte sie sich bereits Gedanken darüber, wie Roluf Asmussen, angesehener Commandeur eines holländischen Walfangschiffes, dieses Unglück aufnehmen würde, sobald er im späten Herbst von der Fahrt nach Grönland zurückkehrte.
Im Geiste ging sie noch einmal jeden Handgriff, jeden Ratschlag, jede Arznei, die sie der Kreißenden verabreicht hatte, durch. Nein, alles war gut und richtig gewesen. Das könnten im Notfall auch die anwesenden Frauen bestätigen. Sie war sich durchaus keiner Schuld bewusst. Aber wer konnte schon vorhersagen, wie der unglückliche Ehemann, der Terke über alle Maßen liebte, reagieren würde? Womöglich lastete er ihr, der erfahrenen Wehmutter, grobes Versagen an, das zum Tod seiner Liebsten geführt habe?
Die Hebamme gab sich keinerlei Illusionen hin, was mit ihr geschähe, sollte man sie vor Gericht schleppen: Geburtshelferinnen waren beim Volk zwar sehr angesehen – solange alles gut lief. Kam es jedoch zu Schwierigkeiten oder gar zum Tod von Mutter und Kind, dann war im Nu die Nähe zu den verabscheuten Hexen hergestellt. Das war dieser Tage noch so wie vor zweihundert Jahren.
Um der Ärmsten die schlimme Pein, die noch auf sie wartete, wenn schon nicht zu ersparen so doch zu erleichtern, beschloss Mutter Harmsen, Terke einen Betäubungstrank, vermischt mit etwas Mohnsaft, zu verabreichen. Ihr andauerndes Wimmern zerrte inzwischen an den Nerven aller Anwesenden.
Die Hebamme warf einen Blick auf die Weiber, die ratlos im Raum umherstanden. Am liebsten hätte sie alle nach Hause geschickt. Aber das war unmöglich. Als Zeuginnen der Geburt hatten sie auch ein Recht, unmittelbar bei der Entbindung dabei zu sein. Auch wenn es, wie in diesem Fall, anscheinend gar keine geben sollte …
Signe Pedersen, Terkes liebste Freundin, legte wohl zum hundertsten Mal einen Stapel mit sauberen Leinentüchern sorgfältig Kante auf Kante zusammen. Anschließend warf sie ihn sofort wieder durcheinander. Moicken war sich sicher, dass Signe überhaupt nicht wusste, was sie tat.
Eine andere Helferin arrangierte – ebenso sinnlos – fortwährend die Arzneifläschchen der Hebamme; immer wieder rückte sie diese auf der Kommode hin und her, vor und zurück, ordnete sie wechselweise nach ihrer Größe, nach Farbe und Höhe ihres Inhalts.
Die Wehmutter erschrak, als sie sich plötzlich am Ellbogen gefasst fühlte. Signe hatte endlich aufgehört, die Wäsche zusammenzulegen, und war dicht an sie herangetreten. Ganz nahe brachte sie ihren Mund an Moickens Ohr und flüsterte ihr zu: »Glaubst du nicht, dass es endlich an der Zeit wäre, Frau Hal anzurufen? Ich denke, nur sie kann jetzt noch helfen!«
Mutter Harmsen erschrak zutiefst. Geschwind blickte sie sich um. Zum Glück schien keine der anderen Frauen Signe gehört zu haben. Dieser fatale Ratschlag kam nun in der Tat zur Unzeit! Dachte Signe wirklich, sie ließe sich darauf ein, die heidnische Totengöttin Hel um Hilfe zu bitten? Sie würde den Teufel tun und eine germanische Heidengöttin bemühen – für eine Gebärende, die überdies mit einem der drei Inselpastoren eng verwandt war!
Unwirsch wehrte sie Signe ab. »Schweig mir von diesen Dingen!« , beschied sie die junge Dänin, der nicht wenige – und wohl nicht zu Unrecht – insgeheim nachsagten, sie hielte es immer noch mit den alten Göttern.
Auf einmal kam Mutter Harmsen der Gedanke, den Oheim der jungen Mutter, den allseits beliebten und verehrten Pastor von Sankt Johannis in Naiblem, wie man den Ort Nieblum damals nannte, holen zu lassen.
Lorenz Brarens war nicht nur ein sogar auf dem Festland sehr bekannter evangelischer Theologe, sondern ein vielseitiger Gelehrter, der so mancherlei wusste, wovon sich ein gewöhnlicher Mensch keinen Begriff machte und der überdies mit bedeutenden wissenschaftlichen Koryphäen der Zeit in regem brieflichem Kontakt stand. Vielleicht vermochte er ihr einen Rat zu erteilen?
Als sie diese Hoffnung laut aussprach, griffen die übrigen, genauso ratlosen Frauen sie begierig auf. Sogleich rannte die Jüngste von ihnen aus dem Haus des Commandeurs und hinüber ins nahe liegende Pfarrhaus.
Falls sich Moicken Harmsen in dieser delikaten Angelegenheit tatsächlich Hilfe von dem Geistlichen erwartet hatte, sah sie sich gleich darauf bitter enttäuscht. Von Gynäkologie und Geburten verstand der gelehrte und kluge Mann rein gar nichts.
Der Vierundvierzigjährige, Ehemann und Vater von vier Kindern, war entsetzt, sobald er seiner Nichte ansichtig wurde.
»Ich bin sicher, sie erkennt mich gar nicht mehr.«
Der vor Schreck erblasste Pastor klang tief bedrückt, die Stimme versagte ihm fast. Er ermannte sich jedoch und sprach einen Segen über Terke, ihr Ungeborenes und über alle anwesenden Frauen. Anschließend verließ er beinahe überstürzt das Zimmer.
Eine Magd führte ihn in den Pesel, den schönsten Raum eines jeden friesischen Hauses. Es handelte sich dabei um die Wohnstube, die im Unterschied zu der jeden Tag benützten Dörnsk nur von besonders geehrten Gästen und zu feierlichen Gelegenheiten betreten wurde.
Der Geistliche ließ sich seufzend in dem großen, ledernen Armsessel nieder, in dem im Winter sein angeheirateter Neffe, der Commandeur Roluf Asmussen, Platz zu nehmen pflegte. Asmussen war nur um vier Jahre jünger als der Pfarrer. Vor zehn Jahren – mit dreißig – hatte er Brarens damals siebzehnjährige Nichte Terke zur Frau genommen.
Für beide war diese Ehe – trotz des nicht unbeträchtlichen Altersunterschieds – ein wahrer Glücksfall: Sie liebten sich innig und der Herrgott segnete sie im Jahr nach der Hochzeit mit dem jetzt neun Jahre alten Harre und drei Jahre später mit der Geburt ihrer Tochter Kerrin.
Des Pastors Gedanken schweiften ein wenig ab in die Vergangenheit, als Roluf, ein gut aussehender, gebildeter und höflicher, aber recht schüchterner Mann, seiner jungen Verwandten beinahe verschämt den Hof gemacht hatte. Ein Lächeln stahl sich auf Lorenz Brarens’ Lippen, als er sich daran erinnerte, wie er und seine Frau Göntje dem zaghaften Werben des Seeoffiziers, der damals sein erstes Kommando als Kapitän erhielt, regelrecht »nachgeholfen« hatten, um das Ganze ein wenig zu beschleunigen …
Die Tränen schossen dem Geistlichen in die Augen, als ihm wieder in den Sinn kam, wie Roluf vor Glück gestrahlt hatte, als Terke ihn an einem der letzten Tage des Monats Februar, kurz vor seiner Abreise nach Holland, von ihrer dritten Schwangerschaft in Kenntnis setzte.
»Wenn du im Spätherbst von großer Fahrt zurückkehrst, mein Liebster, wird seit etwa zwei Monaten ein neuer Sprössling in der Wiege liegen«, hatte sie ihm lächelnd versprochen.
Pastor Brarens, der in jungen Jahren einige Zeit in Frankreich verbracht hatte und deshalb von den meisten seiner Gemeindemitglieder mit »Monsieur« angesprochen wurde – was bei ihnen allerdings nach »Musjöh« klang –, zweifelte nicht daran, dass er in Kürze einen äußerst traurigen Eintrag im Kirchenbuch von St. Johannis vorzunehmen habe:
»Terke Rolufsen, geborene Brarens, zur Gemeinde Sankt Johannis in Nieblum auf Föhr gehörig, verheiratet mit dem Commandeur Roluf Asmussen, Mutter von Harre und Kerrin Rolufsen, ist heute, während der Geburt ihres dritten Kindes, in der Gnade des Herrn verschieden. Gott, der Herr, sei ihrer armen Seele gnädig! Nieblum, am … September, anno 1687.«
Nur das genaue Datum musste er noch abwarten; aber eigentlich zweifelte er längst schon nicht mehr daran, dass Terke noch am heutigen Tag ins ewige Leben einginge.
Als Geistlicher und Sterbebegleiter hatte er schon viele Menschen erlebt, die ihren letzten Atemzug taten, er kannte die Anzeichen, wenn der Tod hinter einem Menschen stand – und bei Terke hatte er ihn ganz deutlich gespürt.
»Es käme dabei einem Wunder gleich, wenn das Kind, dem sie eigentlich das Leben schenken sollte, das Drama überstünde«, dachte er und seufzte wiederum. Mit großer Wahrscheinlichkeit war auch der Säugling dem Tod geweiht. Er beschloss, nicht nur Terke und ihren Mann Roluf, sondern auch Harre und Kerrin – die beiden Waisenkinder, die seine Nichte zurückließe – sowie das unschuldige Kleine in seine Gebete einzuschließen.
Es war immer besonders traurig, wenn ein junger Mensch verstarb; eine junge Mutter zumal, die von ihren Kindern noch dringend gebraucht wurde.
»Herr, warum lässt du so etwas Grausames geschehen?«, entfuhr es ihm unwillkürlich laut. Dann dämpfte er seine Stimme zu einem Flüstern; es wäre nicht gut, sollte jemand im Haus ihn hören.
»Herr im Himmel, bist du wirklich ein gütiger Gott, ein Vater, der seine Kinder auf Erden wahrhaft liebt? Herr, warum machst du es mir so unendlich schwer, dich zu verstehen?«
Wie oft hatte ihm ein frommes Gemeindemitglied diese Frage schon gestellt! Auch er wusste bis heute keine Antwort darauf – jedenfalls keine, die ihn befriedigen konnte.
ZWEI
Zu gleicher Zeit vor Grönland auf See
ROLUF ASMUSSEN, Commandeur des unter holländischer Flagge segelnden Walfängers Adriana, beschloss, nach Stunden ununterbrochener Anwesenheit auf der Brücke endlich seine Kajüte aufzusuchen. Jetzt konnte er es sich leisten, ein wenig zu verschnaufen. Wozu hatte er seine Offiziere?
Alles lief wie am Schnürchen, jeder Handgriff saß, da jeder der Männer wusste, was er zu tun hatte. Die Mannschaft bestand ausschließlich aus Seeleuten der Insel Föhr – das hatte Asmussen sich schon vor Jahren bei der Reederei ausbedungen.
Nur zu bereitwillig war man darauf eingegangen: Föhringer galten nun einmal als die besten Walfänger – und die unter seinem Kommando Dienenden ganz besonders. Wale waren eine äußerst begehrte Beute: Lieferte ihr Speck doch den nötigen Tran, der zum Heizen verwendet wurde und durch den fast sämtliche Lampen Europas ihren hellen Schein verbreiteten. Beinahe jeden Tag, den Gott werden ließ, dankte Commandeur Asmussen dem Herrn für die Möglichkeit des Walfangs.
Seit Menschengedenken boten sich den Friesen in der Hauptsache zwei Erwerbsmöglichkeiten. Die eine war der Heringsfang vor der Insel Helgoland, die andere war das seit dem 11. Jahrhundert übliche Sieden von Salz, wobei das Meersalz aus der Asche von Seetorf ausgekocht wurde. Aus einer Tonne Torf waren immerhin fünfundzwanzig Kilogramm Salz zu gewinnen.
Im 16. Jahrhundert war es mit dem Heringsfang plötzlich vorbei; keiner wusste, weshalb die Schwärme ausblieben. Auch die Salzsiederei gelangte an ein jähes Ende. Die »Große Flut« von 1634 zerstörte zudem einen Großteil des Landes, was den Untergang beträchtlicher Gebiete mit fruchtbarem Marschboden bedeutete. Getreideanbau und Viehzucht wurden stark eingeschränkt.
In dieser Notlage kam der Zufall den Friesen zu Hilfe. Während der Entdeckungsreisen zu Anfang des 17. Jahrhunderts – einer von Rolufs Vorfahren war daran beteiligt – sichteten die Seefahrer in den Gewässern um Grönland und Spitzbergen riesige Wal- und Robbenbestände. Das ließ aufhorchen, war der Waltran doch als Brennstoff heiß begehrt.
Die großen Reedereien der Holländer holten sich anfangs vor allem die im Walfang erfahrenen Basken auf ihre Schiffe. Von ihnen lernten die Holländer, wie man die Wale fangen, töten und »ausschlachten« konnte. Als Ludwig XIV. von Frankreich allerdings seinen baskischen Untertanen verbot, unter holländischer Flagge Wale zu erlegen, sprangen flugs die gelehrigen Friesen ein. Sie füllten die durch die fehlenden Basken entstandenen Lücken und es gelang ihnen, in kurzer Zeit führende Positionen im Walfang zu erlangen, indem sie Harpuniere, Speckschneider und sogar Commandeure wurden.
Die ursprünglichen Fanggebiete lagen bei Spitzbergen, was man anfangs irrtümlich für einen Teil von Grönland hielt. Daher nannte man seit jeher den Walfang »Grönlandfahrt« – selbst als man den geografischen Irrtum längst korrigiert hatte.
Roluf Asmussen schmunzelte unwillkürlich, wie immer, wenn er die noch sehr kurze Geschichte des friesischen Walfangs Revue passieren ließ.
In der diesjährigen Sommersaison hatten er und seine Mannschaft großes Glück gehabt: Zahlreiche Wale hatten die Männer bisher erbeutet und die Adriana war mit allen ihren sechs Schaluppen, den Fangbooten, heil geblieben. Auch sonst hatte es weder durch Krankheiten noch durch andere Misslichkeiten Ausfälle bei der Mannschaft gegeben.
Das war durchaus keine Selbstverständlichkeit.
Als sie im Frühsommer das Grönlandeis erreichten, fanden sie zu ihrer Bestürzung ein verlassenes Schiffswrack vor, im Eis feststeckend – von den Seeleuten entdeckten sie jedoch keine Spur.
Später hörten sie von anderen Walfängern, dass dieses Schiff am Pfingsttag leckgeschlagen war, nachdem es mit seinem Bug einen Eisberg scharf gerammt hatte. Vorsichtig war Asmussen mit der Adriana hingesegelt; jedoch nicht zu nahe, um nicht womöglich selbst im Eis eingeklemmt zu werden. Eine zerquetschte Schaluppe konnten die Männer noch bergen. Es war offensichtlich die des Commandeurs, am Bug war noch ein Name zu erkennen: Peter Steenhagen. Er war Hamburger Kapitän und ein Freund Roluf Asmussens.
Der machte sich natürlich große Sorgen um ihn. Aber bald erfuhren sie von anderen Commandeuren, die sich gleichfalls in dieser walreichen Gegend aufhielten, Steenhagen und seine Leute habe man heil und gesund auf anderen Schiffen aufgenommen.
Im Augenblick waren seine Männer damit beschäftigt, einen weiteren, heute am frühen Morgen erlegten, riesigen Wal, den man längsseits dicht an die Adriana herangezogen hatte, mit starken Winden anzuheben, um ihn vor Haifraß zu schützen. Die Biester hatten es sich längst zur Gewohnheit gemacht, erlegte Wale als ihnen zustehende Beute zu betrachten.
Die Männer ließen sich auf dem Rücken des Tieres nieder, um ihm die Haut abzuziehen. Die dicke Speckschicht schnitten sie mit besonderen Messern herunter – eine Tätigkeit, die man »Flensen« nannte.
Die Speckstreifen und -brocken wurden aufs Mutterschiff gehievt, wo bereits andere warteten – unter ihnen der Küper und der Schiemann –, um das Fett zu zerkleinern und in Fässern zu verstauen. Während dem ersteren die Aufsicht über den guten Zustand der hölzernen Specktonnen oblag, war letzterer für das ordnungsgemäße Verstauen der vollen Fässer im Laderaum des Schiffsbauchs verantwortlich. Verrutschte die schwere Ladung aufgrund starken Seegangs, konnte das den Untergang eines Walfängers bedeuten.
Die wertvolle Fracht wurde nach Beendigung der Fangsaison vom großen Segler zum Heimathafen in die Tran-Brennerei gebracht. Es gab immer weniger Walfangschiffe, auf denen der Tran noch von der Mannschaft selbst an Ort und Stelle in Spitzbergen oder Grönland gekocht wurde. Auch Asmussen vertrat die Ansicht, seine Männer hätten Wichtigeres zu tun – nämlich möglichst viele Wale zu erlegen und ihr Fett herbeizuschaffen – als sich als »Tran-Köche« zu verzetteln.
Je nach Menge der Ausbeute eines »Grönlandsommers« belief sich der Lohn der höher chargierten Seeleute. Dazu zählten der Commandeur, der Steuermann, der Speckschneider, dessen Gehilfe, der Bootsmann, der jeweilige Harpunier auf einer Schaluppe, der Schiffszimmermann, der Oberküper und der Schiemann. Die übrigen niederen Mannschaftsränge erhielten als Sold einen festen Monatslohn und dazu eine recht bescheidene Beteiligung am jeweiligen Fang.
Roluf Asmussen notierte sich im Geiste, dass er später nicht vergessen durfte, den jüngsten Schiffsjungen unter anderem auch darüber zu belehren. Es sollte den Jungen dazu animieren, fleißig zu sein, um es später möglichst vom einfachen Matrosen zum Offizier zu bringen.