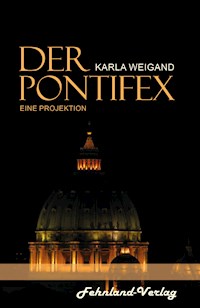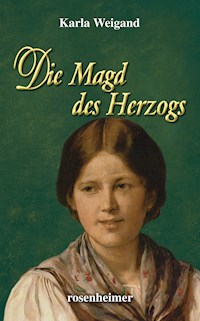7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: p.machinery
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mathilde von Tuszien, auch bekannt als Mathilde von Canossa, war zu Lebzeiten – 1046 bis 1115 – eine der mächtigsten Adligen Italiens in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Als Markgräfin herrschte sie über weite Teile der Toskana und der Lombardei. Ihre Persönlichkeit war nicht frei von Widersprüchen, geprägt von hohem fürstlichem Selbstverständnis und den Idealen der Kirchenreform. Sie war fromm im Sinne der damaligen Zeit, selbstbewusst und politisch interessiert. Sie agierte erfolgreich im Spannungsfeld zwischen König und Kaiser Heinrich IV. und später dessen Sohn Heinrich V. sowie den Päpsten Gregor VII., Urban II. und Pasquale II. Mit den drei Päpsten unterhielt sie Liebesbeziehungen. Ihr Leben war geprägt von Ränkespielen und Intrigen, von Enttäuschungen und Erfolgen. Da sie zeitlebens ohne Nachkommen blieb, starb das Geschlecht derer von Canossa dem Tod Mathildes von Tuszien 1115 aus. Karla Weigand beschreibt in diesem Buch Mathildes Leben aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie zeigt, wie eine Frau in einer seinerzeit männerdominierten Welt ihren Einfluss geltend machen konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Karla Weigand
Mathilde
Markgräfin von Tuszien, Herrin von Canossa, Geliebte dreier Päpste
Außer der Reihe 87
Karla Weigand
MATHILDE
Markgräfin von Tuszien, Herrin von Canossa,
Geliebte dreier Päpste
Außer der Reihe 87
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
© dieser Ausgabe: November 2023
p.machinery Michael Haitel
Titelbild: Robert na‘Bloss (Grabmal der Mathilde von Canossa im Petersdom)
Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda
Lektorat & Korrektorat: Michael Haitel
Herstellung: global:epropaganda
Verlag: p.machinery Michael Haitel
Norderweg 31, 25887 Winnert
www.pmachinery.de
ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 358 1
ISBN dieses E-Books: 978 3 95765 746 6
Prolog
März 1060, auf der Burg zu Canossa – ein unerfreuliches Geburtstagsgeschenk für Mathilde: das Verlöbnis mit dem ungeliebten Stiefbruder – ein Eklat, aber an der Haltung von Mathildes Eltern ändert sich nichts – eine List soll die Heirat verhindern – unwürdiges Treiben mancher Kirchenfürsten – in Cluny formiert sich dagegen Widerstand …
Diskret pochte der Diener an die Tür zum Gemach der Gräfin Beatrix von Tuszien. »Madame, wie von Euch gewünscht, bringe ich Euch Eure Tochter, Contessa Mathilde!«
Nachdem er das »Herein!« seiner Herrin abgewartet hatte, öffnete er die Tür und schob das widerstrebende junge Mädchen mit dem trotzigen Gesicht – fast noch ein Kind – ins Zimmer.
»Danke, Giovanni! Du kannst gehen«, beschied ihn die Gräfin kurz. Nur zu gern befolgte der junge Domestik diesen Befehl. Die Stimme der Herrin hatte frostig geklungen und ihre herrische Handbewegung beschleunigte mit Nachdruck seinen Abmarsch.
Erkennbar lag Ärger in der Luft; da machte sich ein kluger dienstbarer Geist am besten unsichtbar.
Seit Tagen, Wochen, Monaten überwog auf der Burg die schlechte Laune seiner Herrschaft. Ja, man konnte sagen, seit ungefähr zwei Jahren war die Stimmung schon angespannt. Giovanni erinnerte sich noch ganz deutlich, wann das Ganze begonnen hatte.
Im Sommer 1058 war es gewesen; die Contessa hatte ihren zwölften Geburtstag gefeiert, galt somit als »mannbar« und konnte in Kürze eine Ehe eingehen.
Die Gedanken des Dieners bezogen sich auf Ereignisse, die man nur als dramatisch bezeichnen konnte. Dabei hatte das Fest ungewöhnlich feierlich begonnen, obwohl man normalerweise von Geburtstagen wenig Aufhebens machte – im Gegensatz zu Namenstagen, an denen man die Erinnerung an das heilige Sakrament der Taufe wachrief und damit die Mitgliedschaft in der Gemeinschaft der Christen festlich beging.
Mathildes Mutter, Gräfin Beatrix von Canossa, Tochter Friedrichs II. von Luxemburg und Oberlothringen, sowie Mathildes Stiefvater, Herzog Gottfried III., genannt der Bärtige, hatten der zwölfjährigen Contessa feierlich eröffnet, sie sei ab sofort Gottfried IV. zur Ehe versprochen und man feiere dementsprechend an diesem Tag ihrer beider Verlöbnis.
Die Zwölfjährige hatte einen völlig verdutzten Blick auf Gottfried den Jüngeren geworfen, den jedermann insgeheim nur »den Buckligen« nannte – und der der Sohn ihres Stiefvaters aus dessen erster Ehe war – und damit ihr Stiefbruder. Sie musste sich gerade verhört haben.
Aber sein boshaft triumphierender Blick in dem hämisch grinsenden Gesicht sowie die todernsten Mienen von Mutter und Stiefvater hatten Mathilde rasch eines Schlechteren belehrt.
Allen Anwesenden, die man geladen hatte, und natürlich auch ihren Eltern, war sehr wohl bewusst, dass die Contessa den seit seiner Geburt mit einem gewaltigen Höcker belasteten Knaben, der obendrein mit einem nicht sehr angenehmen Wesen, einem verkürzten rechten Bein, sowie einem ziemlich hässlichen Gesicht geschlagen war, von ganzem Herzen verabscheute.
Auf etwaige Befindlichkeiten von Adelstöchtern nahm man jedoch keine Rücksicht und nach ihrer Meinung fragte natürlich niemand. Bei Eheschließungen handelte es sich schließlich nicht um etwas Unwichtiges und Flüchtiges wie »Liebe«, nicht einmal um Sympathie, sondern allein um Zugewinn von Ansehen, Vermögen, Ländereien, Einfluss und Macht.
Die junge Mathilde war die einzige Erbin ihres verstorbenen Vaters, des ehemals mächtigen Markgrafen Bonifaz I. von Canossa-Tuszien, und war damit eine ausgesprochen gute und wohlhabende Partie. Ihr Stiefvater, Herzog Gottfried III., der Bärtige, sah darum nicht ein, warum er künftig das Erbe der Stieftochter an eine andere Sippe verlieren sollte.
Der Dienerschaft und mehr noch den Freunden und Verwandten, die man zur Feier des Verlöbnisses geladen hatte, war der Augenblick niemals aus dem Gedächtnis geschwunden, als der Herzog seiner angeheirateten Tochter die »Freudenbotschaft« mitgeteilt hatte.
Statt des erwarteten, demütigen Einverständnisses in die Notwendigkeit dynastischer Zwänge, erhielt er als Antwort einen mit schriller Stimme hervorgestoßenen, fassungslosen Aufschrei seiner Stieftochter.
»Ihr beliebt wohl zu scherzen, Herzog!«, hatte das zwölfjährige, für sein Alter noch ziemlich kleine Mädchen geschrien. Mathilde war außer sich und im Gesicht ganz rot. »Niemals werde ich Gottfried zum Mann nehmen!«
»Sehe ich aus, als wäre mir nach Scherzen zumute, mein Kind?«, hatte Beatrix’ zweiter Gemahl kühl erwidert. »Ich und deine Mutter haben das beschlossen und dir wird gar nichts anderes übrig bleiben, als zu gehorchen! Du wirst nun meinen Sohn Gottfried als deinen künftigen Gatten umarmen und mit einem Kuss euer Verlöbnis besiegeln, wie es der Brauch ist, Mathilde!«
Da hatte sich das junge Mädchen temperamentvoll an die wie versteinert dastehende Gräfin gewandt.
»Frau Mutter! So sagt doch, dass das nicht wahr ist! Ihr wisst, wie wenig gut ich mich mit meinem Stiefbruder vertrage. Ja, zuweilen verabscheue ich ihn! Er ärgert mich andauernd, spielt mir gemeine Streiche und beleidigt mich immerzu. Ja, er verleumdet mich sogar bei Euch und meinen Lehrern!«
Ihre Stimme war umgekippt; sie schluckte und musste erst wieder zu Atem kommen, ehe sie fortfahren konnte.
»Ihn zu heiraten fällt mir im Leben nicht ein! Lieber gehe ich ins Kloster! Sagt mir doch bitte, Frau Mutter, dass Ihr Euch nur einen Spaß mit mir erlaubt habt!«, hatte das Mädchen gefleht.
Bei aller Empörung hatte Mathilde klugerweise darauf verzichtet, auf Gottfrieds körperliche Gebrechen und seine Hässlichkeit als Grund für ihre Ablehnung hinzuweisen. Frühzeitig hatten ihr die Kinderfrau, ihre Eltern und der Burggeistliche eingehämmert, dass den armen, aber im Übrigen recht aufgeweckten und tapferen Knaben keine Schuld an seinem unglücklichen Aussehen träfe, er im Gegenteil besonderer Liebe und Nachsicht bedürfe.
Zu Anfang, als ihre Mutter nach dem frühen Tod ihres Vaters eine zweite Ehe eingegangen war, hatte Mathilde auch tatsächlich Mitleid mit dem entstellten Jungen empfunden. Das dauerte so lange an, bis sie erkannte, über welch schlechten Charakter ihr Stiefbruder ihrer Meinung nach verfügte: boshaft war er, nachtragend, rachsüchtig, neidisch und heimtückisch.
Der Gräfin war der Auftritt ihrer Tochter vor allen Leuten, meist hohen Adligen aus zum Teil weit entfernten Landesteilen, mehr als unangenehm gewesen. Um die Angelegenheit nicht vollkommen eskalieren zu lassen, hatte sie begonnen, in begütigender Manier auf Mathilde einzureden.
»Mein liebes Kind«, hatte Beatrix begonnen und sich dabei sichtlich zu einem sanften Ton gezwungen, »du bist doch klug für dein Alter und weißt mittlerweile, wie wichtig dynastische Überlegungen sind! Deinem nunmehrigen Vater, Herzog Gottfried, ist natürlich daran gelegen, seine Familie, die auch meine und nicht zuletzt auch die deine ist, noch stärker und mächtiger zu machen.
Und dazu bedarf es nun einmal der Zusammenlegung all unserer Güter. Daraus ergibt sich wiederum, dass du, als mein einziges Kind – deine Brüder sind ja leider schon im frühen Kindesalter verstorben – sowie der einzige Sohn meines jetzigen Gemahls miteinander den heiligen Bund der Ehe eingehen müssen!«
Jedermann im Festsaal der Burg hatte erkennen können, wie sehr die Gräfin um Entschärfung des drohenden Konflikts bemüht war. Aber Mathilde hatte auch deutlich zu spüren vermocht, wie der Zorn in ihrem Stiefvater aufloderte. Widerspruch, zumal vor zahlreichen Zeugen, konnte er nur ganz schlecht ertragen – und von einem unmündigen und ungehorsamen Mädchen schon gar nicht.
Dessen war Mathilde sich durchaus bewusst gewesen; im Allgemeinen vermied sie darum Auseinandersetzungen mit ihm.
Aber hier war es, Machtzuwachs der Familie hin oder her, ausschließlich um sie und ihr zukünftiges Leben gegangen! Und sie war nicht gewillt, es mit diesem Scheusal von Stiefbruder zu teilen.
»Verehrter Herr Vater! Liebe Frau Mutter!«, hatte die Contessa vor den Gästen, die mäuschenstill und gespannt das ungewöhnliche Geplänkel verfolgten, mit aller Würde, die sie krampfhaft aufzubringen versuchte, die Diskussion darüber beendet: »Ehe ich Gottfried heirate, stürze ich mich lieber vom höchsten Turm einer unserer zahlreichen Burgen!«
Damit hatte sie sich von der Gräfin und vom Herzog mit einem tiefen Knicks höflich verabschiedet, hatte ihren Rock samt den Unterröcken gerafft, sich umgedreht und den zu ihren Ehren reich geschmückten Festsaal hocherhobenen Hauptes und auf flinken Sohlen verlassen.
Eine Peinlichkeit sondergleichen. Und höchst ungewöhnlich dazu. Hatte man jemals eine Tochter so mit ihren Eltern sprechen gehört? Wie konnte das junge Mädchen es wagen, gegen den erklärten Willen von Vater und Mutter zu opponieren? So mancher mochte sich im Stillen gedacht haben: Da haben sich der Herzog und die Gräfin ja etwas Schönes herangezogen. Jetzt bestimmten schon die jungen Frauen, halbe Kinder noch, wen sie zu heiraten geruhten! Wo gab es denn so etwas?
Einigen mochte die widerspenstige Tochter vielleicht sogar als wohlverdiente Strafe gelten: Immerhin hatten Gottfried der Bärtige – auch er verwitwet – und Beatrix nach dem Tode ihres Gemahls, Bonifaz von Canossa – in aller Heimlichkeit den Bund der Ehe geschlossen.
Aus gutem Grund: Wegen allzu naher Verwandtschaft war ihre Ehe nach kanonischem Recht eigentlich ungültig und auch erst nachträglich im Jahr 1056 von Kaiser Heinrich III. anerkannt worden.
Im Jahr darauf war Gottfrieds Bruder Friedrich als Papst Stephan IX. sogar zu höchsten kirchlichen Würden gelangt! Somit war Gottfried der Bärtige im Augenblick einer der mächtigsten Fürsten in Mittelitalien und nicht wenige gönnten ihm zumindest im privaten Umfeld einige Turbulenzen …
Dem Elternpaar gelang es jedoch, den sich anbahnenden Eklat mit diplomatischer Routine und gespielter Souveränität zu übergehen, indem der Herzog den pausierenden Musikanten ein Zeichen gab, zum Tanz aufzuspielen. Die Verlobungsfeier ging weiter – wenn auch ohne die kindliche Braut.
Trotzdem war die Stimmung ganz tief unten im Keller gewesen, bedachte der Diener Giovanni im Nachhinein. Er war damals gerade erst auf die Burg gekommen und wusste über die Animositäten zwischen dem ungleichen Geschwisterpaar noch nicht so gut Bescheid. Aber er konnte sich noch gut daran erinnern, welch mörderischen Blick der junge Herzog, Gottfried der Bucklige, drei Jahre älter als Mathilde, seiner Stiefschwester nachgeschickt hatte, obwohl er das Ganze anschließend mit einem verächtlichen Lachen abgetan und seelenruhig behauptet hatte: »Meine temperamentvolle Braut ist noch etwas scheu. Das sei ihrer Jugend geschuldet; gestern hat sie noch mit Puppen gespielt. Aber sie wird sich an mich gewöhnen und schon bald zutraulicher werden!«
†
Zwei Jahre waren seitdem vergangen; Contessa Mathilde war mittlerweile vierzehn und man fasste die Heirat nun ernsthaft ins Auge. Dessen war die junge Dame sich bewusst, nachdem der Diener Giovanni sie gebeten hatte, ihn zu ihrer Mutter zu begleiten, die ein »ernstes Wort« mit ihr zu sprechen wünsche …
Nur mit äußerstem Widerstreben war sie der »Einladung« gefolgt; als ahnte sie bereits, was das Thema des »eminent wichtigen Gesprächs« sein würde.
Ihr Stiefvater, in diesen unruhigen Zeiten im Reich meist mit kriegerischen Verwicklungen beschäftigt (erst als Gegner des Kaisers, später als sein Verbündeter), hatte es rundweg abgelehnt, noch einmal mit der »widerspenstigen Kreatur« über die längst beschlossene Heirat zu sprechen.
Für ihn gab es keinerlei Gesprächsbedarf und Gottfried der Bärtige überließ es seiner Gemahlin Beatrix, ihre unfolgsame Tochter zu zähmen und für die Ehe »bereit zu machen«. Üblicherweise, fand der Herzog, sei »Aufklärung über heikle Eheangelegenheiten« doch ohnehin reine Weibersache.
Mathildes Vorahnung hatte sie nicht getrogen. Aber dieses Mal ließ die Contessa sich nicht überrumpeln, heute war sie vorbereitet. Noch ehe ihre Mutter zum Kern der Sache kommen konnte, begann das junge Mädchen zu jammern und zu stöhnen. Sie krümmte sich zusammen, griff sich mit schmerzverzerrtem Blick an den Leib, als wüte ein Feuer darin.
»Frau Mutter, ich glaube, ein reißendes Tier hat sich in meinem Bauch verkrochen«, fing sie an, um gleich darauf auf einer Liege niederzusinken, so, als könnten ihre Beine sie nicht mehr tragen.
»Ach, meine Liebe! Keine Sorge!«, reagierte die Gräfin kühl. »Ich denke, du bekommst nur deine Tage! Bei Jungfrauen ist das oft recht schmerzhaft. Aber ich kann dich beruhigen. Als Ehefrau, die mit ihrem Gatten häufig die christlich gebotene eheliche Gemeinschaft pflegt, gibt sich das ganz von selbst! Die Krämpfe im Unterleib verschwinden dann in aller Regel; hauptsächlich nach der Geburt eines Kindes. Da spreche ich aus Erfahrung! Dann sind die monatlichen Malaisen so ziemlich verschwunden.
Das bringt mich just zu jenem Thema, weswegen ich dich habe kommen lassen!«
Ehe die Gräfin noch ein weiteres Wort über baldige Heirat, Eheleben, Kinderkriegen et cetera verlieren konnte, ließ Mathilde sich wie entseelt von der Polsterbank sinken und lag verkrümmt auf dem dicken Teppich, der den kalten Marmorboden in der mütterlichen Kemenate bedeckte.
Jetzt erschrak die Gräfin doch. Was war los mit ihrer Tochter? Litt sie womöglich an einer schweren Krankheit? Immer wieder kam es im Frühjahr, im Sommer und sogar noch im Herbst zu Seuchenausbrüchen durch gefährliche Stechmücken. Trotz Trockenlegungen versumpfter Feuchtgebiete in Norditalien fanden die Insekten stets aufs Neue Tümpel oder moorige Wasserlöcher, in denen sie ihre Eier ablegen und sich dank des warmen Klimas enorm vermehren konnten.
Leidtragende waren das Vieh sowie die Hirten und Bauern, aber genauso die Bewohner der Städte und sogar die Adelsherren auf ihren Burgen. In manchen Jahren hielt der Tod reiche Ernte unter den Seuchenopfern.
Besorgt rief die Gräfin nach ihrer Lieblingszofe und befahl ihr, umgehend nach dem Medikus zu schicken. Sie selbst wagte nicht, aus Sorge vor Ansteckung, ihre allem Anschein nach bewusstlose Tochter zu berühren. Der Diener Giovanni musste die junge Dame aufheben und in ihre Kemenate tragen, wo dann der herzogliche Leibarzt sich Mathildes annehmen sollte.
Contessa Mathilde – erst einmal erleichtert über den Aufschub aller Gespräche über verabscheute Hochzeitsvorbereitungen – hoffte sehnlichst, der Arzt möge auf ihren Schwindel mit der Ohnmacht hereinfallen.
›Und falls er so gewitzt ist und merkt, dass ich alles nur vorgespielt habe, möge er um Gottes willen so gut sein und mich weder bei meiner Mutter noch beim Herzog anschwärzen!‹ Selbst in Gedanken nannte sie Gottfried den Bärtigen nur »Herzog« und niemals »Vater« …
Mathilde ging so mancherlei durch den Kopf, während sie auf das Erscheinen des im Laufe der Jahre etwas träge gewordenen Medikus wartete. ›Wie wäre es denn wohl, falls mein wirklicher Vater noch leben würde?‹
Graf Bonifaz von Canossa, ein ausgesprochen harter, ja brutaler Herr seiner zahlreichen Untertanen und dementsprechend verhasst, war am 6. Mai 1052 – Mathilde war gerade einmal sechs Jahre alt gewesen – während einer Jagd in einem Auwald bei Cremona von einem vergifteten Pfeil getroffen worden.
Ob absichtlich oder versehentlich, konnte nie geklärt werden. Er war verstorben, ehe er noch Zeit gehabt hatte, seine vielen Sünden und Missetaten zu bereuen und zu sühnen, etwa durch die Stiftung eines Klosters oder den Bau einiger Kirchen.
Nach Bonifaz’ Tod war es zu schweren Unruhen unter den aufständischen, überwiegend städtischen Untertanen gekommen. Sie witterten Morgenluft, nachdem sie den Tyrannen losgeworden waren, und waren bestrebt, nicht erneut einem ähnlich harten Herrn wie dem glücklicherweise verstorbenen, Gehorsam schulden zu müssen. Sie erhofften sich, mit der jetzt schutzlosen Gräfin leichtes Spiel zu haben.
Die Witwe, Gräfin Beatrix, hatte sich nicht anders zu helfen gewusst, als sich und ihre kleine Tochter Mathilde unter den Schutz des mächtigen, gleichfalls verwitweten Herzogs Gottfried des Bärtigen zu begeben. Der Herzog war immerhin ein Bruder eines der höchsten Geistlichen der katholischen Kirche, des späteren Papstes Stephan IX. …
Eine in ihrer schwierigen Lage durchaus nachvollziehbare Entscheidung, denn Gottfried wurde des Aufstands im Herrschaftsgebiet seiner Gemahlin Beatrix umgehend Herr.
Schwieriger erwies sich indessen seine politische Ausrichtung. Gottfried III., der Bärtige, war als naher Verwandter des Papstes ein Gegner Kaiser Heinrichs III., wohingegen das Haus Canossa bisher stets kaisertreu gewesen war.
Es kam sogar zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Zum Glück dauerten die Scharmützel nur kurze Zeit an. Die kaiserfreundliche Tradition des Hauses Canossa erwies sich der Gegnerschaft Herzog Gottfrieds überlegen und bald darauf erfolgte sogar eine Versöhnung mit Heinrich III., der daraufhin auch des Herzogs Ehe mit Gräfin Beatrix anerkannte.
Somit bildeten Oberlothringen, später auch Niederlothringen, das Kaiser Heinrich III. zeitweilig Gottfrieds schwachsinnigem Bruder Gozelo übertragen hatte, sowie Canossa einen riesengroßen und einflussreichen Herrschaftsbereich.
Es kam immer wieder zu Zwietracht im römisch-deutschen Reich; auch die Kirche sorgte für genügend Unruhe, denn ihre Vertreter machten nicht selten ihrem hohen Amt keinerlei Ehre und es formierten sich allmählich ernsthafte Widerstände gegen das schamlose Treiben mancher Kirchenfürsten.
Vor allem einer sorgte für Aufsehen, ein gewisser »Mönch Hildebrand«, geboren etwa 1030 in Sovana, Tuszien, der sich quasi zu einem der Wortführer der Kirchenreform machte, die von einem Kloster im französischen Cluny ausging. Wobei Hildebrand auch nicht davor zurückschreckte, gewisse Rechte des Kaisers infrage zu stellen.
Dennoch gelang es Heinrich III. noch einigermaßen, die Zügel in der Hand zu behalten.
†
›Welchen Gemahl hätte mir mein leiblicher Vater Bonifaz wohl ausgesucht?‹
Diese Überlegung stellte Mathilde nicht zum ersten Mal an. ›Gemocht hat er mich ja nicht besonders! War doch nach einer Reihe von jung verstorbenen Söhnen, die er lieber behalten hätte, nur ich – eine Tochter – sein einziger Nachkomme. Er ist darüber ziemlich enttäuscht gewesen und hat das mich und meine Mutter deutlich spüren lassen. Meistens jedoch hat er mich gar nicht beachtet!‹
Mathilde stimmten solche Gedanken immer ziemlich traurig. Aber trotz seiner Missachtung, die sie als kleines Mädchen sehr oft gespürt und bis heute nicht vergessen hatte, war Mathilde sich dessen gewiss, dass er ihr mit Sicherheit keinen Krüppel mit schlechtem Charakter zum Gemahl aufgezwungen hätte. Dass Gottfried IV. klug und mutig sein sollte, ließ ihn in ihren Augen keineswegs sympathischer erscheinen.
›Das hätte mein richtiger Vater schon aus Angst unterlassen, dadurch womöglich missgebildete Enkel zu bekommen‹, folgerte die Contessa illusionslos. ›Doch auf einen aufrechten Charakter und ein friedvolles Wesen meines zukünftigen Gatten hätte er vermutlich auch nicht groß geachtet!‹
Sie hörte den Medikus den Flur zu ihrem Gemach, einem Raum ganz am Ende dieses Stockwerks, entlangeilen. Sie erkannte ihn an seinem schweren Schritt. Im Laufe der Jahre hatte der Arzt reichlich Speck angesetzt. Als er schnaufend ins Zimmer trat, fand er im Dämmerlicht, bei nahezu geschlossenen Klappläden, das junge Mädchen vor, scheinbar entkräftet, mit geschlossenen Augen und sich auf dem Bett krümmend.
1. Teil
Herbst 1069 – Hochzeit in Oberlothringen, kein Tag des Glücks und der Freude für die Braut Mathilde – Mathildes Stiefvater erlebt diesen Tag, den er selbst herbeigeführt hat, nicht mehr; sein Nachfolger, Herzog Gottfried der Bucklige, hat die lange Verlobungszeit beendet – eine Hochzeitsnacht, die keine ist …
Mit Grauen und Abscheu hatte Mathilde diesem ganz bestimmten Tag entgegengesehen: dem schrecklichen Tag ihrer Vermählung mit Gottfried IV., dem Buckligen.
Jegliches Widerstreben, alle Ausreden, sämtliche Finten hatten der unglücklichen Braut wider Willen letzten Endes nicht geholfen. Selbst ein Hungerstreik hatte den Stiefvater nicht umstimmen können, genauso wenig, wie ihre Drohung, als Nonne in ein Kloster zu gehen.
Auch der Leibarzt hatte sich seinerzeit nicht als hilfreich in Mathildes Sinn erwiesen, obwohl er wenigstens dichtgehalten hatte, als sie vorgegeben hatte, schwer krank zu sein.
Auch sämtliche Versuche Mathildes, sich ihre Mutter Beatrix als Verbündete zu sichern, waren kläglich gescheitert.
»Mein liebes Kind! Nach Gottes Willen ist es deine Pflicht, deinem Vater und Vormund zu gehorchen! Ich als Ehefrau des Herzogs habe keinerlei Einfluss in dieser Angelegenheit. Auch ich unterliege dem Willen meines Gemahls und kann mich nicht dagegen auflehnen.
Solches gebührt uns Weibern nicht, sagt die Kirche. Also, meine Liebe: Füge dich in Gottes Namen und nimm endlich Vernunft an. Es wird dir, mir, ja, uns allen zu Ruhm und Ehre gereichen!«
Mathildes Protest war daraufhin nur noch ganz schwach gewesen und die Gräfin hatte ihn auch umgehend beiseite gewischt mit den Worten: »Ich verstehe deine Sorge nicht! Du tust gerade so, als handele es sich bei deinem Bräutigam Gottfried um ein Ungeheuer! Er hat mir und seinem Vater einst in die Hand versprochen, dich gut zu behandeln – obwohl du so widerspenstig bist und dich zu keiner Zeit eures Verlöbnisses als liebevolle Braut gezeigt hast!
Ich habe beinah die Befürchtung, Tochter, dass du dich in dieser Ehe als das Monstrum erweisen könntest.
Ich ersuche dich also dringend, in dich zu gehen und dich um Demut zu bemühen. Kein Mensch verlangt von dir, deinen Mann zu lieben. Aber gehorchen – und zwar in allem – musst du ihm.
Rede mit deinem Beichtvater, mein Kind! Ich bin sicher, er wird dir das Gleiche sagen wie ich!«
»Die unglückliche Contessa hat keine Wahl; sie muss endlich in den sauren Apfel beißen und ihrem ungeliebten Stiefbruder das Ja-Wort geben«, flüsterten sich die Domestiken zu und musterten die schöne junge Frau insgeheim mit mitleidigen Blicken.
»Ja, nicht einmal der Hinweis, die Kirche dulde Eheschließungen unter so nahen Verwandten nicht, hat ihr nichts gebracht«, wusste eine Dienerin der Brautmutter hinter vorgehaltener Hand zu berichten. »Ihr Stiefvater, Herzog Gottfried III., konnte schließlich jedermann den Dispens des Heiligen Vaters vorweisen, der in diesem Fall natürlich eine Ausnahme gemacht hat. Es handelt sich schließlich um die einflussreiche Familie von Canossa, der man den Zusammenschluss mit den nicht minder mächtigen Lothringern aus nachvollziehbaren Gründen nicht hat verweigern wollen!«
»Bei Gottfried dem Bärtigen und seiner Heirat mit Beatrix hat es sich ja genauso verhalten!«, wussten die meisten noch. Die beiden waren immerhin Cousin und Cousine ersten Grades gewesen …
Ein schlechter Witz der Geschichte war indes, dass ausgerechnet Mathildes Stiefvater, der ja »das ganze Elend« eingefädelt hatte, von der Hochzeit gar nichts mehr mitbekommen würde: Vor etwa einem Jahr war Herzog Gottfried III. gestorben.
Jetzt war das Trauerjahr vorüber und sein Erbe, Herzog Gottfried IV. der Bucklige, hatte das Datum der Heirat mit seiner Stiefschwester unwiderruflich festgelegt.
Hergerichtet und geschmückt als wunderschöne Braut stand die unglückliche junge Frau an diesem sonnigen Herbsttag 1069 in ihrem Gemach, wo ihre Zofen unter der Leitung ihrer seit Jahren vertrauten Leibmagd Susanna letzte Hand an sie legten, an ihr seidenes Gewand, ihre Frisur und den Kranz auf ihrem dichten aschblonden Haar, das noch offen auf ihre Schultern und über ihren Rücken floss.
»Nicht mehr lange, Herrin, und diese wunderschönen Haare werden unter der Frauenhaube versteckt sein«, meinte Susanna mit bedauerndem Unterton in der Stimme, während sie den traditionellen Myrtenkranz auf dem Kopf ihrer Herrin befestigte.
»Nicht nur meine Haare werden verschwinden, meine Gute«, erwiderte Mathilde gramvoll. »Auch mein Lachen und meine spontane Fröhlichkeit werden künftig der Vergangenheit angehören. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Ehe mit meinem Stiefbruder viel zu lachen haben werde!«
Die Dienerinnen, erschrocken über die offenen Worte der jungen Herrin, taten so, als hätten sie sie überhört. Nur Susanna wagte es, einen Kommentar dazu abzugeben.
»Ich wünsche Euch so sehr, Contessa, dass Ihr nicht zu viel zu leiden haben werdet unter der Gewalt Eures Gemahls! Vielleicht lässt sich doch noch alles besser an, als von Euch befürchtet!«
»Dein Wunsch in Gottes Ohr, meine Liebe«, entgegnete Mathilde trocken. »Aber, glaub mir, zu großer Hoffnung besteht kein Anlass. Mein Gemahl weiß, was ich von ihm und dieser abscheulichen Ehe mit ihm halte. Ich habe es ihm seit Jahren nicht verschwiegen und ihn immer wieder gebeten, seinen Vater von sich aus umzustimmen und ihn zu veranlassen, eine andere Gemahlin für ihn zu suchen.«
Dann ging das Temperament mit der jungen Frau durch und wütend rief sie aus: »Aber Gottfried der Bucklige hat sich boshaft geweigert; es gefiel ihm, dass ich litt unter diesem Verlöbnis, als sei es das Schwert des Damokles, das über meinem Haupt an einem seidenen Faden baumelt.
Oh, nein, Susanna! Mein Gemahl wird es geradezu genießen, mich zu quälen und zu erniedrigen sowie mich für meine deutlich gezeigte Abneigung gegen ihn büßen zu lassen!«
Die langjährige Dienerin hielt es für besser, jetzt den Mund zu halten. Alle Wände in der Burg hatten bekanntlich Ohren …
Mathilde sollte das kostbare Brautdiadem ihrer Mutter Beatrix tragen, das in Form eines Myrtenkranzes gestaltet und mit zahlreichen wertvollen Edelsteinen besetzt war. Die Gräfin hatte es ihrer Tochter am Morgen des Hochzeitstages überreicht mit den mahnenden Worten: »Erweise dich der wertvollen Gabe würdig, mein Kind! Mögest du sie tragen im Zustande der Jungfräulichkeit – wie ich hoffe – und ihr auch als Ehefrau keine Schande bereiten! Auf dass du sie einst unbefleckt weitergeben kannst an deine eigene Tochter, die Gott euch beiden, neben vielen gesunden Söhnen, schenken möge!«
»Ich weiß das wundervolle Geschenk zu würdigen, Frau Mutter, und sage Euch Dank«, hatte Mathilde artig entgegnet. Die Gräfin hingegen hatte die Contessa mit eindringlichem Blick gemustert. Was die körperliche Unberührtheit ihrer eigenwilligen, aufsässigen und eheunwilligen Tochter anbelangte, war sich die Gräfin nämlich keineswegs sicher gewesen …
Mathilde als Braut war bereits ein spätes Mädchen, eine »alte Jungfer« im landläufigen Sinne. Was in diesem Fall bedeutete, dass sie es schlau verstanden hatte, die verhasste Hochzeit ewig lange hinauszuzögern. Einerseits eine wahre Meisterleistung, aber andererseits auch ein Beinaheskandal.
Viele hohe Herren, an deren Meinung Herzog Gottfried III. etwas gelegen war, hatten sich darüber bereits mokiert. Selbst der Heilige Vater hatte schon spöttisch angefragt, ob es im Hause Lothringen und Canossa neuerdings üblich sei, dass Töchter bestimmten, wann und wen sie zu ehelichen geruhten.
Mathilde schenkte der immer noch schönen, älteren Frau, zu der sie immerhin ein besseres Verhältnis als zu ihrem Stiefvater bei dessen Lebzeiten unterhielt, ein aufgesetzt naives Lächeln. Sie wollte der Gräfin damit zu verstehen geben, dass sie durchaus Verständnis für die Skepsis, was die Jungfräulichkeit ihrer ungebärdigen Tochter anbelangte, aufbrachte …
Aber beantworten würde sie ihre stumme Frage auf gar keinen Fall. Das war eine Sache, die sie allerhöchstens mit ihrem Beichtvater besprach, einem Priestermönch in mittleren Jahren aus Cremona, mit Namen Bernardo.
Bei allem Widerwillen, den ihr bereits der bloße Anblick ihres künftigen Gatten einflößte, war sie doch einsichtig genug, dankbar die Tatsache zu begrüßen, dass es ihr zumindest vergönnt gewesen war, die verhasste Hochzeit so lange hinauszuzögern, bis sie beinahe schon ihren vierundzwanzigsten Geburtstag feiern konnte.
»Meine Beharrlichkeit – mögen andere ruhig Sturheit dazu sagen – hat es zuwege gebracht, dass ich die mögliche Dauer dieser grässlichen Ehe immerhin um fast ein Jahrzehnt verringert habe«, hatte sie heute Morgen noch Pater Bernardo anvertraut. Und zwar anlässlich ihrer Beichte vor dem Empfang des Sakraments der Ehe, trotz ihres tapferen Lächelns mit Tränen in den großen blaugrauen Augen.
Seine Antwort darauf würde Mathilde auch niemals vergessen: »Gottes Wege sind unerforschlich, meine Tochter! Wer weiß zu sagen, welche Stolpersteine auf dem Lebenspfad Eures Gatten liegen werden und wann der Herr Euren Gemahl zu sich rufen wird?«
†
Auf den baldigen Tod ihres Gemahls zu hoffen, verbot Mathildes starker Glaube und ihr unbedingtes Festhalten an den Geboten der Kirche, welche den Weibern Gehorsam und Treue gegenüber ihren Eheherren zur christlichen Pflicht erklärten – gleichgültig, wie diese sich gegen ihre Angetrauten benehmen mochten.
Mathilde kannte etliche adlige Damen, die von ihren Ehemännern regelmäßig verprügelt wurden und dennoch bei diesen rohen Kerlen ausharrten – weil ihnen gar nichts anderes übrig blieb.
Außerdem plagten die Braut wider Willen im Augenblick ganz andere Sorgen: diese fürchterliche Hochzeitsnacht einigermaßen unbeschadet an Leib und Seele zu überstehen, war ihr einziges Bestreben.
Sie hoffte, bereits in dieser Nacht schwanger zu werden, um sich dann baldmöglichst ihren aufgezwungenen Gatten buchstäblich vom Leib halten zu können. Ihren Zweck hätte sie dann erst einmal erfüllt; zumindest bis sich herausstellte, dass sie Mutter eines gesunden Kindes geworden war. ›Hoffentlich wird es ein Knabe werden!‹
Mathilde erging sich bereits in Zukunftsfantasien, um die traurige Gegenwart leichter ertragen zu können. ›Mein einziges Glück besteht darin, dass ich keinen anderen Mann liebe. Sonst müsste ich mich wohl tatsächlich aus dem Fenster stürzen‹, überlegte sie nüchtern.
Wie im Traum rauschte die Zeremonie der Eheschließung, die kein Geringerer als der Erzbischof von Florenz vollzog, an ihr vorüber. Auch die anschließenden Feierlichkeiten absolvierte sie wie eine Traumwandlerin, erwiderte die zahlreichen Glückwünsche mit freundlichen, wohlgesetzten Phrasen und erwartete mit Ungeduld und Angst zugleich das Ende dieser makabren Inszenierung.
Nach außen hin ruhig, innerlich vor Angst bebend, stand sie jetzt vor dem breiten, einladend aufgeschlagenen Bett, das beide, nachdem die sogenannten »Ehezeugen« das Schlafzimmer verlassen hatten, um sich auszukleiden und die über einem Sofa parat liegenden Nachthemden anzulegen.
Es war nämlich allgemeiner Brauch, dass die Neuvermählten, noch angekleidet, sich nebeneinander ins Bett legten und somit vor den Augenzeugen ihren Willen bekundeten, diese Ehe auch zu vollziehen. Nachdem sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, erhob sich das Paar wieder, um sich für die Nacht herzurichten.
Das Schlafgemach war in sanftes Kerzenlicht getaucht, aber Mathilde wagte es nicht, ihren Blick vom Boden zu erheben, aus lauter Widerstreben, ihren Gatten ansehen zu müssen, der bereits begann, sich seiner seidenen, mit Gold durchwirkten Gewänder zu entledigen. Achtlos ließ er sie zu Boden fallen. Sobald er das Unterhemd abgelegt hätte, könnte sie seinen monströsen Höcker sehen und davor ekelte sie sich. Aber um vieles schlimmer noch würde es werden, sobald auch seine Beinkleider fielen …
Krampfhaft presste Mathilde die Augen zusammen. Sie machte keinerlei Anstalten, ihrerseits die Kleidung abzulegen.
›Hoffentlich besitzt er wenigstens so viel Anstand und bläst die Kerzen aus‹, schoss es der unglücklichen jungen Frau durch den Kopf. ›Im Dunkeln brauche ich ihn dann wenigstens nicht zu sehen. Es wird schon schlimm genug sein, ihn zu spüren.‹
Mathildes Lieblingszofe Susanna stand wie selbstverständlich abwartend neben dem Bett bereit.
Um ihre junge Herrin aus ihrer Erstarrung zu reißen, begann sie schließlich: »Erlaubt, Frau Gräfin, dass ich Euch behilflich bin, die Prunkgewänder der Hochzeit abzulegen sowie Euer Haar von dem kostbaren Kranz zu befreien und auch den übrigen Schmuck zu verwahren!«
Die Dienerin machte Anstalten, Hand an ihre Herrin zu legen, aber mit einer unwirschen Geste untersagte ihr das Gottfried der Bucklige in barschem Ton. »Du kannst gehen! Wir bedürfen deiner Dienste nicht. Ich selbst werde mich um die Garderobe meiner Gemahlin kümmern!«
Er lachte meckernd. Kaum war die erschrockene Susanna aus dem Zimmer verschwunden, riss er Mathilde als Erstes den Myrtenkranz vom Kopf. Als Nächstes zerrte er rücksichtslos an ihrem Festgewand, ohne sich um die geringste Sorgfalt zu bemühen.
Mathilde hörte, wie der kostbare cremefarbige Seidenstoff riss und sie spürte – bei immer noch geschlossenen Augen – mit welcher Grobheit er ihr die wunderschöne doppelreihig geschlungene Perlenkette vom Hals entfernte, sodass nicht nur der Verschluss, sondern auch die Schnur entzweiging und die einzelnen Perlen klackernd auf dem Fußboden herumsprangen. Reflexartig riss sie daraufhin die Augen auf.
Bereits im nächsten Augenblick stand sie vollkommen nackt vor ihm, denn ihr Ehemann hatte ihr mit einem einzigen Ruck auch das Untergewand heruntergerissen. Instinktiv hob Mathilde die Arme, um mit den Händen ihre Brüste zu bedecken; aber Gottfried hinderte sie daran und presste dabei ihre Finger schmerzhaft zusammen.
»Wieso willst du dich bedecken, Frau?«, fragte er grinsend. »Du gehörst schließlich mir und als dein Gemahl habe ich wohl das Recht, dich genau betrachten zu dürfen! Jeder, der ein Pferd kauft, wird es vor dem endgültigen Zuschlag genau untersuchen. Aber von uns armen Männern verlangt die Kirche, dass wir bei einer Heirat die Katze im Sack kaufen. Es könnte ja gut sein, dass du einen beträchtlichen körperlichen Makel hast, den du bisher sorgfältig verborgen hast. Meine Missbildung kennst du ja schon. Also lass dich gefälligst von mir anschauen!«
Zum ersten Mal hatte Gottfried sein verkrümmtes Rückgrat und den gewaltigen Höcker erwähnt, der ihm wie ein gefüllter Sack auf der linken Schulter lag. Mathilde war darüber ziemlich verblüfft – in gewisser Weise hatte er ihr damit den Wind aus den Segeln genommen.
›Völlig unnötig‹, dachte Mathilde, während Gottfried sie von oben bis unten ungeniert taxierte. ›Ich wäre nie so wenig feinfühlig gewesen, ihn auf diesen Makel hin anzusprechen, denn dafür kann er wirklich nichts. Ganz im Gegensatz zu seinem ekligen Benehmen mir gegenüber!‹
»Ganz ordentlich!«, hörte sie ihn fast gleichgültig sagen. »Das Nachtgewand lass liegen, wo es ist. Mach jetzt, dass du endlich ins Bett kommst, Weib!«
Damit erhielt sie einen Schubs von ihrem Gatten und fand sich rücklings auf der Matratze des Bettes liegend vor. Unwillkürlich biss Mathilde die Zähne zusammen. Jetzt war es offenbar so weit und sie müsste sich in das Unvermeidliche fügen … Erneut schloss sie ergeben die Augen. Sie hatte sich vorgenommen, alles klaglos über sich ergehen zu lassen.
Sie hörte Gottfried im Gemach herumtappen und nach einer kleinen Weile öffnete sie die Augen einen Spalt weit. Was tat er so lange? Sie hatte schon damit gerechnet, er werde sich wie ein Tiger auf sie stürzen.
›Ach! Mich hat er nackt ausgezogen, aber er hat sich das Nachthemd angezogen‹, stellte sie mit Verblüffung fest.
Eigenartig!
Aber diese Nacht hielt für Mathilde noch mehr an Überraschungen bereit. Als Nächstes beobachtete sie, wie ihr Mann die brennenden Kerzen an dem auf einem Tischchen stehenden Leuchter auspustete; worüber sie ein ungeheures Gefühl der Erleichterung empfand. Sollte Gottfried doch ein gewisses Gespür für ihre jungfräuliche Schamhaftigkeit empfinden? Oder wollte er ihr einfach seinen hässlichen Anblick ersparen?
Einerlei! Mathilde war unwillkürlich versucht, ihm für das bisschen Rücksichtnahme zu danken, unterließ es dann aber. In der Dunkelheit nahm sie jetzt wahr, dass ihr Ehemann sich ebenfalls zu Bett begab; allerdings hörte sie seine hinkenden Schritte, die sich zur gegenüberliegenden Seite des riesigen Bettes bewegten. Demnach ließ er sich auf der anderen Matratzenhälfte nieder. Was hatte das wieder zu bedeuten?
Gleich sollte Mathilde es erfahren.
»Schlaf gut, Frau!«, hörte sie ihn sagen. »Es ist schon sehr spät und ich bin hundemüde. Außerdem habe ich mehr Wein getrunken als üblich und muss mich unbedingt ausschlafen!«
Die junge Ehefrau war so verblüfft, dass sie anfangs kein Wort herausbrachte. Ihr erster Gedanke war: ›Ich bin noch einmal davongekommen!‹
Auf ihr zaghaftes: »Ich wünsche Euch ebenfalls eine gesegnete Nacht, mein Herr!« (niemals würde es ihr einfallen, ihn zu duzen), erhielt sie nur ein leises Schnarchen als Antwort.
Sie erhielt somit allenfalls einen kleinen Aufschub. Aber den würde sie auch nutzen, um dem Unvermeidlichen am nächsten Morgen, zwar mit Widerwillen, aber zumindest mit wachen Sinnen, zu begegnen: Sie würde gleichfalls die wenigen restlichen Stunden dieser Nacht einem vernünftigen Zweck zuführen, indem sie versuchte, ein wenig Schlaf zu finden. Ihr Hochzeitstag war in der Tat ein höchst anstrengender Tag gewesen.
Ehe sie endgültig in den Schlummer hinüberglitt, galt ihr letzter Gedanke ihrer vermutlich recht düsteren Zukunft als Ehefrau des Herzogs: ohne jede Zuneigung, ohne die geringste Wertschätzung, ohne einen Funken Respekt – von auch nur einem Hauch von Liebe erst gar nicht zu reden.
Mathildes Hochzeitsnacht, bereitet ihr, wie erwartet, kein Vergnügen – als Gottfried der Bucklige sie verlässt, empfindet sie Erleichterung – sie hofft, bereits ein Kind empfangen zu haben – die Hoffnung erfüllt sich nicht – sie ist erleichtert, so oft ihr Gemahl, der als tapferer Krieger gilt, sie verlassen muss – Gottfried IV., seit Kindertagen ein Freund König Heinrich IV., weigert sich, den letzten Wunsch seines Vaters zu erfüllen – Mathildes Abscheu vor ihrem Gemahl wächst noch an …
Als Mathilde erwachte, war es im Schlafgemach nach wie vor stockdunkel. Sie wusste erst nicht, ob es noch Nacht war. Aber dann konnte sie zwischen den Lamellen der Klappläden vor dem Fenster hellere Lichtstreifen erkennen; das musste bereits der heraufdämmernde Morgen sein.
Geweckt hatte sie, die auf der Seite lag, der feste Griff zweier muskulöser Arme, die sie von hinten besitzergreifend umschlangen. Sie spürte, wie sich ein nackter, männlich behaarter Körper an sie drängte und an der Erektion, die sich in ihren Rücken bohrte, wurde ihr, trotz Schlaftrunkenheit, bewusst, dass ihr Gemahl sich jetzt offenbar anschickte, seine ehelichen Rechte von ihr einzufordern.
Gottergeben wollte Mathilde sich zu ihrem Mann umdrehen, aber der hielt sie eisern fest, zwang sie zu einer weiteren Vierteldrehung, sodass sie auf dem Bauch zu liegen kam. Was hatte Gottfried denn jetzt mit ihr vor? Er zwang ihre Beine auseinander, legte sich auf ihren Rücken und bestieg sie von hinten!
Da ihr Kopf in das dicke Federkissen gedrückt war, vermochte sie nicht einmal laut zu protestieren, ja, nicht einmal ordentlich Luft zu holen.
Was sie von ihrer Mutter (wenig genug und mit tausend Umschreibungen) sowie von Dienerinnen, die sie einfach ganz offen befragt hatte, an »Aufklärung« erhalten hatte, war von dieser Stellung als »einer erlaubten, von Gott vorgesehenen«, jedenfalls nicht die Rede gewesen.
Im Gegenteil! So verkehrten nur Tiere, hatte man ihr beigebracht und es wäre eine Schande und eine schwere Sünde dazu, a tergo die Ehe zu vollziehen. Andererseits wollte ihr Gemahl das so – und ihr blieb nichts anderes übrig, als stillzuhalten, denn wehren konnte sie sich gegen Gottfried den Buckligen sowieso nicht. Obwohl eher klein von Wuchs, war der Herzog unheimlich kräftig.
Ihr Gemahl sprach kein Wort, mühte sich aber redlich ab und Mathilde verspürte nicht nur Ekel, Abscheu und heftigen Widerwillen, sondern auch ziemlich starke Schmerzen. Mithilfe der Finger einer Hand gelang es ihm schließlich, in seine junge Frau einzudringen, sie zu entjungfern und endlich auch seinen Samen in sie zu ergießen.
Nach wie vor hatte sie große Schwierigkeiten, zu atmen. Er hielt sie jedoch weiter gleichsam mit harter Hand gefangen. Nach einer kurzen Verschnaufpause wiederholte Gottfried IV. den Akt auf die gleiche Weise.
Wie eine Ewigkeit war Mathilde die vergangene Zeit erschienen, bis er sich endlich aus ihr zurückzog, sie von seinem Gewicht befreite, ihr erlaubte, sich auf den Rücken zu drehen und wieder zu Atem zu kommen.
»Ich dachte schon, Ihr wolltet mich gleich am ersten Tag unserer Ehe in den Kissen ersticken«, beschwerte sie sich, erhielt jedoch keine Antwort.
Während sie versuchte, sich zu erholen, wozu auch gehörte, die Schenkel zusammenzupressen, zwischen denen das Blut herauslief – das Laken, das nach altem Brauch der Öffentlichkeit präsentiert werden musste, würde ihre »Ehre« als virgo intacta, als intakte Jungfrau beweisen – und damit beschäftigt war, das soeben Erlebte zu verarbeiten, war ihr Gatte aufgestanden und hatte die Läden vor dem Fenster aufgestoßen, um das bereits helle Morgenlicht ins Gemach scheinen zu lassen.
Sein Nachtgewand hatte er erneut angelegt …
Er war an ihre Bettseite gehinkt und instinktiv hatte Mathilde ihre Bettdecke bis zum Kinn heraufgezogen. Er wollte doch nicht etwa erneut …?
Gottfried beugte sich über sie, sah sie lange prüfend an, dann lächelte er plötzlich. Und zwar auf eine Art, wie Mathilde ihn noch nie hatte lächeln gesehen – zumindest nicht, wenn er an sie das Wort gerichtet hatte. Da war sein Mund meist spöttisch oder gar höhnisch verzogen gewesen.
»Ich danke dir, Frau!«, hörte sie ihn zu ihrer grenzenlosen Verwunderung sagen. »Leider muss ich dich heute schon ganz früh morgens verlassen. Ein kleineres Scharmützel, an dem teilzunehmen ich einem Freund fest zugesagt habe, wartet auf mich. Bleib ruhig noch liegen und schlaf dich richtig aus, Carissima!«
Ehe die überraschte Mathilde noch Worte der Erwiderung hatte finden können, hatte ihr Ehemann das Gemach verlassen, um im Nebenraum seine Kleider anzulegen. Wie gewohnt, rief er dazu keinen seiner Diener zu Hilfe.
Er wollte nicht, dass ihm jemand zu nahe kam. Schon seit frühester Jugend hatte er gelernt, sich sogar die Rüstung samt Helm selbst anzulegen. Nur um den Sitz der Beinschienen zu kontrollieren und für das Schnüren der Reitstiefel bedurfte er der kundigen Hände seines Leibdieners.
Das erste Gefühl, das Mathilde in sich aufsteigen fühlte, war grenzenlose Erleichterung gewesen. Sie würde ihn bestimmt nicht vermissen; das Erlebnis ihrer Hochzeitsnacht bedurfte, falls es nach ihr ginge, jedenfalls keiner Wiederholung.
Wichtig war vorerst nur eines: Sie konnte ihrer Familie und auch sonst aller Welt beweisen, dass die Ehe vollzogen worden und dass sie noch Jungfrau gewesen war.
Sie hatte sich zudem geschworen, niemandem etwas darüber zu berichten, auf welche Weise Gottfried der Bucklige sie zu seiner Frau gemacht hatte. Außer, ihr Beichtvater, Pater Bernardo, würde sie danach fragen. Ihr Respekt vor Männern der Kirche war immens und niemals würde sie den Pater belügen.
»Lieber Gott«, hatte sie an diesem denkwürdigen Morgen danach inbrünstig gebetet, »ich habe nur diesen einen Wunsch: Lass' geschehen sein, dass ich bereits empfangen habe!«
Gleich darauf war sie tatsächlich noch einmal in den Schlaf geglitten; was ihr gutgetan hatte für Körper und Seele.
†
Ihr spätes Erwachen wurde durch das Eintreten ihrer Leibmagd Susanna verursacht, einer jungen, nur wenige Jahre als sie älteren umgänglichen Frau, überzählige Tochter einer verarmten, aber mit vielen Kindern gesegneten Familie aus dem niedrigsten Adelsstand.
»Nachdem Euer Gemahl vor zwei Stunden, wohlgerüstet und gestärkt durch ein üppiges Frühmahl, mit all seinen Rittern und Knappen die Burg verlassen hat, wollte ich nach Euch sehen, Madonna Mathilde!«
Die kluge Zofe verlor kein Wort über die Art und Weise, mit der man sie am vergangenen späten Abend des Schlafgemachs verwiesen hatte …
»Vielleicht braucht Ihr irgendetwas, Herrin? Ich habe Euch einen Becher warmen gewürzten Wein mitgebracht, zur Stärkung!«
Widerwillig öffnete Mathilde die Augen und gähnte herzhaft.
»Außer noch ein wenig Schlaf fällt mir im Augenblick nichts ein, was ich brauchen könnte, Susanna.«
Ihr Blick fiel dabei auf das silberne Trinkgefäß, das Susanna in beiden Händen vor ihrer Brust festhielt und aus dem die würzigen Düfte verschiedener Kräuter aufstiegen, die man gemeinhin Leuten verabreichte, die eine schwere körperliche Anstrengung hinter sich hatten. Ein Anblick, der die junge Ehefrau zum Schmunzeln brachte.
»Du bist ja eine ganz Schlaue«, lobte sie ihre treue Dienerin. »Du hast dir schon ganz richtig zusammengereimt, dass diese Nacht eine ganz spezielle für mich sein würde! Ich danke dir für deine Fürsorge. Komm nur her mit dem Becher, meine Liebe!«
Mathilde setzte sich im Bett auf und Susanna stellte erst den Weinbecher auf einem Tischchen ab, um ihrer Herrin behilflich zu sein, indem sie ihr als Stütze mehrere Kissen in den Rücken stopfte, ehe sie ihr den belebenden Trank reichte.
Aus ihren Augen sprach nur allzu deutlich die blanke Neugier. Aber zu fragen würde sie niemals wagen; dazu war sie bei aller Vertrautheit mit Mathilde viel zu diskret.
»Ich weiß schon, was dir im Kopf herumspukt, meine gute Susanna«, sagte Mathilde geradeheraus. »Also, sieh nur her!«
Die Contessa rückte im Bett ein Stück zur Seite, lupfte die wattierte Seidendecke und ließ ihre Leibmagd die Blutflecken sehen, die sich auf dem linnenen Laken ausgebreitet und bereits eine bräunliche Farbe angenommen hatten.
»Gütiger Jesus!«, rief die Dienerin aus. »Ihr Ärmste! Was für ein Schlachtfest hat Euer Gemahl mit Euch veranstaltet!« Dann schlug sie sich verlegen die Hand vor den Mund. Es ziemte sich keineswegs für eine Person ihres Standes, derlei abfällig klingende Kommentare abzugeben. »Verzeiht, Herrin! Ich meinte nur …«
Aber Mathilde winkte ab. »Wie du siehst, Susanna, habe ich die Nacht überlebt! Und was meinen Gemahl anbetrifft, bleibt mir seine Gegenwart eine ganze Weile erspart. Ich hoffe, dass er längere Zeit in Anspruch genommen sein wird, um einem seiner vielen Freunde einen Gefallen zu erweisen!«
Anschließend schlürfte sie mit Behagen den warmen, von ihrer umsichtigen Magd kredenzten Gewürzwein.
Nachdem sie sich vom Lager erhoben hatte und mit kleinen vorsichtigen Schritten – die Schmerzen in ihrem Unterleib waren immer noch beträchtlich – ins geheime Gemach davongeschlurft war, entfernte Susanna das blutige Laken, das von etlichen Knechten außen vor den Turmfenstern der Burg aufgespannt werden sollte, gleichsam als weithin sichtbares »Banner der jungfräulichen Tugend« ihrer jungen Herrin.
»Was für ein barbarischer und unappetitlicher Brauch!«, kommentierte Susanna die alte Sitte mit angeekelter Miene.
†
Mathildes Hoffnung, Gottfried den Buckligen nicht so bald wieder ertragen zu müssen, war berechtigt. Seiner körperlichen Missgestalt zum Trotz war nunmehr, nach dem Tod seines Vaters, Gottfried des Bärtigen, zu Anfang des Jahres 1069, der jetzige Herzog von Oberlothringen ein bedeutender Kämpfer, der großes Ansehen wegen seines Mutes und seiner Tapferkeit genoss.
Sein Kampfeswille und seine Streitlust waren berüchtigt und nicht zuletzt wegen seines strategischen Talents hatte er viele Anhänger, die sich gerne seiner tätigen Mithilfe bei bewaffneten Streitigkeiten versicherten. Außerdem eilte ihm der Ruf voraus, keinem Zwist aus dem Weg zu gehen, sobald es sich darum handelte, »der Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen«.
Wenigstens eine Eigenschaft, die Mathilde an ihrem Gatten schätzte. Veranlasste diese ihn doch, sich während vieler Wochen und Monate nicht um seine Gemahlin »kümmern« zu können.
Gleich nach Übernahme der Regierungsgeschäfte seines Vaters hatte er seine, im besten Falle als »reserviert« zu bezeichnende Haltung gegenüber der Kirche bewiesen. Dem Abt von Sankt Hubert in Verdun hatte er beispielsweise kategorisch die Übergabe der enormen Schenkungen verweigert, die sein im Alter extrem fromm (Gottfried nannte es »senil«) gewordener Vater noch auf dem Sterbebett dem Kloster vermacht hatte.
Sein Sohn befürchtete nämlich nicht zu Unrecht eine militärische Schwächung seines Herzogtums, die er auf keinen Fall hinzunehmen gedachte.
Ganz gegen seine Gewohnheit hatte er sogar mit seiner damaligen Braut Mathilde die Angelegenheit besprochen. »Bloß weil mein Vater Sorge wegen seiner zahlreichen Sünden hatte und Angst vor der Hölle, werde ich auf keinen Fall dulden, dass dein, mein und das Erbe unserer gemeinsamen Kinder auf diese Weise und vor allem in dieser Höhe geschmälert wird!«
Ein vernünftiger Standpunkt – und durchaus in Mathildes Sinn. Ihr Verhältnis zum Stiefvater war ohnehin getrübt gewesen und sie brachte wenig Verständnis dafür auf, dass Gottfried der Bärtige bereit gewesen war, willkürlich Besitztümer, auch solche aus ihrem persönlichen Erbe vonseiten ihres wirklichen Vaters, an dieses französische Kloster zu verschenken.
Der zu Lebzeiten seines Vaters, Gottfried des Bärtigen, noch für zurückhaltend geltende junge Herzog schützte auch umgehend die Westgrenze des römisch-deutschen Reiches gegen einen drohenden Einfall Herzog Wilhelms von der Normandie, einem höchst gefährlichen, kriegslüsternen Wikingernachfahren, den er allerdings sogleich das Fürchten lehrte. Ebenso wenig wich Gottfried der Bucklige dem Kampf mit den Grafen von Flandern aus.
Mathildes Angetrauter war nicht nur ein ausnehmend treuer Gefolgsmann, sondern auch ein intimer Freund König Heinrichs IV. und galt allgemein als »der einzige Mann, der durch seinen klugen Rat den hochfahrenden und gewalttätigen Sinn des jungen Königs zu mäßigen versteht.«
Beide Herren kannten einander seit vielen Jahren, denn Gottfried der Bärtige hatte im Jahr 1046 seinen damals dreijährigen Sohn Gottfried als Geisel an den Kaiserhof Heinrichs III. gegeben, um selbst aus der Haft entlassen zu werden. So hatten sich der kleine Kaisersohn, der nachmalige Heinrich IV., und der missgebildete Knabe angefreundet. Eine Freundschaft, die offensichtlich auch im Erwachsenenalter noch andauerte.
Als Mathilde das erste Mal davon gehört hatte, war sie davon kaum beeindruckt gewesen. Ihr selbst war der hässliche Edelmann dadurch keineswegs in irgendeiner Form liebenswerter erschienen.
†
Leider hatte ihr die Hochzeitsnacht keine Schwangerschaft beschert und so war sie gezwungen, sooft ihr Gatte sie auf ihrer beider Burg in Lothringen aufsuchte, das Bett mit ihm zu teilen und seine »ehelichen Huldigungen« über sich ergehen zu lassen. Es war schließlich ihre Pflicht, ihm einen Erben zu schenken.
Da wäre es auch keineswegs hilfreich gewesen, ihm so gut es ging, auszuweichen. Wenn ihr Gemahl es wünschte, musste sie ihm sogar hinterherreisen, wo immer er sie hinzitierte.
Ihrem Beichtvater, Pater Bernardo, hatte sie bereits kurz nach der Hochzeit anvertraut, wie entsetzlich ihr bereits der Anblick seiner Ritterrüstung war, die er meist im Schlafzimmer aufbewahrte:
»Dieses Monstrum aus Eisen und Leder, mit der monströsen Ausbuchtung am Rücken für meines Gemahls Höcker lässt mich jedes Mal vor Ekel schaudern! Gott möge mir verzeihen: Obwohl ich sogar so etwas wie Mitleid für ihn empfinde, verabscheue ich diesen Mann zutiefst!«
»Bekämpft diese Gefühle, Gräfin, so gut Ihr es vermögt und lasst sie nicht überhandnehmen. Gottfried IV. ist Euer Euch vor Gott und den Menschen angetrauter Gemahl. Ihr schuldet ihm Wohlwollen, Güte und Treue. Bemüht Euch stets aufs Neue, ihm Achtung und Respekt entgegenzubringen!«
Das war leichter gesagt als getan. Mathilde war immerhin froh, dass ihr Beichtvater nicht von »Liebe« gesprochen hatte, die sie für »den Buckligen« empfinden müsse. Dazu würde sie sich wohl niemals zwingen können – selbst wenn ihr Seelenheil davon abhinge.
Spätfrühling 1071 – eine äußerst schwere Geburt, die der Sohn Mathildes und Gottfrieds des Buckligen nicht überlebt – Mathildes Trauer scheint nicht sehr groß – sie beschließt, nicht mehr in die Heimat ihres Gemahls, Lothringen, zurückzukehren – sie will für immer in Canossa bleiben, um ihre (angeblich) kränkliche Mutter Beatrix zu pflegen – Pater Bernardo unterstützt sie dabei …
Man schrieb Mitte Mai des Jahres 1071; auf der Burg Canossa herrschte helle Aufregung.
Vor drei Monaten, am 28. Februar, war Mathilde samt berittener Wachmannschaft sowie dem Gros ihrer Dienerschaft aus Lothringen, der Heimat ihres Gemahls, kommend, bei Schneefall und Eiseskälte in einer Kutsche auf Canossa eingetroffen, jener im zehnten Jahrhundert in der Emilia-Romagna in Norditalien erbauten Felsenburg, die mittlerweile zum Familiensitz der Fürsten der Toskana geworden war.
Seit sechs Monaten war die Gräfin jetzt schwanger, und nachdem ihr Gemahl ihr durch einen Sendboten hatte mitteilen lassen, dass er mindestens noch ein weiteres halbes Jahr mit einem militärischen Konflikt mit den Grafen von Flandern beschäftigt sein werde, hatte Mathilde spontan den Entschluss gefasst, sich in den Schutz ihrer Mutter Beatrix zu begeben, anstatt sich in einer ihr nach wie vor fremden Umgebung fremden Hebammen, Medici und Ammen anzuvertrauen.
Das Verhältnis zur alten Gräfin hatte sich seit einiger Zeit entschieden gebessert; man konnte beinah sagen, nach dem Tod Gottfried des Bärtigen waren sich die beiden Damen herzlich zugetan. Mathilde hatte ihren Groll gegen die Mutter wegen der erzwungenen Heirat mit Gottfried dem Buckligen mittlerweile begraben. Beatrix ihrerseits hatte alle möglichen Anstrengungen unternommen, um ihre Tochter, die ihr erstes Kind erwartete, nach Strich und Faden zu verwöhnen.
Das Jahr war fortgeschritten und mittlerweile war es Frühjahr geworden. Am Morgen des 15. Mai hatten bei der jungen Frau die Wehen eingesetzt, kurz nach dem Frühmahl, das sie wie üblich mit Beatrix in deren Erkergemach eingenommen hatte.
Ein leiser Aufschrei ihrer Tochter und deren schmerzverzerrtes Gesicht hatten die Gräfin alarmiert. »Frau Mutter, ich denke, es geht los! Ich verspüre starke Wehen«, hatte Mathilde atemlos hervorgestoßen und sich in den Rücken gefasst, während sie sich stöhnend auf ihrem Stuhl zusammenkrümmte.
Mathildes Mutter hatte umgehend veranlasst, dass Diener ihre Tochter nicht erst in Beatrix’ Gemach in einem anderen Trakt der Burg geleiteten, sondern Mathilde sofort in ihr eigenes Bett legten. Sie hatte sie, soweit nötig, entkleidet und gleichzeitig nach dem gräflichen Medikus und den beiden schon seit Wochen in Wartestellung verharrenden Wehmüttern schicken lassen.
»Du musst keine Angst haben, mein Kind«, hatte Beatrix die werdende Mutter, die zunehmend in Panik geriet, zu beruhigen versucht. »Sobald die ersten Wehen beginnen, dauert es erfahrungsgemäß noch viele Stunden, bis das Kind endlich kommt. Vor allem bei der ersten Geburt einer Frau können mitunter Tage vergehen.«
Mathilde, die sich erneut vor Schmerzen krümmte, konnte das nicht unbedingt trösten. »Wenn sich das mit diesen teuflischen Schmerzen noch ewig hinzieht, Frau Mutter, springe ich aus dem Fenster in den Burghof!«, kündigte sie keuchend an. »Das hält doch kein Mensch aus!«
Beatrix wischte ihrer Tochter den Schweiß von der Stirn. »Wir Frauen halten das seit urdenklichen Zeiten aus, mein Kind«, rutschte ihr dabei heraus. Die alte Gräfin hatte dabei an ihre eigenen Entbindungen gedacht, die durchwegs grauenhaft gewesen waren.
Diese Geburt versprach ebenfalls, sehr kompliziert zu werden.
Während sie auf den Medikus warteten, wandten sich die Gedanken der älteren Frau zurück in die Vergangenheit, als sie selbst einst so elend darniedergelegen hatte; viermal hatte es sie getroffen.
Seinerzeit hatte sie Gott und die Welt, ihre Eltern und vor allem ihren Gemahl verflucht, Bonifaz von Tuszien, der ihr das Ganze schließlich eingebrockt hatte.
Jede Geburt, ein äußerst schmerzhafter, aber an sich völlig normaler Vorgang, barg trotzdem immer die Gefahr in sich, dass Mutter oder Kind sie nicht überlebten.
Bisher hatte Beatrix diese Bedenken immer beiseitegeschoben, denn Mathilde war jung und robust und hatte bis jetzt nie schwerere Krankheiten durchgestanden. Im Gegenteil. Ihre Tochter schien ein Ausbund an Gesundheit zu sein, ihr Appetit war gut, sie schlief ausreichend, war schlank, ritt leidenschaftlich gerne und ging häufig auf die Jagd. Ein Kind zu gebären dürfte ihr eigentlich keine besonderen Mühen bereiten …
Der Medikus, ein gebildeter Römer namens Claudio Marcellus, hatte die werdende Mutter in Anwesenheit von Gräfin Beatrix, einer Handvoll Dienerinnen, sowie der beiden Wehmütter, Mutter und Tochter namens Sabina und Julia und – dezent im Hintergrund Pater Bernardo – untersucht.
Es war eine schwierig zu bewerkstelligende und höchst ineffektive Prozedur, der sich der Arzt liebend gerne entzogen hätte. War es ihm nach den Schicklichkeitsgeboten der Zeit doch nicht möglich, zumindest einen einzigen Blick auf den nackten Unterleib der Gebärenden zu werfen, geschweige denn mit seinen Fingern den Geburtskanal abzutasten und zu fühlen, ob der Muttermund sich bereits geöffnet habe.
Der Anstand verlangte, dass er den bekleideten (!) Kugelbauch der Schwangeren nur mit einem Hörrohr »untersuchen« durfte.
»Es ist alles in Ordnung«, hatte er gleich darauf verkündigt. »Die Herztöne des Kindes sind gut zu hören. Alles Weitere ist nun Sache der Wehmütter!«
Damit zog sich der Medikus zurück, wobei man ihm die Erleichterung deutlich ansehen konnte. Auch der Pater verließ das Gemach, »Geburten sind reine Frauensache« murmelnd. Immerhin hinterließ er die Ankündigung, sich zum Beten in die Burgkapelle zurückziehen zu wollen, aber sofort zur Stelle zu sein, falls man ihn benötigte.
›Was hoffentlich nicht der Fall sein wird‹, dachten die Übrigen. Der Ruf nach einem Geistlichen während einer Geburt bedeutete in aller Regel, dass Gefahr im Verzug war und Mutter oder Kind, oder womöglich beide, im Sterben lagen …
Die nächsten Stunden tat sich nichts Außergewöhnliches und die Zahl der Zeugen der Geburt hatte sich vermindert. Sie hielten sich in einem etwas entfernteren Nebenraum auf. Aber selbst dort waren die in Abständen gellenden Schmerzensschreie der in den Wehen Liegenden noch zu hören.
Verzichten konnte man keinesfalls auf diese Zeugen. Galten sie in Adelskreisen doch als Garanten dafür, dass das von dieser Frau geborene Kind lebte und dass man aus dynastischen Gründen kein anderes Neugeborenes »unterschob«, meist einen Knaben, um die Fortdauer einer vom Aussterben bedrohten Sippe zu gewährleisten.
Im Augenblick jedoch weilten nur noch die werdende Großmutter, die beiden Geburtshelferinnen Sabina und Julia sowie Mathildes vertraute Dienerin Susanna in dem immer stickiger werdenden Zimmer.
Die Luft, inzwischen von allerlei üblen Gerüchen geschwängert, war zum Schneiden und bereitete der Gebärenden noch zusätzliche Beschwerden. Dennoch durfte unter keinen Umständen ein Fenster geöffnet werden.
Ein uralter heidnischer Brauch, verbreitet in fast ganz Europa, verbot dies strikt: Mit der frischen Luft könnten sich böse Geister in das Geburtszimmer einschleichen und sowohl dem Neugeborenen als auch seiner erschöpften Mutter schweren Schaden zufügen. Dies war allgemeiner Konsens.
Es war bereits zum zweiten Mal Nacht geworden und immer noch kämpfte die bedauernswerte Mathilde ihren schier aussichtslos erscheinenden Kampf. Da die Frauen unter sich waren, hatte man den Unterleib der werdenden Mutter entblößt und eine der beiden Wehmütter prüfte gerade zum x-ten Male, ob der Muttermund sich nicht endlich öffnen wollte. Sie drehte sich um und schüttelte, an Gräfin Beatrix gewandt, bedauernd den Kopf. Immer noch tat sich nichts.
Mathilde war mittlerweile zusehends schwächer geworden. Ihre spitzen Schreie, die in den ersten Stunden auf der ganzen Burg zu hören gewesen waren, waren mittlerweile verstummt und einem jammervollen Wimmern gewichen. Für lautere und stärkere Schmerzensäußerungen war sie nicht mehr kräftig genug. Zeitweilig fiel sie aus Schwäche sogar in Ohnmacht. Was an sich kein Wunder darstellte: Die werdende Mutter hatte vor zwei Tagen das letzte Mal eine Mahlzeit zu sich genommen.
»Die ganze erste Zeit der Schwangerschaft von Gräfin Mathilde ist schon ein einziges Drama gewesen«, platzte plötzlich Julia, die jüngere Wehmutter, heraus. »Das hat mir die hohe Dame selbst erzählt! Aber ich durfte nichts davon verraten, denn sie wollte Euch, Frau Gräfin, nicht beunruhigen! Es sei erst viel besser geworden, nachdem die junge Contessa hier bei Euch in Canossa eingetroffen wäre. Vorher muss ihr Zustand schon die reinste Hölle gewesen sein!«
»Davon hat mir meine Tochter kein einziges Wort gesagt!« Die Stimme der alten Gräfin klang zutiefst besorgt. »Welcher Art sind denn ihre Beschwerden gewesen?«
»Die Contessa musste sich die ersten sechs Monate lang andauernd übergeben; sie habe an Übelkeit, Appetitlosigkeit, Kopf- und Rückenschmerzen gelitten, sowie wiederholte Stiche im Unterleib verspürt«, rückte Julia mit der Wahrheit heraus. »Erst hier bei Euch, Contessa, ging es ihr gut!«
Gräfin Beatrix traf nun eine Entscheidung, indem sie sich an Susanna, die vertraute Leibmagd ihrer Tochter, wandte.
»Geh und hol Pater Bernardo! Vielleicht vermag sein Gebet am Bett meiner Tochter etwas zum Guten zu verändern!«
Susanna, hilflos wie alle anderen und deshalb froh darüber, wenigstens irgendetwas tun zu können, flog beinahe die Stufen des Treppenturms, in dessen oberstem Geschoss sich das Schlafzimmer der alten Gräfin befand, bis ganz nach unten hinab und rannte den langen, auch im Sommer kalten Flur an der Nordseite der Burg entlang bis zur Kapelle am Ende dieser Etage.
Als sie die Tür aufriss, fand sie den Pater kniend auf dem Boden vor dem kleinen Trinitatis-Altar, die betenden Hände gen Himmel erhoben.
»Pater Bernardo, Gräfin Beatrix schickt nach Euch! Sie hofft, Ihr könntet vielleicht durch Euren Zuspruch bei Contessa Mathilde noch etwas bewirken. Meine junge Herrin quält sich beinah zu Tode!«
Wie der Blitz war der Pater auf den Beinen. Seine Kutte raffend rannte er der vorauseilenden Susanna hinterher.
Im Gemach der Gräfin hatten sich mittlerweile erneut die »Zeugen der Geburt« eingefunden. Man konnte kaum noch atmen, denn der Gestank war inzwischen noch übler geworden.
»So riecht der Tod«, murmelte ein weitschichtiger, bereits bejahrter Vetter der alten Gräfin und presste sich ein Tuch vor Mund und Nase. Mathildes Mutter hatte ihn gehört, erwiderte jedoch nichts, sondern bedachte ihren Verwandten nur mit einem wilden zornigen Blick. Wie konnte er es nur wagen …
Als der Pater, dicht gefolgt von Susanna, den Raum betrat, wichen die Übrigen vom Bett noch weiter zurück, um ihn zu Mathilde, die man inzwischen wieder schicklich zugedeckt hatte, vorzulassen.
Er beugte sich über die Totenbleiche, die mit geschlossenen Augen dalag – fast so, als läge sie bereits im Sarg – legte ihr seine Hände auf Stirn und Brust, segnete sie mit dem Zeichen des Kreuzes und begann, leise summend einen Choral anzustimmen.
Als die volltönende Baritonstimme ihres Beichtvaters in Mathildes Ohr drang, öffnete sie nach einer Weile die Augen und versuchte zu sprechen. Aber ihre Kehle war zu trocken.
»Mein liebes Kind«, begann Bernardo, mit einer Hand ihren Hinterkopf stützend und mit der anderen gleichzeitig ihre Lippen mit einem kleinen Becher Wasser benetzend, »mit Gottes und seiner Heiligen Hilfe wird dein Leiden bald ein Ende finden! Einer allerletzten Anstrengung bedarf es noch, dann wirst du es geschafft haben, deinem Kind ins Leben zu verhelfen.«
»Ja, Pater, so wird es geschehen! Es ist gut, dass Ihr an meiner Seite seid«, erklang es sehr leise aus den vom reichlich vergossenen Schweiß durchtränkten Kissen.
In der Tat. Es dauerte nun nicht mehr allzu lange und Mathilde schenkte, einen wilden Schrei des Schmerzes, aber auch der Erlösung und Erleichterung ausstoßend, einem Knaben das Leben.
Die ältere Hebamme Sabina durchtrennte die Nabelschnur und überreichte das Kind ihrer Tochter Julia, die es waschen und in Windeln wickeln sollte, während die ältere Hebamme sich um die Nachgeburt kümmerte und die erschöpfte Mutter versorgte.
Ehe der Kleine gewindelt wurde, begutachteten ihn seine Großmutter sowie die Zeugen der Geburt. Das Kind hatte alle Gliedmaßen, die es haben musste, Kopf, Rumpf und Extremitäten waren nicht missgebildet – wie manche angesichts seines Erzeugers im Stillen geargwöhnt hatten – aber es war auffallend klein und ausgesprochen mager, bestand fast nur aus Haut und Knochen.
Der Medikus, den man über die erfolgte Geburt informiert hatte, stellte fest, dass die Lebenskraft des Knaben äußerst schwach sei und gesunde Reflexe kaum vorhanden wären.
»Es ist ungewöhnlich, dass ein Säugling so lange braucht, bis er den ersten Laut ausstößt.«
Auch Mathilde war nicht entgangen, wie kraftlos sich der Schrei ihres Sohnes, der so lange hatte auf sich warten lassen, schließlich anhörte: Eher wie das Piepsen eines jungen Vögelchens und nicht wie der kraftvolle Schrei einer sich machtvoll ins Leben drängenden Kreatur.
»Ihr solltet ihm sofort das Sakrament der Taufe spenden, Pater«, befand die Großmutter des Kleinen. »Nur zur Sicherheit«, fügte sie schnell hinzu, als ihr Blick auf ihre Tochter fiel. Aber Mathilde schien erstaunlich ruhig und gefasst zu sein.
›Beinah gleichgültig‹, befanden auch der Pater und etliche andere bei sich. ›Kein Wunder, gleich nach dieser grässlichen Geburt‹, überlegte der Burggeistliche. ›Und wenn eine Frau den Erzeuger des Kindes vehement ablehnt, ist auch meist die Zuneigung zu dessen Nachwuchs nicht besonders groß. Oft kommt die Liebe zum eigenen Kind erst ein wenig später, sobald die grausamen Schmerzen vergessen sind.‹
»Wie soll der Knabe denn heißen?«, erkundigte sich Pater Bernardo. Er ersuchte auch darum, die Zofe Susanne möge ihm aus der Burgkapelle eine Karaffe mit Taufwasser holen, das man eigens zu diesem Anlass vom Jordan aus dem Heiligen Land hatte bringen lassen. Danach verließ er eilends das mittlerweile unerträglich stickige Gemach. Er wollte nur rasch seine Kammer aufsuchen, um seine Priesterstola zu holen.
Im Nebenraum fand dann die sogenannte Nottaufe statt, die man all den neugeborenen Kindern spendete, die kurz davor waren, in die Ewigkeit einzugehen, und nicht auf den späteren feierlichen Taufakt warten konnten.
Seine Großmutter hielt den in ein Tuch gewickelten, schwächlichen Knaben, der ganz gelb war, in ihren Armen, während der Pater sein Köpfchen mit dem Wasser beträufelte und die rituelle Taufformel über ihn sprach: »Ich taufe dich auf den Namen Bonifatius, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!«