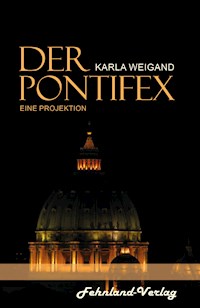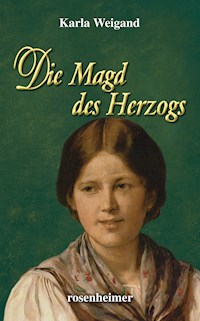Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fehnland-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Theophanus Töchter
- Sprache: Deutsch
Nachdem ihr Ehemann 1323 und ihr Schwiegervater 1324 gestorben sind, regiert Gräfin Loretta von Sponheim ab 1324 alleine die Grafschaft Starkenburg an der Mosel. Nach territorialen Auseinandersetzungen kommt es zu einer Kraftprobe mit einem der damals mächtigsten Männer Europas, dem Kurfürsten Balduin von Luxemburg, Erzbischof von Trier. Loretta nimmt den Erzbischof in Gefangenschaft, ertrotzte ein hohes Lösegeld und weitreichende politische Zugeständnisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Loretta
Eine Frau kämpft um ihr Recht
Historischer Roman
Karla Weigand
Fehnland-Verlag
Erstausgabe
Alle Rechte beim Verlag
Copyright © 2019
Fehnland-Verlag
26817 Rhauderfehn
Dr.-Leewog-Str. 27
Coverdesign: Tom Jay
Lektorat: Dr. Helga Jahnel
9783947220496
Gewidmet
meinem Mann Jörg Weigand, der mich erstens ermuntert hat, überhaupt mir dem Schreiben von Geschichten und Romanen zu beginnen, und der mich zweitens stets tatkräftig bei meinen Recherchen unterstützt.
Inhalt
PROLOG
Der Todesengel geht um; Frühjahr anno 1323
TEIL I
Auch die Mächtigen verschont der Tod nicht
In einem Wäldchen bei Traben-Trarbach
Es geht zu Ende – Erinnerungen an eine glückliche Vergangenheit
Erinnerung und Abschied
TEIL II
Neubeginn, anno 1324
Ankunft auf der Starkenburg; Loretta als gelehrige Schülerin
Ein weiterer Schicksalsschlag
Eine Seuche geht um
Ein weiteres Treffen der Verschwörer im Herbst 1324 bei Traben-Trarbach
Im erzbischöflichen Palais in Trier
Neue Aufgaben für Loretta
Der Familienrat trifft eine Entscheidung
Alltag auf der Starkenburg
Dunkle Wolken brauen sich im Sommer 1325 zusammen
Lorettas stärkster Gegner holt zum ersten Schlag aus; Loretta fällt ein Urteil
Im erzbischöflichen Palais in Trier
Unliebsame Vorfälle häufen sich im Jahr 1326
Not und Elend – und auch anno 1327 kein Ende abzusehen
Herbst 1327; in der erzbischöflichen Stadt Trier
Geschäftiges Markttreiben in der Stadt
Eine interessante Bekanntschaft
TEIL III
Loretta und Balduin begegnen sich zum ersten Mal
Ein schlimmer Vorfall stört den Alltag auf der Starkenburg
Höchste Gefahr für die Starkenburg und ihre Bewohner
Kurz danach hat Loretta eine Idee
Ein merkwürdiger Besucher durchbricht den Alltag
Ein Betrüger fällt auf die Nase
Trügerischer Friede
Ein Fest auf der Starkenburg
Feine Lebensart in der Provinz
Ein Höriger wird Vasall
Gefahr für Lorettas jüngsten Sohn; aber das Fest geht weiter
Erzbischof Balduin von Trier zu Gast beim König
Sängerwettstreit auf der Starkenburg
Es geht nicht nur um Küchengeheimnisse
Loretta gewinnt Madeleine als Vertraute
Ein wichtiges Gespräch mit Frau Gerlind
Gottfrieds Befreiung aus der Geiselhaft
TEIL IV
Loretta macht Ernst
Der Erzbischof geht in die Falle
Lorettas ‘hochgeschätzter Gast‘
Balduins ‘Wunder‘ auf der Starkenburg
Der Erzbischof arrangiert sich
Balduin erlebt Loretta als Richterin
Balduins Gefangennahme schlägt hohe Wellen
Auch der Papst erfährt von Balduins Dilemma
Balduins Abschied von der Starkenburg zeichnet sich ab
Erzbischof Balduin als Helfer in der Not
Gerlind und Balduin als Geiselbefreier
Auf der Burg feiert man ein Freudenfest
Loretta fasst sich ein Herz
Ewige Freundschaften
TEIL V
Lorettas ‘Sieg‘ über Balduin und Henris Enttäuschung
Strafe für Johanns Entführer; Abschied und Reisevorbereitungen
Abweichung von der Reiseroute
Bizarre Form der Frömmigkeit
Radegund, die Seherin aus dem Sundgau, weissagt Schlimmes
Der Aussatz – die schlimmste Geißel der Menschheit
Ludwig der Bayer im römischen Kapitol
Die Reise nach Avignon nimmt weiter ihren Lauf
Schon wieder die Gaukler!
Ein weiteres Unglück überschattet die Reise
Lorettas Sorge um Heinrich
TEIL VI
In der Papststadt Avignon
Loretta beginnt, sich mit Avignon vertraut zu machen
Loretta zu Gast bei Monsieur Arnaud
Loretta und Monsieur Arnaud kommen sich näher
Was kostet die Lösung vom Kirchenbann?
Eine ganz besondere Liebesnacht
Loretta fällt eine Entscheidung
Avignon, Sündenbabel und ‘heilige Stadt‘ zugleich?
Pater Radolfs starke Schulter bietet Loretta Halt
Lorettas Bereitschaft, sich dem Papst zu unterwerfen
EPILOG
Nachsatz
PROLOG
Der Todesengel geht um; Frühjahr anno 1323
»So helft mir doch! Haltet sie fest!«, schrie der Altbauer Simeon, der vergeblich versuchte, seine Schwiegertochter Sigrun zu bändigen. Das junge Weib war außer sich. Rasend vor Schmerz hatte sie sich erst über die Leichen ihrer drei- und fünfjährigen Kinder geworfen, ihre Finger ins Laken krallend, womit Mutter Sara, die Dorfheilerin, die Kleinen zugedeckt hatte. Jetzt schlug Sigrun wild um sich.
»Nein, nein, nein!«, kreischte sie fortwährend, »nicht meine Anna! Nicht meine Berta! Dann hatte sie begonnen, ihren Herrn, den Grafen von Sponheim, den sie – und nicht nur sie! – für das Elend der Dorfleute von Hammerstein verantwortlich zu machen und wüst zu beschimpfen.
»Der hohe Herr lässt es sich wohl sein auf seiner Burg und uns Bauern lässt er seelenruhig verrecken! Schande über ihn!« »Still! Lass’ das bloß keinen Fremden hören«, versuchte Simeon sie zu bremsen. Aber für Sigrun gab es nun, nachdem sie kurz nach Weihnachten zur Witwe geworden war und jetzt auch noch ihre Kinder begraben musste, kein Halten mehr. »Ich mag nicht mehr schweigen!«, brüllte sie, dass es den wenigen Anwesenden, die Zeugen des Dramas waren, in den Ohren gellte.
Außer Sigrun und Simeon, dem Großvater der Kinder, hielten sich noch Erdmute, seine mittlerweile geistesschwach gewordene Frau, sowie Sara, die Heilerin und Heidrun, Simeons jüngere, unverheiratet gebliebene Schwester, in der Kammer auf.
»Ich verfluche Euch, Graf Heinrich von Sponheim, samt Eurem Vater Johann, die Ihr nichts getan habt, um unser Elend zu lindern! Möge der Teufel Euch holen!«, verstieg sich, drohend die erhobenen Fäuste ballend, die junge, sichtlich schwangere Bäuerin und warf sich erneut mit wildem Schluchzen über die ausgezehrten, noch warmen Leiber ihrer Kinder.
Hilflos versuchte Simeon, die Schwiegertochter wegzuzerren. Die fauchte wie eine Wildkatze und begann, ihn zu kratzen und nach ihm zu schlagen. Erschrocken wichen die älteren Frauen bis zur Kammertür zurück. Gefährlich erschien ihnen die sich in ihrem Schmerz und ihrem Zorn wie wahnsinnig Gebärdende. Nach Simeons Aufforderung näherten sie sich nur zögernd der jungen Frau.
Endlich gelang es ihnen mit vereinten Kräften, die Tobende vom Bett mit den kleinen Leichen fortzuziehen. Mit Nachdruck setzte Simeon sie auf einen Hocker. Daraufhin begann Sigrun Gott zu lästern. Dem ginge es droben in seinem Himmel ja gut! Was scherten ihn da die Kümmernisse der kleinen Leute? Im Grunde waren dem Herrgott doch bloß die edlen Herrschaften wichtig!
»Und die wiederum trampeln auf uns rechtlosen Leibeigenen herum!«, krächzte Sigrun erschöpft. Vor lauter Brüllen versagte ihr allmählich die Stimme. »Nach dem Mann hat der Herrgott mir jetzt auch noch meine Kinder genommen! Soll ich ihm dafür vielleicht noch ein Dankgebet aufsagen?«
Das Letzte brachte sie nur noch mühsam hervor, ehe sie ohnmächtig vom Schemel auf den gestampften Lehmboden rutschte. Erdmute, ihre Schwiegermutter reagierte überhaupt nicht; die alte Frau begriff nicht mehr, was sich hier abspielte.
Simeon, Sara und Heidrun hatten es schwer, die kurz vor der Entbindung stehende junge Frau ins Bett zu schaffen, dasselbe, in dem bereits ihre toten Kinder nebeneinander lagen … Es war die einzige Bettstatt, die zur Verfügung stand. Die übrigen Hausbewohner pflegten ihren Strohsack des Nachts in irgendeinem Winkel des winzigen Häuschens oder in der Scheune, die zugleich als Hühner- und Ziegenstall diente, auszubreiten.
Den alten Simeon, der in kurzer Zeit seinen einzigen Sohn und zwei seiner Enkel verloren hatte, hielt es plötzlich nicht mehr in dem elenden Loch, in dem es nach bitterer Armut und jetzt auch noch nach Tod roch. Seine Pflicht vorschützend, sofort den Dorfpriester von der neuerlichen Tragödie verständigen zu müssen, stürzte er förmlich durch die wackelige Tür nach draußen.
Für gewöhnlich informierte Sara, die Heilkundige, die auch als Wehmutter fungierte, den Geistlichen über Todesfälle in seinem Sprengel. Zum Glück tat sie es dieses Mal nicht. Bald darauf, als Sigrun aus ihrer Ohnmacht erwachte und erkannte, wer bei ihr lag, tat sie einen wilden Aufschrei und gleich noch einen zweiten: Ihre Fruchtblase war geplatzt; sie würde niederkommen – und zwar direkt neben ihren toten Kindern. So konnte Sara der Gebärenden wenigstens Hilfe leisten.
Der Winter von 1322 auf 23 war ungewöhnlich lang und hart gewesen. Viele, zumeist Alte und Kinder, hatten ihn nicht überlebt, denn Nahrungsmittel waren aufgrund einer Missernte Mangelware geworden, ebenso wie Brennholz und Viehfutter. Bereits vor dem Weihnachtsfest aßen die Bauern ihr Kleinvieh auf; Kühe besaßen nur die wenigsten. Eine tödliche Krankheit, die sich vor allem jüngeren Männern, auch Simeons Sohn, auf die Brust legte und ihnen den Atem abschnürte, hatte verhindert, dass genügend Nachschub an Brennbarem herangeschafft wurde, um die Elendskaten der Dörfler wenigstens notdürftig zu beheizen.
Weiber und Knaben waren zu schwach gewesen, bei Schnee und Eis Bäume zu fällen und Holz zu hacken. Was Krankheiten und Hunger nicht vermochten, vollendete die über Wochen andauernde Eiseskälte. Vor Anstrengung keuchend und mit Schmerzen in Rücken und Beinen erreichte Simeon das Haus des Geistlichen. Der Pfarrherr von Hammerstein seufzte schwer, als er das Kirchenbuch aufschlug: Neuerliche Sterbefälle waren zu verzeichnen; und wiederum handelte es sich um kleine Kinder.
Die Einträge erfolgten nicht namentlich; so hieß es beispielsweise: ›Anno 1323 am dritten Tag des Monats Martii ein Knecht, seines Alters 22 Jahre, an Lungensucht gestorben‹. Oder, wie an diesem Tag, an dem er die im wahrsten Sinne des Wortes doppelt traurigen Angaben des leibeigenen Bauern Simeon eintrug: ›Am 17.Tag des Monats Martii zween Mägdlein, drei und fünf Jahre alt, Hungers wegen verschieden‹.
Unter der Rubrik ›Geburten‹ war seit vergangenem November nichts mehr vermerkt. Wenn er von Zuwachs im Dorf lesen wollte, musste der Geistliche schon ziemlich weit im Kirchenbuch zurückblättern.
»Das gilt nicht nur für Hammerstein«, stellte der Geistliche bekümmert fest, nachdem Simeon ihm wortreich sein Leid geklagt hatte, »sondern auch für Enkirch, Trarbach, Reil, Reichenbach, Answeiler, Nohen und Rimsberg.«
Für Simeon bedeutete das keinen Trost. Auch nicht die Aussicht, dass seine Schwiegertochter in Kürze neues Leben hervorbrächte. Bei dem unterernährten Zustand des jungen Weibes war die Wahrscheinlichkeit gering, ein lebensfähiges Kind zu gebären …
Auf dem Heimweg musste Simeon daran denken, was Sigrun Böses über den Grafen gesagt hatte und über den Herrgott, der ganz offensichtlich nur auf die Reichen und Vornehmen schaute. Es stimmte ja! Er, Simeon, mit kaputten Füßen und schmerzenden Beinen, gänzlich abgeschafft mit Mitte fünfzig, sah es genauso.
»Obwohl ich dem Ende meines irdischen Daseins um vieles näher stehe, als meine junge Schwiegertochter und daher zu Recht Angst vor dem Tod und dem ›Danach‹ habe, glaube ich ihr in diesem Punkt unbesehen. Im Himmel wird es nicht viel anders sein als hier auf Erden: Die Edelleute schaffen an und wir Bauern ducken uns«, murmelte er grimmig vor sich hin. Vorsichtshalber schaute Simeon sich um, ob ihn womöglich jemand hören konnte, ehe er fortfuhr: »Eigentlich müsste man doch was dagegen tun können!«
TEIL I
Auch die Mächtigen verschont der Tod nicht
»Alles Weitere liegt nun allein in Gottes Hand, Herrin.«
Die Stimme Radolfs von Metz, vierzigjähriger Priestermönch eines Benediktinerklosters in der Nähe der Stadt Colmar und Beichtvater der jungen Gräfin Loretta von Sponheim, klang rau und erschöpft.
Es war der 16. März anno 1323, genau elf Uhr nachts. Der Pater nahm das Stundenglas von der Truhe neben dem Bett auf. In diesem Augenblick rieselten die letzten Körnchen in die untere Glaskugel und er drehte den Zeitmesser um. Die Mitternachtsstunde begann.
»Ihr solltet Euch zur Ruhe begeben, Madame! Es nützt keinem, wenn auch Ihr krank werden solltet, am wenigsten Euren Kindern. Sobald sich im Befinden Eures Gemahls auch nur das Geringste ändert, werde ich Euch sofort Nachricht geben. Aber, jetzt bitte ich Euch«, redete er ihr eindringlich zu, »versucht, ein wenig zu schlafen, meine Tochter. Die nächste Zeit wird Euch das Äußerste an Kraft abverlangen.«
Die überschlanke, junge Dame, derzeit Hausherrin auf der Burg Wolfstein, an die sich die Worte des hoch gewachsenen Paters richteten, wandte ihm ihr blasses Gesicht zu. Sie nickte zögernd, ehe sie sich von ihrem Schemel erhob.
Seit vielen Stunden verharrte die junge dunkelblonde Frau schon am Lager ihres Gemahls, Heinrich von Sponheim-Starkenburg. Dem anwesenden Medicus warf sie einen letzten verzweifelten Blick zu. Der Mann verbeugte sich tief vor ihr, ehe er sich anschickte, das Krankenzimmer samt den üblichen Utensilien seines Berufsstandes zu verlassen, in der Hauptsache Aderpresse, verschiedene Nadeln und Schröpfgläser.
Er hatte die Gräfin nicht darüber im Unklaren gelassen, dass es der letzte Aderlass sei, den er an ihrem erst dreiunddreißig Jahre alten Gemahl vorgenommen habe: Die ärztliche Kunst war an ihr Ende gelangt. Von nun an wäre der Platz am Bett des Sterbenden allein dem Priester, sowie den nächsten Angehörigen vorbehalten.
Seit Jahrzehnten bereits versah Girolamo Croce, ein in Medizin versierter Magister aus Bologna, seine Pflicht bei der Grafenfamilie. Lorettas Schwiegervater, Graf Johann von Sponheim, hatte, sobald er vom bedenklichen Zustand seines einzigen Sohnes erfuhr, seinen eigenen Leibarzt, Dottore Girolamo, nach Wolfstein gesandt. Auch Loretta hatte alle ihre Hoffnungen in die Fähigkeiten dieses Gelehrten gesetzt.
Und nun ließ dieser nicht den geringsten Zweifel daran, dass nicht nur die Tage, sondern bereits die Stunden ihres Gatten gezählt waren und dass Schloss Wolfstein an der Lauter, unweit Meisenheim, Heinrichs Sterbeort sein werde. Das Einzige, was man noch zu tun vermöge, sei, dem Todkranken die bereitgestellten Drogen zu verabreichen; sie würden ihm eventuelle Schmerzen und Angstgefühle nehmen und ihn friedlich in die Ewigkeit hinüber dämmern lassen.
Loretta wollte nichts davon hören.
Hartnäckig weigerte sie sich, die Möglichkeit, ihr Gatte werde nie mehr genesen, auch nur in Erwägung zu ziehen. Sie wollteeinfach, dass der Arzt sich irrte! Daran änderte auch das sanfte Zureden ihres Beichtvaters nichts. »Mich zurückziehen und schlafen kann ich nicht.« Sie flüsterte mit blassen Lippen. »Ich werde mich dort drüben auf die Bank setzen und ein wenig ausruhen. Seid so gut und leistet mir dabei Gesellschaft, Pater Radolf.«
Leicht schwankend vor Schwäche begab sich die junge Gräfin zu der Polsterbank am Fenster und ließ sich schwerfällig darauf nieder. Den Mönch beschlich die Sorge, seine junge Herrin könne unter der Last ihrer schweren Bürde zusammenbrechen. Seit dem frühen Morgen hatte sie keine Nahrung mehr zu sich genommen.
»Ich will so lange bei ihm ausharren und für seine Genesung beten«, hörte er sie murmeln, »bis der Herrgott endlich ein Einsehen mit uns hat.« Wie der Benediktiner mit Unbehagen feststellte, waren aus ihrem Tonfall Hartnäckigkeit und eine gewisse Auflehnung gegen den Willen Gottes heraus zu hören.
»Es kann und darf nicht sein, dass ein so junger Mann stirbt«, fuhr die Gräfin eigensinnig fort. »Ich, seine Frau, sowie seine drei unmündigen Söhne, wir brauchen Heinrich noch lange Zeit. Gütiger Gott, Johann, unser Ältester, ist doch erst sieben Jahre alt«.
»Wie Ihr wünscht, Madame«, gab der langjährige Beichtvater der Gräfin nach und verließ seinen Platz am Sterbelager. Er erkannte den eigenwilligen Trotz in Lorettas graublauen Augen und wusste, dass seine Herrin sich keinesfalls umstimmen ließe. Radolf von Metz liebte die Gräfin wie eine eigene Tochter und empfand großes Mitgefühl mit ihrem Schicksal. Gott allein wusste, wie sie die unabwendbare Tragödie verkraften würde.
Vor acht Jahren, aus Anlass ihrer Heirat mit Heinrich von Sponheim, war der Benediktiner aus dem Elsass mit der noch nicht ganz fünfzehnjährigen Loretta in ihre neue Heimat an der Mosel gezogen. Es war ihr ausdrücklicher Wunsch gewesen, den von Kindheit an vertrauten Pater bei sich zu haben und ihre Eltern, Johann I. von Salm und seine französische Gemahlin, Jeanne de Joinville, hatten ihr diesen Wunsch erfüllt, obwohl Graf Johann seinen Burggeistlichen sehr gerne selbst behalten hätte.
Radolf unterdrückte einen tiefen Seufzer.
Loretta, seit ihren frühen Mädchentagen eine wahre Schönheit mit ovalem Gesicht, ausdrucksstarken großen Augen, einer zierlichen Nase und vollen Lippen, schlanker Figur und dunkelblond-rötlich schimmerndem Haar, wurde mit knapp fünfzehn Jahren vermählt und war jetzt bereits Mutter dreier Söhne. Mit erst dreiundzwanzig Jahren würde sie eine ungewöhnlich junge Witwe sein. Der Benediktiner ahnte Schlimmes angesichts der Tatsache, dass sein Beichtkind jeden Gedanken an Graf Heinrichs Tod einfach beiseiteschob.
Das für jedermann Ersichtliche ignorierte sie standhaft, um sich die Illusion seiner Genesung um jeden Preis zu erhalten. Wie schrecklich müsste ihr Erwachen sein, sobald ihr Gemahl seinen letzten Atemzug getan hatte?
Auf der niedrigen, mit weinrotem Samt bezogenen Sitzbank, unter einem mit grüngelben Glasscheiben versehenen Erkerfenster, überließ Loretta sich den Erinnerungen an glücklichere Tage, während der um zwanzig Jahre ältere Pater, dessen brauner Haarkranz sich allmählich grau verfärbte, sich neben ihr erneut in ein stummes Gebet flüchtete.
Mit großer Sehnsucht dachte die junge Frau an ihre wohlbehütete Kindheit in den Vogesen, an ihren geliebten Vater Johann von Salm und an Madame Jeanne, ihre schöne Mutter, der sie es verdankte, neben der deutschen auch die französische Sprache perfekt zu beherrschen.
Ihre gesamte Kindheit schien Loretta eine Zeit der Liebe und des Glücks gewesen zu sein, voller Geborgenheit und Fürsorge ihrer Eltern. Sie erinnerte sich an keinen einzigen Tag des Ungemachs. Ja, in ihren Erinnerungen an das Elsass schienen ihr sogar die Sonnentage gegenüber garstigem Regenwetter weit zu überwiegen.
Wie schön war es doch, als kleines Mädchen auf den Knien meiner Maman zu sitzen und sachte über ihr seidenes Gewand zu streicheln. Und wie habe ich es genossen, den wunderbaren Duft einzuatmen, der ihren Kleidern und ihrem goldenen Haar entströmte.
Beinahe noch mehr hatte sie es jedoch geliebt, wenn ihr Papa sie vor sich auf sein Pferd nahm, um mit ihr ›vite comme le vent‹ über die Felder zu reiten. Ja, schnell wie der Wind ritt sie auch heute noch gerne.
Beiden Eltern war viel daran gelegen, ihr neben einer musischen Erziehung, welche die Kunst des Gesangs, des Musizierens auf dem Psalterium und des Reigentanzes beinhaltete, und einer gewissen sportlichen Ertüchtigung wie Reiten, Fechten und Bogenschießen, auch eine vielfältige Ausbildung in Sprachen und wissenschaftlichen Fächern angedeihen zu lassen, ihren mannigfachen Begabungen und Neigungen entsprechend.
Geliebter Papa, meine über alles geliebte Maman,wie dankbar bin ich Euch dafür. Dank Eurer klugen Vorausschau ist es mir möglich, meinem Gemahl eine ebenbürtige Gefährtin zu sein, der er nicht nur Zuneigung, sondern auch Achtung entgegen zu bringen vermag, dachte sie im Stillen.
Und damit sollte jetzt auf einmal Schluss sein? Oh, nein! Gewiss irrte sich dieses Mal der Medicus. In dem abgedunkelten Raum wanderten Lorettas Gedanken erneut zurück in die Vergangenheit.
Nie würde sie den bewussten Tag vergessen. Ihr Hauslehrer, der sie in Latein und Geschichte unterwies, war gegangen und sie hatte beschlossen, auszureiten, als ihr im väterlichen Schlosshof eine alte Frau den Weg zu den Ställen vertrat und Anstalten machte, sie anzusprechen.
Bertold, ein neunzehn Jahre alter Knecht, der die Zwölfjährige stets bei ihren Ausritten begleitete, war darüber sehr unwillig und schickte sich an, die Alte mit dem geflickten bodenlangen Rock und dem grauen Umschlagtuch, das sie nachlässig über Kopf und Schultern geschlungen hatte, zu vertreiben. Aber Loretta fiel ihm in den Arm.
»Was ist es denn, worüber du mit mir so dringend sprechen willst, Notburga?«, richtete sie das Wort an die in der Gegend südlich von Straßburg allgemein als weise Frau bekannte Kräutersammlerin und Seherin. Wie Loretta am Inhalt ihres Weidenkörbchens erkannte, wollte Notburga jemandem, vermutlich einer Magd oder einem Knecht, der an hartnäckigem Husten litt, fein geschnittene Huflattichblätter bringen, die das Übel beseitigen würden.
Notburga, eine erschreckend magere, kinderlose Witwe mit tiefschwarzen Augen und einem Wust grauer Haare, der auch durch das dunkle Kopftuch kaum zu bändigen war, wirkte ein wenig unheimlich. Aber Loretta, die sie schon oft gesehen hatte, empfand keinerlei Berührungsängste vor der Alten. Auch als die ganz nah an sie herantrat und es sogar wagte, ihre rechte Hand zu ergreifen, zuckte sie nicht ängstlich zurück.
Bertold drängte sich dazwischen. Loretta aber verbat sich jede Einmischung ihres Reitknechts. »Ich will wissen, was Notburga mir zu verkünden hat«, beharrte sie eigensinnig. Widerstrebend wich der junge Bursche zur Seite. Die weise Frau, die oft von ›Gesichten‹ heimgesucht wurde, richtete ihren Blick starr auf Lorettas Handfläche, wobei sie Unverständliches vor sich hin murmelte.
»Du musst schon deutlich sprechen, Notburga, sonst verstehe ich dich nicht«, ermahnte das zwölfjährige Edelfräulein die ältere Frau.
»Es ist doch nur alles blanker Unsinn, was die zu sagen hat«, mischte sich der Knecht erneut ein. »Ihr solltet gar nicht auf sie hören, Mademoiselle!« Ein unwilliger Blick aus großen blaugrauen Augen ließ ihn augenblicklich verstummen.
»In drei Jahren bist du die glückliche Ehefrau eines deutschen Grafen und neun Monate später stolze Mutter eines Sohnes«, weissagte Notburga schließlich, nachdem sie die Linien beider Handflächen Lorettas gründlich studiert hatte. »Du wirst insgesamt drei gesunden Knaben das Leben schenken«, fuhr sie fort, »von denen zwei eine höhere geistliche Laufbahn einschlagen werden.«
»Zu so einer Voraussage braucht es nicht viel! Das hätte ich auch noch zustande gebracht«, hatte Bertold daraufhin verdrießlich vor sich hin gebrummt.
Die Gräfin sah die Szene noch ganz deutlich vor sich und trotz ihres Kummers musste sie lächeln. Bertold hatte nicht Unrecht gehabt; es war üblich, dass adelige Töchter schon mit vierzehn, fünfzehn Jahren verheiratet und daher auch frühzeitig Mütter wurden. Und was den Sohn anbelangte – dass sich diese Vorhersage bewahrheitete, dafür bestand die Wahrscheinlichkeit ja immerhin zur Hälfte!
Warum sollte sie auch nicht im Laufe der Jahre drei Söhne zur Welt bringen? Sie war jung und gesund und die Frauen in ihrer mütterlichen Familie hatten allesamt mehr männliche als weibliche Kinder geboren. Selbst die Ankündigung, zwei dieser Knaben würden hohe Geistliche werden, war keine große Überraschung, sondern die Regel bei nachgeborenen Söhnen adliger Sippen. Damals, als Zwölfjährige, war sie allerdings von den Worten der Seherin ungeheuer beeindruckt gewesen.
»Es klingt ganz wunderbar, was du mir weissagst, Notburga!« Sie griff in ihre am Gürtel befestigte Börse und schenkte der Heilerin zum Dank zwei Kupferpfennige.
»Was kannst du mir sonst noch vorhersagen? Das war doch gewiss noch nicht alles!« In kindlicher Neugier bedrängte sie die alte Frau. Aber auf einmal schien Notburga es eilig zu haben, in die Quartiere des Salmer Gesindes zu gelangen.
»Weiter weiß ich nichts mehr, Gnädiges Fräulein«, wurde sie ganz förmlich, knickste und wollte sich davonmachen. »Halt! Hiergeblieben, Notburga!« Lorettas Stimme, nun bar jeglicher Verbindlichkeit, klang so autoritär, dass die weise Frau, verlegen zu Boden starrend, gehorsam vor dem Kind stehen geblieben war.
»Nun? Was ist, Notburga? Auch wenn es unangenehm ist, musst du es mir sagen, Frau! Ich will gegen alle Gefahren gewappnet sein. Also rede!«
Die junge Gräfin erlebte das Vergangene, als geschähe es unmittelbar in diesem Augenblick. Die Seherin hatte den Blick erhoben und ernst in Lorettas große Augen geschaut, die sie unter langen dunkelbraunen Wimpern erwartungsvoll anstarrten.
Loretta erinnerte sich auch, wie auf einmal eine unbestimmte Furcht sie erfasst hatte, als sie ihrerseits in die dunklen, geheimnisvollen, einem tiefen Brunnen gleichenden Augen der Seherin getaucht war. Plötzlich hatte ihr gegraut und am liebsten hätte sie ihre Frage zurückgenommen. Allein bei der Erinnerung daran, fühlte die Gräfin auch heute noch, wie ein Schauder über ihren Rücken lief.
Es war, als hätte ich geahnt, dass es klüger sei, nicht alles ganz genau zu wissen, was das Leben mir bescheren werde, überlegte Loretta. Damals aber hatte ihre naive Neugierde gesiegt und sie weiter insistieren lassen.
»Nun, wie Ihr wollt, Fräulein!«, hatte Notburga schließlich nachgegeben, mit ernster, beinah grimmiger Miene. »Nach acht Ehejahren Ehe werdet Ihr als Witwe die Rechtsansprüche Eurer drei kleinen Söhne verteidigen müssen. Unterschätzt die Pflichten eines weiblichen Vormundes nicht. Denn als Mumparsin habt Ihr Euch dann mit Feinden herumzuschlagen, die danach trachten, Euer Hab und Gut und das Erbe Eurer Kinder auf schurkische Weise zu schmälern.«
Die Alte schien etwas gesprächiger, nachdem sie ihre Hemmung überwunden hatte. »Man wird denken, Ihr seid ein dummes und hilfloses junges Weib, das man leicht betrügen kann. Jahrelang werdet Ihr um Euer Recht kämpfen müssen. Aber zuletzt werdet Ihr Euch durchsetzen und als strahlende Siegerin aus allen Streitigkeiten hervorgehen.«
»Nun, immerhin: Ende gut, alles gut!« Jugendlicher Leichtsinn hatte ihr damals eine zufriedene Miene beschert.
»Eine Frage habe ich noch!« Und die Seherin, die sich bereits zum Gehen gewandt hatte, blieb gehorsam stehen. »Du sagst, mein Gemahl werde früh sterben. Was bedeutet das für mich, Notburga? Werde ich erneut heiraten oder muss ich für immer einsam bleiben?«
Wie sie sich jetzt mit beträchtlicher Scham entsann, war ihrer Stimme damals große Verzagtheit anzumerken gewesen. Nun, da ihr Gemahl mit seiner schweren Krankheit rang, empfand sie es als zutiefst beschämend, seinerzeit so oberflächlich, ja egoistisch, gedacht zu haben.
Die weise Frau hatte ein Schmunzeln unterdrückt.
»Ihr werdet zwar kein zweites Mal mehr den Bund der Ehe schließen, Mademoiselle. Aber das heißt ja nicht, dass Ihr nie mehr die Freuden der Liebe kosten dürft! Insgesamt wird Euer Leben ein erfülltes sein; mit mancherlei bedeutsamen Ereignissen und sogar einigen Abenteuern, mit traurigen Begebenheiten, aber auch mit mannigfachen Lustbarkeiten und allerlei Zerstreuungen. Aufs Ganze gerechnet werdet Ihr es nicht schlecht treffen, junge Herrin.«
Loretta, der am Krankenbett ihres Liebsten die Schamröte in die bleichen Wangen stieg, wusste noch ganz genau, dass sie vor Erleichterung aufgeatmet hatte.
In einem Wäldchen bei Traben-Trarbach
Die Sonne war bereits hinter dem Horizont verschwunden. Obwohl es tagsüber noch heiß gewesen war, wehte nach Sonnenuntergang ein empfindlich kalter Wind, der die kleine Schar ärmlich gekleideter und mangelhaft ernährter Gestalten frösteln ließ. Auf einer Lichtung in einem abgelegenen Waldstück der Sponheimer Gemarkung hatten sie sich verabredet.
»Wo bleibt denn Frieder bloß?«, brummte Hannes, ein noch junger Bursche, unwillig. »Die Sonne, die mir heut‹ noch ordentlich den Buckel gewärmt hat, ist lang schon weg und von Frieder ist immer noch nichts zu sehen!«
»Ich finde es auch nicht gut, dass wir uns hier die Füße in den Bauch stehen sollen«, maulte Simeon, mit Mitte fünfzig bereits ein alter Mann. Er strich sich fettige graue Zottelhaare unter die Kapuze seines fadenscheinigen Umhangs. Die meisten knurrten zustimmend. Nein, angenehm war die Warterei hier im Freien keineswegs.
»Na, jetzt beschwert euch doch nicht gleich«, versuchte ein anderer die Wogen zu glätten. »Ausgemacht als Zeitpunkt unseres Treffens war ›nach Sonnenuntergang‹ und die Sonne ist grade mal fünf Vaterunser lang verschwunden. Also, habt noch ein bisschen Geduld, Freunde!«
»Du hast leicht reden, dicker Georg«, kreischte eine Alte, die mit zweiundsechzig kaum noch einen Zahn im Mund hatte und die in ihrem dünnen Gewand und dem weitmaschigen Schal, den sie nachlässig um Kopf und Schultern geschlungen hatte, wie Espenlaub zitterte.
»Du hast immerhin Speck auf den Rippen und frierst nicht so leicht wie unsereins, der bloß noch aus Haut und Knochen besteht.«
Die meisten lachten. »Trude hat recht!«, »Stimmt genau!«, »So gut wie dir, Georg, geht es uns leider nicht!«, tönte es auf der kleinen Lichtung.
»Na, jetzt hört aber auf!«, glaubte der Angesprochene, sich verteidigen zu müssen. »Ihr wisst genau, dass es kein Fett ist, das mich so dick ausschauen lässt, sondern bloß Wasser! Ich glaube kaum, dass auch nur einer von euch mit mir tauschen möchte!«
Das ließ die Lästerer verstummen. Es entsprach ja der Wahrheit, dass der dicke Georg kaum noch laufen konnte und neuerdings Schwierigkeiten beim Schnaufen hatte, weil das Wasser nicht nur in seinen Beinen und im Bauch lagerte, sondern mittlerweile in seinem Körper immer höher stieg.
»Horcht!« Die dürre Elsbeth war es, die zur Ruhe mahnte. »Seid doch nicht so laut, ihr Narren! Ich glaube, da kommt einer«, flüsterte die etwa vierzigjährige abgeschundene Magd, die aussah wie sechzig, und reckte ihren sehnigen Hals.
»Verstecken wir uns lieber hinter den Bäumen«, riet einer, »solang wir nicht wissen, wer es ist!«
»Soweit kommt’s noch«, protestierte Hannes. Er war Hufschmied, vierundzwanzig, kräftig gebaut und ließ gleich seine Muskeln spielen. »Wir sind doch genug Leute, um uns notfalls gegen einen einzigen Angreifer wehren zu können, oder?«
»Kann nicht schaden, sich zu verdünnisieren«, murmelte der unfreie Bauer Simeon. Neuerdings hatte er zu allem Übel noch ein steifes Knie und war für schwere Feldarbeit nur eingeschränkt tauglich. Ohne die Hilfe seiner Schwester hätte er nicht gewusst, wie er seine kindisch gewordene Frau und die seit der Geburt ihres letzten Kindes kränkliche Schwiegertochter hätte durchbringen sollen. Im nächsten Augenblick waren alle verschwunden hinter Büschen oder Baumstämmen, nur Hannes blieb trotzig stehen.
»He! Ihr Hosenscheißer!«, schrie der gleich darauf. »Ihr könnt euch wieder her trauen! Es ist Frieder!«
Im Nu umringten die heimlichen ›Verschwörer‹ – so nannten sie sich selbst – den Ankömmling. Er war ihr Anführer und der Initiator dieses Treffens, bei dem sie die Lage und ihr weiteres Vorgehen besprechen wollten.
»Warum kommst du so spät?«, wollten die armen Schlucker als erstes wissen. Und Hannes legte nach: »Ich bin zwar stark, aber Schuhe hab ich keine! Und der Boden hier ist saukalt. Was ist, wenn ich mir die Zehen abfriere?«
»So schnell erfrieren deine Plattfüße schon nicht«, beschied ihn Frieder kurz. »Auf dem Weg hierher habe ich einen weiten Umweg machen müssen. Ich bin nämlich direkt auf eine Gruppe von Starkenburger Jägern zugelaufen. Erst wollte ich mich in einem Haufen Reisig verstecken, aber die Saukerle hatten verdammte Köter dabei. Da musste ich schleunigst Reißaus nehmen. In meiner Not bin ich durch den Bach gewatet, um den Viechern meine Spur zu vergällen. Was glaubst du wohl, wie eiskalt meine Treter sind?«
»Seit wann gehen die Starkenburger Knechte denn hier auf die Jagd? Dieses Gebiet hat sie doch noch nie interessiert, weil hier angeblich kaum Wild ist«, erkundigte sich die dürre Elsbeth giftig. »Ist man denn nirgends mehr vor den Sponheimischen Teufeln sicher?« Der dicke Georg schnaubte und der lahme Simeon fluchte gotteslästerlich.
»Umso wichtiger ist, dass wir uns einig sind!«, riss Frieder erneut die Gesprächsleitung an sich. »Der junge Herr Graf und seine hochnäsige Frau Gemahlin, die mit ihren Bälgern am liebsten nur französisch redet, sowie sein Vater, der alte Graf und die nicht minder eingebildete Gräfin, sie alle sollen ihr blaues Wunder erleben!«
»Klingt wie Musik in meinen Ohren!« Simeon rieb sich erfreut die Hände; sein schmerzendes Knie und die Kälte vergaß er dabei. Auch die übrigen fröstelten auf einmal nicht mehr, als Frieder ihnen den Plan darlegte, den sich der wahre Anführer der Rebellion, der Schultheiß Sibeln von Bulenberg, ausgedacht hatte.
Er und seine erwachsenen Söhne waren es leid, das ganze Leben lang für eine adlige Familie zu schuften, um zum Dank dafür nicht besser als ein Hund behandelt zu werden. Er hetzte insgeheim die Leibeigenen und Hörigen auf, indem er ihnen die ›paradiesischen‹ Zustände in den deutschen Städten, vor allem im nahen Trier, ausmalte.
Um dieser Wohltaten teilhaftig zu werden, bedurfte es nur des beherzten Schrittes, die heimischen Äcker zu verlassen und hinter die schützenden Mauern zu flüchten. Im Laufe der Zeit war es ihm durch Frieder gelungen, eine ganze Reihe von Landbewohnern zu überzeugen. Die gräfliche Familie hatte jedoch noch nicht darauf reagiert, obwohl die Anzahl leerer Hütten dafür sprach, endlich Maßnahmen zu ergreifen.
Frieder, der als ebenfalls höriger Bauer kaum das tägliche Brot für sich, sein ständig schwangeres Weib, sowie die vier überlebenden Kinder, zu beschaffen vermochte, musste erst noch eine wichtige Frage der dürren Elsbeth beantworten. Sie wollte wissen, ob es ihm inzwischen gelungen wäre, sich dem alten Grafen von Sponheim zu nähern.
Das musste er zu seinem Leidwesen verneinen. Nach seinen Worten hatte sich noch keine Gelegenheit ergeben.
»Verrat‹ uns doch, warum du dich unbedingt als Bettler ausgeben willst, wenn du dich dem Sponheimer in den Weg stellst. So tief sind wir doch noch nicht gesunken, dass so eine Maskerade nötig ist«, verlangte der lahme Simeon zu erfahren.
»Ja! Das möcht‹ ich auch gern wissen. Was versprichst du dir eigentlich von einer so demütigenden Aktion?«, erkundigte sich auch Hannes.
»Weil das vermutlich die einzige Gelegenheit sein wird, überhaupt in die Nähe unseres edlen Herrn zu gelangen, Freunde. Wisst ihr überhaupt, wie gut der Graf auf Schritt und Tritt bewacht wird? Ein normaler Mensch kommt höchstens bis auf sechs Schritte an ihn ran, dann hält ihn auch schon einer seiner Knechte mit einer Keule zurück. Aber einen Bettler halten alle für ungefährlich.«
»Jawohl, das klingt vernünftig, Frieder.« Hannes, der Schmied, grinste verstehend. »Ein Bettler ist in aller Regel demütig und unterwürfig wie ein geprügelter Hund, der froh ist, einen Brocken zugeworfen zu kriegen, und wedelt noch dankbar mit dem Schweif.«
»Ich will unseren Unterdrücker und Leuteschinder ja nicht ermorden, sondern ihn einfach einmal aus der Nähe sehen«, fuhr Frieder fort. »Es ist mir sozusagen ein Bedürfnis, Auge in Auge mit dem Mann zu sein, der sich durch seine Geburt höher und besser dünkt als unsereiner. Vom Schultheiß Sibeln habe ich gelernt, dass es immer gut ist, seinen Gegner zu kennen, wenn man ihm ernsthaft schaden will. Und das wollen wir doch alle.«
»Und wie!«, tönte es von verschiedenen Seiten. »Allein soll er hocken in seiner Grafschaft und selber seine verdammten Felder beackern, wenn er etwas zu fressen haben will«, brummte Simeon rachsüchtig.
»Ich habe mir auch schon allerhand scheinheilige Segenswünsche für den Grafen zurechtgelegt, wenn ich ihm als Bettelmann gegenüberstehe und er seine prall gefüllte Geldkatze öffnet und lange wird suchen müssen, ehe er die kleinste Münze herausrückt. Vielleicht packe ich ihn auch noch am Arm und schüttle ihn ein bisschen; vor lauter Begeisterung für seine Großzügigkeit, versteht sich!«
»Wie mutig von dir!«, »Respekt, Frieder!«, »Du bist ja ein Teufelskerl!«, klang es aus der Schar der Aufständischen.
»Warum willst du ihn denn nicht gleich an der Gurgel packen?«, fragte einer der Verschwörer giftig.
»Weil ich das wohl kaum überleben würde, mein Freund.« Unter der ärmlich gekleideten Schar brandete Gelächter auf. Da hatte Frieder wohl Recht.
Eine Weile tauschten sie noch Neuigkeiten aus und lauschten auf die Ermahnungen, die ihnen Frieder vom Schultheiß zukommen ließ, was die absolute Geheimhaltung anbelangte: »Wenn die Obrigkeit mitbekäme, dass wir uns alle in die Stadt Trier davonmachen wollen, kämen wir nicht weit. Man wäre vorbereitet, würde uns abfangen, in Gewahrsam nehmen und vermutlich alle miteinander aufhängen.«
»Pah! Aufhängen!«, krächzte die dürre Else. »Dem Sponheimer wär’s um den Strick zu schad‹. Er tät‹ uns allesamt wie einen Wurf junger Katzen mit Knüppeln erschlagen lassen. Das wär‹ billiger!«
»Wichtig ist, meine lieben Freunde, dass keiner von euch die Nerven verliert, wenn es noch ein Weilchen dauert, bis der Bulenberg das Kommando zum Abhauen gibt. Also: Geduld, ihr Lieben. Unser Tag wird kommen!«
Wenngleich sie alle froren und ihre eiskalten Füße nicht mehr spürten, so hatten Frieders Worte doch ihre Herzen erwärmt. Und diese Wärme nahm ein jeder mit in sein jeweiliges schäbiges Zuhause.
Es geht zu Ende – Erinnerungen an eine glückliche Vergangenheit
Tränen verschleierten den Blick der Gräfin. Heinrich seufzte in unruhigem Schlummer und stöhnte schmerzvoll auf. Lorettas Herz zog sich vor Mitleid zusammen; immer weniger vermochte sie sich den Überlegungen für die nahe Zukunft zu verweigern.
Mein über Alles Geliebter, warum willst du mich und unsere Söhne schon verlassen? Du kannst und darfst mir das nicht antun!, flehte sie stumm, während sie ihre tränenblinden Augen auf den Todkranken richtete. Der wand sich unruhig auf der Matratze. In ihrer Herzensnot wandte sich Loretta an den neben ihr sitzenden Pater Radolf. »Ich kann und will einfach nicht glauben, was der Medicus sagte. Gewiss irrt der gelehrte Mann sich dieses Mal!«
Ohne zu bemerken, was sie tat, umschloss Loretta die Hand ihres Beichtvaters mit ihrer eigenen, ja, drückte sie sogar kräftig, wie um ihrer Aussage mehr Gewicht zu verleihen. »Ihr wisst doch auch, Pater, wie oft mein Gemahl schon auf den Tod gelegen hat und immer hatte der Herrgott ein Einsehen und ließ ihn genesen. Dieses Mal wird es genauso sein. Ich weiß es einfach. Was glaubt Ihr?«
Dem Benediktiner tat es in der Seele weh, mitzuerleben, dass seine junge Herrin offenbar immer noch nicht bereit war, das Unumstößliche anzuerkennen. Für jeden Menschen war ersichtlich: Diese Nacht noch würde der Todesengel nicht mehr von Heinrichs Bett weichen, ohne ihn mit sich zu nehmen.
Radolf von Metz blieb Loretta die Antwort schuldig. Er wollte sie nicht belügen und für die traurige Wahrheit schien seine Herrin noch nicht bereit zu sein.
Die Nachtstunden vergingen quälend langsam und Dutzende von brennenden Kerzen, von den Mägden rund um das Bett des Grafen in silbernen Leuchtern aufgesteckt, brannten nieder. Der Duft von heißem Bienenwachs erfüllte das Gemach und überlagerte den üblen Geruch von Krankheit und baldigem Tod. So wie die Wachslichter allmählich erloschen und der Raum mehr und mehr in Düsternis versank, so verhielt es sich auch mit Heinrichs Lebenslicht. Gleich etlichen seiner Untertanen war es auch ihm in jener Nacht vom Schicksal vorgegeben, sich für immer zu verabschieden.
Kräftig war Lorettas Gatte nie gewesen. Bereits von Kind an schwächlich und häufig von Krankheiten geplagt, hatten die Ärzte seinen Eltern, Graf Johann und Gräfin Katharina, wenig Hoffnung gemacht, ihrem einzigen Sohn stünde ein langes Leben bevor.
Ein tragisches Wissen, aus dem beide jedoch nie ein Hehl machten. Nur seine Gemahlin Loretta hatte bisher erfolgreich jeden Gedanken daran aus ihrem Gedächtnis verbannt.
Um die Sponheimer Linie nicht aussterben zu lassen, war man schon frühzeitig bestrebt, dem Erben eine Gemahlin zu suchen. Am günstigsten erschien die Verbindung mit dem elsässischen Geschlecht derer von Salm aus den Vogesen. So wurde Loretta von Salm, wie von Notburga vorausgesehen, bereits kurz nach ihrem zwölften Geburtstag mit Heinrich von Sponheim verlobt. Nach drei Jahren sollte die Hochzeit sein.
Lorettas Eltern hatten ihre Tochter keineswegs gezwungen, den um zehn Jahre älteren jungen Mann zu heiraten. Aber sie fand Heinrich sehr hübsch von Angesicht und angenehm in seiner Wesensart. Das hatte ihr genügt.
Graf Johann II. wollte seinem Sohn anlässlich seiner Vermählung die Feste Herrstein übergeben und Loretta würde von ihren Eltern eine Mitgift von 2200 Pfund Metzer Pfennigen erhalten.
Um mich jugendliche Braut ja nicht abtrünnig werden zu lassen, schenkte mir der zukünftige Schwiegervater bis zur Hochzeit sogar alljährlich eine Summe von einhundert Pfund Hellern als Schmuckgeld, dachte Loretta jetzt gerührt und blickte hinüber zum Bett ihres Gemahls, der sich laut Medicus anschickte, seinen letzten Kampf zu kämpfen.
Was versteht Dottore Girolamo Croce schon von der Lebensgier meines Gemahls, der es noch jedes Mal geschafft hat, sich von etlichen Sterbelagern zu erheben, wie Phönix aus der Asche, um weiterzuleben mit mir und seinen drei prächtigen Söhnen, dachte sie nach wie vor unbeirrt.
Seit sie ihn das erste Mal gesehen hatte, war sie in den Edelmann mit dem glatten braunen Haar, den dunklen Augen, der kühnen Nase und dem weichen Mund verliebt.
»Als Johanns Nachfolger wird er einst über die Gebiete zwischen Soonwald, Nahe und Mosel, die so genannte hintere Grafschaft oder die Starkenburger Linie, gebieten. Während ein anderer Zweig der Sponheimer die Ländereien zwischen Rhein, Nahe und Soonwald, die vordere Grafschaft oder die Kreuznacher Linie beherrscht. Und wer weiß, womöglich ergibt es sich in der Zukunft, dass beide Linien wieder zusammenfinden?«, hatte Lorettas Mutter sich familienpolitischen Spekulationen hingegeben. Überdies hätten sämtliche Sponheimer sich durch eigene Verdienste, sowie durch Verwandtschaft mit Königen und Kaisern, ansehnliche Besitztümer, Macht und Einfluss erworben, pries sie die Vorzüge ihres Wunsch-Schwiegersohnes.
Heinrich selbst, ein mittelgroßer, überschlanker, stets etwas kränklich, dennoch sehr gut aussehender Herr, mit seelenvollen dunkelbraunen Augen, erschien Loretta freundlich und wohlerzogen. In der Tat war unsere Ehe, trotz vieler Unpässlichkeiten und Krankheiten meines Gemahls, sehr glücklich, dachte Loretta. Gott der Herr hat uns mit drei gesunden Söhnen gesegnet; genau, wie Notburga es mir einst geweissagt hat.
Gleich darauf erschrak sie: Es wurde ihr bewusst, zum ersten Mal an Heinrich und ihre Ehe in der Vergangenheitsform gedacht zu haben.
Die junge Frau wischte sich heimlich die Tränen ab und unterdrückte ein Schluchzen, als sie sich entsann, wie glücklich Heinrich stets gewesen war, wenn er davon erzählte, wie er als junger Mann von zwanzig Jahren den römisch-deutschen König Heinrich VII. im Jahre 1310 auf seinem prachtvollen Zug nach Italien hatte begleiten dürfen.
Dort war der König 1312 als erster Deutscher – nach beinahe einem Jahrhundert – zum Kaiser gekrönt worden. Und er, Heinrich von Sponheim, war dabei gewesen. Ein Erlebnis, das unvergesslich in seinem Gedächtnis und in seinem Herzen haften blieb. »Allein die Ehre, die mir damals widerfahren ist, rechtfertigt es schon, überhaupt geboren worden zu sein«, pflegte er zu sagen. Sie erinnerte sich auch, wie stolz sie jedes Mal auf ihn gewesen war, sooft er davon sprach.
Die angestrebte Erneuerung des Kaisertums in Italien war allerdings eine Illusion geblieben, denn Kaiser Heinrich VII. erkrankte bereits im Jahr darauf an Malaria und starb am 24. August 1313 in der Nähe von Siena.
Loretta wischte sich erneut mit einem Tüchlein über die verweinten Augen. Ihr Blick wanderte hinüber zum Bett, auf dem ihr Gatte schwer keuchend, allem Anschein nach aber ohne Bewusstsein, mit dem Tode rang.
Die Turmuhr der Kapelle im Burghof schlug in diesem Augenblick Mitternacht; die Atemzüge des Sterbenden wurden qualvoller, setzten zeitweise aus. Mühsam kämpfte Graf Heinrich um jedes Quäntchen Atemluft, das ihm eine weitere winzige Zeitspanne des Überlebens erlauben sollte.
Loretta hielt es nicht mehr auf der Sitzbank. Auch Pater Radolf erhob sich und näherte sich dem Bett. Schweißnass klebten die dunklen Haare auf der Stirn des Grafen. Dessen Gemahlin zog ein Seidentüchlein aus dem Ärmel ihrer langen hellblauen Tunika und tupfte Heinrich die Schweißperlen ab. Dann warf sie sich vor dem Bett auf die Knie. Schweigend verharrte der Mönch hinter ihr.
»Oh, seht doch, Pater!«, rief die junge Frau auf einmal und wandte sich nach dem Benediktiner um. »Mein Gemahl ist nicht mehr so blass! Seine Wangen zeigen eine rosige Färbung. Ob dies vielleicht der letzte Aderlass bewirkt hat?«, fragte sie aufgeregt. »Aber nein!«, verbesserte sie sich gleich darauf. »Die Anzeichen der Besserung sind gewiss die Folge der Letzten Ölung und der heiligen Wegzehrung, die Ihr meinem Gemahl vor zwei Stunden gespendet habt, Pater. Nicht selten wirkt dieses Sakrament doch heilend, nicht wahr?«
Der Mönch verspürte ein schmerzhaftes Ziehen in der Brust. Sein Mitleid mit der Gräfin, die er von Kindheit an kannte und wie ein Vater liebte, war unendlich. Sollte er sie aus Barmherzigkeit belügen – oder bei der Wahrheit bleiben? Er, der schon an so vielen Sterbelagern ausgeharrt hatte, erkannte nur zu genau die Zeichen des unmittelbar bevorstehenden Todes. Es war keineswegs ungewöhnlich, dass in den letzten Stunden vor ihrem Dahinscheiden die Betroffenen munter, ja, häufig sogar auf dem Wege der Genesung zu sein schienen. Oftmals konnten die Angehörigen den Eindruck gewinnen, der aussichtslose Zustand wende sich definitiv zum Guten.
Für Pater Radolf jedoch galt es als untrügliches Zeichen für die Bereitwilligkeit der Sterbenden, Abschied vom irdischen Leben zu nehmen; versöhnt mit ihrem Schicksal, freuten sich die meisten sogar darauf, bald in Gottes Nähe zu gelangen. Nicht wenige starben mit einem Lächeln auf den Lippen.
Eine Antwort blieb ihm erspart, denn Loretta drehte sich erneut zu ihrem Gatten um. Sie griff nach Heinrichs Hand, in die der Pater vorhin ein kleines Kruzifix aus Pinienholz gelegt hatte, das aus dem Heiligen Land stammte und vor Jahren von einem Kreuzfahrer der Familie Sponheim mitgebracht worden war.
»Mein Liebster«, hörte der Pater die junge Frau sagen, »auch wenn Ihr mich im Augenblick nicht hören könnt, weiß ich, dass Ihr Euch auf dem Wege der Besserung befindet- Ich könnte jubeln vor Freude!«
Worte, die wiederum den Mönch wie ein Stich ins Herz trafen. »Auch die Sponheimer Untertanen werden glücklich sein, ihren guten Herrn bald wieder zu haben«, fuhr Loretta euphorisch fort.
Ironie des Schicksals, dass beinahe zur gleichen Zeit eine junge unglückliche Mutter ihn mitsamt seinem Vater verfluchte.
»Sobald Ihr ganz genesen seid, Heinrich, wollen wir gemeinsam überlegen, was wir der Kirche zum Dank für Eure Rettung spenden. Auch die weite Pilgerfahrt zu den Heiligen Stätten der Christenheit fände ich durchaus angemessen.«
In diesem Augenblick erwachte der Sterbende, öffnete weit die tief in ihre Höhlen gesunkenen Augen, umfasste mit erstaunlich klarem Blick seine Gemahlin und den Mönch – und lächelte.
Mit großer Kraftanstrengung versuchte Heinrich zu sprechen. Seine Stimme versagte; aber er schien entschlossen, ein letztes Mal das Wort an seine Frau zu richten. Nur mit Mühe waren die ganz leise gesprochenen Sätze zu verstehen. Loretta erschien es ein weiteres Zeichen der Gesundung. Sie versuchte, ihren Gatten am Sprechen zu hindern.
»Strengt Euch nicht an, mein liebster Herr«, bat sie ihn. »Ihr müsst erst wieder zu Kräften kommen, dann könnt Ihr mir und Pater Radolf Eure Wünsche mitteilen. Aber jetzt solltet Ihr Euch nur ausruhen, Heinrich, um recht bald wieder ganz obenauf zu sein.«
Der Blick des Todgeweihten verdüsterte sich daraufhin und sein Mund verzog sich unwillig. Der Graf unternahm sogar die Anstrengung, verneinend sein Haupt von einer Seite zur anderen zu drehen. Für Radolf von Metz Anlass, sich einzumischen.
»Madame! Ich bitte Euch, lasst Euren Gemahl sprechen. Hört genau hin: Es sind seine letzten Worte. Ihr solltet sie als das Vermächtnis des Grafen getreulich in Eurem Herzen bewahren.«
Sachte zog er die fassungslose Gräfin ein Stück weit zurück, als sie Anstalten machte, ihren Kopf auf Heinrichs Brust zu legen. Ungewollt hätte sie ihm dadurch das ohnehin eingeschränkt mögliche Atmen zusätzlich erschwert.
»Habt Dank, Pater«, hörte Loretta gleich darauf ihren Mann mit bedeutend kräftigerer Stimme sagen. »Du musst jetzt sehr stark sein, Frau«, fuhr der Graf mühsam fort. »Du allein bist nun verantwortlich für unsere Kinder – vor allem für meinen Erben Johann. Mein Vater wird dir helfen, so gut er kann und auch meine Mutter wird dich gerne als ihre Tochter annehmen und dir und unseren Söhnen zur Seite stehen.«
Der im Sterben Liegende musste eine Pause einlegen. Das Sprechen fiel ihm zunehmend schwerer. Bei jedem Atemzug war ein schreckliches Rasseln in seiner Brust zu hören. Loretta verhielt sich jetzt ganz still; wie erstarrt stand sie vor Heinrichs Bett und lauschte der Stimme des Geliebten, als er erneut das Wort an sie richtete.
»Ich habe dich über alles geliebt, Loretta«, versicherte ihr der Graf, dessen Antlitz jetzt beinahe so weiß war wie das Laken seines Bettes. »Du warst die beste Frau, die ich mir wünschen konnte und dazu die beste Mutter meiner Kinder. Dafür danke ich dir, Geliebte. Ich wünsche dir für die Zukunft, die du ab jetzt ohne mich meistern wirst, Liebste, das Allerbeste. Dazu gehört, dass du, die du noch so jung bist, einen anderen Gemahl findest, der deiner würdig ist und meinen Kindern ein guter Vater sein wird.«
Um zu verhindern, von Loretta unterbrochen zu werden, fuhr er unmittelbar fort: »Versprich mir, Liebste, dass du dich nicht in Trauer vergräbst. Schon um unserer kleinen Söhne willen, die eine starke und umsichtige Mutter brauchen, musst du dich bemühen, ihnen ein Heim zu geben, in dem sie glücklich aufwachsen können. Unser Pater Radolf wird dir Stab und Stütze sein.«
Heinrich fasste den Mönch scharf ins Auge. Als er dessen zustimmendes Nicken erkannte, entspannte sich seine sorgenvolle Miene. Mit großer Mühe holte der Kranke den Atem aus seinen nahezu zerstörten Lungen. Laut Medicus waren sie bereits voll Wasser.
»Geliebte Frau, bete für mich! Bitte beim Schöpfer Himmels und der Erde, dass er mich gnädig aufnehmen möge in sein Reich. Bitte die Jungfrau Maria und alle Heiligen darum, dass mir armem Sünder Barmherzigkeit widerfahre und mir als Strafe für meine Sünden die Ewigkeit nicht zum höllischen Schrecknis gerate.«
Kaum hatte der Graf diese letzte Bitte ausgesprochen, schien seine Lebenskraft zu Ende. Ermattet schloss Heinrich von Sponheim die Augen und seine Gesichtszüge verfielen regelrecht vor Lorettas Augen.
»Alles wird so geschehen, wie Ihr es wünscht, mein Gebieter, so es denn wirklich so kommen sollte, wie Ihr glaubt!«
Erschüttert wandte die Gräfin sich an ihren Beichtvater: »Noch habe ich die Hoffnung auf ein Wunder des Herrn nicht ganz aufgegeben, Pater. Ich will beten für Heinrich und seine Genesung. Und noch etwas, Pater: Niemals werde ich unseren Kindern einen Stiefvater zumuten! Für mich selbst will ich schwören, dass niemals ein anderer Mann als Heinrich das eheliche Lager mit mir teilen wird.«
Pater Radolf hätte es vorgezogen, Loretta würde sich dieses Schwurs, der ihm voreilig erschien, enthalten und kniete sich auf der anderen Seite des Bettes nieder. Wie es einem Geistlichen anstand, dachte er dabei an die unsterbliche Seele des mit dem Tode Ringenden, der kaum noch atmete, sondern bereit schien, einzugehen in Gottes Herrlichkeit.
Erinnerung und Abschied
Lorettas Gedanken hingegen schweiften während der folgenden Stunde wiederum ab in die Vergangenheit, die sie gemeinsam mit Heinrich erlebt hatte und die für immer Teil ihres Bewusstseins bleiben würde. Sie sah sich selbst als frisch angetraute Ehefrau, wie sie in der Hochzeitsnacht voll banger Erwartung der Ankunft des Gatten im Schlafgemach entgegengesehen hatte.
Getuschel und merkwürdige Andeutungen der Mägde, ja, selbst eine Ermahnung der eigenen Mutter, dem Vermählten in allem willfährig zu sein – auch wenn das gewisse Schmerzen bedeuten konnte – hatten sie eher verwirrt, als neugierig gemacht. Besonders der Hinweis, dem Ehemann keinesfalls Unwillen oder gar Widerwillen zu bezeigen bei dem, was er fordern werde, hatte Loretta stutzig gemacht. Gütiger Himmel! War Heiraten so schlimm? Weshalb hatte ihr das vorher keiner gesagt? Zumindest Pater Radolf, dem sie blind vertraute, hätte sie doch warnen müssen.
So jung sie auch gewesen war, wusste sie natürlich, dass Hochzeiten beim Adel nicht stattfanden, um Vergnügen zu haben, sondern politischer Bündnisse wegen, um größeren Reichtums, vermehrten Einflusses und höheren Ansehens willen, da man im Allgemeinen Ländereien und Untertanen hinzu gewann. Nach einer Weile hatte aber ihr jugendlicher Optimismus gesiegt.
Ihr frisch angetrauter Gemahl, ein schlanker Herr mit braunem schulterlangem Haar, dessen dunkelbraune Augen zuweilen etwas melancholisch in die Welt blickten, war ihr heute bei der Hochzeitsfeier ganz besonders liebenswert erschienen. In diese Augen, die kühn vorspringende Nase und in seinen breiten Mund mit den vollen roten Lippen hatte sie sich schon als Zwölfjährige verliebt gehabt, als sie ihm am Hof ihres Vaters zum ersten Mal begegnet war.
Überaus höflich war er zu ihr gewesen – ebenso wie die wenigen Male, die sie ihn vor ihrer Vermählung getroffen hatte. Und gar am heutigen Tag, da er sich zum Hochzeitsfest so feierlich herausgeputzt hatte mit einem weißen seidenen Hemd mit weiten gefältelten Ärmeln, einem Gold bestickten Wams und einem schwarzen kurzen Überrock mit rotem Seidenfutter und engen weißen Strumpfhosen in spitz zulaufenden Schuhen.
Wie ein junger Gott hast du ausgesehen, Geliebter, dachte sie voll Zärtlichkeit, während sie jetzt auf dem Boden vor seinem Lager kniete. Und außerdem schienst auch du sehr in mich verliebt gewesen zu sein.
So war es ihr damals, als sie noch jungfräulich war, eher unwahrscheinlich vorgekommen, dass er sich nach der Hochzeit als ein Ehemann erweisen sollte, der ihr brutal zusetzte. Sie erinnerte sich sogar noch an die Sprüche einer munteren Stallmagd, die sie kurz vor ihrer Heirat belauscht hatte, als diese sich mit zwei anderen Mädchen darüber ausließ, wie schön und aufregend sie es gefunden habe, letzte Nacht bei einem der Knechte zu liegen.
Loretta klang die Stimme des jungen Frauenzimmers heute noch im Ohr, wie es kichernd von dem unvergleichlichen Genuss geschwärmt hatte, von einem Liebhaber genommen worden zu sein, der seine Sache überaus gut gemacht habe. Ja, die unkeusche Magd hatte sich sogar zu der Aussage verstiegen: »In den Augenblicken, in denen der Schaft eines Mannes sich in meinem Bauch bewegt, würde es mir auch nichts ausmachen, wenn ich sterben müsste. Im Gegenteil! Dabei zu sterben, stelle ich mir als den schönsten Tod überhaupt vor!«
Beide Mägde hatten dann in schönstem Einvernehmen dazu gelacht.
Der unerfahrenen Loretta war das Ganze seltsam vorgekommen. Sicher hatte das dumme Weibsbild maßlos übertrieben. Aber eines schien ihr doch als nahezu gewiss: So schrecklich, wie manche Frauen behaupteten, konnten die Dinge, die in der ersten gemeinsamen Nacht eines Hochzeitspaares geschahen, nun doch nicht sein. Immerhin überlebten die Frauen sie in aller Regel – auch ihre eigene Mutter hatte sie überstanden. Und bekanntlich liebte Madame Jeanne ihren Gemahl noch immer.
Erneut wanderten Lorettas Gedanken zurück in die Vergangenheit. Als Heinrich, der ihr genügend Zeit gegeben hatte, sich auf ihn vorzubereiten im Schlafgemach eintraf, war Loretta einigermaßen zuversichtlich gewesen. Die nicht mehr ganz nüchterne Schar von Verwandten und Freunden, die das Paar vor einer halben Stunde bis zur Tür des Brautzimmers geleitet hatte, war von Heinrich fortgeschickt worden. Nach altem Brauch sollten sie bezeugen, dass und wie das junge Paar im Bett nebeneinander lag; aber diese peinliche Zeremonie hatte ihnen ihr Ehemann erspart.
Bei der Erinnerung daran, wie liebevoll und zartfühlend ihr Gemahl gewesen war, schwammen Lorettas Augen erneut in Tränen. Wie er versucht hatte, ihr die Befürchtung zu nehmen, er werde Unmögliches und unsäglich Schmerzvolles von ihr fordern. Seine Küsse und das Streicheln an Stellen ihres Körpers, die nur ein Ehemann berühren durfte, gefielen ihr ausnehmend gut; aber als ihr schließlich aufging, dass ein ihr riesig erscheinender Körperteil ihres Gatten dazu bestimmt war, in ihr zartes Inneres einzudringen, war sie beinahe vor Schreck in Ohnmacht gefallen.
Wie ein vollendeter Liebhaber hatte er sie lange gereizt und bereit gemacht für die Vereinigung, wie es nun einmal üblich war zwischen ehelich Verbundenen in der Hochzeitsnacht, um am nächsten Morgen mittels einiger Blutflecken auf dem Laken all den Neugierigen zu beweisen, dass die Gefreite noch Jungfrau gewesen.
Ja, sogar Lust hatte sie empfunden bei dieser allerersten Vereinigung mit ihrem Ehemann – allen Ermahnungen der Kirche zum Trotz, die dies gerne auch bei Verheirateten als Sünde deklarieren wollte. Sie hielt sich lieber an Pater Radolf, der ihr versichert hatte, in der Ehe seien diese süßen Empfindungen für eine Frau durchaus wünschenswert.
Mein Gott, wie lang ist das alles her!, dachte Loretta bedrückt. Unverwandt hielt sie die Hand des Geliebten, die ihr viel zu kalt erschien. Sie drückte sie und erwartete insgeheim, dass er den Druck – zumindest andeutungsweise – erwidern möge. Als dies ausblieb, schalt sie sich selbst als ungeduldig und undankbar. Heinrich – kaum dem Tode entronnen – war dafür noch viel zu schwach. Dass er vorhin so lange gesprochen hatte, galt ihr als untrügliches Zeichen dafür, dass Medicus und Beichtvater sich irrten und noch genügend Lebenskraft in diesem hinfälligen Körper schlummerte.
Dass dies ein Anzeichen allerletzten Aufbäumens gewesen sein könnte, kam ihr nicht in den Sinn. In ihrem Inneren beschwor die junge Frau jetzt eine andere Szene herauf. Es war der Augenblick, als er kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes Johann an ihr Schmerzenslager trat. Niemals würde sie den glücklichen und stolzen Ausdruck seiner strahlenden Augen vergessen. Sein Mund unter dem braunschwarzen Oberlippenbart, den er neuerdings trug und der ihm so gut zu Gesicht stand, hatte gelacht, als er sie küsste und ihr dankte, ehe er dem Kind, das in Windeln gewickelt in ihrem Arm ruhte, ebenfalls einen Kuss auf das kahle Köpfchen drückte.
»Ich danke Euch für meinen Stammhalter und Erben des Hauses Sponheim, der den Namen seines Großvaters Johann erhalten soll«, hatte er gesagt und ihr einen kostbaren goldenen Ring mit einem funkelnden Smaragd auf einen Finger ihrer rechten Hand gesteckt, den sie seitdem nie mehr abgelegt hatte.
Oh, Heinrich du bist ein ebenso guter Vater, wie du ein vollendeter Ehemann bist, dachte Loretta. Und ich bin noch so jung. Das ganze Leben, zumindest viele gemeinsame und glückliche Jahre liegen noch vor uns. Spontan beschloss sie, ihm noch viele weitere Kinder zu schenken.
Da ließ etwas sie aus ihren Gedanken aufschrecken. Im ersten Augenblick wusste sie nicht, was die Ursache war. Dann überlief es sie allerdings wie Eiswasser, als ihr die plötzliche Totenstille im Gemach auffiel. Die mühsam keuchenden, zuletzt immer schwächer werdenden Atemzüge hatten gänzlich aufgehört. Gleichzeitig machte sie die erschreckende Entdeckung, dass die Hand ihres Gemahls, die sie immer noch in der ihren hielt, sich auf einmal kalt wie Eis anfühlte.
Wie gelähmt war Loretta zu keinerlei Regung fähig. Was sie zur Besinnung brachte, war der leise Gesang des Mönchs, der einen Choral angestimmt hatte, den man im Kloster üblicherweise intonierte, um die Seele eines heimgegangenen Bruders hinüber zu geleiten in die Gefilde der Ewigkeit.
Laut aufschluchzend ließ Loretta die Hand Heinrichs los und warf sich über seinen Leichnam. Lange lag sie so. Als sie endlich in sein Gesicht zu blicken wagte, schien er mit geschlossenen Augen zu lächeln. Ganz leise und unspektakulär hatte der Graf sich davongeschlichen, um seine Liebste nicht zu erschrecken.
Die junge Frau weinte lange und hemmungslos, begleitet vom leisen Gesang des Paters, der selbst mit den Tränen kämpfte. Auch er hatte mit dem Tod Herrn Heinrichs einen herben Verlust erlitten. In seinem Herzen schwor er sich, weiterhin nur für Loretta da zu sein, ihr und ihren Söhnen bedingungslos zu dienen, sie vor Ungemach so gut er es vermochte, zu beschützen und dafür zu sorgen, dass ihr Herz nicht vor Kummer brach.
Lange vor Sonnenaufgang trafen zwei Nonnen des nahe liegenden Zisterzienserinnenklosters ein, um den Grafen zu waschen und herzurichten, um ihn anschließend in einem Eichensarg vor dem Altar der Burgkapelle auf einem mit Blumen geschmückten Katafalk, im Strahlenkranz hunderter von Kerzen, aufzubahren. Drei Tage lang würden Verwandte, Freunde, Dienstmannen und Gesinde, sowie andere Untertanen Gelegenheit haben, von ihrem Herrn Abschied zu nehmen, ehe er in der Zisterzienserabtei von Himmerod beigesetzt würde.
»Auf ein Wort, edle Frau«, wagte der Pater nach einer Weile, Loretta anzusprechen. Mittlerweile hatte sie aufgehört, laut zu weinen und zu klagen; sie schluchzte nur noch leise vor sich hin. Der Mönch legte ihr die Hand leicht auf die Schulter. »Ihr habt die Gewissheit, dass Euer Gemahl, wohlversehen mit den Tröstungen der heiligen Mutter Kirche, zum Herrn ins Ewige Reich eingegangen ist. Jetzt ist es an Euch, seine Arbeit innerhalb der Familie fortzusetzen.«
»Ihr habt recht, Pater«, ermannte sich die junge Gräfin und hob das Haupt. »Das Wichtigste erscheint mir, meinen Kindern den Tod ihres Vaters nahe zu bringen. Bei unserem Ältesten, Johann, dem künftigen Grafen von Sponheim, wird es am schwersten sein. Er ist sieben Jahre alt und begreift durchaus die Tragweite dieses herben Verlustes. Bei Heinrich, der fast fünf Jahre zählt, ist es einfacher. Er wird in seiner Kindlichkeit glauben, dass sein lieber Vater nur einen längeren Spaziergang in den Himmel gemacht hat, um ihn von dort oben aus zu beobachten, ob er seiner Maman gehorsam ist. Und was Gottfried anbetrifft, ist es fraglich, ob er überhaupt versteht, was geschehen ist. Mit seinen gerade mal zwei Jahren denkt er gewiss, sein Papa habe nur eine kurze Reise unternommen und kehre jeden Augenblick zurück.«
Erneut wurde Loretta von einem Weinkrampf geschüttelt. Ihr Beichtvater ließ ihr Zeit, sich zu beruhigen. Ihr Schmerz griff ihm ungeheuer ans Herz; im Stillen schwor er sich, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um ihr das Gefühl zu nehmen, ganz allein vor einem Riesenberg an Aufgaben und Verantwortung zu stehen, der auf ihr lastete.
»Wenn Ihr es wünscht, werde ich bei dem Gespräch mit Euren Kindern anwesend sein, um ihre Fragen zu beantworten, Madame«, bot er spontan seine Hilfe an, worauf ihn die Gräfin dankbar, wenn auch mit Tränen in den Augen, anblickte.
»Jetzt aber solltet Ihr Euch endlich Ruhe gönnen, mein Kind. Ich werde in der Kapelle Totenwache halten bei meinem Herrn, wie ich früher schon oft bei einem meiner Mitbrüder gewacht habe. Bald wird der Morgen grauen und Ihr müsst dann stark sein als Herrin von Sponheim, als Mutter Eurer Söhne und als ein Vorbild all Euren Dienern, Knechten und Hintersassen.«
Dieses Mal gehorchte die Gräfin ihrem Beichtvater, nachdem sie ihren Gatten ein letztes Mal auf die blassen eisigen Lippen geküsst hatte. Schleppenden Schrittes, niedergedrückt von Trauer, Sorgen und Gram verließ sie die Burgkapelle.
Der Pater war sicher, bereits am nächsten Morgen werde Loretta sich aufrecht halten, das schöne stolze Haupt erhoben, den Blick nach vorne gerichtet und ihren Schmerz vor fremden Augen verbergen, wie es sich schickte für eine Dame von hohem Adel, guter Erziehung und dem Bewusstsein großer Verantwortung. Niemals würde es die Gräfin dulden, dass andere Menschen etwas von ihrem Kummer und ihrer Verzagtheit bemerkten. Radolf von Metz seufzte; am meisten graute ihm vor der Aufgabe, den Kindern den Tod ihres Vaters begreiflich zu machen.
Das Begräbnis und die endlosen Besuche derjenigen, die ihr Mitgefühl, ihre Betroffenheit und ihre Trauer auszudrücken gedachten, lagen wie ein Stein auf Lorettas Seele. Pater Radolf war stolz auf seine Herrin: Sie blieb stark. Blass und abgezehrt, aber ungebeugt und tränenlos, mit ernster Würde ließ sie das Défilé der Trauergäste über sich ergehen, reichte jedem Einzelnen die Hand, nahm die Kondolenzwünsche mit ernster Miene entgegen und spendete den zahlreichen Männern und Frauen Worte des Trostes. Worte, die sie selbst wohl am nötigsten gebraucht hätte.
Auch ihre Söhne verhielten sich angemessen. Wobei sie es als eine Art von Glücksfall betrachtete, dass nur die beiden Älteren einigermaßen begriffen, was geschehen war, während der Jüngste in der Tat davon auszugehen schien, der geliebte Papa werde bald wieder zuhause sein.
Der bedeutendste Ankömmling auf Schloss Wolfstein war Lorettas Schwiegervater, Graf Johann II. von Sponheim-Starkenburg. Er hatte die Frau seines Sohnes von Anfang an geliebt wie eine eigene Tochter. Jetzt brach es ihm schier das Herz, als er sie anlässlich der Trauerfeier sah, hoch aufgerichtet, in den schwarzen Gewändern noch schmaler und zerbrechlicher wirkend, als sie in Wahrheit war, das schöne bleiche Antlitz hinter einem dichten Schleier verborgen.
Das Bild, das sich ihm bot, würde dem alten Grafen unvergesslich bleiben: An jeder Hand führte sie einen Sohn, während ihr Ältester vor ihr im Trauerzug allein marschierte und mit gefasster Miene zu der kleinen Burgkapelle schritt, in der die Totenfeier abgehalten wurde. Die Überführung des Leichnams nach der Abtei Himmerod in die Familiengruft würde man erst später vollziehen.