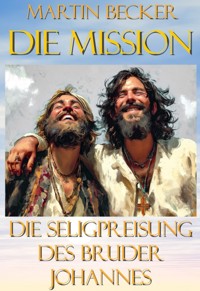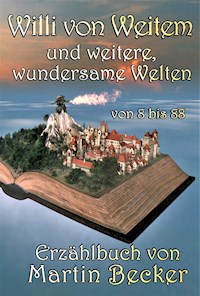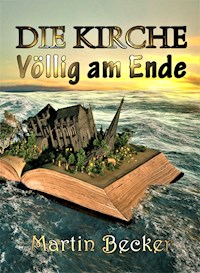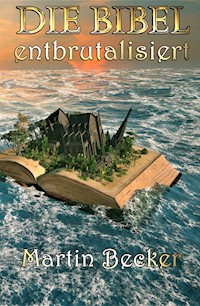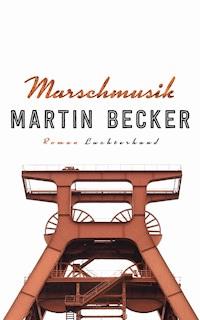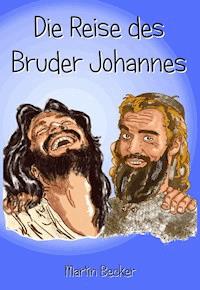5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein junger Mann kommt zurück in die Kleinstadt seiner Kindheit, um das Haus seines verstorbenen Vaters zu verkaufen und mit seiner Vergangenheit abzurechnen. Er will seine Mission erfüllen und so schnell wie möglich wieder verschwinden. Nichts könnte ihn halten. Aber dann sieht er eine Frau und verliebt sich in ihre Augen, steinalt und traurig wie die Welt. Mit einem Mal ist er nicht mehr der Sohn, der das Gestern überwinden will. Mit einem Mal ist er nur noch ein Mann, der eine Frau liebt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Martin Becker
DERRESTDERNACHT
Roman
Luchterhand Literaturverlag
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. © 2014 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Satz: Uhl + Massopust, Aalen Alle Rechte vorbehalten. ISBN 978-3-641-12296-6 V003 www.luchterhand-literaturverlag.de www.facebook.de/luchterhandverlag
»Ich kann nicht über ihn schreiben, ich kann nur durch die Felder laufen und durch die Gräben klettern, ihm nach.«
Brief von Samuel Beckett an Thomas McGreevy, 02.07.1933
I ANFANGDERNACHT
1 DIEAMEISEN
WAS IHNEN PERSÖNLICHerscheint, das verbrennen Sie. Räumen Sie es in Kartons, bringen Sie es in den Garten, zünden Sie es an.
Unser Haus wird geräumt. Ein Jahr nach dem Verschwinden meines Vaters wird auch unser Haus verschwinden, endgültig, weil die Zigarettenpapierfabrik es mir abgekauft hat.
Schnaufend tragen sie die ersten schweren Möbel vor die Tür. Sie stöhnen über das Gewicht der Anrichte aus der Küche, sie stöhnen über den schweren Bauernschrank, sie stöhnen über das sperrige Krankenbett aus Eisen, an dem die Handfesseln herunterhängen wie tote Hühner. Es gibt einen Container, der ist für den Unrat. Die meisten Sachen in unserem Haus sind Müll. Es gibt einen Laster, der ist für die Sachen, die noch zu verscherbeln sind. Sein Motor läuft stundenlang, unentwegt, als würden auch die verwertbaren Dinge unseres Hauses in Wahrheit direkt zermalmt und zermahlen und unter dem Laster als Staub zurück auf die Erde rieseln. Unser Haus riecht nach Benzin, sonst nach nichts mehr.
Ich bin mit dem Zug aus dem Norden gekommen, nichts anderes bei mir als meinen Rucksack, nichts anderes bei mir als meine dünne Jacke. Ich habe mich nicht gewaschen, ich habe nicht gegessen, ich habe mir nichts Frisches angezogen, ich bin sofort zum Haus, wir hatten Verspätung, und ich wollte nicht zu spät sein. Die Männer standen schon rauchend da. Sie begrüßten mich mit zu festem Händedruck. Alle drei kompakt und muskulös wie die Wildschweine. Alle drei mit kurzen Hemden und Hosen. Und alle drei stumm. Sie zeigten es mir, indem sie ihre Hände an die Lippen führten und so taten, als würden sie ihre Münder mit einem Schlüssel abschließen. Die stummen Männer. Sie erwarten klare Anweisungen, die ich ihnen nicht geben kann. Schmeißen Sie alles weg, sage ich, aber damit sind sie nicht zufrieden. Nehmen Sie mit, was sich verkaufen lässt, der Rest kommt auf den Müll. Auch das reicht ihnen nicht. Werfen Sie fort, was nicht mehr zu gebrauchen ist, sage ich, behalten Sie alles, woraus sich noch was machen lässt, sage ich, und was Ihnen persönlich erscheint, das verbrennen Sie.
Wir müssen die Zimmer vorher gemeinsam besichtigen, schreibt einer der Stummen auf seinen Notizblock, sonst kommen Reklamationen, sonst wird behauptet, wir hätten die teuren Sachen unterschlagen, man erlebt alles Mögliche, wenn man Häuser ausräumt. Jetzt übernimmt der zweite Mann den Stift: Nichts macht den Menschen verzweifelter, schreibt er, als der Verlust. Es ist, schreibt er, als würde man den Menschen an den Eingeweiden zerren, da kann man doch verstehen, dass er zur Hysterie neigt, dass er die falschen Leute zur Verantwortung zieht und uns die Schuld an der Misere gibt, obwohl wir doch nur das tun, was er uns sagt. Jetzt hat der dritte Mann den Stift übernommen: Deshalb müssen Sie mit uns durch die Zimmer gehen, Sie müssen sagen, das kommt weg und das bleibt, und dann müssen Sie dafür unterschreiben.
Ich schleiche hinter ihnen her, fremd geworden in meinem eigenen Haus. Zuerst sammele ich die Prospekte und Briefe hinter der Haustür ein: unzählige Umschläge, alle adressiert an meinen Vater. Die Post eines langen Jahres. Ich schaue nicht drauf, ich stopfe sie in meinen Rucksack und eile den Männern in die Zimmer hinterher. Ich bin ja schon dankbar, dass sie endlich mit der Arbeit angefangen haben. Natürlich, die Astronautentapete im Kinderzimmer ist noch da, wo soll sie auch hin sein. Es ist immer nur ein Motiv, welches sich über die langen Tapetenbahnen hundertfach wiederholt: Der Astronaut mit seinem Raumschiff inmitten von Sternen, und über allem ein viel zu großer Mond. Ausgerechnet am Rand jeder Tapetenbahn wurde der Mond abgeschnitten, es war nicht möglich, die Tapete so zu kleben, dass die Bilder vollständig wurden. Die vielen Sterne sind über die Jahre verblasst, und die abgeschnittenen Monde haben sich mit den Ecken der Tapete von der Wand gelöst. Natürlich, das Zimmer der Eltern ist noch da, ich gehe vorbei an den Hochzeitsfotos, ich will keinen Blick riskieren. Natürlich, da ist noch der Hundekorb, da ist noch die Leine, da ist noch die Kiste mit den Medikamenten von meinem Vater, da ist noch das Regal mit den ungeöffneten Konservendosen aus den Achtzigern, als wir das Haus gerade gekauft hatten, da sind noch die Puppen mit den bleichen Gesichtern und roten Mündern, da sind noch die Kupferstiche an der Wand, da sind die Fotoalben, die Kochbücher, die Schnapsflaschen, die vergilbten Lottoscheine, gestapelt und von Gummiringen zusammengehalten.
Los jetzt, sage ich, nachdem ich unterschrieben habe. Los jetzt, rufe ich und klatsche in die Hände, was den stummen Männern eine Freude macht, denn sie lachen wie Kinder, jetzt aber, hopp, hopp, schreie ich, und schon birst das erste Holz in den Zimmern, schon poltern die ersten Bücher aus den Regalen, schon fliegen die ersten Porzellanpuppenköpfe durch unser Haus.
Ich stelle mir einen Klappstuhl auf den Kies im Vorgarten. Jetzt bringen sie die Werkbank raus, jetzt die Kleider der Mutter und die Pullover des Vaters, sie haben die Stoffe in blaue Säcke gepackt und zugebunden, aber regelmäßig platzen die Säcke auf, schöne Sommermode und dicke Winterteile quellen heraus. Ich erkenne Sachen von mir, aber ich schreite nicht ein, alles soll verschwinden. Ich erkenne die wertlosen Schätze der Großtanten aus dem Schwarzwald, die in den Container fliegen und zerbersten, all die Kuckucksuhren und Heidelandschaften in Öl, all die Buddelschiffe und Kistchen und Kisten.
Als ich beinahe schwach werde, als mein Hals trocken wird und meine Augen sich mit Tränen füllen, da retten mich die Tiere. Vier oder fünf Ameisen kriechen an meinem Bein hoch, ich mache eine falsche Bewegung und sie beißen zu. Sie verspritzen ihr Gift auf mir, weil sie mich für den Feind halten. Ich scheuche sie weg. Wie kann das sein. Der Winter kommt bald, und sie sind noch da. Diese vier oder fünf Tiere sind nicht allein; ich knie mich auf die Steine und entdecke die traurige Kolonie. Sie haben sich zwischen Kellerschacht und Vorgarten angesiedelt, wahrscheinlich lange vor uns. Viele Sommer lang habe ich ihnen über Stunden zugesehen. Es sind keine dummen Tiere. Wenn einer Ameise das Stück Holz abhandenkommt, dann dreht sie auf der Stelle um und holt ein neues. Wenn neben ihr der Kamerad stirbt, dann weint sie nicht, dann ruft sie nicht den Pfarrer an, dann wird sie nicht in den Nächten von Panikattacken heimgesucht, dann muss kein Sarg ausgesucht und keine Wahl zwischen Feuer-, Erd- und Seebestattung getroffen werden, wenn der Kollege tot ist, dann wird er entsorgt, dann wird er verbaut. Er wird das verlorene Stück Holz. So geht das bei den Ameisen. Sie wissen gerade genug. Aber jetzt machen sie mir Sorgen: Sie müssten längst unter der Erde sein und erstarrt auf den Frühling warten. Bald kommt der erste Frost, aber sie sind noch hier. Langsam torkeln sie hintereinander her ohne Stöckchen und ohne toten Kollegen unter dem Arm über den Kiesweg und werden von den Möbelpackern zertreten. Eine Kolonne von Tieren läuft Richtung Blumenbeet, aber selbst der Anführer taumelt, als hätte er die letzte Nacht durchgesoffen. Sie haben in meiner Abwesenheit, so muss es sein, den Krieg oder die Bombe überstanden, und jetzt wissen sie nicht mehr, was zu tun ist und wohin sie gehören. Es ist, als wüssten sie zu viel.
Einer der stummen Männer deutet jetzt mit angestrengtem Blick auf den Ohrensessel auf seiner Schulter, den er schon wurfbereit in die Höhe hält. Weg, sage ich. Er nickt und schleudert ihn, meine Ameisenfreunde zertrampelnd, in den Container. Ich sehe noch das Sofa, ich sehe noch die Garderobe, ich sehe noch die fleckige Matratze. Einer der Stummen streift mit seiner Hand meine Schulter, wird schon wieder, das kann ich seinem Nicken entnehmen, wird schon wieder. Bald ist der Container voller als unser Haus.
Dann sind die stummen Männer verschwunden. Der Laster ist weg, der Container ist weg, das Haus ist weg, auch wenn es noch steht. Die Küche und eine Küchenuhr haben sie mir gelassen, ansonsten sehen die Räume so aus, als wären wir nie hier gewesen. In allen Zimmern sind die Wände nikotingelb, helle Flecken bleiben da und erinnern daran, wo Bilderrahmen und Regale hingen, wo Vitrinen standen. Das Schlafzimmer, das eine Kinderzimmer, das andere Kinderzimmer, das Bad, das Wohnzimmer, die Küche, das Gästeklo. Der Keller und die Waschküche. Die stummen Männer waren gründlich und gut.
Erst, als ich gehen will, finde ich die beiden Umzugskartons im Flur: Was Ihnen persönlich erscheint. Sie sind zu schwer, um sie vom Balkon zu kippen. Sie sind zu schwer, um sie an die Straße zu stellen. Die persönlichen Dinge. Alles sollten sie verbrennen. Aber das haben sie nicht gemacht. Auch ich lasse die persönlichen Dinge, wo sie sind, fülle kochend heißes Wasser in den letzten verbliebenen Eimer und ziehe die Tür hinter mir zu.
Schwall um Schwall klatscht das dampfende Wasser an die Wand, schwemmt die Ameisen fort in den Rinnstein, ich spüle sie alle weg, bis die Steine sauber sind.
2 DIEROTEKLINGEL
SANTA MONICA, weiß der Teufel, warum der Club so heißt. Es vergehen einige Sekunden, nachdem ich auf die rote Klingel gedrückt habe, dann der Türsummer. Ich kann eintreten. Die Treppe führt nach unten. Draußen ist früher Nachmittag, drinnen nicht. Die Kellerfenster sind mit schwarzer Folie zugeklebt. Schummriges Licht schwacher Glühbirnen. Eine ältere Frau im kurzen, verwaschenen Kleid nennt mir die Preise und Konditionen, erklärt, dass Sonderwünsche extra kosten, dass das erste Getränk teuer ist, weil es zugleich als Eintritt gilt, und dass die Dame auf dem Zimmer gern einen Sekt auf meine Einladung hin trinke, weil sie Sekt so möge.
Dann ruft sie die Mädchen, wie Zirkuspferde kommen sie aus den Zimmern, paradieren an mir vorbei und geben mir die Hand. Jung sind sie alle nicht mehr. Ich höre die Namen, ich sehe die viel zu hohen Schuhe und die viel zu enge Kleidung. Das letzte Mädchen ist kleiner und trägt keinen Rock und keine hochhackigen Schuhe, ganz normale Sachen hat sie an. Sie lächelt nicht, sie sieht mir in die Augen wie einem alten Bekannten. Ich kenne sie nicht. Und ich entscheide mich für niemanden.
Ich bestelle mir ein Bier und setze mich auf das Sofa in der Ecke. Die Mädchen verteilen sich auf den Sesseln um mich herum, gerade so nah, dass ich sie sehen kann, gerade so weit weg, dass ich zu nichts gezwungen bin. Sie schlagen ihre Beine übereinander und machen sich die Haare. Sie tun so, als würden sie mich nicht sehen, und doch beobachten sie mich. Ich weiß wie immer nicht, wohin mit meinen Augen, ein Blick zu viel, und sie rücken mir zu nah, ein Blick zu wenig, und sie sind gekränkt. Was mache ich eigentlich hier.
Santa Monica gibt es seit Jahren, der Besitzer hat gewechselt, der Name ist so geblieben. Früher war die Polizei oft da und das Lokal ständig ausgebucht, die Männer der Sparkasse, die Männer der Feuerwehr, die Männer der umliegenden Dörfer und Gemeinden. Ich war noch zu jung, um alles zu verstehen, was in der Zeitung stand. Die Mädchen nicht alt und nicht legal genug, die hygienischen Bedingungen problematisch, die Kunden betrogen und ausgenommen, so was halt. Heute gibt es im Santa Monica keine zu jungen Mädchen mehr. Die Fenster sind mit schwarzer Folie zugeklebt und das Licht ist schummrig. Es ist still, furchtbar still, nur das Geräusch vom Kratzen an Nylonstrümpfen und das beständige Räuspern der Prostituierten, weil die Luft hier unten so trocken ist. Reihum stecken sie sich ihre Zigaretten an; ich würde auch gern rauchen, aber das geht nicht mehr. Die ältere Dame bringt mir ein Bier, lächelt mich an und sagt nichts – dann dreht sie ihre Runde. Auf den Kellerfensterbänken stehen künstliche Rosen in kleinen Vasen, zwanzig, dreißig Stück. Mit einer Dose geht die Puffmutter von Blume zu Blume und sprüht sie mit ebenfalls künstlichem Rosenduft ein. Dann geht sie hinter die Bar zurück und schaltet die Musik an.
Ich trinke mein Bier hastig aus und will zahlen und gehen, als sich die kleine Frau mit den flachen Schuhen zu mir setzt. Ich weiß nicht, was zu tun ist; sie schon. Sie legt mir ihre Hand auf den Oberschenkel und bewegt sie keinen Millimeter. Meine Kälte. Ihre Wärme. Dabei will ich eigentlich nichts von ihr. Kommst du, sagt sie und gibt mir die Hand. Ich antworte ihr, dass ich lieber gehen würde. Sie nickt. Dass ich ein anderes Mal wiederkäme. Sie nickt. Ich sage, es hat nichts mit dir zu tun. Und sie nickt und nickt und sagt nur: Komm schon, mein Schöner. Erst da fällt mir ihr Zungenschlag auf, erst da begreife ich, dass sie mich nicht versteht, dass sie nur ihre auswendig gelernten Sätze und Wörter kann. Sie versteht mich nicht, und doch hat sie die Macht ohne Worte, und doch lächele ich und gehe mit. Die ältere Dame sagt etwas zu meinem Mädchen in einer Sprache, die ich nicht kenne, und lächelnd zu mir: Das ist Petra. Spricht nicht viel, kann aber viel. Schon gebe ich der älteren Dame einige Scheine, und schon bekommt Petra das in Folie eingepackte Bettlaken. Sie nimmt mich bei der Hand, die müden, gleichgültigen Blicke der anderen Frauen treffen mich. Sie liegen oder hängen halb in den Sesseln wie Raubtiere im Zoo, die in ihren Käfigen nichts mehr verloren haben.
Im Zimmer klebt blaue Fototapete an den Wänden, das Meer. Der Boden ist aus gelbem Kunststoff und gibt vor, der Strand zu sein. Petra macht Musik an, sie kennt die Choreographie auswendig. Sie tanzt für mich zu dem Lied, das gerade läuft. Und ich werde ihr nicht erklären können, dass ich zwar hier bin, um zu schlafen, nicht aber mit ihr. Dass mich ihr Körper zwar nicht interessiert, dass ich ihn aber brauche. Als etwas, das mich schützt im Schlaf. Als etwas, das die Kontrolle hat gegen die Gespenster um uns herum. Sie tanzt langsam und lässt mich nicht aus den Augen, zieht mich vom Bett hoch und nimmt meine Hände und küsst mir die Wangen und die Arme und die Hände und die Finger. Wenn ich schlafe, will ich ihr sagen, jede Nacht, dann immer nur für eine Stunde, für zwei Stunden. Ich kann besoffen sein, ich kann Tabletten nehmen, ich kann die Nacht davor durchgemacht haben, will ich ihr sagen, ich wache mit kaltem Schweiß auf der Stirn auf und kann nicht mehr einschlafen. Je nach Jahreszeit und Wochentag denke ich an die Ratten in den Wänden, an die Einbrecher, die schon ihr Ohr an meine Wohnungstür gelegt haben und lauschen, an den Verrückten auf der Straße, der mich sucht und der mich finden wird. Und wenn es das nicht ist, dann fürchte ich die Gespenster in der Heizung, als wäre ich wieder fünf Jahre alt. Verdammt nochmal, will ich ihr sagen, jede Nacht schlafe ich nur ein oder zwei Stunden, und dann wache ich auf, und dann geht gar nichts mehr, dann gibt es nur noch mich und den Rest der Nacht, und ich kann ihm nicht entkommen.
Mein Schöner, flüstert mir Petra ins Ohr, sie zieht mir die Jacke aus und mein Hemd und meine Schuhe und meine Socken und meine Hose. Sie legt meine Hände auf ihre Hüften, sie will, dass ich sie ausziehe jetzt, und als ich nichts sage und nichts mache, da tut sie es selbst. Die ersten Male glauben sie mir nicht, dass ich in den Puff komme, um an ihrer Seite zu schlafen. Auch nicht, wenn sie mich besser verstehen als Petra. Sie spulen ihr Programm ab, damit sie es ertragen können: dass ein Kerl neben ihnen einschläft wie ein Kind. Es gab Frauen, die ich anderswo getroffen habe, natürlich. In der Kneipe, im Café, auf der Straße. Natürlich haben wir uns viel zu erzählen gehabt, natürlich fand ich sie hübsch, natürlich wurde über die nächsten Tage gesprochen, über die nächsten Wochen und Monate. Aber immer dann, wenn sie mich zu sich einluden, wenn ich bei ihnen übernachten sollte oder sie bei mir, dann bin ich abgehauen, dann bin ich untergetaucht, dann bin ich verschwunden. Der Nachtschweiß, die Angst –
Petra ist älter als ich, aber das sieht man nicht. Wir sind beide nackt und ich lasse manche Sachen zu. Während sie mit mir beschäftigt ist, flüstere ich ihr Sätze ins Ohr. Sie nickt und macht kleine, wohlwollende Geräusche, als wären es Liebesschwüre. Dabei sage ich ihr nur, warum ich hier bin: Weil ich unser Haus verkaufen muss. Und weil ich jemandem eine Spritze geben muss, ich muss eine Immobilie verkaufen und eine Spritze verabreichen und danach aus diesem Nest verschwinden. Ich muss wieder wegfahren, sage ich, weit, weit weg von hier. Noch bin ich kein Mörder, flüstere ich, aber wenn ich wegfahre, werde ich einer sein. Sie lächelt und sagt: Komm, mein Schöner.
Wir trinken Wasser. Petra raucht und bietet mir eine an. Nein, sage ich, ich rauche nicht mehr. Drei, sagt Petra jetzt mit erstauntem Gesicht und drückt ihre Kippe aus. Ich nicke: ja, für drei Stunden. Und dann zeige ich ihr, dass sie sich auf die Seite legen soll, und als sie so liegt und ihre Hand mich schon wieder sucht, da schiebe ich sie sanft weg und mache die Augen zu, vielleicht spielt sie nur gut, vielleicht ist sie aber wirklich schon vor mir eingeschlafen, als ich noch einen Platz für meinen Kopf suche, weil die Kissen auf dem Bett fehlen.
3 DERANFANGDERNACHT(SAGENWIR,17UHR)
SAGEN WIR, DER junge Mann hat den ganzen Tag gearbeitet. Geben wir ihm ruhig einen Alltag, den man passabel nennen kann: Er hat eine Stelle in einem Büro, die ihn ausfüllt und an deren Sinn er glaubt. Geben wir ihm eine gute Stoffhose und ein ordentliches Hemd, lassen wir ihn zum Ende des langen Arbeitstages eine gewisse Müdigkeit empfinden. Belohnen wir ihn für seinen Fleiß mit dem letzten schönen Nachmittag des Jahres – sagen wir, man kann sogar noch in der Sonne sitzen. Müde und zufrieden sitzt der junge Mann also in der Sonne vor einem der kleinen Cafés, die in seinem Viertel in den letzten Monaten reihenweise geöffnet haben. Er sitzt vor einem Salat mit gebratenem Hähnchen und trinkt Kaffee, er denkt darüber nach, am Abend einen neuen Film im Kino zu sehen, er könnte ein Mädchen anrufen, mit dem es noch etwas werden könnte in nächster Zeit. Und wenn sie nur einen schönen Abend zusammen verbringen, dann soll es auch gut sein – sagen wir, der junge Mann ist an sich recht ausgeglichen, er ist keine Schönheit, er ist aber auch nicht hässlich; sein Charakter ist durch und durch gut, er kann verschlagene Leute nicht ausstehen. Sagen wir, er hat durchaus große Ängste, aber die machen ihn sogar anziehend. Diese Ängste bekämpft er mit einem strukturierten Alltag – woraus wiederum folgt, dass er keine Sorge vor der Zukunft zu haben braucht. Dass er leben kann, ohne darüber nachzudenken. Der Salat ist frisch, das Hähnchen nicht zu fettig, der Kaffee hat ein gutes Aroma und ist angenehm stark. Nach dem Essen ruft er das Mädchen an, sie freut sich, seine Stimme zu hören, sagen wir ruhig, sie glaubte schon nicht mehr daran, dass er sich überhaupt noch meldet. Sie verabreden sich zur Spätvorstellung im Kino, und als er auflegt, denkt der junge Mann plötzlich, dass man selten so glücklich ist wie er in diesem Augenblick. Er bestellt sich noch ein kleines Bier und blinzelt gegen das Sonnenlicht, gönnen wir ihm einen freien Tag, dann kann er am Abend länger wegbleiben, ach was, gönnen wir ihm gleich eine ganze Woche Urlaub, das hat er sich verdient.
Als er gerade aufstehen und an der Bar bezahlen will, klingelt sein Telefon. Er kennt die Nummer nicht, er zögert kurz, den Anruf anzunehmen, dann aber denkt er: Es könnte das Mädchen sein. Es könnte mit der Firma zu tun haben. Er geht ran. Können wir uns unterhalten, sagt die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung, haben Sie Ruhe. Aber ja, sagt der junge Mann, worum geht es denn. Um eine ernste Angelegenheit. Ich höre, sagt der junge Mann. Ihr Vater, sagt die Stimme, es hat mit Ihrem Vater zu tun. Sie wissen, dass er bei uns in der Klinik ist. Er erzählte mir davon, sagt der junge Mann, es gäbe einige Untersuchungen, es wäre wegen seiner Lunge. Hat er Ihnen nicht mehr gesagt, sagt die Stimme. Mehr weiß ich nicht, sagt der junge Mann. Stille. Sie wissen noch gar nichts. Nein, sagt der junge Mann. Stille. Er hat Krebs, sagt die Stimme. Warum ruft er mich nicht selbst an, sagt der junge Mann, warum hat er nichts gesagt, ich hätte ihn besuchen können. Ich weiß es nicht, sagt die Stimme. Er ist schweigsam. Vielleicht wollte er nicht, dass Sie davon erfahren. Aber jetzt müssen Sie es wissen. Geben Sie mir meinen Vater, sagt der junge Mann. Das geht nicht, sagt die Stimme. Es ist eine ernste Sache. Soll ich kommen, sagt der junge Mann. Sie müssen, sagt die Stimme. Lebt er, sagt der junge Mann. Ja, sagt die Stimme. Wann können Sie hier sein. Gegen Mitternacht, sagt der junge Mann, vielleicht eine Stunde früher. Kommen Sie bitte schnell, sagt die Stimme, es tut mir leid, dass ich Ihnen keine andere Mitteilung machen kann.
4 DIEBRIEFE
HIER SCHLIEFEN DIEProminenten, die Zauberkünstler, die Vertreter auf der Durchreise, die zu müde waren, um noch in die größeren Städte zu fahren. Hier schlief die reiche Verwandtschaft bei Taufen und Beerdigungen. Auch, als die Stadt noch blühte, war es das einzige Hotel der Stadt. Es gab keine Alternative. An sich braucht sie gar keins mehr. Die Zimmer des Hotels sind in den oberen Etagen des alten Kinos. Ich stehe vor dem Gebäude. Die linke Tür führt in die Bar des Kinos. Durch die rechte Tür gelangt man ins Hotel. Ich ziehe die Tür mit den grünen Bleiglasverzierungen auf. Schon springt der Portier aus seiner Kammer an die Theke, stößt sich den Kopf am Türrahmen und flucht. Sein Fernseher dröhnt, man versteht sein eigenes Wort kaum. Eine Sportübertragung. Der Herr wünschen, ruft er mir zu. Können Sie mir die Zimmer zeigen, rufe ich. Sein Mund zuckt, als habe er keine Kontrolle über ihn; seine Augen mit den hellen Wimpern sehen aus wie die eines Schweins, dazu trägt er eine viel zu große Brille mit angelaufenem Rand, die an den Bügeln mit braunem Klebeband provisorisch repariert worden ist. Wir haben renoviert, ruft er, wir haben das blaue, das grüne, das gelbe, das normale Zimmer, auf jeder Etage. Der Portier ist etwa so alt wie ich, sehr groß und sehr dünn. Er murmelt und räuspert sich unentwegt, tänzelt zwischen dem Tresen und dem Stapel mit den Gästeanmeldungen hin und her. Wollen Sie ein Zimmer sehen oder alle Zimmer sehen, fragt er. Alle sind sie verschieden. Sie haben die freie Wahl, Sie sind der einzige Gast, denn die Rosenzüchter sind gestern alle abgereist. Stellen Sie sich das mal vor, ein Hotel voller Rosenzüchter, ruft er, und dann: Sie sind doch Schauspieler, ich kenne Sie aus dem Fernsehen. Entschuldigen Sie, das war vorlaut, aber Schauspieler sind Sie. Zeigen Sie mir doch bitte mein Zimmer, sage ich, nehmen Sie das, in dem Sie selbst schlafen würden. Er schweigt und überlegt lang. Unerhört, sagt er mehr zu sich selbst als zu mir. Nein, so was. Daran habe ich nie gedacht. Unerhört.
Jetzt wird er ganz still. Kopfschüttelnd nimmt der Portier seine Brille ab und zieht sich in seine Kammer zurück, wirft sogar die Tür hinter sich zu. Habe ich was Falsches gesagt, rufe ich. Zeit vergeht. Eine Minute. Zwei Minuten. Fünf Minuten. Ich will weg hier, aber es gibt keine Alternative. Der Portier kommt zurück. Mit roten Augen, als hätte er geweint. Entschuldigen Sie, sagt er, das darf mir nicht passieren. Schon in Ordnung, sage ich. Manchmal glaube ich, sagt er, die Stadt tut mir nicht mehr gut. Macht nichts, sage ich. Wissen Sie, sagt er, mein Bruder hat es leicht. Der steht nicht jeden Tag hinter der Rezeption bis tief in die Nacht, der arbeitet für die Zigarettenpapierfabrik, der hat einen eigenen Schreibtisch, an vielen Tagen darf er kleine Reisen unternehmen, an anderen früher nach Hause gehen, und jeden Tag trägt er ein blütenweißes Hemd, das von der Zigarettenpapierfabrik gestellt wird. Ich bin nicht eifersüchtig, doch, ich bin es, aber ich sollte es nicht sein, aber wir sprechen seit Jahren kein Wort mehr miteinander, und ich kann nicht sagen, dass mir das egal ist, ich …
Mein Zimmer, frage ich. Das normale, sagt der Portier, nehmen Sie das normale Zimmer in der obersten Etage. Es ist größer als die anderen. Und der Ausblick. Die Anmeldung, sagt er, und da belebt sich seine Stimme wieder, einfach ausfüllen, sagt er, und setzt sich eilig seine Brille auf und verschwindet in altem Tempo in seinem Kabuff, wo der Fernseher nur einen Augenblick später wieder dröhnt: ein Fußballspiel, eine historische Aufnahme.
Kennen Sie sich hier aus, fragt der Portier. Ein wenig, sage ich. Was machen Sie hier, sagt der Portier. Ich übe neue Rollen, sage ich. Ah, dann sind Sie es also doch, sagt der Portier. Kann ich im Voraus bezahlen, frage ich. Ja, sagt der Portier. Ich ziehe das Bündel mit den Geldscheinen aus der Tasche und lege es auf den Tresen. So viel, platzt er heraus, habe ich ja noch nie gesehen. Nehmen Sie, sage ich, verwahren Sie es. Sie sind erfolgreich, sagt der Portier jetzt mit leiser Stimme. Ja, aber das behalten wir für uns, sage ich. Ja, sagt der Portier flüsternd, das behalten wir für uns. Wie lange, wispert er, bleiben Sie denn. Eine Woche höchstens, flüstere ich. Dann üben Sie wohl für einen neuen Film, wispert er. Nein, flüstere ich, für fünf neue Filme. Donnerwetter, wispert der Portier. Wollen Sie mir dabei helfen, flüstere ich. Ich, wispert er. Ausgerechnet ich. Ja, Sie. Jederzeit. Ich komme morgen zu Ihnen, flüstere ich. Ich warte, wispert der Portier, was immer ich für Sie tun kann.
Ich ziehe die Vorhänge zur Seite: der Wald. Bliebe ich länger, könnte ich den Schnee fallen sehen. Manchmal verweilt er in den Ästen, wochenlang, wenn es nur kalt genug dafür ist. Ich packe meinen Rucksack aus und werfe die Unterhosen und Hemden in die Ecke. Der Portier ist eine gute Seele, denke ich, er wird mir helfen und mir zuliebe von nichts wissen. Es wird ihm ja nicht schaden, es wird mir nur nutzen.
Tief unten in meinem Rucksack finde ich eine Tafel Schokolade. Ich reiße die Verpackung auf, werfe sie achtlos in die Mitte des Zimmers und stopfe sie hastig in mich hinein, es ist kein Genuss, es geht nur darum, so schnell wie möglich den Hunger zu verlieren.
Zuletzt packe ich die Tüte mit meiner Bewaffnung aus. Im Kleiderschrank gibt es ein kleines Schließfach, dort lege ich die wichtigsten Utensilien hinein: einige Spritzen. Das Fläschchen mit dem Gift, doppelt verpackt und versiegelt. Es wird von Tierärzten benutzt, um Hunde und Katzen einzuschläfern – man verabreicht es ihnen und sie sind innerhalb von weniger als einer Sekunde fort. Das Gift ist so stark, dass man vorsichtig damit sein muss. Fällt dem Tierarzt nur ein einziger Tropfen auf den Finger, dann ist der für viele Monate taub. In der kleinen Dose ist das harmlose Pulver, ich habe es ausprobiert; löst man es in Wasser auf, dann riecht es süßlich; nimmt man Alkohol dafür, dann merkt man nichts. Man schläft davon ein, rasch entspannt sich der ganze Körper, die Bewusstlosigkeit ist tief und man spürt nichts mehr, sonst würde ich es niemals tun. Zuletzt lege ich die kleine Flasche mit dem chinesischen Pflaumenwein in das Schließfach, er eignet sich für jeden Anlass.
Von meinem Vater sind jetzt nur noch diese Briefe übrig, alle ans Nichts adressiert, an einen Verschwundenen. Ich liege auf dem Bett, im Fernsehen läuft ein historisches Fußballspiel, die Schlussrunde irgendeiner Weltmeisterschaft in Schwarz-Weiß, bei jeder Torchance höre ich den Portier von unten schreien und jubeln. Nur die Briefe an meinen Vater sind noch übrig, und seine einzige Nachricht an mich: das Geld. Er hatte gespart. Über Jahrzehnte muss er jeden Monat von seinem bisschen Lohn was zur Seite gelegt haben; als er vor einem Jahr für immer verschwand, habe ich es gefunden. Es lag in seinem Nachttisch, nach Größe der Scheine sortiert und eingepackt in alles, was er finden konnte. Er hatte es eilig. Und er wusste, dass ich das Geld finden würde: die Zehner in einem zusammengeknoteten Stofftaschentuch, die Hunderter in einem alten Nähmäppchen, die Fünfhunderter auf Briefumschläge verteilt. Zuviel, um es in einigen Nächten auszugeben, zu wenig, um sich nie wieder um die Zukunft zu scheren. Nach einem Jahr ist schon viel weg. Aber es ist noch was da, falls ich fliehen muss –
Ich öffne die Post an meinen Vater: Die Lebensversicherung will ihn eine Woche nach seinem Tod gleich wieder versichern, noch günstiger als jemals zuvor. In der Gaststätte von Kunibert kann er zwei Schnitzel zum Preis von einem essen. Sein Zahnarzt schenkt ihm eine kostenlose Zahnreinigung und die Tierhandlung ein mit Knochen bedrucktes Halstuch für den Hund. Was ihn an der Post interessiert hätte: die Prospekte. Es gab Radios und Bananen im Winter, es gab Bier und Rinderbraten im Sommer, es gab Zwiebeln und Freizeitstühle, es gab orientalische Salate und spanische Melonen, es gab Polohemden und Jogginganzüge. Die Prospekte kamen sonntags, und mein Vater stand montags um acht Uhr auf der Matte, als könnte er nur dann Ananas und dicke Bohnen und Schweinekoteletts und orientalischen Brei kaufen. Und jetzt sehe ich, zwischen den Prospekten, einen Umschlag, der älter ist als alle anderen. Mein letzter Brief an ihn. Meine Schrift. Er hat ihn nie gelesen.
5 DERHERBST
IN DEN ERSTENNächten habe ich noch ein Ziel. Vielleicht, weil ich da noch glaube, es sei alles überblickbar. Ruhig Blut, sage ich mir, ruhig Blut, bald bist du wieder fort. Seit einem Jahr ist mein Vater tot. Seit einem Jahr gibt es, ganz egal, wo ich bin, nur noch diese eine Rechnung: Vor soundsoviel Tagen bin ich angekommen. In soundsoviel Tagen bin ich wieder weg. Vor soundsoviel Stunden hast du deinen Fuß auf dieses Stück Erde gesetzt, in soundsoviel Stunden wird es hinter dir liegen. Gestern hat die Woche angefangen, in sechs Tagen ist sie beendet. Seit über einem Jahr gibt es kein Jetzt mehr, es gibt den Anfang hinter mir und das Ende vor mir, die Zwischenzeit: ein einziges Aushalten. Vor dreißig Tagen kam der erste Regen. Es muss also Herbst sein. In einundsechzig Tagen fällt der erste Schnee. Das ist dann also der Winter. In den ersten Nächten ist es leicht, denn ich habe noch Ziele.
Schlaftrunken poltert der Portier aus seiner Kammer, die zusammengeklebte Brille schief auf der Nase. Groß gähnend sucht er nach einem festen Stand. Können Sie mir eine dickere Jacke borgen, frage ich, ich muss an die frische Luft. Um diese Zeit, sagt er, um diese Zeit. Haben Sie eine Jacke, frage ich, es regnet. Und er verschwindet und kommt mit einem viel zu großen Anorak von der Armee zurück: Genügt Ihnen das, fragt er. Gibt es eine Kapuze, frage ich. Ja, sagt er, sehen Sie. Das genügt, sage ich, ich danke Ihnen. Und schlafen Sie gut. Passen Sie wegen der Tiere auf, sagt er, die Wölfe sind überall. Ich weiß, sage ich, ich passe auf.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: