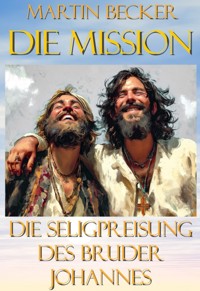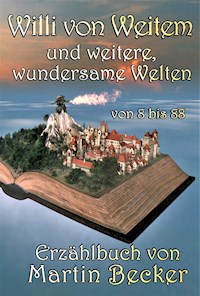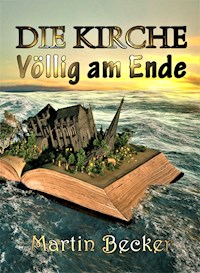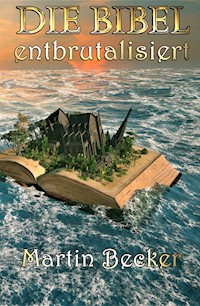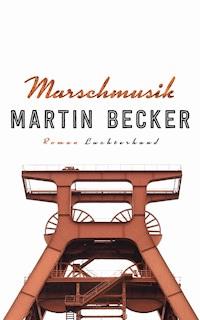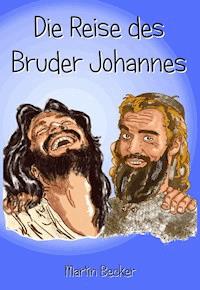17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebeserklärung an ein aussterbendes Milieu, dessen Kinder vom großen Los träumten, aber auch mit den Trostpreisen zufrieden sind.
Manchmal lassen die Eltern die heißen Fabrikhallen hinter sich und fahren los. Mit den Kindern ans Meer, immer an die Nordsee und immer nur für ein paar Tage. Der Rest ist Plackerei: Für das Reihenhaus, für die Kinder, für ein bisschen Glück – wenigstens im Rahmen des Sparkassendarlehens. Martin Becker erzählt in „Die Arbeiter“ von einer kleinstädtischen Familie, die es nicht mehr gibt. Von zu früh gestorbenen Eltern und Geschwistern, von einem unverhofften Wiedersehen an der Küste, vom kleinen Wunder, nach dem Verschwinden der Ursprungsfamilie nun selbst Vater zu sein und einen Sohn zu haben. Die altmodischen Nähmaschinen der Mutter, der schwere Schmiedehammer des Vaters, die billig eingerichteten Ferienwohnungen und stets zugequalmten Kleinwagen aus dritter, vierter, fünfter Hand: es ist die Geschichte über eine Herkunft aus einfachen Verhältnissen, fern aller Romantik und Verklärung. Ein Denkmal für die verschwundene Arbeiterfamilie. Eine Liebeserklärung an ein aussterbendes Milieu, dessen Kinder vom großen Los träumten, aber auch mit den Trostpreisen zufrieden sind. Aktueller denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
Eine Liebeserklärung an ein aussterbendes Milieu, dessen Kinder vom großen Los träumten, aber auch mit den Trostpreisen zufrieden sind.
Manchmal lassen die Eltern die heißen Fabrikhallen hinter sich und fahren los. Mit den Kindern ans Meer, immer an die Nordsee und immer nur für ein paar Tage. Der Rest ist Plackerei: Für das Reihenhaus, für die Kinder, für ein bisschen Glück – wenigstens im Rahmen des Sparkassendarlehens. Martin Becker erzählt in »Die Arbeiter« von einer kleinstädtischen Familie, die es nicht mehr gibt. Von zu früh gestorbenen Eltern und Geschwistern, von einem unverhofften Wiedersehen an der Küste, vom kleinen Wunder, nach dem Verschwinden der Ursprungsfamilie nun selbst Vater zu sein und einen Sohn zu haben. Die altmodischen Nähmaschinen der Mutter, der schwere Schmiedehammer des Vaters, die billig eingerichteten Ferienwohnungen und stets zugequalmten Kleinwagen aus dritter, vierter, fünfter Hand: Es ist die Geschichte über eine Herkunft aus einfachen Verhältnissen, fern aller Romantik und Verklärung. Ein Denkmal für die verschwundene Arbeiterfamilie. Eine Liebeserklärung an ein aussterbendes Milieu, dessen Kinder vom großen Los träumten, aber auch mit den Trostpreisen zufrieden sind. Aktueller denn je.
Zum Autor
MARTINBECKER wurde 1982 geboren und wuchs in der sauerländischen Kleinstadt Plettenberg auf. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie aus dem Ruhrgebiet, sein Vater war Bergmann und seine Mutter Schneiderin. Er ist freier Autor für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und berichtet in Features und Reportagen unter anderem aus Tschechien, Frankreich, Kanada und Brasilien. 2007 erschien sein mehrfach ausgezeichneter Erzählband »Ein schönes Leben«, 2014 sein Roman »Der Rest der Nacht«, 2017 sein Roman »Marschmusik« und 2021 »Kleinstadtfarben«. Martin Becker lebt mit seiner Familie in Halle (Saale).
Martin Becker
Die Arbeiter
Roman
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 Luchterhand Literatur Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt unter Verwendung eines Motivs von © plainpicture/Wolfgang Steiner
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-30489-8V001
www.luchterhand-literaturverlag.de
facebook.com/luchterhandverlag
Für Kathrin, Rudi und Benno.
»Geschichte wiederholt sich nie / Aber sie reimt sich immer ein Mal«
Spinvis, Oostende
»… und schaffe selig zu werden mit Furcht und Zittern.«
Inschrift in der protestantischen Kirche St. Laurentius, Tönning
Prolog
Da kommen wir her. Aus der Kleinstadt, aus dem Reihenhaus. Das sind wir. Mit Unterhemd, Sonnenbrand und Kippe auf dem Zahn. Mit glasigem Blick an Weihnachten und heiligem Ernst zur Konfirmation. Mit Mama, Papa, zwei Töchtern und zwei Söhnen. Mit Schwarzwälder Kirschtorte vom Fließband, zu früh auf dem Tisch, noch gefroren, zum Geburtstag viel Glück. Wir arbeiten uns den Arsch aus der Hose. Unter Tage ist es finster, in der Schmiede heiß, in der Wäscherei stickig. Manchmal dürfen wir ans Wattenmeer, verdorrich nochmal, ist das schön. Selbst im stinkigen Schlick. Bald ziehen wir ganz hin, wenn wir sechs Richtige haben, irgendwann sind wir dran, dann stehen wir in der Zeitung.
Bis die Lottofee kommt, läuft das Ganze so: Mein Vater steht auf, geht malochen, kommt nach Hause. Isst Schweinebauch, Kotelett, Frikadellen, gut für die Kraft, ruht sich aus, nimmt uns mit zum Einkaufen, setzt sich nach dem Abendbrot (Aufschnitt, Fleischwurst, Salami) vor die Glotze und trinkt. Mal ist das Knie dick, dann legt er Eis drauf, mal kriegt er Spritzen gegen die Piene im Rücken, davon wird er böse, dann geht man ihm aus dem Weg. Ansonsten helfen Hausmittel: samstags eine Kiste Bier und eine Flasche Schnaps. Sonntags ein Liter Rotwein aus dem Tetra Pak. Früher hat ihn das auch böse gemacht, aber das ist lange her. Meine Mutter trinkt gar nichts mehr, sie haben ihr im Schützenverein mal Korn ins Bierglas gekippt, um sie so richtig stramm zu sehen. Zu runden Hochzeitstagen machen die Eltern was für sich, dann zieht mein Vater das weiße Hemd mit Kragen unter den Pullover und meine Mutter holt ihren Weihnachtsrock mit farblich exotischer Weste aus dem Schrank. Elegante Damenmode vom Quelle-Versand mit Sammelbestellerrabatt, auch das geht auf Raten. Sie reden schon Tage vorher davon, was sie beim Chinesen essen, sie nehmen jedesmal die Ente. Eigentlich trägt meine Mutter von morgens bis abends ihre geblümten Küchenkittel aus Polyester. Sie steht auf, macht die Kinder fertig, kümmert sich um den Haushalt. Beim Bügeln in der Waschküche schiebt sie die Kassette mit Heintje in den Rekorder und stellt laut, Mama, du sollst doch nicht um deinen Jungen weinen, ich bau dir ein Schloss, du wirst schon sehen, und dann kommen ihr die Tränen.
Das Auto ist aus dritter Hand und rostbraun und rostig. Helmut Kohl wird Bundeskanzler. Die Fassade streichen zu lassen ist schweineteuer, das macht mein Vater selbst. In Tschernobyl explodiert ein Atomreaktor. Im Erdbeernetz im Garten verheddert sich eine Amsel und stirbt vor Aufregung. Über Lockerbie wird ein Flugzeug gesprengt und die Passagiere hängen tagelang in den Bäumen, zum Glück fliegen wir nie. Das Auto ist jetzt hellblau und ein Kleinwagen, uns fährt jemand rein, und die Versicherung zahlt nur den geringen Restwert. So ein Arschloch. Die Mauer fällt, auf dem Balkan ist Krieg, Dagobert erpresst Karstadt, in Eschede entgleist ein ICE. Unser Auto ist ein metallicgrauer Opel, der macht was her. Bei der Tombola des Firmenjubiläums in der Fabrik meines Vaters gewinnt meine Mutter eine Weinfahrt nach Boppard und verschenkt sie gleich weiter. Wegen der Kinder, wie soll das denn gehen. Trotzdem blättert sie am Küchentisch im Hotelprospekt und sagt wochenlang, so fühlen sich reiche Leute, Mensch, so muss das sein.
So vergehen die Achtziger und die Neunziger, und die Lottofee bleibt weg. Wir sehen ein letztes Mal Ebbe und Flut, und dann ist es vorbei. Mein Vater stirbt. Meine Mutter stirbt. Und dann auch noch eins von ihren Kindern. Das waren wir. Eine Familie aus der Vergangenheit. Aus der Kleinstadt, aus dem Reihenhaus. Das nie ganz uns gehörte. Wie alles. Ohne Geld, mit geringer Lebenserwartung. Arbeit taktet die Tage durch, bis sie stottern, bis sie gezählt sind.
I Ebbe
Meine Mutter meint: Ach, schön hier. Mein Vater hat schon das Poloshirt ausgezogen und trägt sein Feinrippunterhemd. Ruhrpottsmoking. Ich leg mich hin, ruft er mir zu. Du holst die Koffer aus dem Auto und dann fängst du mir Würmer. Wenn ich aufstehe, geh ich angeln. Ich nicke. Man kann das Meer von hier aus nicht sehen, niemals. Aber man kann es riechen, überall. Schmeckst du das Salz auf den Lippen? Seit Tagen schon. Wir sind an der Nordsee. Nicht direkt, wir sind doch unserem Geld nicht böse, sagt meine Mutter. Wir wohnen in Petersgroden, wie jedes Jahr. Eine Ferienwohnung mit schlichter Ausstattung und vielen Fliegen. Gegenüber hat der Milchbauer seinen Stall, hundert Kühe treibt er jeden Tag von der Weide über die Landstraße zu den Melkmaschinen.
Das mit den Regenwürmern hat mir mein Vater so erklärt: Früher haben sie die mit Strom gejagt, das war einfacher, aber dann sind ein paar Blödmänner dabei draufgegangen. Nimm eine alte Pulle, tu Wasser rein und Spülmittel, nicht zu viel, nicht zu wenig, das verteilst du, dann juckt den Viechern der Pelz und sie kommen gucken, was da los ist.
Mein Vater liegt auf dem Bett, seine Oberarme kräftig und muskulös, die flache Hand ruht auf der Stirn. Er ist gleich eingeschlafen und schnarcht, kaputt von der Fahrt, kaputt von den Wochen davor. In der Fabrik haben sie was an der Produktionsstrecke umgestellt, er muss neuerdings wieder Nachtschichten machen. Meine Mutter gießt ein Glas Cola ein, sitzt am Küchentisch, steckt sich ihre erste Nordseezigarette an, schaut zu mir und sagt wieder: Schön ist das hier, woll. Fang bloß nicht an zu heulen, denke ich. Bald wird sie morgens wieder aufstehen und japsen, das ist immer so im Urlaub. Das Atmen fällt ihr schwer. Das ist das Reizklima, stöhnt sie, dabei, denke ich, sollte es hier doch gerade besser werden und nicht schlechter. Weil selbst ihr starkes Kortisonspray nichts bringt gegen die Kurzatmigkeit, sitzen wir beim Kurarzt im Wartezimmer. Der hängt sie wie jedes Jahr an den Tropf (Kochsalzlösung mit ein paar Vitaminen, aber das sagt der Kurarzt ihr nicht). Danach kriegt sie wieder Luft.
Meine Geschwister sind schon groß und in die eigenen Ferien gefahren, auch für Lisbeth haben meine Eltern einen Verein gefunden, der eine Rollstuhlreise nach Schottland anbietet. Ich bin das jüngste Kind, alle nennen mich den Kurzen. Wir packen das Auto am Abend davor. Meine Mutter stopft viel zu viele Klamotten für zwei Wochen in die Koffer, auch Herbstkleidung, als würden wir auf einen fremden Kontinent reisen, man weiß doch nie, wie das Wetter da oben ist. Mein Vater zelebriert sein jährliches Ritual, verschwindet im Schlafzimmer und kommt mit einer kleinen Banktasche aus Leder zurück: Dort hat er das ganze Jahr über große Münzen und kleine Scheine gesammelt. Wir setzen uns um den Küchentisch herum und zählen fiebrig, Donnerwetter, ist das wieder viel. Dreihundertfünfzig Mark für Fischbrötchen und Eis und Spielsachen für den Strand und Souvenirs und kleine Geschenke, mit denen mein Vater meine Mutter überrascht. Mein Vater trinkt vor der Fahrt nichts, das war früher anders, da ist er auch mit Restalkohol losgefahren. Jetzt ist er älter und braucht Konzentration für die Strecke. Meine Mutter kocht Eier und belegt die Brote mit Wurst und Käse, darin hat sie Routine, das macht sie auch für meinen Vater vor der Schicht. Dann sind alle Koffer im Auto, zum Schluss kommt das Wichtigste, ein ganzer Pappkarton mit Zigarettenstangen. Es hat gerade noch so geklappt, ein Kollege meines Vaters hat ihm die Zigaretten ohne Steuerbanderole aus Polen mitgebracht. Wusstest du, sagt mein Vater, der mehr redet als üblich, dass die Zigaretten nach dem Krieg eine eigene Währung waren? Wäre das heute noch so, hätten wir jetzt richtig viel Moos.
In der Nacht schlafe ich kaum. Ich lecke mir das Salz von den Lippen. Im Halbschlaf wird aus dem Gluckern der schlecht entlüfteten Heizkörper das Rauschen des Meers. Dann sitzen wir im Auto. Meine Mutter steckt sich eine Zigarette an und reicht sie meinem Vater. Die Radiosender ändern sich stündlich. Wie auf der Reise in ein fernes Land. An einem Rastplatz bei Ascheberg essen wir unsere Eier und die Brote. Meine Mutter rückt auf der Bank ganz nah an meinen Vater und lehnt sich an. Sie trinken Kaffee aus der Thermoskanne und teilen sich eine Zigarette. Dann fahren wir weiter. Auf den Feldern tauchen die ersten schwarzgefleckten Kühe auf. Jetzt kann es nicht mehr weit sein. Die Autobahn ist leer, wir sind um fünf Uhr morgens losgefahren, und man braucht nur dreieinhalb Stunden. Heute haben wir das Glück im Rücken, murmelt mein Vater. Was, frage ich, weil ich denke, ich hätte mich verhört. Glück, schreit er ungehalten. Und ich wundere mich. Denn viel öfters sagt er: Das Pech klebt uns wie Scheiße an den Fingern. Das mit dem Glück hingegen höre ich nur ein einziges Mal. Das ist so bemerkenswert, dass ich den Satz nach seinem Tod sogar dem Pfarrer diktiere für seine Grabrede. Heute haben wir das Glück im Rücken.
Während mein Vater die ersten Stunden an der Nordsee verschläft und ich für ihn Regenwürmer sammele, besucht meine Mutter unsere Vermieter. Diesmal bringt sie Sauerländer Honig und eine Flasche Wacholderschnaps mit. Fenna und ihr Mann Finn wohnen nebenan. Finn ist hager und wortkarg und arbeitet als Schiffsingenieur in Wilhelmshaven. Fenna ist kräftig, backt den ganzen Tag Brot und Kuchen, flennt bei jeder Gelegenheit und sagt nicht, warum. Mit Finn und Fenna verstehen sich meine Eltern. Das ist selten. Denn meine Mutter eckt überall an, dauernd kämpft sie um ihr, wie sie sagt, gutes Recht. Das ist doch ein starkes Stück, meckert sie und pflaumt die Leute an. Am Grabbeltisch, auf dem Amt, im Linienbus. Immer kommt sie zu kurz, immer regt sie sich über die Welt auf, die sich gegen sie, die sich gegen uns, verschworen hat. Als hätten wir es nicht schon schwer genug. Sie meint es nur gut, für Freundschaften allerdings ist das schlecht. Mein Vater wird vor anderen Leuten nicht laut. Aber mit denen hat er auch nichts zu tun. Er ist in keinem Verein. Nicht bei den Taubenzüchtern, nicht im Männerchor, nicht im Kegelclub und erst recht nicht beim Altherrenfußball. Er ist ein Eigenbrötler, und das ist noch untertrieben. Er muss schon ordentlich trinken, bis er gesellig wird. Und da er zum Saufen nicht in die Kneipe geht, bleibt er immer bei uns.
Mit Finn und Fenna ist das anders. Wir sitzen abends zusammen im Garten, und es wird gegrillt. Meine Mutter redet und lacht unentwegt, mein Vater tauscht mit Finn einige Details über die Teile aus, die er schmiedet. Manche davon gibt es auch im Schiffsmotor. Sie duzen sich, auch das gibt es nicht oft, normalerweise läuft bei meinen Eltern alles per Sie. Vielleicht klappt es so gut, weil wir nur ein Mal im Jahr hier sind, vielleicht macht uns die Nordseeluft zu anderen Leuten, vielleicht sind wir hier nicht so klein und verbissen, vielleicht gehören wir in Wahrheit an diesen Ort, wo es nach Kuhmist riecht und es mehr Tiere als Menschen gibt.
Während meine Mutter bei Fenna sitzt und erzählt, was seit unserem letzten Urlaub passiert ist, knie ich auf dem Boden und verteile gewissenhaft das Wasser mit dem Spülmittel auf den Steinen vor dem Haus. Es sickert in die Ritzen. Dann winden sich die ersten Tiere aus dem Boden. Sie wissen nicht, was das für eine ätzende Flut ist, die aus heiterem Himmel über ihr Zuhause hereinbricht. Ich will meinen Vater beeindrucken, ihm ein randvolles Glas mitgeben, als würden die Fische allein durch das Überangebot an Ködern anbeißen. Bald wird mein Vater aufstehen und die Angel aus dem Auto holen, die darf ich nicht anrühren. Er wird das Glas mit den Regenwürmern in der Hand wiegen, die Unterlippe stumm nach vorn schieben und anerkennend nicken. Dann nimmt er das rostige Gästefahrrad aus dem Schuppen, dessen Sattel seinen schweren Körper kaum trägt, klemmt die Utensilien umständlich unter den Gepäckträger und verschwindet für Stunden, bis wieder Ebbe ist. Mich kann er am Meer nicht gebrauchen, ich quatsche ihm zu viel. Er will in Wahrheit nur seine Ruhe, behauptet aber, selbst die Fische könnten mein Gelaber nicht ertragen und würden stiften gehen. Er wird mit leeren Händen zurückkommen, er hat nur ein einziges Mal einen Aal gefangen, so einen Oschi, erzählte er hinterher, aber dann hatte die vorbereitete Reuse ein Loch.
Als mein Vater mit dem Fahrrad außer Sichtweite ist, halte auch ich es nicht mehr aus. Ich gehe in den Garten, wo meine Mutter fröhlich sitzt und raucht, während Fenna in der Küche den Käsekuchen anschneidet, den sie für uns gebacken hat. Ich will nicht bleiben, sondern mich nur kurz verabschieden. Aber meine Mutter macht mir eine Szene, wie üblich. Mit Tränen in den Augen drückt sie mich an sich, als würde ich auf Weltreise gehen, dabei will ich doch nur mit dem Fahrrad ein paar Kilometer zur Nordsee fahren. Pass auf dich auf, fahr schön langsam, geh auf keinen Fall ins Wasser, hörst du, da sind selbst gute Schwimmer schon ersoffen, und schieb das Fahrrad den Deich runter, versprich mir das, hier hast du fünfzig Pfennig, wenn was ist, dann rufst du von der Telefonzelle aus die Fenna an und wir kommen dich holen, hast du das verstanden? Sprich nicht mit fremden Leuten, nimm dein Asthmaspray mit, und mach dir Sonnencreme ins Gesicht, aber ganz flott.
Ich nicke mit gespieltem Ernst, die ständigen Sorgen meiner Mutter gehen mir auf die Nerven. Das ist doch nicht normal, denke ich, so ist doch sonst keine Mama, aber ich mache mit. Jedes Widerwort würde mein Abenteuer nur verzögern, und ich will endlich los. Ich schnappe mir das kleine Kinderfahrrad aus dem Geräteschuppen. Vorbei an den Kuhställen, vorbei an den Kartoffelfeldern, rauf auf den Deich, runter vom Deich, ich begrüße die Schafe wie alte Bekannte. Mein Vater ist zum Glück weit weg, irgendwo hinterm Hafen, wo ihn keiner stört. Einen Spinner hat er mich genannt, als ich ihm von meinem großen Moment erzählte, den ich monatelang herbeisehne. Jetzt kann ich die Brandung schon hören, aber ich schaue nicht hin. Ich stelle mein Rad an einem Laternenpfahl ab, ziehe meine Schuhe aus, stopfe die Socken hinein und klemme sie unter dem Gepäckträger fest. Hier sind selten Menschen, da kann man so was machen. Ich drehe mich zum Wasser um und schließe die Augen, laufe langsam los über die Wiese und dann durch den Sand, blinzele höchstens, um nicht zu stolpern, fühle den stärker werdenden Wind, das Salz auf den Lippen ist echt. Noch wenige Meter, dann geht es los, das erste Gefühl von Gischt, ich warte noch, bis mir das Wasser bis zum Knöchel steht, und dann öffne ich die Augen und bin mittendrin.
Abends sitzen wir zusammen am Küchentisch und spielen Karten oder knobeln. Holen wir uns morgen einen Strandkorb? Fangen wir zusammen Krebse? Baust du uns eine Burg und dann ziehen wir da ein? Mein Vater ist albern, meine Mutter überschwänglich, das Lachen dröhnt bis auf die Straße, bis auf den Deich, bis ans Meer, wo gerade Flut ist. An unserem letzten Tag vor der Abreise haben Finn und Fenna ein Lagerfeuer gemacht. Es gibt Bratwürstchen und Steaks, und ich nippe an dem kleinen Schluck Bier, den mir mein Vater ins Glas geschüttet hat. Es ist ungewöhnlich warm. Eine Schar von Glühwürmchen schwebt aufgeregt durch die Luft. Ich verwechsele die Leuchtkäfer mit Sternschnuppen und bin felsenfest davon überzeugt, dass man sich mit jedem erlöschenden Glühwürmchen was wünschen darf. Jedesmal schließe ich die Augen ganz fest.
Mein Vater ist tot. Lisbeth und Mama sind im Heim, das man neuerdings Seniorenzentrum nennt. In zwei unterschiedlichen Wohnbereichen, eine Etage voneinander getrennt. Sie glauben damals noch, dass es weitergeht. Lisbeth träumt vom betreuten Wohnen, von Gesellschaftsspielen am Nachmittag und Gitarrenunterhaltung am Abend. Meine Mutter sehnt sich zurück. Wenn ich diesen Tag, diese Woche, diesen Monat geschafft habe, dann. Mein schönes Häuschen wartet auf mich. Wir erzählen ihr nichts vom Abschied, noch nicht. Wir sind ja selbst gerade mittendrin.
Mein Bruder Kristof hat das Haus geräumt, weil er immer alles machen muss. Er wohnt mit seiner Familie nur eine Straße entfernt. Als mein Vater stirbt, tritt er an seine Stelle wie im Märchen. Kümmert sich um unsere Mutter, um unsere Schwester, neben der Arbeit, neben der eigenen Familie, jahrelang. Das Entrümpeln der Bude ist ein letzter Akt der Fürsorge: Mit dem Verkauf des Elternhauses ist selbst nach Abzug des noch ausstehenden Darlehens Geld da für zwei Heimplätze. Kristof ist ein weicher Kerl, das weiß ich. Aber in der Not hat er einen kühlen Kopf. Einen Container für Sperrmüll, dessen Inhalt nach Kubikmetern abgerechnet wird. Eine Rolle reißfester Kleidersäcke. Etliche Umzugskartons aus dem Baumarkt. Mehrere Wochenenden hintereinander steht er zwischen all den Erinnerungen in Schrankwänden und von Kleidermotten befallenen Kommoden und Möbeln und Pflegebetten und mistet aus. Schier aussichtslos nach vier Jahrzehnten, in denen wir hier gewohnt haben. Als alles leer ist, ruft er mich nochmals an: Kannst du mit mir die wichtigen Sachen durchgucken? Willst du rein, bevor es weg ist?
Frühmorgens sitze ich also ein letztes Mal in unserem Zuhause. Vom Munde abgespart, nie ganz bezahlt. Ich stelle mir den letzten verbliebenen Stuhl mitten ins Wohnzimmer. Ins Zentrum der untergegangenen Welt. Ich sehe durch das große Fenster nach Holthausen rüber, der nächstgelegene Stadtteil auf der anderen Seite vom Tal, ein Katzensprung heute, damals eine ganze Welt weit weg von unserer Reihenhaussiedlung.
Es ist absolut still, so ruhig wie selten. Als würde die ganze Stadt Trauer tragen. In Wahrheit ist die Gewerkschaft schuld. Normalerweise setzt der Schmiedehammer im Tal um halb sechs Uhr morgens ein. Wegen ihm sind schon Familien wieder weggezogen, weil sie vom Krach geweckt wurden, sich nie an den Rhythmus gewöhnt haben. Ich kenne es nicht anders. Der laute Betrieb in den Stahlwerken Westfalen gehört dazu. Hintergrundrauschen, so selbstverständlich wie der letzte Zug in der Nacht, wenn man neben der Bahnstrecke wohnt. Heute bleibt das gewohnte Hämmern aus. Das hat die IG Metall so entschieden. Der Streik wird den ganzen Tag über dauern. Abschiedsstille. Ich sitze da und sehe mich um: Die gerahmten Urkunden und Fotos sind verschwunden. Die Strukturtapete aus den späten Neunzigern war wirklich mal weiß, das sieht man aber erst jetzt mit der nikotingelben Patina drumherum, für die es eine ganze LKW-Ladung gerauchter Zigaretten brauchte.
Ein Stockwerk höher hatte ich mein Kinderzimmer mit holzverkleideter Decke und Ausblick auf die Mittelgebirgslandschaft. Wenn mir alles zu viel, zu laut oder zu verqualmt wurde, dann schloss ich – so lautlos wie möglich, um nicht aufzufallen – die dünne Zimmertür aus dunklem Furnier, stemmte mich fachmännisch dagegen, drehte an unsichtbaren Knöpfen, stellte mir ein massives Schleusentor vor, das ich schließe. Mit Hebeln und Haken und mächtigem Rahmen. Mit Sicherheitsmechanismen für den Druckausgleich, wie beim Flugzeug, wie beim Raumschiff. War die Tür dicht genug verschlossen, ging ich ans Fenster und kontrollierte unsere Flugbahn. Ich hatte das Kommando. Ich war der Chef, der Kapitän unserer Geschichte. Katapultierte uns in andere Länder, in andere Städte – oder auch nur nach Holthausen auf der anderen Seite vom Tal. Richtig gut funktionierte das immer nur für ein paar Minuten. Die Wände des Hauses waren dünn. Im Küchenradio lief der Schlagersender. Schönes bleibt, der Jingle, der zwischen zwei oder drei Schnulzen gespielt wurde. Damit man ahnte, wo man war. Damit man wusste, wo man blieb. Ich bau dir ein Haus, du wirst schon sehen. Tiritomba, denn die Liebe ist so schön. Sagt der Igel zu dem Stachelschwein.
Die Melodien sind nie wieder verschwunden. Auch, wenn ansonsten nicht mehr viel übrig ist. Von uns und wie wir waren. Denke ich, während ich im besenrein gefegten ehemaligen Wohnzimmer ein letztes Mal das Reihenhausraumschiff kommandiere. Wenn es einen Grund gibt, die Geschichte unserer Familie abermals zu erzählen, erschöpfend, bis zur Erschöpfung, dann diesen: damit sie nicht gänzlich verloren geht. Es gibt keine haarklein aufgezeichneten Stammbäume, es gibt keine gesammelten Kassetten mit launigen Erinnerungen der rüstigen Urgroßeltern, es gibt kein einziges Tagebuch, es gibt kaum Briefe, es gibt nahezu keine Verwandtschaft mehr, es gibt nur diese großen Worte und was sie bedeutet haben: eine Familie von Bergleuten. Eine Familie von Arbeitern. Eine arme Familie. Eine stolze Familie. Eine Familie, die es nicht leicht hatte. Es gibt Geräusche, die mir überall begegnen, wo ich bin, mich zurückholen. Schönes bleibt. Das erste Knacken beim Öffnen der Schnapsflasche. Das Klicken des elektronischen Feuerzeugs, das Knistern der aufglimmenden Zigarette. Das Klackern beim Lösen der Rollstuhlbremse. Das Rattern der Nähmaschinen. Das Blubbern der schlecht entlüfteten Heizungsrohre. Das Knattern des ersten Mofas. Das Wummern des Schmiedehammers im Tal. Das Schnalzen meines Vaters durch die Lücke seiner am Rand abgebrochenen Schneidezähne. Das Fiepen der Hörgeräte meiner Mutter. Das Zirpen des Wellensittichs. Das Wispern von Lisbeth, stundenlang. Das Fauchen der kleinstädtischen Omnibustüren. Und ja: das ferne Bullern des Meeres nach einem Tag mit viel Wind. Aber auch: das zielgerichtete Zischen des Asthmasprays, das rhythmische Pumpen der Beatmungsmaschine auf der Intensivstation, das humorlose Geräusch der Krankenhausschiebetür, sommers wie winters, bevorzugt nachts.
Nach ein paar Minuten schaltet ein Nachbar den Rasenmäher ein, er hat wegen des Streiks frei und nutzt den unerwarteten Urlaubstag. Das Geräusch ist mein Startsignal. Ich stehe auf und laufe ein letztes Mal durch alle Zimmer. Ein junges Paar mit Kindern, hat Kristof erzählt, will das Haus kaufen, es innerhalb von ein paar Wochen renovieren. Es geht also weiter. Der Stuhl stand bis zuletzt in der Küche, gehörte zu einer Vierergarnitur mit Tisch und Eckbank aus dem Quelle-Versand. Mein Vater hatte die Sachen noch bestellt, als er schon ungewöhnlich häufig müde und schlapp war und der Alltag ihm schwerfiel. Die letzte Rate dafür war nach seinem Tod fällig gewesen. Ich nehme das letzte Möbelstück, trage es hinaus und pfeffere es in den Container auf unserem längst nicht mehr genutzten Parkplatz. Überlege, ob es sich überhaupt lohnt, die Haustür jetzt noch abzuschließen, mache es dann aber doch.
Ein Kleinstadtfriedhof. Die Stadt heißt Plettenberg. Es nieselt, und wir beerdigen meine Schwester.
Bestatter und Pfarrer sind faktenorientiert vorgegangen. Der Vater? Geboren 1940, gestorben 2008, Bronchialkarzinom, auf Wunsch der Ehefrau erdbestattet. Die Mutter? Geboren 1946, gestorben 2019, multiples Krankheitsbild, eingeäschert. Die Schwester? geboren 1970, gestorben 2022, Herzversagen, eingeäschert. Die Preise? Haben sich mit den Jahren erhöht, die Grundkomponenten bleiben unverändert. Es braucht für eine gescheite Kleinstadtbeerdigung laut Kostenvoranschlag: 1 Kiefernvollholzsarg mit Innenausstattung, 1 x Einsargen mit 2 Mann, 1 Sterbegewand aus Baumwolle, 1 x Ausgestaltung und Betreuung der Trauerfeier, 1 Transport zum Krematorium, 1 Erledigung sämtlicher Formalitäten, 1 Auslage für Todesbescheinigungen, 1 Sterbeurkunde, 1 Organistin, 1 Blumengesteck, 1 Feuerbestattung und 1 Zeitungsanzeige.
Mein Bruder Kristof unterdrückt ein Lachen, als wir an der Spitze des Trauerzugs auf dem geschotterten Weg von der Kapelle zum offenen Grab laufen. Auch ich muss lächeln. Mein ewiges Stolpern ist Familienfolklore. Die billigen weißen Baumwollhandschuhe durchgeschwitzt, die Griffe der Urnentrage rutschig, die schwarzen Schuhe glatt: mit Würde straucheln. Nur keine falsche Bewegung. Natürlich ist ein Schauer aufgezogen, wie könnte es anders sein. Wir kämpfen mit dem Weg und mit der schwankenden Urne und gegen Regen und Lachanfälle an, Kristof und ich. Zum Glück ist der Friedhof überschaubar, zum Glück ist das Grab nicht weit entfernt. Ist dir die Schieflage nicht aufgefallen, fragt mich Kristof später beim Kaffeetrinken, Lisbeth wäre uns in ihrer Urne fast umgekippt. Hab mir schon vorgestellt, wie wir sie irgendwie wieder aufklauben müssen.
Es ist immer so schön hier. Selbst jetzt. Die Berge, die Täler, das Land. Das Meer ist weit weg, aber manchmal ist es hier so ruhig, nur der Wind geht sanft durch die Bäume. Wie das Wogen der Nordsee an einem nahezu windstillen Tag. Wir laufen weiter.
Kristof hatte mir jahrelang im Spaß gedroht, mich im Falle meines zu frühen Ablebens in das noch freie Urnengrab neben meinem Vater und meiner Mutter zu stecken. Jetzt brauchen wir es eher als gedacht. Wir haben das Reihenhaus eingetauscht gegen ein Gemeinschaftsgrab auf dem evangelischen Friedhof. Unsere Familie aus sogenannten kleinen Verhältnissen, die Malocher, die Arbeiter, die Outsider, die Kinderreichen, die Komischen, die Zugezogenen, die mit der Behinderten, die mit der kranken Mutter, die mit dem maulfaulen Vater, sie ist fort. Ausgeträumt. Die Terrasse mit Waschbetonplatten und Blick auf Wiese und Garten: nicht mehr die unsere. Das dazugehörige Häuschen mit rissiger Fassade: verkauft. Was noch übrig bleibt, Briefe, Fotoalben, Kontoauszüge, ein paar Tassen und Tinnef, liegt in zwanzig Umzugskartons.
Es ist immer so schön hier. Auch, wenn ich zu einer Beerdigung komme. Drei Mal ist mir das schon passiert. Drei Mal hat das Telefon geklingelt (nachts, morgens, tagsüber), wie es sonst nie klingelt. Drei Mal war ich jeweils woanders: Hustend, im Bett eines katzenhaarverseuchten Gästezimmers, während draußen ein Sturm aufzieht, auf genau diesen Anruf wartend. Vor einem Fischladen im Kölner Stadtteil Deutz an einem gleißend hellen Sommermorgen, nicht sonderlich überrascht. Auf einer Betontreppe unseres Zuhauses in Halle an der Saale, eiskalt erwischt. Eine Stufe, ein Schaufenster, ein Gästezimmer. Drei gleiche Botschaften, unterschiedlich überbracht: Wir sollen sofort ins Krankenhaus kommen wegen Papa. Mama ist letzte Nacht gestorben. Lisbeth ist einfach nicht wieder aufgewacht.
Mittlerweile sind wir am Grab angekommen: Einige der grünen Damen aus dem Pflegeheim, die ehrenamtlich für Abwechslung im Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner sorgen, ihnen aus der Zeitung vorlesen und zuhören. Die engste Verwandtschaft. Eine ältere Dame, die den Kontakt gehalten hat, möglicherweise eine Freundin, wir wissen nichts Genaues. Bei meinem Vater war die Kapelle noch voll, die Verwandtschaft kam aus dem ganzen Land. Ex-Kollegen drückten mir stumm Geldscheine in die Hand. Bei meiner Mutter dünnte es sich schon aus, ihre Lieblingspflegerinnen kamen trotz Urlaubs und einige ehemalige Nachbarn und Freundinnen. Diesmal ist es ein sehr überschaubarer Kreis.
Überhaupt, diesmal ist alles gleich und alles anders. Diesmal gibt es Katja und meinen Jungen. Das macht einen Unterschied. Im Sommer vor drei Jahren habe ich meine Mutter beerdigt. Im Herbst vor drei Jahren wurde mein Sohn geboren. Das war das Ende. Das war der Anfang. Hier komme ich her, hier bin ich weggegangen. Hierher kehre ich für den Friedhof zurück. Arbeiterkind wird man nicht, Arbeiterkind ist man. Mein Sohn verschläft die komplette Beerdigung im Kinderwagen. Für ihn ist diese Reise ein großes Abenteuer. Er genießt sie. Die lange Reise mit dem Zug. Das Fernsehen spät am Abend. Das Frühstücksbüfett.
Wir schlafen im Hotel der Prominenten. Dort, wo die ehemaligen Stars aus der Schwarzwaldklinik übernachteten, wenn sie mit ihrem Tourneetheater nach Plettenberg kamen und nach der Vorstellung nicht direkt nach Dortmund oder Bochum weiterfuhren. Vom kleinen Balkon des Hotelzimmers aus schaut man in alle Richtungen auf Wälder. Die Luft am Morgen ist kälter und klarer als irgendwo sonst. Beim ersten Atemzug bin ich der kleine Plettenberger Junge, der von Kaninchenausstellungen und Feuerwehrfesten träumt.
Warum sind meine Eltern aus dem großen Ruhrgebiet in so eine kleine Industriestadt jenseits der Autobahn gezogen? Wie konnten sie diesem Kaff mit den vier Tälern und ein paar Talsperren und den Mittelgebirgshügeln mit Windrädern und den Menschen mit ihrer sturköpfigen sauerländischen Mentalität jemals etwas abgewinnen? Haben sie diesen Flecken Erde allen Ernstes mehr oder weniger freiwillig zu ihrer Heimat erkoren? Jahrzehntelang habe ich mir diese Fragen gestellt. Heute suche ich im Netz nach renovierungsbedürftigen Häusern und stelle mir vor, wie wir alle Urlaube dort verbringen. Unten wohnen wir, oben wird vermietet. Es ist so schön hier. Aber man will ja immer erst dann nach Hause, wenn es nicht mehr geht.
Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr noch da ist, hatte ich zu meinem Bruder und seiner Frau gesagt, als wir Lisbeth an Weihnachten im Pflegeheim besuchten. Sie sieht schlecht aus und ist viel zu dick. Ich fürchte, sie hat endgültig aufgegeben. Alle hatten betreten auf den Boden gestarrt, und dann hatte meine Schwägerin Sarah gesagt: Komm, das sagst du mittlerweile auch schon seit fünf Jahren. Wir hatten gelacht. Nur diesmal sollte ich Recht behalten.
Nach dem Jahreswechsel fühlte meine Schwester sich unwohl und müde, irgendwas mit dem Magen. Sie schrieb mir täglich und versuchte ständig, mich anzurufen. Heute bereue ich, dass ich in ihren letzten Tagen so selten ans Telefon gegangen bin. Dass sie das Gefühl haben musste, auch ich hätte sie im Stich gelassen. Aber ich machte mir keine Sorgen. Sie suchte eben nach Aufmerksamkeit, wo es nur ging. Schließlich war sie vom Pflegeheim ins benachbarte Krankenhaus verlegt worden, auch da war ich noch nicht alarmiert, weil sie nichts Konkretes fanden. Es gibt schon wieder was Neues, bei mir kommt morgen die Galle raus, schrieb sie mir. Zuvor hatte sie versucht, mich telefonisch zu erreichen. Ihre letzte SMS an mich blieb für immer unbeantwortet. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich sie nicht zurückgerufen hatte, die Arbeit, mein Sohn, reiner Trotz gegenüber ihrer rücksichtslosen Kontaktaufnahme zu jeder Tageszeit. Ich wollte mich nach der Operation in Ruhe bei ihr melden. Stattdessen rief mich mein Bruder an: Lisbeth ist einfach nicht wieder aufgewacht. Ich setzte mich auf die Betontreppe und machte meiner Frau gegenüber mit der freien Hand eine Vorbei-Geste, die sie gleich verstand. Ich brach nicht in Tränen aus, wurde nur stumm und bleich. So sehr, dass auch mein Sohn begriff, dass etwas nicht stimmte. Er setzte sich vorsichtig zu mir auf die Treppe, rückte dicht an mich heran und legte mir seinen Lieblingsbagger in den Schoß.
Meine Schwester ist nicht alt geworden. Sie war die letzten Jahre andauernd krank, sie fing an, wunderlich zu werden, glaubte an ein geheimes Bitcoinvermögen, das uns alle retten wird, verlor sich in privaten Verschwörungstheorien, ihre ehemaligen Pflegedienste betreffend, lebte das Leben einer sehr alten Frau mit den Altenpflegerinnen als engste Vertraute. Ich war mir sicher gewesen, dass Lisbeth eine Art Telefonliste pflegte, die sie alle paar Tage abarbeitete, um sich ein paar Minuten Zerstreuung zu holen. Wie geht es dir, fragte sie zu Beginn jedes Gesprächs, sie wartete meine Antwort kaum ab und hakte gleich ein, und dann kam ein minutenlanger Sermon über ihr eigenes vermeintliches Leid, den man nur konsequent und grob unterbrechen konnte. Deshalb war ich oft nicht ans Telefon gegangen, wenn sie anrief. Deshalb hatte ich auf ihre sich ewig wiederholenden Nachrichten selten oder gar nicht reagiert. Als Kristof und ich ihr Telefon nach ihrem Tod sichteten auf der Suche nach möglichen Bekannten, die wir zur Beerdigung einladen könnten, traf mich die Wahrheit: Sie hatte in den ganzen letzten Jahren nur eine einzige Nummer immer wieder angerufen. Es war meine.
Am Tag der Beerdigung kaufe ich mir morgens im Modepark der kleinen Stadt ein Jackett und eine dazu passende Hose. Die Sachen sind teuer.
Vor der Trauerfeier drehe ich eine Runde durch die Stadt. In der Fußgängerzone wischt sich Otto Maloche seit Jahrzehnten die Stirn, gestützt auf seine schwere Schmiedezange. Die Bronzefigur erinnert nicht von ungefähr an meinen Vater, der sich mit der Außenseite seiner rechten Hand den Schweiß aus dem Gesicht reibt. Die kräftigen Arme. Die verschlossene Mimik. Otto Maloche ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Kurz verschnaufen. Eine rauchen. Sich die Suppe aus den Augen wischen. Wieder malochen.
Zufällig treffe ich einen ehemaligen Klassenkameraden vor der Eisdiele, er ist mittlerweile Arzt in einer Großstadt im Westfälischen und besucht Verwandtschaft. Sein Onkel hat einst meine Mutter operiert und mir später seinen maßgeschneiderten Anzug vermacht, aber das ist eine andere Geschichte. Wie geht’s, was machst du hier, wo wohnst du jetzt, Glückwunsch zu deinem Sohn, hast du schon gehört, unseren Sportlehrer Erwin gibt es auch nicht mehr. Uns fällt auf, dass wir uns immer nur dann begegnen, wenn bei mir wieder jemand gestorben ist.
Dann ist die Urne in der Erde. Niemand ist gestolpert. Der alte Pfarrer ist die Vertretung der Vertretung, Geistliche sind gesuchte Leute auf dem Land. Er macht das Beste aus der Situation. Er spricht vom Sorgenkind der Familie, das jetzt wieder bei den Eltern ist. Dass man auch im Rollstuhl die Welt entdecken kann. Schweift ab nach Amerika, wo meine Schwester war, bevor die Türme einstürzten. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Am Schluss spielt der Sohn des Bestatters ein Lied der Kelly Family ab. Oh I wish I were you. Die mobile Box ist viel zu laut eingestellt, die Musik dröhnt über den Friedhof, ein Paketbote fährt langsam mit heruntergekurbeltem Fenster an der Friedhofsmauer vorbei und schaut irritiert auf die Trauergemeinde. Selbst die scheppernden Engel wecken meinen Sohn nicht auf.
Jetzt hat sie es gut. Jetzt tut ihm nichts mehr weh. Jetzt sind sie wieder zusammen. Auch mit dem Abstand vieler Jahre wundert mich, wie sehr wir auf Erlösung getrimmt waren. Wir hier unten, er da oben: der liebe, liebe Gott. Dafür, dass wir im Alltag nichts mit ihm am Hut hatten, war oft von ihm die Rede. Vielleicht müsste man auf unsere Familie bezogen sagen: Er war ein gnädiger Gott. Besser: der Gnadende, obwohl es das Wort nicht gibt.
Machen wir uns nichts vor, eigentlich war er in erster Linie zum Strafen da. Wenn es donnerte, dann sagte mein Vater: der liebe Gott schimpft. Und wenn es regnete: jetzt heult er auch noch. Diesen Protestantenkomplex wurden wir nicht los. Der steckte uns in den Knochen. Für immer werde ich daran erinnert, wenn ich in meine Geburtsurkunde schaue. Dass Dietmar, der Mann von Gabriele, mangels Alternativen mein Patenonkel wurde, wundert mich nicht weiter. Gabriele und ihre Familie waren meine ganze Kindheit und Jugend über die einzigen konstanten Freunde meiner Eltern. Zu ihnen gingen meine Mutter und ich fast jede Woche, dann gab es Kaffee und Kuchen. Weitere Freundinnen von Gabriele saßen mit am Tisch und lästerten über andere Kleinstadtmütter, während ich mit Gabrieles erwachsenem und schwer beeinträchtigtem Sohn Harald in alten Versandhauskatalogen blätterte, mit ihm Autostau spielte und Onkel Dietmar mir vor Rührung immer einen viel zu großen Schein zusteckte. Erstaunlicher war die Wahl meiner Patentante: Diese Funktion übernahm die Ehefrau des evangelischen Pfarrers, der mich taufte. Lange Zeit war das für mich selbstverständlich. Aber wie waren meine Eltern auf die aberwitzige Idee gekommen, sie zu fragen? Natürlich, meine Mutter hatte für Lisbeth immer und überall wie eine Missionarin um Unterstützung geworben, die Pfarrersfrau, ein direkter Draht zum Herrgott, das konnte ja nicht verkehrt sein – meine Mutter kannte die Würdenträger bei Kirche und Stadt und natürlich auch deren Partnerinnen. Aber weshalb hatte jene Ehefrau des Pfarrers zugestimmt, die ich meine gesamte Kindheit und Jugend hindurch siezte und zu der ich nach meiner Konfirmation den Kontakt nach und nach verlor? Ich fürchte, es war die Bedürftigkeit, die wir ausstrahlten: ein Malocher, eine Hausfrau, vier Kinder, eins davon im Rollstuhl: Wenn es hier keine Patenschaft aus Gnade brauchte, wo bitte dann?
Unsere Kirchenbesuche beschränkten sich neben Taufen, Konfirmationen und den damals noch seltenen Beerdigungen auf den jährlichen Weihnachtsgottesdienst. Und trotzdem: Selbst mein Vater, dem stets wenig heilig war, hatte einen Höllenrespekt vor der Kirche. So sehr, dass er sie, wie ich als Kind dachte, gar nicht mehr betreten wollte, sondern beim ersten Orgelton hinausstürmte, nachdem er einen Zwanzigmarkschein in die Kollektendose gestopft hatte. Den Gottesdienst über lief er vor der Tür auf und ab, rauchend.