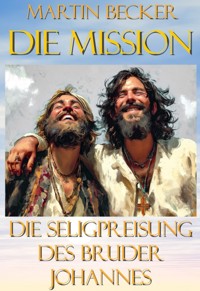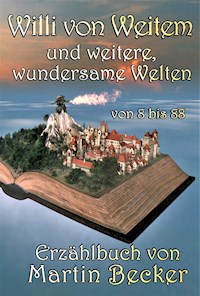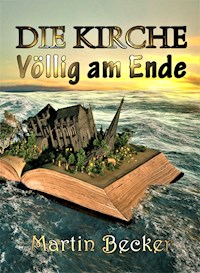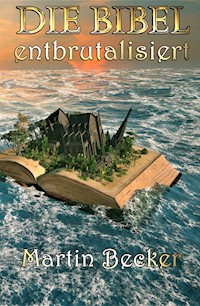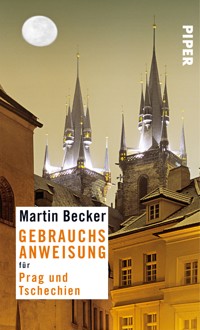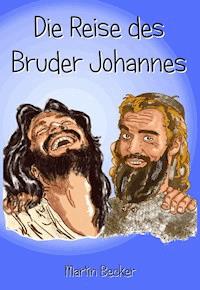Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Prag 1910. Kisch ermittelt in seinem ersten FallPrag ist in Aufruhr. Der Weltuntergang steht bevor. Im Mai 1910 soll die Erde den Schweif des Halley'schen Kometen kreuzen – ein jeder blickt zum Himmel, und die Verbrecher auf Erden haben leichtes Spiel. Egon Erwin Kisch, berühmt-berüchtigter Reporter der »Bohemia«, ermittelt auf eigene Faust in seinem ersten Fall. Er lässt sich sogar als Schwerverbrecher ins Gefängnis sperren, um mit dem Kopf der Prager Unterwelt Portwein zu trinken. Zum Glück bekommt Kisch Hilfe: Vom tschechischen Zöllner Novák, der sich mit Panikattacken herumschlägt, dem schüchternen Sonderling Brodesser und natürlich von seiner kongenialen Partnerin Lenka Weißbach, eigentlich Medizinstudentin, die sich fürs Böse interessiert und wie ihr Kumpel Kisch in den engen Gassen von Prag zu Hause ist. – Der furiose Auftakt einer neuen Krimi-Serie um Egon Erwin Kisch und Lenka Weißbach als Ermittlerduo.»Martin Becker und Tabea Soergel lieben das alte Prag und bringen es zum Leuchten! Eine magische Zeitreise durch die engen Gassen der goldenen Stadt – und zu einem genialen Ermittler und Reporter, noch dazu mit Humor. Das ist Babylon Praha!« Jaroslav Rudiš
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN 978-3-98568-124-2
1. Auflage 2024
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2024
Umschlaggestaltung: zero-media.net
Unter Verwendung eines Motivs von ©FinPic®, München
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Ingo Neumann / boldfish
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Martin Becker / Tabea Soergel
Die Schatten von Prag
Die Burg thronte müde über der Stadt. Der Mond blendete die Moldau, damit sie nicht auch noch einschliefe. Selbst die verrufenen Spelunken in den verwinkelten Gassen der Altstadt, letzte Zufluchtsorte für alle, die nicht nach Hause konnten oder wollten: wie leergefegt. Am endlos gewölbten Himmel leuchteten die Sterne stumm um die Wette. Die kälteste Nacht des Jahres 1910 war hell und frostig. Dazu eine gedämpfte Stille, als wäre gerade frischer Schnee auf das Kopfsteinpflaster und die hundert Türme der Stadt gefallen. Nur hier oder da zerschnitt eine spätabendliche Elektrische die eisige Ruhe. Prag hielt Winterschlaf.
Karel Novák fröstelte, obwohl er den zugigen Wind auf der Franzens-Brücke gewohnt war. Der alte Zöllner, klein und mit hagerem Gesicht, hockte in seiner schlecht sitzenden Uniform im steinernen Mauthäuschen. Auf der anderen Seite der Brücke hatte sein Kollege Honza gerade die Läden seines Fensters geschlossen. Wer den Fluss überquerte, musste bis zum Morgengrauen bei Novák bezahlen. Fußgänger zwei, Radfahrer vier, Einspänner zehn, Zweispänner zwanzig Heller. Die Preise waren in dieser Nacht allerdings nicht von Interesse. Selten sollte der Zöllner einen derart einsamen Dienst auf der Brücke verbringen.
Auf dem Weg zur Arbeit suchte Novák wie üblich den Himmel ab. Der Johannesburger Komet hatte vor einigen Tagen seine maximale Helligkeit erreicht. Man sah seinen Besuch allerdings nur als Vorboten des eigentlichen Unglücks: Die Erde, so wurde gemunkelt, würde im Frühjahr den gewaltigen Blausäureschweif des Kometen Halley passieren und darin vergehen. Ganz Prag starrte seit dem Jahreswechsel also nach oben und verlor den Boden unter den Füßen. Überall blühte das Geschäft mit der Himmelspanik. Wer wollte, konnte sich an eilig zusammengezimmerten Ständen von Kanarienvögeln und Wellensittichen die Zukunftskarten ziehen lassen. Je mehr man zahlte, desto besser wurden die Aussichten. In allabendlichen spiritistischen Séancen riefen die Bürgerkinder der Stadt die Geister der Vergangenheit an. Als wären sie von allen guten Geistern verlassen, fand Novák.
Zugegeben, auch er bereitete sich vor. Aber auf seine Art. Im Keller seiner Mietskaserne in Žižkow, der ausufernd wachsenden Vorstadt der tschechischen Arbeiterschaft, grub er in den freien Nächten im hintersten Winkel ein Erdloch. Mit bloßen Händen. Breit und tief genug, um die Apokalypse zu überstehen. Schlimmstenfalls will ich wenigstens ein bequemes Grab haben, schwor er sich, ganz für mich allein. Seine Frau war vor einigen Jahren an Typhus gestorben. Seitdem hatte er nichts mehr zu verlieren, nur das eigene Leben. Und das war ihm lieb. Nach getaner Arbeit verdeckte er sein künftiges Refugium unter Holzbrettern und Lumpen und versteckte auf dem Weg in seine winzige Bleibe die erdverkrusteten Hände in den Hosentaschen. Niemand würde jemals von seinem Versteck erfahren.
In den übrigen Nächten saß Novák auf der Brücke, allein mit der Moldau als Gefährtin. Ihr Plätschern war seine Gesellschaft. Wie er hatte sie alles gesehen und gehört. Wie ihn konnte sie nichts mehr überraschen. Sie litten gemeinsam und wurden zusammen alt. Sie waren immer da. Gerade baute man schon wieder eine neue Badeanstalt unterhalb vom Vyšehrad. Ab dem Sommer würden sich die Besseren und Betuchten dort amüsieren. Novák verstand nicht, warum alle ständig ins Wasser wollten. So sehr er seine Moldau auch liebte: Es wäre ihm nicht eingefallen, auch nur einen Fuß in die vom Abwasser verseuchte Brühe zu setzen.
Stunde um Stunde verging. Keine Menschenseele in Sicht. Wahrscheinlich sparten sich die wenigen Nachtgestalten die Gebühr und nahmen trotz der bitteren Kälte den Umweg über die Karlsbrücke in Kauf, deren Überquerung kostenlos war. Seit einigen Tagen konnte Novák allerdings nur davon abraten. Er glaubte nicht an Gespenster, ehrlich nicht, aber an seinem freien Tag letzte Woche hatte er eine Erscheinung gehabt. Auch an dienstfreien Tagen spazierte er nachts über die Brücken. Schlafen konnte er nicht, und der Fluss beruhigte ihn. Als er aber in jener ebenfalls schon kalten Winternacht über die einsame Karlsbrücke lief, waren plötzlich Schatten auf der Mauer gewesen. Gesichter. Münder. Augen, die ihn anstarrten. In diesem Augenblick hatte er aus unerfindlichem Grund sofort gewusst, wer diese Fratzen waren: die böhmischen Aufständischen. Vor Jahrhunderten hatten die Habsburger sie nach der Schlacht am Weißen Berg beim Blutgericht auf dem Altstädter Ringplatz exekutiert. Ihre abgeschlagenen Köpfe hingen zehn Jahre lang zur Abschreckung in eisernen Käfigen am Brückenturm. Und jetzt waren sie als Schatten zurückgekehrt und stierten ausgerechnet den Zöllner an. Novák hatte aufgeschrien und sich vor Schreck die Hände vors Gesicht gehalten: »Was wollt Ihr von mir?«
Er war weiter gestolpert. Dann ein heftiger Schlag.
»Verschwindet, lasst mich in Ruhe!«
»Was ist denn mit Ihnen los?«, hatte eine strenge Stimme gefragt. Novák war mit einem Polizisten kollidiert. »Ist Ihnen nicht gut, Herr Zöllner?«
»Was ist mit den Schatten?«
»Ruhig Blut, mein Herr.«
Der Polizist hatte Novák beschwichtigend die Schulter getätschelt.
»Haben Sie das auch gesehen?«
»Aber ja, Sie wissen doch, viel Licht, viel Schatten.«
»War wohl in Gedanken«, hatte Novák gemurmelt.
»Lieber nicht mit geschlossenen Augen durch die Weltgeschichte laufen, das kann übel ausgehen! Schönen Abend, der Herr.«
Der Polizist war lachend weitergezogen. Auch Novák hatte seinen Weg fortgesetzt und gewusst, dass der Polizist ihn verhöhnte. Dass er als kauziger Sonderling galt, der einen Spaß vertragen konnte. Schlecht gelaunt und zittrig war er nach Hause gekommen. Vielleicht war ein Erdloch, hatte er beim Einschlafen gedacht, wirklich der beste Ort, um diese verfluchte Stadt zu überleben.
Im Januar hatte Novák Geburtstag gehabt. Er feierte ihn nicht, aber doch hatte er mit Honza, seinem Kollegen von der anderen Seite der Brücke, beim morgendlichen Dienstwechsel noch einen Tee getrunken. Und wieder wollte Honza ihn überreden.
»Eine bequemere Arbeit in der Verwaltung zu bekommen wäre ein Leichtes«, hatte Honza gesagt. »Wie kannst du das nur. Man lebt doch, wenn es hell ist.«
»Du vielleicht«, hatte Novák erwidert. »Du bist noch jung.«
Honza schüttelte den Kopf. Wie Nováks Vorgesetzter aus dem warmen Bureau der Stadtverwaltung. Er hatte den alten Mann allein aus Mitleid von der Brücke holen wollen. Aber der hatte stets die Arme verschränkt und gesagt: »Lasst mir meine Nacht.« Seine Logik: Je weniger Leuten er begegnete, desto geringer die Gefahr. Keine murrende Schlange vor dem Mauthäuschen, keine hitzige Diskussion über Sinn und Unsinn des neumodischen Brückenzolls, der den Reichen lästig war und die Armen um ihre letzten paar Heller brachte. Außerdem hatte Novák nicht mehr die Kraft, jedem drahtigen Kerl hinterherzuhetzen und wegen der lächerlichen Gebühr Leib und Leben zu riskieren. Drüben auf der Elisabethbrücke zum Beispiel hatte es neulich seinen Kollegen Jirka erwischt. Anstelle der Münzen zog ein Verrückter sein Messer aus der Tasche und steckte es dem Zöllner zwischen die Rippen. Aus Wut darüber, gab er später zu Protokoll, dass ihm der Eintritt in eine Wärmestube verwehrt worden war. Der Kerl versauerte jetzt im kalten Pankratzer Gefängnis. Jirka hatte zwar überlebt, aber unter die Menschen traute er sich nicht mehr, der arme Hund.
Der Zöllner lehnte sich zurück und lauschte in die Stille hinaus: In Nächten wie dieser war die Stadt fast wie früher. Brach der Tag erst an, dann blieb wieder kein Stein auf dem anderen. Überall wurde geplant und gebaut. Selbst die Brücke, auf der er hockte, gab es erst seit 1901. Der Kaiser persönlich war aus Wien zur Einweihung gekommen. Die vorher existierende Kettenbrücke hatte den stetig zunehmenden Verkehr nicht mehr bewältigen können, man hatte sie abgerissen. Auch die Josefstadt hatten sie schon dem Erdboden gleichgemacht. Angeblich wegen der Ratten und Seuchen. In Wahrheit, weil Prag bald wie Paris werden sollte. Das hatte Novák in der Zeitung gelesen und gedacht: Was für ein Unsinn. Brauchte es diese monströsen neuen Zinshäuser und ein riesiges Neues Rathaus? Musste die Stadt zu allen Seiten hin auswuchern? Sie lockte sowieso schon mehr und mehr Menschen an, die wie Strandgut am Ufer der Moldau landeten, oft mittellos. Ein bisschen Glück suchend und doch nur ihr Unglück vermehrend.
Prag hatte sich verändert. Nicht zum Guten, wie Novák fand. Die Stadt wurde enger und ungemütlicher. Auch das aufgepeitschte Gerede von Tschechen und Deutschen und ihrem Kampf um die richtige oder die falsche Sprache auf Straßenschildern mochte er nicht mehr hören. Ganz zu schweigen von der Feindseligkeit gegen die Prager Juden. Vor einigen Jahren waren reihenweise die Schaufensterscheiben ihrer Läden zu Bruch gegangen, bis endlich die Soldaten diese verfluchten Nationalisten aufhielten. Hass und Neid und Missgunst gärten weiter. Ein brodelnder Strom im Untergrund der selten goldenen Stadt, stinkend wie der Fluss unter dem Zöllner. Warum konnte man einander nicht einfach in Ruhe lassen? Novák war kein Pessimist, beileibe nicht, aber er hatte Augen im Kopf. Raub und Mord und Totschlag gab es mittlerweile jeden Tag. Und die Polizei kam nicht mehr hinterher. Viele Fälle blieben ungelöst, nur das Offensichtliche wurde bestraft.
Vor dem Morgengrauen trat Novák vor sein Häuschen und schaute hinüber zum Nationaltheater. Zeit für den täglichen Aufruhr. Seit einigen Wochen konnte er ihn Nacht für Nacht beobachten: Vom Dach des Theaters flog kreischend ein Vogelschwarm auf, drehte mehrere Runden über dem Fluss und landete wieder. Er glaubte nicht an böse Vorzeichen, ganz sicher nicht, aber irgendwann, nahm Novák sich vor, würde er jemandem von den verdächtigen Heimsuchungen der letzten Zeit erzählen. Gerade wollte er zurück in sein Häuschen und vor Dienstschluss die kaum nennenswerten Heller in der Kasse zählen, da zuckte er zusammen. Eine Gestalt in einem kuttenartigen Mantel eilte über die Brücke, ihre Kapuze tief ins Gesicht gezogen. »Guten Morgen, der Herr«, murmelte Novák, doch der Mann beachtete ihn gar nicht und lief im Stechschritt weiter. Novák sah ihm nach, aber dann zog etwas am Fluss im Mondschein seine Aufmerksamkeit auf sich. Der Zöllner zögerte, rieb sich die Augen, aber tatsächlich: Am Franzens-Kai saß jemand auf der Bank. Den Kopf nach hinten gestreckt, in den Himmel starrend. War das eine Falle? Eilig griff Novák nach der Eisenstange, die er für solche Fälle in seiner steinernen Hütte deponiert hatte. Seine Hände zitterten plötzlich, als er sich dem Franzens-Kai näherte, die Stange fiel zu Boden. Er stand vor dem Mann auf der Bank und sah in ein bleiches, leeres Gesicht. Der Mann war tot. Mit entsetzt aufgerissenen Augen und offenem Mund starrte er in den Sternenhimmel. Was auch immer er gesehen hatte im Moment des Todes: Es musste gewaltig gewesen sein.
Das Donnern des massiven Eisengitters hallte lange in den düsteren Katakomben nach. Dann ertönten schwere Schritte. Das mittelalterliche Gemäuer ließ keinerlei Rückschlüsse auf die augenblickliche Verwendung der modrig riechenden Räumlichkeiten zu: War es ein ehemaliger Kerker? Das Tunnelsystem unter einem verlassenen Kloster? Der als Lagerraum genutzte verwinkelte Keller einer Kneipe? Die Gestalten trugen schwarze Kutten. In diesem schummerigen Licht waren ihre Gesichter unkenntlich. Der Raum, in dem sie sich trafen, war karg und kalt. Lediglich einige Kerzen erhellten einen grob behauenen Tisch und wuchtige Stühle. Einer stellte eine Flasche Schnaps und Silberbecher auf den Tisch und goss reihum ein. Das Silber der Becher schimmerte im Kerzenschein, an den steinernen Wänden ringsherum bewegten sich Schatten wie schwarze Wogen. Minutenlang sprach niemand ein Wort. Dann räusperte sich einer der Männer, zog seine Taschenuhr hervor, starrte aufs Zifferblatt und wartete. Schließlich hob er den Kopf und sagte: »Nun ist es vollbracht. Die neue Zeitrechnung hat begonnen. Es gibt kein Zurück mehr.«
Jemand brummte zustimmend.
»Erweisen wir dem feinen Herrn der Prager Gesellschaft die letzte Ehre, trinken wir zum Abschied auf ihn!«
Schallendes Gelächter, das Scheppern der mit Schwung aneinander gestoßenen Becher, gleich wurde wieder Schnaps nachgefüllt. Die nervöse Unruhe, die zu Beginn noch geherrscht hatte, wich nun.
»Wo ist sie?«
»Schläft ihren verdienten Rausch aus.«
»Wird sie loyal bleiben?«
»Das sollte sie. Wenn nicht, dann jagen wir sie auch zum Teufel.«
»Wann machen wir weiter?«
»Wir haben keine Eile. Warten wir auf neue Befehle des Rates. Wenn der richtige Moment gekommen ist, werden wir es wissen.«
»Denkt dran«, erhob jetzt einer seine Stimme, der bis dahin geschwiegen hatte, der Plan ist größer als wir. Nur wenn wir siegen, sind wir endlich wieder frei.«
»Auf die Freiheit!«, schrie jemand und hob seinen Becher.
»Auf die Freiheit!«, wiederholten die anderen im Chor. Sie schenkten immer wieder nach und tranken gierig, dann stand der erste Mann auf.
»Die Nacht ist bald vorbei. Lasst uns hinausgehen und den ersten Coup im hellen Licht des Tages genießen.«
Auch die anderen Männer erhoben sich. Jemand blies die Kerzen aus, und in den alten Katakomben unter der Stadt breitete sich wieder Finsternis aus.
Der eisige Berliner Wind fuhr Lenka erbarmungslos ins Gesicht. Sie stand auf dem Askanischen Platz, die Reisenden strömten um sie herum, rempelten sie an, entschuldigten sich nicht. Das Chaos rührte sie, ihr kamen beinahe die Tränen. Das Geschrei, der Baulärm, die vor Aufregung geröteten Gesichter der Ankommenden und Abfahrenden, selbst das dümmliche Stolzieren des Reservisten mit seinem lächerlichen Bart und seiner Pickelhaube: Lenka wollte alles in sich aufnehmen, nichts vergessen. »Gebt mir noch diese paar Minuten«, sprach sie leise und wischte sich mit dem Handrücken über beide Augen. Sie beobachtete die Damen und Herren vor dem noblen Hotel Excelsior, dem prachtvollen Askanischen Hof, dem eleganten Preußischen Hof: Wie gern hätte sie sich jetzt in eines der luxuriösen Zimmer auf ein weiches Bett gelegt und ihre Abreise verschlafen.
Sie hörte den Zeitungsjungen rufen, seine Stimme schon ganz heiser und rau: »Riesensensation, erstes Foto vom Nordpol, große Pläne, Roosevelt will nach Berlin!« Ein humpelnder Bettler sprach sie an: »Bitte eine Gabe für einen frierenden Schlafgänger, meine Dame, die Nächte sind so schrecklich kalt.« Sie gab ihm viel zu viele Münzen. Ihr Gepäck hatte Lenka schon nach Prag vorgeschickt. Der Träger konnte heute an ihr nichts verdienen. Sie hatte nur einen kleinen Koffer mit den wichtigsten Dingen dabei, den sie nicht aus der Hand geben würde, auch wenn sie ihn am liebsten in Berlin gelassen hätte.
Ein knöchellanges blaues Kleid, ein Mantel, ein Hut. Dazu ihre weißen Wollstrümpfe, die sie mit trotzigem Stolz trug, seitdem ihre Berliner Zimmervermieterin ihr zu verstehen gegeben hatte, dass sich dieser Aufzug nicht ziemte, auch wenn die Strümpfe bloß dann zwischen Schuhen und Kleidersaum aufblitzten, wenn man unweiblich große Schritte machte. Was Lenka wohlgemerkt häufig tat. Selbst hier fiel sie auf. Wie sollte das erst in Prag werden? Die feinen Herrschaften auf dem Graben, die sich so kleideten, als kämen sie gerade vom Nachmittagstee auf der Hofburg: Ohne Claire, die ihr Frotzeleien ins Ohr flüsterte, mit der sie skandalös laut über die empörten Gesichter um sie herum lachen konnte, würde sie daran keine Freude haben. Sie wollte nicht an die Stille denken, die an der Endstation ihrer Reise auf sie wartete, an die Trostlosigkeit.
Nun musste sie die Stadt verlassen, die keine Ruhe kannte. Fort von den Nachtlokalen, in denen Frauen fast so frei waren wie Männer. Vor allem: weg von Claire. Mit der sie gelernt hatte, beim Tanzen die Zeit anzuhalten. Sie war verloren. Vor diesem bitteren Morgen hatte sie den Anhalter Bahnhof immer gemocht. Claire und sie hatten sich manchmal ausgemalt, wohin sie reisen würden. Nichts war mit der Eisenbahn mehr unerreichbar. Der Ägypten-Express hätte sie bis nach Kairo getragen. Vielleicht wären sie auch nach Neapel gefahren. Oder nach Ostende, wo sie den Sommer im prächtigen Seebad verbracht hätten.
Sie legte den Kopf in den Nacken und vermaß die Weite der Halle, bis ihr schwindelig wurde. Zehntausende Menschen hatten hier gleichzeitig Platz. Der Bahnhof war größer als jede Kathedrale. Lenka passierte die prunkvollen Wartesäle, einer davon allein für den Kaiser und seine Gäste reserviert. Das Licht fiel durch die riesigen Fenster und stach ihr in die Augen. Sie blinzelte und beschleunigte ihren Schritt. Ab diesem Punkt gab es keine Rückkehr mehr. Sie suchte ihr Gleis, und ihr wurde übel. Die Menschenmenge, von der sie sich vorher kaum hatte trennen können, war ihr jetzt zuwider. Der Schnellzug nach Prag. Sie drängte sich hindurch zwischen grauen, großen Männern mit strengen Bärten und Hüten. Vorn am Perron: lauter bellende und verängstigte Hunde. Es war ihnen nicht gestattet, in den Personenwagen mitzufahren. In enge Käfige gesperrt warteten sie auf ihren Transport. Die Tiere taten Lenka leid. Sie spürte den fehlenden Schlaf. Alles drehte sich, und ihr wurde schwarz vor Augen. Zum Glück fing sie jemand auf. Und zum Glück war es kein bärtiger Herr. Lenka lag in den Armen einer Frau, deren betörendes Parfüm ihr gleich zu Kopf stieg.
»Verzeihen Sie, mir war kurz schummerig«, sagte Lenka und richtete sich auf.
»Kommen Sie, meine Beste«, antwortete die Dame und hakte sich unter, »ich helfe Ihnen.«
»Es geht schon wieder«, erwiderte Lenka.
»Nein, ich bringe Sie zu Ihrem Platz. Keine Widerrede.«
Benebelt ließ Lenka sich helfen und reichte der Frau ihr Billet.
»Wir sitzen sogar im selben Coupé«, sagte die Dame, »das Schicksal meint es gut mit uns.«
Lenka sank auf ihren Fensterplatz und betrachtete die vor ihr stehende Frau. Ein bisschen älter als sie, leicht hervorstehendes, selbstbewusstes Kinn, dazu ein durchdringender Blick aus erstaunlich grünen Augen hinter einem Schleier: Auch unter anderen Umständen wäre Lenka so eingeschüchtert und fasziniert gewesen wie jetzt gerade. Die Dame war eine eindrückliche Erscheinung. Sie trug ein bodenlanges schwarzes Kleid unter einem reich bestickten, kurzen Jackett aus glattem Serge, dazu einen auffälligen Hut mit schwarzem Schleier und geradezu bedrohlicher Hutnadel.
»Wie können Sie darin laufen?«, fragte Lenka und deutete auf den eng geschnittenen Rock der Frau. Kurz hielt die Frau inne und taxierte Lenka mit einem Blick, den diese nie wieder vergessen würde.
»Nun«, sagte die Dame, »ich bevorzuge zu schweben.« Dann lachte sie auf. »Und jetzt passen Sie auf«, sagte sie und bückte sich. Sie öffnete einige versteckt eingearbeitete Häkchen oder Knöpfe. »Darin kann man sogar rennen«, sagte sie in verschwörerischem Ton. »Und nun sollten Sie sich ein wenig ausruhen.«
Lenka war zu kraftlos, um sich gegen die Bemutterung durch die Fremde zu wehren. Sie schmiegte sich in ihren Plüschsitz. Mit halb geschlossenen Augen betrachtete sie die vergoldete Leselampe und die aufwendige Strukturtapete, hob dann ihren Kopf zur seidenbespannten Decke, deren Jugendstil-Ornamente sich zu drehen begannen, wenn sie länger hinsah. Ruckelnd setzte sich der Zug in Bewegung. Sie schloss die Augen und merkte entsetzt, dass ihr Tränen über die Wangen liefen, obwohl die Kälte auf dem Perron geblieben war. Sie wischte sich mit dem Handrücken durchs Gesicht. Kurz vor ihrer erzwungenen Abreise hatte sie gelesen, Berlin sei dazu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein. Das war ihr Gefühl. Das war ihr Daheim. Bis zum Ende der Nacht hatte sie in einem Lokal getanzt, von dem man in ihrer Heimatstadt nur träumen konnte: Es war ausschließlich Frauen vorbehalten. Claire und sie hatten viel getrunken, erst Champagner, dann Weinbrand, um ja nicht nüchtern zu bleiben. Gegen die Müdigkeit hatten sie sich ein Pulver geteilt, das Lenka aus der Charité hatte hinausschmuggeln können. Sie hatten sich neu und glücklich gefühlt. Und die Zeit blieb stehen, und die Nacht weitete sich ins Unendliche. Jetzt musste Lenka wieder in ihr altes, endliches Leben. Zurück in die stickige Provinz. Kaiserlich, königlich und kleinkariert.
Ihre Mutter hatte gerufen, und Lenka kam. Vor fünf Jahren war ihr Vater überraschend gestorben, der angesehene und hochdekorierte Prager Chirurg Doktor Samuel Weißbach. Er hatte so vielen Patienten ein neues Leben geschenkt, den Reichen, den Armen, den Tschechen, den Deutschen, egal ob aus Prag oder vom Lande. Das hatte ihn zu einer Legende gemacht. Und Lenka war seine größte Bewunderin. Denn ihr Vater war trotz seiner gewaltigen Autorität anders gewesen als die Männer, die sie als Kind kannte. So weich und lustig und gesellig. So warm und verständnisvoll. Während sie ihrer Mutter schon als Mädchen verschwieg, wenn sie in den Prager Gassen Unsinn getrieben hatte, konnte sie sich auf ihren Vater verlassen. »Ärztliche Verschwiegenheitspflicht«, hatte er dann gesagt, wenn sie ihm etwas anvertraute, seinen Mund mit einem imaginären Schlüssel verschlossen und gelächelt.
Die himmelschreiende Ungerechtigkeit schmerzte Lenka bis heute: Ausgerechnet er, der alle gerettet hatte, die ihn brauchten, war selbst nicht zu retten gewesen. Vor der Hauptpost am Wenzelsplatz war ihm eines Nachmittags einfach das Herz stehengeblieben. Seitdem blieb Lenka allein die Mutter. Ihr verschwieg sie weiter, was sie wirklich beschäftigte, sie würde es ja doch nicht verstehen. Ihre Mutter entstammte einer anderen Zeit mit einem erstickenden Geflecht aus Regeln und Konventionen. An ihnen hatte sie sich orientiert, seitdem sie ein Mädchen war. An ihnen hielt sie nun umso krampfhafter fest, je unübersehbarer sich diese Zeit dem Ende neigte. Ihr Vater hatte liebevoll über seine altmodische, vornehme Ehefrau gespottet, Lenka machte die Förmlichkeit ihrer Mutter dagegen rasend. Dennoch riss sie sich ihr zuliebe jahrelang zusammen. Der einzig moderne Zug ihrer Mutter war ihr Glaube an Bildung. Auch nach dem Tod ihres Vaters stand außer Frage, dass Lenka studieren würde, ehe sie heiratete und eine Familie gründete. Eine Frau, und dann noch Medizin, wie stolz er auf dich wäre. Da es einfacher war, als sich offen zu widersetzen, spielte Lenka das Spiel mit, schrieb sich an der Deutschen Universität in Medizin ein und ließ sich von ihrer Mutter an den Wochenenden einen heiratswilligen jungen Tölpel nach dem anderen präsentieren. Dachte sich schon vor der Begegnung Ausreden aus, auf die ihre Mutter zusehends konsternierter reagierte: »Wählerisch und eigensinnig wie die Erzherzogin Erzsi, die Leute tuscheln schon.« Kurz bevor sie nach Berlin gegangen war, war zwischen Lenka und ihrer Mutter ein fragiler Frieden eingetreten. Sie wussten beide, dass Lenkas Zeit im Ausland eine Atempause wäre, für sie beide. Lenka hatte keine Vorstellung davon, wie es nun weitergehen würde. Nicht nur sie war in Berlin ein neuer Mensch geworden – in den letzten Wochen hatten die Nachrichten aus Prag immer besorgniserregendere Ausmaße angenommen. In kürzester Zeit hatte sich der Geisteszustand ihrer Mutter rapide verschlechtert. Sie schien den Verstand zu verlieren. Ging sie allein aus dem Haus, verirrte sie sich mittlerweile regelmäßig in den Prager Straßen, die sie schon ihr ganzes Leben kannte. Mehrmals war sie von der Polizei aufgegriffen und nach Hause gebracht worden, weinend, verängstigt und Unverständliches stammelnd. Jana, ihre Haushälterin, hatte berichtet, dass die Mutter nach diesen Episoden in tiefen Schlaf gefallen und scheinbar regeneriert erwacht war, doch bald darauf hatte es den nächsten alarmierenden Zwischenfall gegeben. So gut Lenka auch wusste, wie subtil die Mittel waren, mit denen ihre Mutter Macht auf sie ausüben konnte: Diesmal war es ernst. Die Mutter selbst wurde von einer allein in ihrem Kopf existierenden, unkontrollierbaren fremden Macht heimgesucht. Vor wenigen Tagen hatte Jana eigens bei Lenkas Vermieterin in Berlin angerufen und nach Lenka verlangt.
»Ich bleibe jetzt immer über Nacht, weil ich Angst habe, Ihrer Mutter stößt andernfalls etwas zu«, hatte sie erklärt, »aber, Fräulein Weißbach, ich habe einen Mann und einen eigenen Haushalt zu führen, ich kann nicht für immer in der Herrengasse bleiben. Ihre Mutter braucht Sie.«
Lenka hatte keine Wahl. Sie würde sich um ihre Mutter kümmern und wieder eine gute Tochter sein. Nicht weil sie wollte, sondern weil sie musste. Ob sie es auch konnte, war eine andere Frage.
Lenka schlug die Augen auf und spürte den Blick der Dame ihr gegenüber. Hatte sie Lenka etwa die ganze Zeit betrachtet, so wie Lenka zuvor die Details der Tapeten studiert hatte, die Jugendstil-Ornamente der seidenbespannten Decke?
»Mir ist gar nicht bewusst gewesen, wie furchtbar müde ich war«, sagte Lenka.
»Willkommen im Zeitalter der Ermüdung«, sagte die Dame. »Schön, wie alles zugrunde geht, nicht wahr?«
»Verzeihung«, antwortete Lenka, »was sagten Sie?«
»Fällt Ihnen nicht auch auf«, erwiderte die Dame, »wie alles prachtvoll vor die Hunde geht?«
Lenka nickte. »Immer eine Frage der Perspektive«, sagte sie.
»Alles Schlechte kommt vom Himmel her«, sagte die Frau, »darauf hat man sich doch neuerdings geeinigt.«
»Glauben Sie daran etwa wirklich?«, fragte Lenka, während die Dame sie neugierig taxierte.
»Ich glaube an gar nichts.«
»Wenn etwas dran ist am Zusammenstoß mit diesem Kometen«, sagte Lenka, »dann können wir immerhin in seinem Schweif feiern bis zum Schluss«.
Die Frau deutete ein Klatschen an. Ein Leuchten zog Lenkas Blick auf sich. Die Dame trug einen Smaragd am Finger, in dem sich momentweise das Licht der Wintersonne brach.
»Sie gefallen mir ausgesprochen gut«, sagte die Frau, »was haben Sie in Prag zu schaffen?«
»Meine Mutter«, sagte Lenka. »Und Sie?«
»Ach«, antwortete die Dame, »das ist eine lange Geschichte. Mögen Sie Prag?«
Lenka schüttelte sachte den Kopf. »Mein Vater hat sein Leben lang geglaubt, der Ort sei magisch. Wenn ich als Mädchen an seiner Hand spaziert bin, dann hat er manchmal gefragt: ›Spürst du die Kraft?‹, und hat auf das Kopfsteinpflaster gedeutet. Ich habe ihm eifrig zugestimmt, um ihn nicht zu enttäuschen. Aber ich habe nichts gefühlt. Das habe ich erst in Berlin.«
Lenka wusste nicht, warum sie der Unbekannten all das erzählte. Es war typisch für sie. Wie schnell sie sich anvertraute, wenn sie jemanden mochte. Ihre Stärke war auch ihre Schwäche.
»So übel wird die Stadt wohl nicht sein«, meinte die Dame.
»O doch«, sagte Lenka, »für mich schon. Sie vergiftet uns sogar.«
Die Dame stutzte.
»Inwiefern das?«
»Hat Sie niemand gewarnt?«, fragte Lenka.
»Gewarnt?«
»Hüten Sie sich vor dem Wasser aus den Leitungen. Die gelbe Brühe macht krank. Wirkt sofort, hat mein Vater immer gesagt.«
Die Dame lachte lauthals auf, geradezu unziemlich. Mit ihr, dachte Lenka, könnte man auf dem Graben so viel Aufsehen erregen wie mit Claire.
»Sie hingen wohl sehr an Ihrem Papa«, sagte die Frau, beugte sich nach vorn und strich ihr tröstend mit der Hand über die Schulter, woraufhin Lenka zusammenzuckte.
»Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken«, sagte die Frau.
»Nein, Sie müssen verzeihen«, sagte Lenka, »ich bin heute ganz und gar außer mir.«
»Ich wüsste gern mehr über Sie«, sagte die Dame. »Sie scheinen mir ganz und gar außergewöhnlich zu sein.«
Wieder dieser Blick, dem sich Lenka nicht entziehen konnte. Sie fühlte das vertraute Flattern in der Magengrube, die Mischung aus Furcht und Vorfreude. Die Dame nickte ihr auffordernd zu. Und Lenka hörte selbst erstaunt dabei zu, wie es nur so aus ihr heraussprudelte. Wie sie immerzu nur fort gewollt hatte aus Prag. Wie überglücklich sie gewesen war, als sich die Gelegenheit auftat, nach Berlin zu gehen. Wie wenig sie sich daraus gemacht hatte, die einzige Medizinstudentin aus Böhmen an der Friedrich-Wilhelms-Universität zu sein. Es war seltsam befreiend gewesen, für alle anderen plötzlich nur die Böhmin zu sein oder sogar die Österreicherin, ohne sich sogleich für eine der drei Prager Zugehörigkeiten entscheiden zu müssen: deutsch, tschechisch, jüdisch. Sie zeigte der Dame ein Foto, das sie für ihre Mutter mitgebracht hatte. Der bildgewordene Nachweis ihres vermeintlich ernsten Interesses an ihren Studien. Lenka bei einer Sektion des berühmten Anatomen Carl Benda. Lieber berichtete sie allerdings von den ausgelassenen Damenbällen, wo sie Ritter und Pagen gewesen waren und schwarze Herrenanzüge getragen hatten. Von ihren trunkenen Streifzügen durch die überfüllte Friedrichstraße, in der sich ein schummeriges Lokal ans nächste reihte. Und später dann, wenn eine ordentliche junge Frau schon längst daheim zu sein hatte, ins Piccadilly, ins Gubarry oder in den sogenannten Damen-Kegelclub, wo sie auf den Tischen tanzten und keine Männer sie dabei störten. Die durchzechten Nächte in diesem schmutzigen, wuseligen Moloch. Wunderschön. Vorbei.
Die Dame nickte immer wieder beifällig, lachte, fragte nach – und gab von sich nichts preis.
»Vielleicht sind wir einander schon einmal begegnet«, sagte sie jetzt und blitzte Lenka aus ihren tiefgrünen Augen an.
»Nicht dass ich wüsste«, sagte Lenka.
»Die Demonstration«, sagte die Dame, »erinnern Sie sich?«
»Das ist ja unglaublich«, sagte Lenka. Sie war in einer Gruppe von Frauen unterwegs gewesen und verschwunden, bevor die Polizei die Versammlung auflöste. Es war die Zeit der großen Proteste. Die Wahlrechtsreform trieb die Menschen zu Zehntausenden auf die Straße. Sie protestierten gegen das Unrecht und für mehr Mitbestimmung: Wie konnte es sein, fragte sich ganz Berlin, dass wieder nur die Reichen und Mächtigen entscheiden, wer regieren soll?
»Und wieder vergessen sie uns«, hatte Claire zu Lenka gesagt und sie mitgerissen in ihrem Zorn: »Wer denkt an uns Frauen?«
Während sich die Berliner also über die Privilegien dreier Klassen an der Wahlurne stritten, waren Lenka und ihre Freundinnen für ihre Sache auf die Straße gegangen: das Frauenwahlrecht.
»Sie waren also auch mittendrin?«
»Das kann man wohl sagen«, antwortete die Dame. »Wir dürfen uns nichts mehr gefallen lassen.«
Lenka hielt dem Blick der Frau stand und lächelte. »Offenbar haben wir viel gemeinsam«, sagte sie überschwänglich, »vielleicht sollte ich Ihnen Prag zeigen. Hat ja auch ganz schöne Seiten, wenn man nur zu Besuch ist. Die Karlsbrücke, die Kleinseite, der Laurenziberg, ich glaube, all das würde Ihnen gefallen.«
Diesmal schüttelte die Dame den Kopf. »Ich muss Sie leider enttäuschen, meine Liebe. Ihr Angebot ehrt mich, aber mich zieht es morgen schon wieder fort. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, und nun entschuldigen Sie mich bitte, ich habe eine Verabredung im Speisewagen.«
Mit diesen Worten erhob sie sich. Und Lenka, entgegen ihrer sonstigen Zurückhaltung, sprang ebenfalls auf und sagte, ehe sie es sich noch einmal anders überlegen konnte: »Nehmen Sie mich mit.«
Sie standen voreinander und sahen sich an, das Lächeln der Dame hatte nichts Amüsiertes mehr, sondern zeigte reine, tiefe Zuneigung, jeden Moment würde sie nach Lenkas Hand greifen und sie aus dem Coupé herausführen. Dann fuhr der Zug ratternd über eine Weiche und schüttelte sie beide so heftig durch, dass Lenka beinahe das Gleichgewicht verlor und die Dame wieder eine Hand ausstreckte, um sie am Fallen zu hindern.
»Ich kann Sie nicht mitnehmen«, sagte sie sanft und trat einen Schritt auf Lenka zu, die den Blick abwenden musste. »Es geht um eine sehr private Angelegenheit.«
Eine Verabredung in der Eisenbahn? Sehr privat? Lenka errötete, ein wenig aus Scham, weil sie sich aufgedrängt hatte – ein wenig aber auch aus einer ihr unbekannten Eifersucht: Obwohl sie diese Dame gerade erst getroffen hatte, beneidete sie denjenigen, der im Speisewagen auf sie wartete. Lenka ließ sich zurück in ihren Sitz fallen. Auch dieser Abschied war nun besiegelt.
»Nehmen Sie das hier«, sagte die Dame und hielt Lenka die flache Hand hin.
Irritiert griff Lenka nach dem Fläschchen, das darauf lag. »Was ist das?«, fragte sie.
»Ein Gegengift«, sagte die Dame.
»Wogegen?«, fragte Lenka.
»Gegen alles, was du fürchtest«, sagte sie, beugte sich zu Lenka herunter und strich ihr über die Wange.
»Aber die Flasche ist doch leer«, sagte Lenka.
»Eben«, sagte die Dame, »Berliner Luft, wirkt sofort.«
Lenka lachte und ergriff die Hand der Frau, die sich rasch entzog. Die Dame ließ sie im Abteil zurück, bloß ihr Parfüm hing noch in der Luft, so intensiv, dass Lenka es zu schmecken meinte. Nach ein paar Minuten schlief sie erschöpft und aufgewühlt ein, das Gegengift fest in ihrer Hand. Sie träumte davon, dass man ihr Gesicht mit Blütenblättern bedeckte.
Als sie aufwachte, fuhr der Zug gerade durchs Elbtal. Im ersten Augenblick freute sie sich sich sogar, die Elbe zu sehen. Sie mochte, wie sich das Gebirge geradezu anschmiegte an die Eisenbahn. Erst mit Verzögerung bemerkte sie, dass ihr mittlerweile ein Mann gegenüber saß. Ein schneidiger Kerl mit Schmiss, der sie angrinste. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Sie richtete sich auf und bedachte ihn mit einem kleinen harten Lächeln.
»Kann ich Ihnen helfen«, sagte sie.
»So schön, so schlau, so allein, meine Dame«, sagte er.
Lenka hörte den Prager Zungenschlag und stöhnte unwillkürlich auf. Sie wandte den Blick ab und antwortete: »Ersteres kann ich nicht beurteilen. Zweiteres ist möglich. Das Dritte wiederum soll Ihr Problem nicht sein.«
»Bitte verzeihen Sie«, sagte der Mann, »und geben Sie mir die Gelegenheit, es wiedergutzumachen. Haben Sie am Abend schon Pläne? Ich würde Sie gern zu einem Maskenball ausführen.«
Lenka schüttelte den Kopf. Als sie ihm einen verstohlenen Blick zuwarf, grinste er sie noch immer erwartungsvoll an. Ihr fiel ein Ekzem direkt unter seiner Nase auf und eine leichte Eindellung in seinem Nasenrücken. Syphilis, Stadium 2 bis 3, schätzte sie.
»Ich mag keine Verkleidungen«, sagte sie. »Und nun lassen Sie mich bitte wieder ausruhen.«
Sie drehte sich zum Fenster und betrachtete die Landschaft mit halb geschlossenen Lidern. So leichtsinnig, noch einmal einzunicken, war sie nicht. Sie kannte die Männer. Erst als er seinen Mantel nahm, eine Verbeugung andeutete und das Abteil verließ, wehrte sie sich nicht länger gegen den Schlaf.
Sie wurde von der Geschäftigkeit auf dem Gang geweckt: Bald würden sie in Prag einfahren. Erst sah sie die bäuerlichen Vororte, schon taten sich die ersten Fabriken auf, in denen Baumwolle und Leder, Möbel und Glas verarbeitet und produziert wurden. Mit jeder Kurve, die der Zug nahm, rückte die gefürchtete Enge näher. Das nennst du magisch, Papa, dachte Lenka, als sie die ersten Türme erblickte und die monströse Prager Burg, die ihr schon als Kind Angst eingejagt hatte. Sie würde gleich nach Hause kommen, ihre Mutter herzen und nichts erzählen von dem, was ihr schmerzlich fehlte. Sie würde sich ins von Jana frisch gemachte Bett legen und sich vorstellen, sie läge im Askanischen Hof, dicht neben Claires warmem Körper. Bis zum nächsten Morgen würde sie schlafen und begreifen, dass sie ab jetzt immerfort sein würde und nicht mehr werden.
Bei Mord und Totschlag hatte er ein schönes Leben. Jetzt gerade musste er aufpassen, sich nicht zu Tode zu langweilen. Er stand auf der Estrade des Festsaals und sah dem lächerlichen Umzug zu. Eine Blaskapelle spielte. Neben ihm schunkelte sein Kollege mit. Der einfältige Hradecky vom Prager Tagblatt, bei dem er sich lebhaft vorstellen konnte, wie er diese alberne Veranstaltung in den höchsten Tönen loben würde. Die Narren schoben jetzt die Nachbildung eines Kometen herein, gefolgt von einer sichtlich mitgenommenen Aeroplane. Das laute Gelächter dröhnte ihm in den Ohren. Sie feierten auf derart vulgäre Weise, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als dass der Komet die Erde noch in dieser Nacht mit voller Wucht träfe. Er war auf Anweisung hier und hatte noch keinen blassen Schimmer, was er über dieses Maskenkränzchen schreiben sollte. Ausgerichtet wurde es von der Burschenschaft Saxonia. Kisch war in seinen beiden außerordentlichen Semestern an der Universität dort sogar Ehrenbursch gewesen, ihm war es aber in erster Linie ums Fechten gegangen. Er liebte Duelle, immer noch. Ansonsten war ihm das Militärische so fremd wie alle deutschnationalen Tendenzen. Sein älterer Bruder war nach wie vor Mitglied der Saxonia, ließ sich aber schon den ganzen Abend nicht blicken – es sei denn, er war so überzeugend verkleidet, dass Kisch ihn nicht erkannt hatte.
»Paul, bist du es?«, fragte er eine vorbeistolpernde Schuhfabrik, doch die schüttelte vehement den Kopf.
Kisch würde es wie immer machen: die Angelegenheit übertreiben. Das Schönste erfinden. Einen Narren beim Anblick des nachgebauten Kometen zusammenbrechen und in die Irrenanstalt bringen lassen, um dem ereignislosen Abend ein bisschen Würde zu verleihen, wenigstens in der Zeitung.
Vor ein paar Jahren hatte Egon Erwin Kisch eines Abends im Café Central gesessen. Eine Runde von Dichtern und Schreibern und solchen, die es gern wären. Rilke hatte sich gerade in Rage geredet und verkündet, Poesie sei Liebe, und Liebe sei Gottesglaube. In diesem göttlichen Moment hatte sein alter Freund Meyerhoff von der bohemia Kisch die Hand auf die Schulter gelegt und ihn im Flüsterton vom Tisch weggelockt: »Willst du Melzers Redakteursstelle? Es geht vor allem um Morde.« Kisch hatte noch am selben Abend zugesagt und das Ende von Rilkes Vortrag verpasst.
Seit einigen Jahren war er nun Reporter bei der bohemia. Und die Leute liebten seine Geschichten. Wenn er hörte, dass es in manchen Familien zu Gerangel kam, weil jeder zuerst seine neue Gerichtsreportage lesen wollte, dann schmeichelte ihm das. Aber es reichte ihm nicht. Worauf Kisch seit Jahr und Tag lauerte, das war der große Scoop. Der Solokarpfen. Der ihn nicht nur in seiner Stadt, sondern im ganzen Land berühmt machen würde. Der ihn aus der Obskurität des Lokalreporters herauskatapultieren würde, diesem Grenzland zwischen Bürgertum und Bohème. Damit war bei dieser Veranstaltung sicher nicht zu rechnen, hier gab es nicht das Geringste zu erzählen, aber wenn Mord und Totschlag fehlten, musste der Platz in der Zeitung eben anders gefüllt werden. Zum Beispiel mit Fasching. Normalerweise luden Kisch seine Streifzüge durch Prag mit Energie auf. Wenn er sich in einem zerlumpten Anzug mit den Ärmsten der Stadt am Schalter einer Volksküche drängte, mit ihnen Graupensuppe löffelte, ihre Gesichter sah und ihren Gesprächen lauschte, wusste er, dass er seiner Leserschaft anschließend eine Welt beschreiben konnte, die sie nie mit eigenen Augen sehen würden, von deren Existenz sie aber erfahren mussten. Der greise Bettler, der so stark zitterte, dass er die Hälfte seiner kostbaren Suppe verschüttete. Die Schulkinder, deren einzige Mahlzeit des Tages in einem Stück Mohnkuchen bestand. Auf diesem Kränzchen, zwischen all den milchkalbsgemästeten Burschen, fühlte er sich von Stunde zu Stunde kraftloser. Kisch brauchte das echte Leben, und hier war nichts und niemand echt.
Auf seinem Weg durch den Saal umarmte ihn plötzlich ein feister Pierrot: »Du bist doch der Kisch, nicht wahr? Wir singen heut’ den Kometen vom Himmel! Schreib das auf, Kisch!«
Ein paar Meter weiter lief er dann auch noch dem sturzbetrunkenen Gruber in die Arme: in der Fantasieuniform eines kolonialen Herrschers, was sonst. Seine Kopfbedeckung hatte große Ähnlichkeit mit der Mütze, die Mitglieder der Saxonia trugen, wenn sie nicht gerade als Nordpol oder Reklamesäule für Maggis Suppenwürze verkleidet waren. Kisch zog einem in der Nähe vor sich hin wippenden Kartenspiel am Ärmel und fragte hoffnungsvoll: »Paul?« Aber auch das war nicht sein großer Bruder.
»Unser Schreiberling, der Kisch«, sagte Gruber, dessen Schmiss auf der Wange in dieser Montur mit Degen am Gürtel und Blechorden auf der Brust nur noch lächerlicher wirkte.
»Unser Imperator«, sagte Kisch, aber Gruber hatte ihn nicht verstanden und wiederholte nur stumpf: »Unser Schreiberling, der Kisch.«
Er nahm die rote Mütze ab, setzte sie kichernd Kisch auf den Kopf und betrachtete ihn für einen Moment.
»Fast könnte man dich für einen von uns halten«, lallte er. Er nahm ihm die Mütze wieder ab und grinste. »Aber du bist keiner von uns, nicht wahr. Du bist einer von«, Gruber begann zu gestikulieren, »von denen.«
Kisch wusste nicht und wünschte auch nicht zu erfahren, wer die sein sollten. Studienversager, Künstler, Freiheitsfanatiker, Privilegiertenhasser, Tschechenfreunde. Juden. Auf Kisch traf alles zu. Gruber starrte ihn herausfordernd an. Kisch hätte Lust gehabt, ihn zum Duell herauszufordern, hier und jetzt, und ihm einen weiteren, weniger schmucken Schmiss zu verpassen, doch es musste bei der reinen Vorstellung bleiben. Grubers Vater war Mitbesitzer der bohemia. Er hatte seinen versoffenen Sohn vor einigen Wochen in der Redaktion installiert. Mitarbeiter ohne besondere Aufgaben, spottete Kisch, aber leider eben auch der unangenehme Sohn des Chefs. Wenigstens war er so betrunken, dass er schließlich ohne Fortführung des Gesprächs weiterzog. Was wusste der Kerl schon von richtiger Arbeit? Stunde um Stunde saß er in der Redaktion herum, starrte Kisch und seinen Kollegen frech über die Schulter, stand dauernd im Weg, als würde ihn die Hektik in der Redaktion nichts angehen: Täglich erschienen zwei Ausgaben, eine morgens um 6 und eine nachmittags um 5. Gerade das gefiel Kisch: dass bei der Zeitung alle ständig unter Strom standen. Dass er kommen konnte, wann er wollte, selbst mitten in der Nacht, wenn er nicht schlafen konnte – es gab immer genug zu tun. Hauptsache, am Ende kam er auf die erforderliche Zeilenzahl.
Bei diesem Ball wiederum konnte Kisch nicht mehr viel ausrichten. Er hatte genug gesehen. Noch ein bisschen mehr vom schallenden Lachen der aufgesetzt ausgelassenen Offiziere, und er selbst würde als tragischer Totschläger in der Morgenausgabe der bohemia auftauchen. Er trat in den Prager Abend hinaus.
Kaum jemand war unterwegs, ab und an ein paar verhuschte Gestalten mit hochgeschlagenem Mantelkragen. Wer bei dieser Hundskälte nicht vor die Tür musste, war längst daheim. Kisch steckte sich eine Zigarette an und fröstelte. Er hörte die vereinzelten Pfiffe eines Wintervogels, sonst war es ruhig. Genau diese ungewohnte Stille der Stadt fürchtete Kisch. Wenn er selbst in den von ihm bevorzugten Kneipen allein vor seinem Bier hockte und irgendwann verzagt nach Hause ging.
Doch jetzt nahte Gefahr, mit anderen Worten: seine Rettung. Kisch hörte hektische Schritte und drehte sich um. Aus der schmalen Gasse kam der Botenjunge der Redaktion gerannt. Kisch grüßte. Der Junge beugte sich an sein Ohr und flüsterte ihm etwas zu, ganz außer Atem und geheimniskrämerischer als nötig, waren sie doch gerade allein auf der Straße. Kisch nickte, gab dem Jungen einen aufmunternden Klaps auf die Schulter und lächelte wie befreit. Nun gab es doch noch etwas zu tun.
Der nächtliche Todesnachrichtendienst war Kisch ans Herz gewachsen. Schlafen konnte er sowieso nicht, höchstens ein paar Stunden nach Anbruch des Tages, was gab es also Besseres, als auf Schlagzeilen zu lauern? Eigentlich war es ganz einfach. Tagtäglich klapperte Kisch das Sicherheitsdepartement der Polizei, die Lobbys der Hotels und die Kneipentische der Halbweltgestalten ab, um über jüngst geschehene oder sogar bevorstehende Verbrechen im Bilde zu sein. Ebenso wichtig war die Suche nach Toten oder, besser gesagt, die Jagd nach gerade noch Lebenden. Der Junge aus der Redaktion hatte Kisch bestätigt, was auch er im Laufe des Tages schon als Gerücht vernommen hatte: Der stadtbekannte Opernsänger Rudolf Altberg, hieß es, liege nach missglückter Operation in seiner Prager Wohnung im Sterben. Kisch würde also seine Rückkehr nach Hause so weit wie möglich hinausschieben, um vor der Wohnung des Sängers auf dessen endgültiges Ableben zu warten, dann in die Redaktion zu eilen und noch für die Morgenausgabe eine Schlagzeile zu verfertigen.
Aber der Opernsänger war noch nicht so weit. Kisch lehnte an einem Baum und rauchte eine Zigarette nach der anderen, spazierte zwischendurch auf und ab in dieser bitterkalten Nacht. Die Wohnung war dunkel. Der Todgeweihte rührte sich nicht. Nichts geschah. Und selbst wenn sich jetzt noch etwas täte: Die Schlagzeile in der Morgenausgabe konnte er abschreiben. Als Kisch gerade seinen Todesnachrichtendienst unverrichteter Dinge abbrechen wollte, bemerkte er, dass er beobachtet wurde. Zuerst das Aufblitzen einer Gürtelschnalle im Schein der Gaslaterne eine Ecke weiter. Dann ein Rascheln aus dem Park hinter ihm, jemand versuchte, sich leise zu nähern. Aber Kisch hatte genug Erfahrung mit Ganoven aller Couleur, um sich des Nachts nicht überrumpeln zu lassen. Also weg vom Park, raus aus seiner schummerigen Beobachterposition, ins nahe Wirtshaus. Auf der Grenze, wie er es bei sich nannte, weil das neu errichtete Gebäude exakt auf der Trennlinie zwischen Alt- und Neustadt lag. Die Kneipe hatte zu dieser Stunde natürlich regulär schon längst geschlossen und wirkte von außen auch wie in Dornröschenschlaf versunken, aber sie würde, wie er wusste, noch gut besucht sein. Kisch beschleunigte, doch diesmal hatte er zu spät reagiert. Von der Seite und von hinten stürzten zwei Männer auf ihn zu. Er versuchte zu entkommen, aber da hörte er schon das Pfeifen und einen tschechischen Ruf: »Halten Sie an!«
Kisch blieb stehen. Die Polizisten holten ihn ein.
»Was machen Sie hier«, fragte der erste Wachmann, ein junger Bursche, schlaksig und groß gewachsen.
»Ich gehe spazieren«, antwortete Kisch, der gleich wusste, dass er wohl an die einzigen beiden Prager Wachleute geraten war, die ihn nicht kannten. Jetzt hatte er erst recht kein Interesse mehr daran, die Wahrheit zu sagen.
»Um diese Zeit, merkwürdig«, spottete der andere Polizist, älter und kleiner als sein Kollege.
»Ich kam von der Arbeit und wollte mir die Beine vertreten. Was ist daran verwerflich?«
»Die Beine vertreten! Von welcher Arbeit kommen Sie denn?«, fragte der Lange.
»Ich bin bei der Firma Haase angestellt«, antwortete Kisch wahrheitsgemäß.
»Ach was, bei Haase arbeitet man neuerdings nachts«, sagte der Alte.
»Es scheint wohl so zu sein«, antwortete Kisch.
»Sie scheinen mir auch wohl so zu sein«, sagte der Lange.
»Ihre Kollegen kennen mich alle«, sagte Kisch, um sich noch verdächtiger zu machen, »schließlich gehe ich bei Ihnen ein und aus.«
»Im Sicherheitsdepartement?«, fragte der Alte.
»Natürlich, grüßen Sie gern morgen die Herren Olic und Protiwenski.«
»Sie kennen Olic«, sagte der Lange, der nun eine große Sache witterte.
»Kann ich jetzt«, bat Kisch, »mir wird recht kalt, möglicherweise ist Ihnen auch aufgefallen, dass die Nacht sehr frostig ist.«
Der Ältere winkte ab und wollte schon umdrehen, aber der junge Polizist ließ sich das nicht gefallen.
»Sie gehen nirgendwohin, Sie kommen jetzt mit zum Kommissariat, und wir klären die Angelegenheit.«
»Das werde ich sicher nicht tun«, sagte Kisch.
»Lass doch«, flüsterte der ältere Polizist auf Tschechisch, aber sein Kollege war in Rage. »Letzte Chance, sonst dreh ich dir die Hände auf den Rücken, und dann geht es flott«, rief der Jüngere, und Kisch: schrie um Hilfe. Aus dem Waldfrieden strömten wenig später Menschen nach draußen. Eine sichtlich angetrunkene und abenteuerlustige Gruppe, die sein Rufen gehört hatte. Gleich umringten die Kneipengänger die Polizisten und Kisch. Ein Johlen brach los, als würde hier ein Fest gefeiert: »Wen haben Sie erwischt?« »Was ist passiert?« »Kennen wir den nicht?« Ein regelrechter Tumult in der bis dahin so stillen Prager Nacht. Der jüngere Polizist hatte Kisch schon am Arm gefasst, da trat ein Mann an sie heran: Anton Pester, ein Setzer der Zeitung, mit dem Kisch schon oft ein Bier vor Morgengrauen getrunken hatte.
»Soll ich Sie vielleicht legitimieren, Herr Redakteur? Ist das überhaupt nötig?«
Das reichte dem Polizisten, um Kisch loszulassen.
»Jetzt erkenne ich Sie«, sagte der Ältere, »Sie sind der Kisch!«
Peinlich berührt und wütend zog der Jüngere seinen älteren Kollegen zur Seite. Sie kehrten dem Trubel den Rücken. Kisch zündete sich sogleich eine Zigarette an, richtete sich auf und lief aufreizend langsam an den Polizisten vorbei.
»Grüßen Sie Herrn Olic bitte besonders herzlich von mir!«
Der alte Wachmann nickte ergeben und salutierte aus unerfindlichem Grund sogar vor dem Reporter.
»Komm«, sagte sein junger Kollege, »wir haben hier schon viel zu viel Zeit vergeudet. Und jetzt hinein mit euch«, rief er in die Menge hinein, »das ist ruhestörender Lärm.«
Nachdem die Polizisten verschwunden waren, kehrte Kisch um und bedankte sich beim Setzer. Er war drauf und dran, über den Hintereingang die Kneipe zu betreten und ihn auf ein Bier einzuladen, als ihm in der sich auflösenden Menschentraube eine junge Frau auffiel.
»Du lässt die Leute immer noch nicht schlafen, alter Quälgeist«, sagte sie.
»Was für eine Begrüßung, Frau Doktor«, erwiderte Kisch.
»Ich war gerade erst eingeschlafen«, log sie. In Wahrheit hatte Lenka die Stunden nach ihrer Ankunft im Bett verbracht, aber ohne Schlaf. Mit ihrer Ankunft waren auch die hämmernden Kopfschmerzen zurückgekommen, von denen sie in Berlin verschont geblieben war. Die gute Jana hatte ihr eine Suppe gekocht und kalte Lappen für die Stirn gereicht, ihre Mutter hingegen war zu nichts zu gebrauchen gewesen: Erst brach sie weinend an ihrer Schulter zusammen, dann saß sie stundenlang lethargisch murmelnd auf ihrer Chaiselongue und starrte hinaus in den trüben Prager Wintertag.
Als der Trubel vor dem Fenster losbrach, war Lenka schlecht gelaunt ans Fenster getreten und hatte Kisch gleich erkannt. Das letzte Mal hatten sie sich vor ein paar Monaten in Berlin gesehen. In der Stadt also, der Kisch nicht verzeihen konnte, dass er dort nie einen Fuß auf den Boden bekommen hatte. Nachdem Lenka dreimal überprüft hatte, dass ihre Mutter in ihrem Bett lag und tief und fest schlief, hatte sie die Wohnung verlassen und sich durch den dunklen Hausflur nach unten getastet. Bitte, lass sie nicht aufwachen, hatte sie gedacht, nicht jetzt. Das Hämmern in ihrem Kopf gab den Takt vor: nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Die Migräne war ein Fluch, doch wenigstens übertönte sie den Gedanken, dass Lenka ihre verwirrte Mutter schon in der ersten Nacht nach ihrer Rückkehr ihrem Schicksal überließ.
»Seit wann bist du denn zurück?«, fragte Kisch.
»Seit ein paar Stunden.«
»Wie geht es deiner Mutter?«
Lenka zuckte mit den Schultern, schüttelte verzagt den Kopf.
»Komm, wir gehen was frühstücken«, sagte Kisch. »Oder willst du etwa schon schlafen?« Nicht jetzt, gab Lenkas Kopf pochend zur Antwort, nicht jetzt. Sie sah für einen Moment ihre friedlich schlafende Mutter vor sich und ließ sich einfach mitziehen, immer weiter fort von ihr, obwohl sie nur ihr Nachtgewand trug, darüber einen langen warmen Mantel. Wer sollte sich in der Nacht schon an ihrer Toilette stören? Im besten Fall würde man sie für eine Irre halten und in Ruhe lassen. Kisch rief, und Lenka wollte mit. Das Merkwürdige: Er hatte sie immer genervt, seitdem sie ihn in einer Berliner Spelunke getroffen hatte. Ihre Begleitung an diesem Abend, eine Kommilitonin, kannte seinen Begleiter, und ehe Lenka es sich versah, saß Kisch neben ihr und verwickelte sie in ein Gespräch. Es war wirklich so, wie ihr Vater immer gesagt hatte: Prager erkennen einander am Geruch, ob er ihnen gefällt oder nicht. Lenka hatte Kisch früh zu verstehen gegeben, dass seine Komplimente ins Leere liefen. Nach dem zweiten Bier sagte sie: »Ach, Kisch. Ihre Avancen sind vergebliche Liebesmüh. Sie glauben gar nicht, wie vergeblich.«
Er probierte es trotzdem weiterhin, gab ihr aber andererseits das Gefühl, ehrlich interessiert daran zu sein, was sie zu erzählen hatte.
»Was meinen Sie, warum begehen Menschen Verbrechen?«, fragte sie ihn.
»Aufgrund ihrer äußeren Umstände«, sagte er.
»Und was ist mit ihren inneren Umständen?«, fragte sie.
»Das Soziale wiegt schwerer als das Psychologische«, sagte er, und Lenka versuchte sich ihre Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Er klang fast wie ihre Medizinprofessoren in Prag, die so taten, als ließen sich Körper und Seele sauber voneinander trennen und lediglich somatische Beschwerden seriös behandeln.
Irgendwann unterhielt Kisch die ganze Kneipe. Er gab Anekdoten aus Prag zum Besten, und die Anwesenden, die ihm an den Lippen hingen, brachen in regelmäßigen Abständen in Jubel und Gelächter aus. Sein Talent, einen Raum voller Menschen in ein Sonnensystem zu verwandeln, das um ihn als Zentralgestirn kreiste, fand Lenka anstrengend. Zumal er so übertreiben musste, dass es an Lügen grenzte: Wo in Prag sollte es, bitte schön, ein Lokal geben, in dem Tschechen mit Deutschen auf den Tischen tanzten? Gleichzeitig spürte sie selbst eine Anziehungskraft zwischen ihm und sich, die sie erst in der folgenden Nacht verstand.
Es war Kischs letzter Abend vor seiner Rückreise nach Prag, und er hatte Lenkas Kommilitonin und sie zu einem kleinen Abschiedsumtrunk eingeladen.
»Ein Glück, dass ihr hier seid«, rief er, als sie ins Bierlokal kamen, »in Berlin gibt es viel zu wenig lustige Mädchen.«
Sein Hotel war nicht weit von Lenkas Zimmer auf der Rosenthaler Straße entfernt, also begleitete er sie nachts nach Hause. Am Spreeufer machten sie halt und blickten auf den Fluss, auf dem sich schemenhaft die Kuppel des Doms spiegelte. Lenkas Augen tränten unablässig im Winterwind, und irgendwann stopfte sie sich das Taschentuch in den Mantelärmel und sagte: »Diese dummen Tränen! Manchmal glaube ich, mein Inneres besteht ausschließlich aus Wasser!«
Kisch sah sie von der Seite an und sagte: »Sei froh. Ich habe nicht mal nach dem Tod meines Vaters weinen können.«
»Wie alt warst du?«, fragte sie.
»Fünfzehn.«
»Woran?«
»Herzschlag.«
Lenka nickte. »Alles wie bei mir.«
Auch Halbwaisen erkannten einander anscheinend am Geruch. So schnell hätte Lenka das Wiedersehen nicht gebraucht, aber jetzt war es so, wie es war. In ihr regte sich bei Kischs Anblick ein Gefühl, das sie familiär genannt hätte. Sie durchfuhr eine Erkenntnis: Er würde ihr noch oft genug entsetzlich auf die Nerven gehen, aber unbestreitbar Teil ihres Lebens bleiben. Wenigstens ist es mit Kisch eher Berlin als Prag, dachte sie, auch wenn er selbst sich darüber mokieren würde.
Sie gingen zum Café Kandelaber, einer der mobilen Teestationen unter freiem Himmel, an denen die Verlorenen der Stadt noch vor dem Morgengrauen für zwanzig Heller einen Tee mit Rum, eine Buchtel und eine Zigarette bekamen. Sie standen und froren dort eine ganze Weile. Kisch erzählte vom Maskenkränzchen der Burschenschaft und davon, dass ein Offizier beim Anblick des hereingefahrenen Kometen einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte und in die Heilanstalt gebracht worden war. Lenka lachte und berichtete ihm ihrerseits von ihren nächtlichen Erlebnissen in Berlin, bei denen Kisch dann doch die Augen funkelten, so sehr er die Stadt auch zu hassen gelernt hatte, weil er, wie er behauptete, die Berliner allesamt für Ekel und Berlin für ein geschmackloses Moloch hielt. Spätestens bei der Episode von der Frau mit dem grünen Smaragdring und der Berliner Luft in ihrer Manteltasche hatte sie Kischs Aufmerksamkeit endgültig.
»Solche Geschichten würde ich auch gern erleben«, sagte er anerkennend.
»Dann musst du wohl doch wieder nach Berlin«, meinte Lenka und rempelte ihn übermütig an.
»Jetzt sind wir aber hier, Frau Doktor«, sagte Kisch.
»Aus mir wird kein Doktor«, sagte Lenka. Sie konnte selbst kaum glauben, dass sie das ausgesprochen hatte. Sie spürte wieder das Flattern in der Magengrube. »Ich werde mein Medizinstudium nicht beenden.«
»Du bist doch fast fertig«, sagte Kisch. »Wie viele Jahre noch, zwei, drei?«
Lenka schüttelte den Kopf. »Ich habe es meiner Mutter zuliebe aufgenommen. In Gedenken an meinen Vater. Um sein Werk fortzuführen. Aber ich bin doch kein menschliches Traueramulett.«
Kisch lachte auf, dann wurde er wieder ernst. »Was hast du stattdessen vor?«
»Ich weiß es nicht«, sagte Lenka. »Ich weiß bloß, was ich nicht mehr will. Offiziell bin ich noch in Berlin eingeschrieben. Bis zum Ende dieses Semesters kann ich mir also überlegen, wie es mit meinem Leben weitergeht.«
Kisch sah sie lange an und dachte nach. »Kannst du Maschine schreiben?«, fragte er schließlich.
Lenka nickte überrascht. »Frag mich bitte nicht warum, aber zum elften oder zwölften Geburtstag habe ich mir eine Schreibmaschine gewünscht, und der Wunsch wurde mir erfüllt. Ich bin ziemlich schnell.«
»Gut. In der bohemia ist sehr kurzfristig die Stelle einer Schreibmaschinistin freigeworden.«
»Was ist mit der alten Schreibmaschinistin passiert?«
»Ihr hat jede Woche ein blasierter Feuilletonredakteur seine Meditationen zur Abschrift untergeschoben und sie ihm, als sie sich nicht mehr anders zu helfen wusste, ein Kind.«
»Dann hätte er sie nicht in diese Lage bringen sollen«, sagte Lenka. Sie beneidete Kisch um seine Leichtfertigkeit, die sich