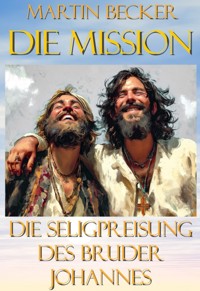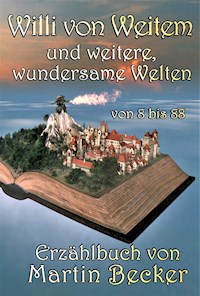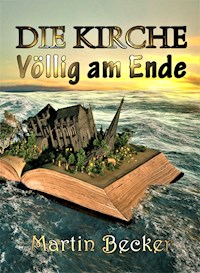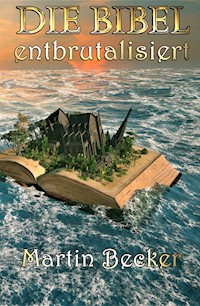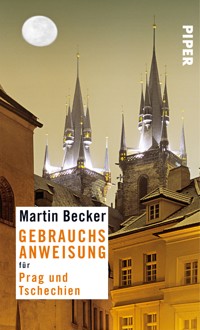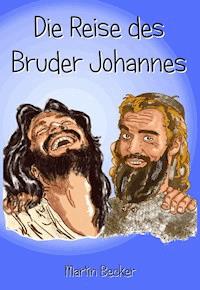Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Schreiben Sie über das Leben, weiser Mann! Schreiben Sie über jeden Tag des Lebens und über die Liebe. Das ist das Einzige und das Wertvollste, das wir haben. Schreiben Sie es hin, denn dies ist die Er-kenntnis." Josef flieht vor seinem eigenen Schatten, denn dieser ist sein Tod. Und er sucht Eva, seine Geliebte. Er muss sie retten, und sie müssen fliehen, hinaus ins Leben, hinaus in die Liebe. Eine fantastische Geschichte über eine Reise, die sich in Traumbildern bewegt. Josef und Eva begegnen Traumfreunden, die es nicht immer gut mit ihnen meinen. Doch sie stoßen auf Weisheiten und auf Erkenntnisse, die sie tief berühren. Das Leben ist es wert, darum zu kämpfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Becker
Josef in der Unterwelt
Eine fantastische Reise
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Exposè
Vorwort
Der Steinbruch
Der Ausflug
Fremde Welt
Die weite Ebene
Die Stadt im Dunkeln
Die Stadt im Krieg
Das Spiel mit dem Licht
Eva
Karli
Bebende Luft
Impressum neobooks
Exposè
Josef in der Unterwelt
Eine fantastische Reise
Martin Becker
2018 Neobooks Verlag, München, erschienen als E-Book
„Schreiben Sie über das Leben, weiser Mann! Schreiben Sie über jeden Tag des Lebens und über die Liebe. Das ist das Einzige und das Wertvollste, das wir haben. Schreiben Sie es hin, denn dies ist die Erkenntnis.“
Josef flieht vor seinem eigenen Schatten, denn dieser ist sein Tod. Und er sucht Eva, seine Geliebte. Er muss sie retten, und sie müssen fliehen, hinaus ins Leben, hinaus in die Liebe.
Eine fantastische Geschichte über eine Reise, die sich in Traumbildern bewegt.
Josef und Eva begegnen Traumfreunden, die es nicht immer gut mit ihnen meinen. Doch sie stoßen auf Weisheiten und auf Erkenntnisse, die sie tief berühren.
Das Leben ist es wert, darum zu kämpfen.
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
kennen Sie die alte griechische Sage von Orpheus in der Unterwelt?
Ist diese Geschichte nicht schauderhaft und doch schön zugleich?
Zur Erinnerung: „Orpheus in der Unterwelt“, frei nach Homer
Orpheus war ein berühmter Schlagersänger im antiken Griechenland. Er sang von Heimatland, von Liebe und von Bergeshöhn und entzückte mit seinem lieblichen Gesang alle Menschen, weit und fern. Ja, selbst die Götter im Olymp hörten auf zu streiten, wenn sie ihn hörten und lauschten ihm aufmerksam zu. Und weil der Olymp so hoch droben, und die Stimme des Orpheus so zaghaft leise klang, erhielt er zum besseren Verständnis ein Musikinstrument aus den Händen des Lichtgottes Apollon: eine goldene Leier. „Seine Reime sind zwar noch nicht perfekt“, sagte Gottvater Zeus. „Aber diese Leier wird ihn anspornen, seine Kunst zu verbessern.“ Und Orpheus sang und spielte und dichtete. Er perfektionierte seine Kunst, und so geschah es, dass, wann immer er seine neue, goldene Leier hervorholte und mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen an ihr zupfte, die Menschen, ja selbst Tiere und Vögel von Ferne herbeieilten und vor Begeisterung tobten.
Orpheus war verheiratet mit Eurydike, einer Nymphe von großem Liebreiz. In keines Bergquells Wasser spiegelte sich des Sonnenhimmels Licht so rein, so ungetrübt, wie in Eurydikes holdseligem Antlitz.
Der junge Sänger war mächtig verliebt in Eurydike und widmete ihr bald jedes zweite Lied. „Oh, rote Lippen, die Brüste so fest, trallala, ich brech‘ gleich zusammen, wenn du mich verlässt.“
Sie liebten sich innigst, doch diese Liebe konnte nicht lange anhalten, denn Eurydike wurde von einer Schlange gebissen und getötet.
Es ist nicht überliefert, ob sich der Schlangenbiss zum Zeitpunkt eines Leiervortrags durch Orpheus ereignete, als sich die Schlange im allgemeinen Beifallssturm, der Ekstase nah, irgendwo festzuhalten versuchte und dabei Euridyke an die Hand nahm. Euridyke verstarb und ihre Seele wanderte in das Reich der Schatten.
Orpheus war untröstlich über den Tod seiner Geliebten, dass er daraufhin keine fröhlichen Lieder mehr spielen konnte. Seine Lieder waren so voller Trauer, dass alle Tiere, die ihn hörten, mit ihm weinten, die Wasserfälle erstarrten und die Steine vor Schmerz zerflossen, oder umgekehrt.
Und so konnte Orpheus seine Einsamkeit nicht länger ertragen, also beschloss er, lebend in die Unterwelt hinabzusteigen, um Eurydike freizubitten. Er wanderte nach Lakonien zum Berge Tainaros und stieg hinab in das schwarze Reich der Schatten.
Doch bevor er den Hades erreichen konnte, lag vor ihm der Fluss Styx, der das Reich der Lebenden mit dem der Toten trennte. Charion, der Totenfährmann, setzte ihn freundlicherweise, aber nicht ohne zu murren über, und der dreiköpfige Hund Kerberos, der Wächter der Unterwelt, ließ ihn knurrend durch den Eingang passieren, von wo sich der junge Sänger aufmachte zum Thron des Gottes Hades und der Halbgöttin Persephone, dessen Teilzeitkraft. Dort wurde Orpheus vorstellig und bat unter Tränen in einem Lied um das Leben seiner geliebten Frau.
„Da es den Menschen doch ziert, unter Vettern“, sang Orpheus. „Darf Mitleid nicht ebenso wohnen bei Göttern?“
Das wirkte. Tatsächlich ließen sich, vielleicht auch, damit Orpheus zu singen aufhörte, die eineinhalb Götter erweichen und gaben Eurydike frei, allerdings nur unter der Bedingung, dass der junge Sänger sich nicht einmal nach seiner Gemahlin umblicken dürfe, während sie gemeinsam aus der Unterwelt aufstiegen. Orpheus lachte: „Nichts leichter, als das“, und sprang schon die Stufen empor, dem Tageslicht entgegen. Doch, oh weh! Er konnte es nicht lange aushalten, sich nicht umblicken zu dürfen. Er hatte bereits den Styx überquert und war so überglücklich, bald wieder mit Eurydike zusammen zu sein, wohl auch vom Zweifel gepeinigt, ob sie ihm auch wirklich folgte, da riskierte er einen klitzekleinen Blick, der aber schon ausreichte, die Bedingung des Gottes der Unterwelt zu brechen. Dass er schnell wieder seine Augen schloss, half nicht mehr, und so konnte er nicht einmal zusehen, wie Eurydike mit einem schmerzlichen „Lebewohl Geliebter!“ in die graue Tiefe zurücksank.
Der Junge erkannte die Peinlichkeit seiner Tat und wollte seine Geliebte sofort wiederholen. Aber dieses Mal weigerte sich Charion, der Fährmann, ihn wieder über den Styx zu rudern. „Ich bin doch kein Taxi, oder was!“
Und so durchstreifte der enttäuschte Orpheus drei Jahre lang die Wälder und Flure. Seine Lieder wurden immer kläglicher und seine Reime immer schlechter, bis er von seiner Fan-Gemeinde verlassen wurde und keine Zuhörer mehr fand. Eines Tages erschlugen ihn, oder vielmehr den Rest von dem Häuflein Elend, das von ihm übriggeblieben war, aufgebrachte und betrunkene Bacchantinnen, die seine Trauerlieder als Verhöhnung ihres Weingottes Dionysos empfanden.
Die Tiere, die sich noch seiner glorreichen Tage erinnern konnten, begruben Orpheus, und der Flussgott Hebros trug die goldene Leier auf Lesbos, die Insel der großen Dichterin Sappho.
Von nun an weilte auch Orpheus Seele, die widerstandslos vom Fährmann über den Styx gebracht wurde, in der Unterwelt, wo er von nun an gemeinsam mit Eurydikes geliebten Schatten auf ewig vereint war.
Und weil sie gestorben sind, leben sie glücklich, bis ans Ende der Tage.
Ende der traurigen und tragischen Sage, mit Happy End.
Die vorliegende Erzählung über „Josef in der Unterwelt“ ist noch schrecklicher und noch schöner, als die Sage von Orpheus:
Josef war ebenfalls ein schöner, junger Mann, allerdings konnte er nicht singen, und er kannte auch nicht die Regeln, die in der Unterwelt herrschten. Aber eines wusste er gewiss: Er liebte seine Eva, und nichts, aber auch gar nichts konnte ihn von seiner Liebe trennen.
Diese Geschichte handelt von der wahren Liebe: der reinen, echten, ewigen Liebe. Es ist eine Liebe, die über den Tod hinausgeht. Die Geschichte handelt aber auch vom Leben, von Licht und Schatten, von Sehnsucht, von Wahrheit und von Spiegelei mit Speck. Und passen Sie gut auf. Der Autor hat sich selbst in eine kleine Nebenrolle eingeschmuggelt – als Tubaspieler.
Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die Erlebnisse von Josef und seiner Geliebten Eva mitverfolgen, so denken Sie bitte an eines: Die Wahrheit ist subjektiv.
Wer sich für den Werdegang seines Lebens an irgendwelche Richtlinien hält, der lebt vielleicht gelassener, beständiger und zufriedener, als andere. Mancher richtet sein Leben aus nach moralischen, ethischen, und religiösen Gesichtspunkten und benennt diese Grundlage seines Lebens als die „Wahrheit“. Aber auch derjenige, der mit politischen und philosophischen Richtlinien eine bessere Welt erreichen will, nimmt dafür den Begriff „Wahrheit“ für sich in Anspruch.
Es gibt also Menschen, die glauben, sie hätten bereits die absolute „Wahrheit“ des Lebens für sich gefunden, und diese Wahrheit gelte folglich auch für die ganze, übrige Menschheit. Daher verbreiten sie diese mit missionarischem Eifer, manche unter ihnen gar mit der Knute. Das alles ist sehr töricht, denn niemand kennt sie wirklich, die absolute Wahrheit.
Weil sie eine subjektive Anschauung ist, kann die Wahrheit des einen für dessen Nachbarn schon nicht mehr gelten. Jedes gehörte Wort und jeder gedachte Gedanke ruft unterschiedliche Emotionen und Reaktionen hervor, und so gleicht keine Empfindung der anderen, wie auch keine Wahrheit der anderen gleicht. Jemand aber, der zuhört und überlegt und den Unterschied zwischen der Wahrheit des einen und der eigenen herausfindet, der ist bereits einen wesentlichen Schritt gegangen auf der Feststellung seiner eigenen, subjektiven Wirklichkeit.
Die Ansichten der Dinge, die in diesem Buch behandelt werden, sind deshalb wohlweislich keine allgemeingültigen Wahrheiten und keine unumstößlichen Erkenntnisse. Vielmehr ist es die Geschichte eines Menschen, auf der Suche nach irgendetwas Wichtigem. Ganz sicher auf der Suche nach der Liebe. Vielleicht sogar, wer weiß, auf der Suche nach Wahrheit. Doch ob dieser Mensch sie findet, und was er da findet, das gilt für ihn allein.
So betrachten Sie bitte diese Geschichte als Wegbeschreibung einer Suche, und seien Sie kritisch mit der Wahrheit der Weisen. Doch seien Sie dem armen Burschen Josef, dem seine Suche nicht immer recht gelingen mag, wohl gesonnen.
Ganz sicher werden Sie, geneigte Leserin und Leser, alsbald Ihren Schatten mit ganz anderen Augen ansehen.
Der Steinbruch
Es war still im Wald. Vom vergangenen Sommer spürte man nur noch wenig Wärme. Der lautstarke Singsang der Vögel in den Ästen und Zweigen hatte sich verflüchtigt, und die kunstvoll bereiteten Nester, Bauwerke für eine Saison, waren verlassen. Verblasst war auch das üppige Grün der Blätter in den Bäumen, der Sträucher, Farne und Gräser. Seit einigen kühlen Nächten verfärbten sich die Bäume und hüllten sich ein in orangegelbe, rote und braune Gewänder. In den Senken der weichgeformten Hügel lagen weiße Nebelbänke, und aus den dunklen Tannen leuchteten weißgelbe, feingliedrige Birken hervor. Es roch nach Pilzen, nach Moos und nach feuchtem Holz.
Hinter den Hügeln stieg die Morgensonne auf und fasste mit schnellen, leuchtenden Strahlenarmen nach nassem, tauglitzerndem Gras und kaltem Gestein. Sie legte schräge, parallele Leuchtstreifen auf die Äste und Stämme und wärmte Lichtplätze und Fußwege am Waldrand. Auf den offenen Wiesen flossen niedrige Nebelschwaden, die im klaren Gegenlicht der aufsteigenden Sonne wie von selbst leuchteten.
Die Vögel waren bereits fortgezogen, und mit ihnen war auch das Lärmen und bunte Treiben in den Ästen verschwunden, wie das Lachen von Kindern im Haus, die erwachsen wurden. Nur hin und wieder piepste die Stimme von Nachzöglingen und überwinternden Vögeln, auf der Jagd nach einer fetten Beute.
Vom nahe gelegenen, steil abfallenden Hügel ertönte ein lang gezogener Hupton.
Plötzlich bebte die Erde und eine Explosion zerriss die Stille, wie das unerwartete Donnern eines nahen Blitzeinschlages. Steine und Staub schleuderten auf, und fielen prasselnd auf die dürren Zweige im Waldboden. Das Poltern des Steingerölls legte sich im kleinen Steinbruch, der mit seiner scharfen Schnittkante den schönen Waldhügel trennte, wie eine Schürfwunde. Maschinen heulten auf. Riesige Radlader vergruben mächtige Schaufeln in das schwere Gestein und räumten dröhnend den Geröllhaufen beiseite, bis zur nächsten Explosion.
Seit es den Steinbruch gab, wurde er nahezu halbkreisförmig in den Hügel eingegraben, und die sandsteinfarbenen, nackten Felsen waren weit vom Tal aus zu sehen. Jetzt im seitlichen Morgenlicht, zeichneten sich die Schatten des Felsens an der Wand in harten, bedrohlichen Konturen ab.
Wer vom nahe gelegenen Städtchen im Tal über die schmale Schotterstraße zum Steinbruch gelangen wollte, fuhr durch einen unwegsamen, von Lastwagenreifen tief zerfurchten Waldweg den Hügel hinauf, bis sich dort plötzlich der Blick über die bunten Herbstwälder öffnete. Für die Arbeiter im Bruch war das der schönste Arbeitsplatz der Welt. Der Weg führte ebenerdig in den schmalen Eingang des Steinbruchs, durch den die Baggerfahrer ihre schweren Maschinen mit besonderem Spaß überschnell durchjagten.
Am Rand der engen Straße vor dem Steinbruch stand eine hohe, verrostete Schottermühle mit Laufbändern und Sortieranlage, wie ein vorzeitliches, grünes Dinosaurier-Gerippe. Gut sortiert rieselte das gemahlene Gestein von den Sortierbändern auf verschiedene, pyramidenförmige Steinhügel. Ein alter, verbeulter Lastwagen, mit einer verwitterten Firmeninschrift an den Türen glotzte mit zwei hohlen, runden Lampen auf die Straßenzufahrt und markierte die Einfahrt zum Steinbruch. Die Achse seines fehlenden Vorderrads war mit Holzklötzen unterlegt und drohte jederzeit nach vornüber zu kippen. Das wuchernde Gestrüpp unter dem Wagen zeigte jedoch an, dass dieser schon lange hier stand.
Vor der kleinen Wellblechbaracke gegenüber, dem Büro, Pausen- und Umkleideraum des Steinbruchs, unterhielten sich Franz, der dicke alte Vorarbeiter mit zwei Männern. Diese trugen weiße Bauhelme mit roter Aufschrift. Heute war wieder Sprengstofflieferung, wie jeden Monatsanfang. Franz nahm diese Lieferung wie immer besonders wichtig, zählte die Päckchen in der Blechkiste genau ab und quittierte sie auf den rosa Lieferscheinen, wobei er seine Unterschrift mit der Zunge auf den Lippen mitverfolgte. Er bedankte sich mit einem billigen Schnäpschen, gegen den sich die beiden Männer jeden Monatsanfang immer wieder erfolglos wehrten, wo ihnen doch ein Kaffee lieber wäre. Ihr Gespräch wurde unterbrochen, als ein großer, gelber Lader mit mannshohen Rädern an ihnen vorbeidröhnte. Das Ungetüm stieß dichten, schwarzen Ruß aus den beiden Auspuffrohren und grub seine riesige Schaufel ohne Mühe in das grobe, scharfkantige Gestein.
„Ja, dann wollen wir mal wieder“, sagte der Sprengstofflieferant zu seinem Kollegen und reichte dem Vorarbeiter das leere Schnapsglas zurück. Dieser verstand die Geste falsch und schenkte das Glas noch einmal voll.
„Halt, nein, nein!“ protestierte der Lieferant.
„Ach, was!“ brummte Franz unbeirrt, „ein Schnäpschen hat noch keinem geschadet.“
Von der letzten Kurve des Waldwegs her sah man einen jungen Mann auf dem Fahrrad, die letzte Steigung zum Steinbruch bezwingen. Mühelos erreichte er die Baracke und hielt mit staubenden Reifen vor den Männern an.
„Guten Morgen, zusammen“, grüßte er grinsend und stieg ab.
Er zeigte nicht die geringste Spur von Anstrengung und trug sein Geländefahrrad mit einer Leichtigkeit unter das kleine Vordach der Baracke, als wäre es ein Aktenkoffer. Auch die beiden Herren in den weißen Helmen lernten seine Kraft kennen, als er sie mit festem Blick und beherztem Handschlag begrüßte. Nach seinem Anstieg zum Steinbruch war die Feinmotorik seines Händedrucks für zarte Herren noch nicht abgestimmt.
Franz lachte. „Grüß Gott, Josef!“ sagte er und schaute auf die Uhr. „Ist wohl ein bisschen spät geworden, was?“
Der junge Mann überragte die Umstehenden um Kopfeslänge. Er strich mit der Hand durch sein schwarzes, zerzaustes Haar, das sich durch die wilden Locken schwer ordnen ließ und suchte nach einer schnellen Ausrede. Ihm fiel aber keine ein.
„Tja, äh“, stotterte er und grinste verlegen.
Als Sohn des Chefs wusste er zwar, dass seine Unpünktlichkeit nicht geahndet wurde, aber man erwartete von ihm, ein Vorbild gegenüber den Kollegen zu sein. Der Vorarbeiter verzog lachend seinen breiten Mund, in dessen Winkel ein Zigarrenstummel steckte und klatschte dem Jungen auf die Schulter.
„Da ist der feine Herr heut wohl nicht aus den Federn gekommen, was?“ und mit listigem Blick zu den beiden Sprengstofflieferanten sagte er geziert: „Aber als Sohn des Chefs kann man sich das wohl erlauben, oder?“
Franz, der Vorarbeiter, arbeitete bereits mit Josefs Großvater zusammen und kannte den Jungen schon als Kind. Natürlich wusste er, dass er zu ihm nicht streng sein musste. Die Jungs im Bruch arbeiteten alle gern und fleißig. Da konnte er schon manches durchgehen lassen. Und in zwei Jahren würde er in die wohlverdiente Rente gehen.
„Äh, ja. Wurde ein wenig spät, schätz ich“, murmelte Josef. Er dachte an Eva und bereute gar nichts. Sein muskulöser Hals und die etwas eng liegenden Augen verrieten ihn als einen körperbetonten Menschen. Die Augenbrauen zeichneten eine gerade Linie über der Nasenwurzel, und in den letzten Winkeln seines Mundes spielte ein leichtes, selbstzufriedenes, stolzes Lächeln, das er auch im größten Ärger nie verlor. Er hatte eines dieser Gesichter, die niemals einem anderen ähnlich sein konnten. Vielmehr sahen alle ähnlichen Gesichter höchstens nur ihm gleich.
Er entdeckte die vollen Schnapsgläser in den Händen der verlegenen Sprengstofflieferanten, die genau wussten, dass ihnen das Glas nachgeschenkt wurde, sobald sie es leerten. Franz wartete bereits mit dem Korken in der Hand.
„Komm, Sepp“, bestimmte der Alte. „Jetzt holst du dir auch mal ein Glas.“
„Es ist immer dasselbe, Franz“, lachte Josef, und holte zwei Gläser aus der Teeküche der Baracke. „Dieses Mal aber kommst du uns nicht davon. Du trinkst jetzt auch einen.“
„Aber du weißt doch, ich trinke nie. Mein Magen!“
„Keine Widerrede. Hier. Jetzt sagen wir Prost.“ Josef schenkte die Gläser voll und stieß sein Glas an das der anderen.
Die vier hoben die Gläser und stürzten das scharfe Zeug mit Verachtung die Kehlen hinab.
„Aah, pfui Deibel!“ ächzte Franz und spuckte den Mundinhalt hinter sich aus. „Was ist denn das?“
Die Lieferanten lächelten höflich aber verschmitzt.
„Am besten schmeckt dieses künstliche Aprikosen-Aroma.“ sagte Josef, verzog seinen Mund und klopfte sich hustend auf die Brust. „Vor allem bei Zimmertemperatur.“
„Igitt. Und davon habe ich noch zwei Flaschen.“ Franz leerte den Rest der Flasche verächtlich auf die Erde.
„Also, dann wollen wir mal“, die Sprengstofflieferanten bedankten sich freundlich, verabschiedeten sich und gingen zurück zu ihrem Fahrzeug.
„Bäh“, sagte Franz. „Ich brauche jetzt einen Kaffee, um den Nachgeschmack wegzukriegen. Willst du auch einen?“
„Nee, Franz. Dein Kaffee ist noch schlimmer.“
Josef lebte noch bei seinen Eltern, am Fuße des Waldwegs im Tal. Sein Großvater begann nach dem Krieg mit dem Steinbruch und belieferte die Eisenbahn mit Schottersteinen. In den alten Familienfotos sah man Großvaters ersten LKW, derselbe, der heute völlig verrostet den Eingang bewachte. Sein Sohn Karl erweiterte später das Geschäft und errichtete im Tal ein Bitumenwerk für den Straßenbau.
Eva hatte den schönsten Streichelkörper der Welt, und ihre rehbraunen Augen und ihr strahlendes Lächeln sagten „Ich liebe Dich“, ohne dass sie ein Wort dazu sagen musste. Eigentlich wäre Josef ja schon früher aufgestanden, aber sie ließ ihn nicht weg. Und er blieb gern, ließ sich von ihr wieder zurückziehen, in ihre Arme, an ihren weichen Körper.
„Bleib heute hier.“ hat sie ihm ins Ohr gehaucht. Er aber lachte sanft. Die Disziplin hatte er von seiner Mutter geerbt, aber auch das weiche Herz seines Vaters. Natürlich konnte er nicht einfach bleiben, aber er könnte ja daheim fragen, ob er für heute frei haben könnte, oder zumindest früher Schluss machen.
Josef zog sich seinen blauen Bauhelm über, der an einem Nagel an der Baracke hing. Er besprach sich kurz mit dem Vorarbeiter.
„Heute Mittag mache ich früher Schluss“, sagte er. „Eva und ich fahren in die Stadt.“
„Hast du das mit deiner Mutter abgeklärt?“ fragte Franz und paffte an seinem kurzen Zigarrenstummel.
„Ja, ja. Sie war einverstanden.“
„Aber wie ich sie kenne, gab es erst einmal große Diskussionen, stimmt’s?“
„Ja. Sie will, dass ich Verantwortung lerne, bis ich mal das Geschäft übernehme.“
„Hör mal, mein Junge“, sagte der Alte und nahm Josef beiseite. „Du bist jetzt bald fünfundzwanzig. Was denkst du, wann du das Geschäft übernehmen wirst?“
„Ich?“ fragte Josef und sah ihn betrübt an. „In frühestens zwanzig Jahren, schätz ich.“
„Und freust du dich schon darauf?“
„Freuen? Ich sage dir, Franz. Ich habe jede Nacht Alpträume davon.“
„Das habe ich mir gedacht. Deine Eltern wollen dich schon so langsam einwickeln, stimmt’s?“
„Mmmmh. Ich soll den Fuhrpark übernehmen.“
„Du weißt, ich mag deine Mutter sehr, und dein Vater ist wie ein Sohn für mich“, sagte der Alte so geheimnisvoll, als würde er schlecht über andere Leute reden. „Aber noch viel lieber mag ich dich. Weißt du, ich sehe das, wie du leidest. Dafür kenne ich dich zu gut.“
„Leiden ist kein Ausdruck. Und ich weiß nicht, wie ich das meinen Leuten sagen soll.“
„Ich muss dir eins sagen. Aber wehe, du erzählst das deinen Eltern, was ich dir jetzt erzähle! Glaube mir, das Geschäftsleben ist nichts für dich. Du solltest deinem Vater sagen, dass er sich einen anderen Nachfolger suchen soll. Irgendeinen Manager aus der Stadt.“
Josef lachte erschreckt auf. „Nein! Das kann ich doch nicht meinem Vater sagen. Das bringt ihn um.“
„Willst du tatsächlich auf Warteposten gehen, bis du für deinen Vater Türklinken putzt für jeden Auftrag und für deine Mutter die Buchhaltung machst und Quittungen abheftest? Nein, mein Junge. Das ist doch nichts für dich. Da gehst du ein, wie ein Primelchen. Schau dich doch an! Was willst du auf einem Bürostuhl. Du solltest dich bald nach einem Job umschauen, der dir Spaß macht und dich eine Weile von deinen Eltern wegbringt.“
„Die haben aber keinen anderen Nachfolger, als mich. Und einen Fremden werden sie niemals nehmen.“
„Ich beobachte dich schon lange, mein Junge. Ich sage dir das deshalb, Sepp, weil ich meinen Sohn verloren habe. Der will nichts mehr von uns wissen.“
„Du hast einen Sohn?“
„Weißt du, es gibt ein Naturgesetz und das heißt: `Die Natur holt sich immer ihr Recht zurück`. Man kann keine Kinder gegen ihre Natur aufziehen. Als Erwachsene werden sie das nachholen, was sie als Kind vermissten. Da, wo du die Entwicklung deiner Kinder heute unterdrückst, da brechen sie später einmal aus. Wir haben zu viele Erwartungen in unseren Sohn gesteckt. Er sollte studieren und es einmal besser haben. Und dann hatte er die Schule abgebrochen, weil wir ihn so gezwungen haben. Er ist ausgebrochen und wollte nichts mehr von uns wissen. Jetzt kennen wir nicht einmal unsere Enkelkinder. Es ist nicht gut, dass deine Eltern dich schon so früh zu ihrem Nachfolger erziehen. Das ist sogar schlecht fürs Geschäft, denn du wirst ein schlechter Geschäftsmann sein. Du bist nicht fürs Büro geschaffen. Sie sollten dich deinen eigenen Weg gehen lassen. Wenigstens für ein paar Jahre. Zurückkommen kannst du ja immer noch in zwanzig Jahren. Denk mal darüber nach.“
„Ich danke dir, Franz“, sagte Josef und legte die rechte Hand auf seine Schulter. „Es stimmt, was du sagst.“
„So, und jetzt brich nicht gleich in Tränen aus, schau zu, dass du endlich das Arbeiten anfängst.“
Beide lachten und Josef machte sich auf.
Er drehte sich noch mal um. „Ich weiß trotzdem nicht. Ich könnte nie mit meinem Vater reden.“
„Überleg dir das, mein Junge. Nimm dir Zeit dafür.“ sagte der Alte und rief dann: „Nimm heute den Blauen und zerkleinere die Steine da drüben.“
Josef stieg in ein blaues Kettenfahrzeug, mit dem Schlagbohr-Eisen am Ausleger, so stark wie ein Oberarm. Er ließ den Motor an, der das Gefährt zunächst in eine schwarze Rußwolke hüllte. Grinsend steuerte der junge Mann seinen Bagger mit wippendem Ausleger und jammernden Motor an der Baracke vorbei in den Steinbruch. Franz nahm die Zigarre vom Mund und schaute sie sich an. Der Diesel hatte ihm den Geschmack verdorben.
Josef bewegte seine Maschine zu besonders großen Steinbrocken, um sie für den Abtransport zu zerkleinern. Mit tuckernden Schlägen bohrte sich die Lanze der Raupe in den gewaltigen Stein, bis dieser zersprang. Die gelben Riesen besorgten den Rest. Die Steinbrucharbeit war hart und gefährlich und in den Fahrerkabinen war es heiß.
Ein Fahrer im blauen Helm stoppte seinen Bagger und winkte Josef zu sich herüber. Beide stiegen auf die monströsen Räder und öffneten die Motorhaube. Irgendwie lief der Motor nicht rund. Vielleicht ließ sich der Schaden schnell beheben. Josef kletterte wieder hinab und lief zur Hütte, um den Werkzeugkasten zu holen. Um den Weg abzukürzen, nahm er aber den Weg direkt auf dem Geröll der riesigen Steinbrocken, an der frisch gesprengten Wand vorbei.
Plötzlich schrien die Kollegen. Von oben lösten sich einige späte Felsbrocken und donnerten splitternd den Felsen hinab. Josef schaute hoch und sprang schnell zur Seite. Dabei stolperte er, verlor das Gleichgewicht und fiel mit dem Gesicht voran zwischen das Gestein.
Einige große Steine stürzten dicht neben Josef ein, zersprangen und rollten über ihn hinweg. Er lag geschützt in einem Spalt zwischen zwei großen Felsbrocken und legte seinen freien Arm schützend über den Kopf. Ein Stein rollte über die beiden Felsbrocken, die Hauptlast links und rechts verteilt, wie eine Lock auf Schienen, berührte Josefs Brustkorb und drückte ihn tiefer in den Spalt ein, ohne ihn zu verletzen. Der Junge keuchte unter dem schweren Brocken und konnte nicht mehr atmen.
Plötzlich spürte er ein Würgen am Hals. Es war wie ein Klammergriff zweier starker Hände an seiner Gurgel. Eine tiefe Stimme raunte ihm zu:“ Du kommst jetzt mit.“
Noch ehe er dieses Gefühl beachten konnte, rollte der schwere Felsen wieder von ihm ab und kullerte weiter. Es folgte ein prasselnder Regen von Steinbrocken und Staub. Josef blieb regungslos liegen. Er atmete einige Male tief durch. Das Würgegefühl am Hals ließ nach.
Der Steinschlag war zu Ende. Die Arbeiter liefen schnell herbei, um Josef zu bergen.
„Sepp!“ riefen sie und zogen ihn aus dem Spalt hervor.
Der Junge war benommen und völlig eingestaubt. Er öffnete die Augen, bewegte seinen Arm, sein Bein. Er fühlte keinen Schmerz. Langsam begriff er, was geschehen war und schaute auf sich herab. Ihm war nichts passiert. Keine Knochenbrüche, keine Wunden. Glück gehabt. Sein Helm lag einige Meter von ihm entfernt, völlig zertrümmert.
„Mensch, Sepp!“ riefen sie.
„Glück gehabt“, lachte Josef, räusperte sich und fasste sich an den Hals. „Es ist nichts passiert.“
Die Kollegen begleiteten Josef zur Baracke. Der alte Vorarbeiter lief ihnen entgegen.
„Sepp! Ist dir was passiert?“
„Nein, nein, Franz. Glück gehabt“, sagte Josef mit dünner Stimme. Seine Knie waren etwas weich vom Schreck.
„Junge, verflixt! Wie konntest du nur so unvorsichtig sein!“
„Das nächste Mal passe ich besser auf“, lächelte Josef.
„Willst du dich ausruhen?“ fragte Franz besorgt.
„Na, klar!“ lachte er und wandte sich den anderen Kollegen zu. „Ist doch Frühstückspause, oder nicht?“
Die Arbeit im Steinbruch ging bald wieder wie gewohnt weiter. Josef behielt aber den steilen Fels respektvoll im Auge. Seinen zerstörten Helm wollte er sich daheim im Zimmer ins Regal stellen.
Der Ausflug
Am Eingang des Steinbruchs hielt ein weißer Jeep. Eva stieg aus. Sie hatte sich heute hübsch gemacht für den Ausflug. Die Haare waren locker hochgesteckt, und ihr weißgepunktetes, rotes Kleid erlaubte einen Blick auf ihre langen, schlanken Beine. Klar, dass die Jungs im Bruch sofort laut johlten und pfiffen. Und Josef schritt, in einer Mischung aus Verlegenheit und Stolz, lächelnd, mit nacktem Oberkörper, sein Hemd geschultert, so männlich und heldenhaft, wie der Zigaretten-Mann zum Ausgang. Seine weißen Zähne strahlten im Sonnenlicht. Er blickte sich nicht nach seinen Kollegen um, die ihn auf seinem Weg mit Klatschen, Pfeifen und Motorengeheul aufmunterten. Er hatte seinen Blick nur noch für sie: Für seine Traumfrau.
Eva verschränkte ihre Arme, grinste und lehnte sich an den Jeep. Sie wusste, dass ihr Macho-Man diesen Abgang tierisch genoss.
Franz zündete sich einen Zigarrenstumpen an, als Josef die Baracke passierte.
„Viel Spaß, mein Junge.“
„Heute fahre ich“, lächelte sie selbstbewusst, nachdem er frisch geduscht aus dem Haus seiner Eltern kam und dabei strahlte, wie ein kleiner Junge auf dem Weg zum Jahrmarkt. Er hatte sein rotes Lieblingshemd angezogen und sah dabei einem kanadischen Holzfäller nicht unähnlich.
Die Sonne stand hoch am Himmel und hatte nicht mehr die Kraft eines Sommermittags. Dafür war das Licht so klar und hell, wie es nur im Herbst sein konnte. Die Bäume leuchteten, als hätte man sie in Brand gesteckt, dabei strahlten sie eine Ruhe und Ehrwürdigkeit aus, wie man es nur im Beisein von alten, klugen Menschen mit schneeweißen Haaren empfindet. Ein kräftiger Wind blies in die Zweige und wehte die ersten goldbraunen Blätter über die Straße. In kräftigen, runden Bogentürmen bauten sich die Wolken in den tiefblauen Himmel auf. Eva zeigte auf die Vögel, die scheinbar ohne Widerstand im Wind hin und her geweht wurden. Hinter dem weißen Jeep wirbelte das bunte Laub.
Die schmale Landstraße zur Stadt führte über den Kamm der lieblichen Hügellandschaft auf ein tiefes Flusstal zu. Josef liebte diese Strecke, die sich mit einem schnellen Auto so herrlich fahren ließ. Eva wollte jedoch nicht so schnell fahren. Sie genoss den Blick des Höhenwegs, hinweg über die bunten Laubwälder, zwischen denen kleine Dörfer und Siedlungen mit den roten Dächern hervorleuchteten, wie Fliegenpilze im Wald.
„Wir haben unheimlich viel vor“, freute sich Eva. „Zuerst müssen wir sämtliche Läden abklappern. Ich habe ja überhaupt nichts mehr anzuziehen. Dann brauche ich noch ein Geschenk für meinen Vater und ein neues Buch für mich. Und wenn wir noch Zeit haben, können wir ja noch in den Musikladen vorbei und heute Abend vielleicht ins Kino.“
Josef schaute sie von der Seite an und grinste.
„Eigentlich wollten wir noch auf die Burg spazieren“, sagte er und dachte an die schöne Parkbank, auf der es sich so herrlich schmusen ließ.
„Dazu haben wir keine Zeit. Vielleicht nach Ladenschluss. Vorher müssen wir ganz schön stressen.“
„Leider konnte ich nicht früher. Tut mir leid.“
„Warum haben dir deine Eltern auch nur den Nachmittag freigegeben. Ich fürchte, wir kommen mit dem Programm nicht ganz durch.“
„Ach, wir hatten wieder einmal eine dieser ewigen Diskussionen.“
„Das sollte dir doch langsam nichts mehr ausmachen, oder?“
Josef blieb still und schaute wie geistesabwesend vor sich auf die Straße.
„Ist was mit dir, Liebling?“ fragte Eva, die bemerkte, dass Josef schon die ganze Fahrt über recht schweigsam neben ihr saß.
„Heute bin ich in einen Steinschlag geraten“, sagte er.
„Liebling!“ rief sie erschreckt. „Hast du dich verletzt?“
„Nein, ich lag so in einem Spalt, dass die Steine über mich hinweggerollt sind.“
„Warum hast du mir das nicht gleich erzählt, als ich dich abgeholt habe?“
„Nein, nein“, beruhigte er sie. „Es ist ja nichts weiter passiert.“
„Dir sitzt aber doch noch der Schreck in den Knochen.“
„Es ist nichts passiert. Ich habe eben Glück gehabt.“
„Schatz“, Eva schaute ihn vorwurfsvoll an. „Du warst wieder leichtsinnig, stimmt’s?“