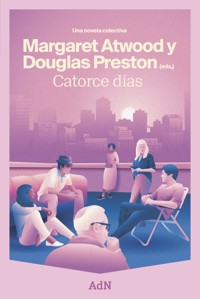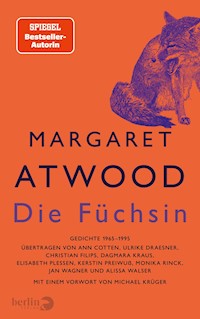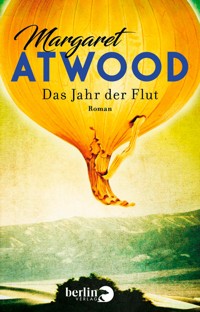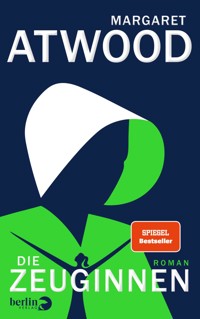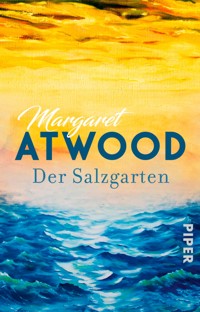
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie die filigranen Formationen von Salzkristallen in einem chemischen Experiment erscheinen bei Margaret Atwood die irritierenden und verwirrenden Familienverhältnisse und Konflikte. In dreizehn Geschichten erzählt sie von skurrilen Charakteren und Konstellationen, die sie mit Witz, Ironie und Originalität in Szene setzt ... »Margaret Atwood ist die stille Mata Hari, die geheimnisvolle, gewalttätige Gestalt, die sich wie eine Brandstifterin gegen die geordnete, zu saubere Welt wirft.« Michael Ondaatje
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Für meine Eltern
Übersetzung aus dem kanadischen Englisch von Charlotte Frank
ISBN 978-3-4929-7741-8© O. W. Toad Ltd. 1983Titel der kanadischen Originalausgabe:»Bluebeard’s Egg«, McClellands & Stewart Ltd, Toronto 1983© der deutschsprachigen Ausgabe:Piper Verlag GmbH, München 2001, 2015© der deutschen Übersetzung 1994:S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2016Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenUmschlagabbildung: FinePic®, MünchenDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Bedeutende Augenblicke im Leben meiner Mutter
Als meine Mutter klein war, schenkte ihr jemand einen Korb mit Küken zu Ostern. Sie sind alle gestorben.
»Ich wusste nicht, dass man sie nicht herausnehmen darf«, sagt meine Mutter. »Die armen kleinen Dinger. Ich habe sie alle in einer Reihe auf ein Brett gelegt, ihre kleinen Beine so steif wie Feuerhaken, und sie danach lange beweint. Ich hatte sie totgeliebt.«
Vielleicht will meine Mutter mit dieser Geschichte bloß veranschaulichen, wie dumm sie war, und wie sentimental. Sie will uns damit zu verstehen geben, dass sie heute so etwas nicht mehr tun würde.
Vielleicht ist es eine Erläuterung der Liebe; aber da ich meine Mutter kenne, halte ich das für unwahrscheinlich.
Der Vater meiner Mutter war Landarzt. In den Tagen, bevor es Autos gab, fuhr er mit einem Pferdegespann und einem Wagen in seinem Gebiet herum, und in den Tagen vor den Schneepflügen kutschierte er mit einem Pferdegespann und einem Schlitten mitten in der Nacht durch Schnee und Regen zu Häusern, in denen Öllampen brannten und Wasser auf dem Holzherd kochte und über dem Tellerbord Flanelltücher zum Wärmen hingen, für die Babys, denen er verhalf, das Licht der Welt zu erblicken, und die nach ihm benannt wurden. Seine Praxisräume waren im Haus, und als Kind sah meine Mutter die Leute über die vordere Veranda an seine Tür kommen, mit Teilen von sich, die sie fest umklammert hielten – Daumen, Finger, Zehen, Ohren, Nasen –, die sie bei einem Unfall verloren hatten und die sie an die rohen Stümpfe ihrer Körper pressten, als könnten diese abgetrennten Teile wie Teig darangeklebt werden, in der meist vergeblichen Hoffnung, mein Großvater würde sie ihnen wieder annähen und so die klaffenden Wunden, von Äxten, Sägen, Messern und dem Schicksal verursacht, zu heilen imstande sein.
Meine Mutter und ihre jüngere Schwester lungerten so lange dicht beim Eingang zur Praxis herum, bis man sie verjagte. Hinter der Tür konnte man Stöhnen, erstickte Schreie, Hilferufe hören. Für meine Mutter waren Krankenhäuser nie etwas Schönes, und Krankheiten haben nie Aufschub oder Ferien bedeutet. »Werdet bloß nie krank«, sagt sie und meint es ernst. Sie selbst wird fast nie krank.
Nur einmal wäre sie fast gestorben. Das war, als sie einen Blinddarmdurchbruch hatte. Mein Großvater musste die Operation selbst durchführen. Hinterher sagte er, dass er dies eigentlich nicht hätte tun dürfen: Seine Hände hatten viel zu sehr gezittert. Das war eines seiner wenigen Eingeständnisse von Schwäche, von denen meine Mutter je berichtet hat. Meist wird er als ernst dargestellt, als jemand, der alles im Griff hat. »Wir hatten Respekt vor ihm«, sagt sie. »Alle hatten Respekt vor ihm.« (Das ist ein Wort, das seit der Kindheit meiner Mutter etwas an Wert eingebüßt hat. Früher war es sogar noch wichtiger als Liebe.)
Die Geschichte von der Bisamfarm meines Großvaters erzählte mir jemand anders: Wie er und ein Onkel meiner Mutter den Sumpf im hinteren Teil ihres Anwesens einzäunten und die Ersparnisse einer unverheirateten Tante meiner Mutter in Bisamratten investierten. Sie hatten die Idee, diese Bisamratten sich vervielfältigen zu lassen und zu Bisampelzmänteln zu verarbeiten, aber ein Nachbar mit einer Apfelfarm pflegte seine Spritzgeräte ein Stück weiter flussaufwärts zu waschen, und das Gift brachte die Bisamratten alle um, so dass sie mausetot waren. Das war zur Zeit der Depression und gar nicht witzig.
Als sie noch jung waren – das kann heutzutage so gut wie alles bedeuten, aber ich nehme an, es war mit sieben oder acht –, hatten meine Mutter und ihre Schwester ein Haus in den Bäumen, wo sie einen Teil ihrer Zeit mit ihren Puppen verbrachten, um mit ihnen Tee zu trinken und so. Eines Tages fanden sie eine Schachtel mit niedlichen kleinen Fläschchen vor der Apotheke meines Großvaters. Die Fläschchen waren zum Wegwerfen, aber meine Mutter (die schon immer gegen Verschwendung war) hob sie für ihr Puppenhaus auf. In den Flaschen war eine gelbe Flüssigkeit, die sie drinließen, weil es so hübsch aussah. Wie sich herausstellte, waren es Urinproben.
»Das hat vielleicht ein Donnerwetter gegeben«, sagt meine Mutter. »Aber woher sollten wir das wissen?«
Die Familie meiner Mutter lebte in einem großen weißen Haus in Neuschottland neben einem Obstgarten mit Apfelbäumen. Es hatte eine Scheune und einen Wagenschuppen und in der Küche eine Speisekammer. Meine Mutter kann sich noch an die Zeit erinnern, als es noch keine Backwaren zu kaufen gab, als man das Mehl noch in Fässern aufhob und das Brot zu Hause gebacken wurde. Sie kann sich noch an die erste Rundfunksendung erinnern, die sie gehört hat und die mit irgendwelchen Songs für Socken warb.
Dieses Haus hatte viele Zimmer. Obwohl ich dort war, obwohl ich das Haus mit eigenen Augen gesehen habe, weiß ich noch immer nicht, wie viele es waren. Ein Teil des Hauses war verschlossen, jedenfalls hatte es den Anschein, und da waren Hintertreppen. Gänge, die irgendwo hinführten. In ihm lebten fünf Kinder, zwei Eltern, zwei Hausangestellte, ein Mann und ein Mädchen, deren Namen und Gesichter ständig wechselten. Die Struktur des Hauses war hierarchisch, mit meinem Großvater an der Spitze, aber sein heimliches Leben – das Leben ungefüllter Pasteten, sauberer Laken, der Schachtel mit Flicken in der Wäschekammer, den Brotlaiben im Ofen – war weiblich. Das Haus und alle Gegenstände darin knisterten vor statischer Elektrizität, es war von Sogen unterspült, die Luft erfüllt von Dingen, die jeder kannte, über die aber niemand sprach. Es hallte wie ein hohler Baumstamm, eine Trommel, eine Kirche, so dass Gespräche, vor sechzig Jahren flüsternd darin geführt, selbst heute noch halb vernehmbar sind.
In diesem Haus blieb man am Tisch sitzen, bis der Teller leer gegessen war. »Denkt an die hungernden Armenier, pflegte Mutter zu sagen. Ich sah nicht ein, womit ich ihnen auch nur im Geringsten half, wenn ich meine Brotrinde aufaß.«
In diesem Haus sah ich zum ersten Mal Haferhalme in einer Vase stehen, jeder Einzelne mit kostbarem Silberpapier umwickelt, das man von einer Schachtel Schokolade sorgfältig aufbewahrt hatte. Für mich war es das Schönste, das ich je gesehen hatte, und so fing auch ich an, Silberpapier aufzuheben. Aber ich bin nie dazu gekommen, Haferhalme einzuwickeln, und außerdem hätte ich sowieso nicht gewusst, wie. Wie so viele andere Kunstformen vergangener Zivilisationen ist auch diese Technik verloren und lässt sich nicht völlig nachvollziehen.
»Zu Weihnachten gab es Orangen«, sagt meine Mutter. »Sie kamen den ganzen weiten Weg von Florida; sie waren sehr teuer. Das war das Höchste: eine Orange in der Zehe deines Strumpfes zu finden. Es ist komisch, dass ich mich noch heute daran erinnere, wie gut sie damals geschmeckt haben.«
Als meine Mutter sechzehn war, hatte sie so lange Haare, dass sie darauf sitzen konnte. Inzwischen hatten die Frauen angefangen, sich ihre Haare kurz zu schneiden; die zwanziger Jahre hielten ihren Einzug. Meine Mutter sagt, ihre Haare hätten ihr Kopfschmerzen bereitet, aber mein Großvater, der sehr streng war, verbot ihr, sie abzuschneiden. Sie wartete bis zu einem Samstag, als sie wusste, dass er einen Termin beim Zahnarzt hatte.
»Vereisen gab es damals noch nicht«, sagt meine Mutter. »Und der Bohrer wurde mit einem Fußpedal in Gang gesetzt und machte knirsch, knirsch, knirsch. Der Zahnarzt selbst hatte braune Zähne: Er kaute Tabak, und den Tabaksaft spuckte er in einen Spucknapf, während er sich an deinen Zähnen zu schaffen machte.«
An dieser Stelle ahmt meine Mutter, die gut imitieren kann, die Geräusche des Bohrers und des Tabaksafts nach: »Rrrr! Rrrr! Rrrr! Phtt! Rrrr! Rrrr! Rrrr! Phtt! Das war die reinste Höllenqual. Und als das Gas kam, war es wie eine Erlösung des Himmels.«
Meine Mutter ging in die Zahnarztpraxis, in der mein Großvater schmerzensbleich auf dem Stuhl saß. Sie fragte ihn, ob sie sich die Haare schneiden lassen dürfte. Er sagte, von ihm aus könne sie tun, was sie wollte, wenn sie nur endlich verschwinden und ihn nicht länger plagen würde.
»Und da bin ich sofort losgelaufen und hab sie mir abschneiden lassen«, sagt meine Mutter fröhlich. »Hinterher war er wütend, aber was konnte er tun? Er hatte sein Wort gegeben.«
Meine eigenen Haare werden im Keller meiner Mutter in einem Pappkarton in einer Schiffstruhe aufbewahrt, und ich stelle mir vor, wie sie jedes Jahr immer stumpfer und spröder werden, vielleicht von Motten zerfressen; inzwischen sehen sie wohl aus wie die verblassten Kränze auf den viktorianischen Gräbern. Oder vielleicht haben sie auch trockenen Schimmel angesetzt; an der Innenseite des Seidenpapiers, in das sie eingewickelt sind, ist ein mattes Glühen in der dunklen Truhe. Ich glaube, meine Mutter hat ganz vergessen, dass sie da drin sind. Zu meiner Erleichterung wurden sie abgeschnitten, als ich zwölf war und meine Schwester geboren wurde. Davor trug ich es in langen Locken: »Denn sonst«, sagt meine Mutter, »wäre dein Haar nur ein einziger Knoten gewesen.« Meine Mutter kämmte es jeden Morgen, indem sie es um ihren Zeigefinger wickelte, aber als sie im Krankenhaus war, wurde mein Vater einfach nicht damit fertig. »Er kriegte es nicht um seine kurzen dicken Finger«, sagt meine Mutter. Mein Vater sieht hinunter auf seine Finger. Verglichen mit den langen eleganten Fingern meiner Mutter, die sie als knochig bezeichnet, sind sie tatsächlich kurz und dick. Er setzt ein Miezekatzenlächeln auf.
So kam es, dass meine Haare abgeschnitten wurden. Ich saß in meinem ersten Schönheitssalon und sah zu, wie meine Haare, wie viele Hand voll Spinnweben, über meine Schultern zu Boden fielen. Und in der Mitte tauchte mein Kopf auf, kleiner, kompakter, mit eckigem Gesicht. Nach fünfzehn Minuten war ich fünf Jahre älter geworden. Jetzt konnte ich nach Hause gehen und Lippenstift auftragen.
»Dein Vater war außer sich«, sagt meine Mutter verschwörerisch. Das sagt sie nicht, wenn mein Vater dabei ist. Wir lächeln über die merkwürdigen Reaktionen der Männer auf Haare.
Ich habe immer geglaubt, meine Mutter hätte in ihren frühen Tagen ein Leben voller Heiterkeit und haarsträubender Abenteuer geführt. (Das war, bevor mir klar wurde, dass sie nie von den langen ereignislosen Zeiten sprach, die den Großteil ihres Lebens ausgefüllt haben mussten: Die Geschichten waren nur das Kursive darin.) Pferde sind mit ihr durchgegangen, und Männer haben angeboten, dasselbe zu tun; ständig fiel sie von Bäumen oder von den Dachbalken der Scheunen, wurde von der Flut fast hinaus ins Meer geschwemmt oder geriet, wenn es mal weniger dramatisch herging, in missliche Situationen, die ihr höchst peinlich waren.
Kirchen waren besonders gefährlich. »Eines Sonntags kam ein Gastprediger«, sagt sie. »Natürlich mussten wir jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und da war er, in vollem Schwung, predigte Fegefeuer und Verdammnis« – sie klopft auf eine unsichtbare Kanzel –, »und sein ganzes Gebiss falscher Zähne schoss – wupp! – aus seinem Mund heraus – einfach so. Nun, er zögerte keine Sekunde. Seine Hand schnellte nach vorn, schnappte es sich und steckte es sich wieder in den Mund, dann fuhr er fort, uns allesamt zu ewigen Qualen zu verdammen. Die Gemeinde zitterte! Über unsere Gesichter rannen Tränen, aber das Schlimmste war, dass wir in der ersten Reihe saßen und er uns direkt ansah. Aber natürlich konnten wir nicht laut loslachen: Dann hätte es von Vater ein Donnerwetter gegeben.«
Anderer Leute gute Stuben waren für sie mit Fallen ausgestattet; genauso wie auch sonst alle gesellschaftlichen Ereignisse. An den strategischen Punkten ihrer Kleidung platzten die Reißverschlüsse, auf Hüte war kein Verlass. Der Mangel an echtem Gummi während des Krieges forderte ständige Wachsamkeit: Die Unterhosen hatten damals Knöpfe und waren ein größeres Tabu als heute, und daher auch von größerer Verfänglichkeit. »Und plötzlich bist du dagestanden«, sagt sie, »mitten auf der Straße, und ehe du es dich versahst, saßen sie unten auf deinen Galoschen. Dann musste man schnell einen Schritt machen und aus dem einen Bein rausfahren und sie mit dem andern Fuß hochwerfen und in die Tasche stecken. Das konnte ich ziemlich gut.«
Diese spezielle Geschichte erfahren nur einige wenige, während andere Geschichten für den allgemeinen Verbrauch bestimmt sind. Wenn sie sie erzählt, wird das Gesicht meiner Mutter zu Gummi. Sie übernimmt alle Rollen, fügt die Toneffekte hinzu, fährt mit den Händen durch die Luft. Ihre Augen glänzen, manchmal sogar ein bisschen boshaft, denn obwohl meine Mutter nett und alt und eine Dame ist, vermeidet sie es, eine nette alte Dame zu sein. Geraten die Leute in Gefahr, sie dafür zu halten, wirft sie schnell etwas vom linken Außenfeld ein; sie will nicht als selbstverständlich angesehen werden.
Und meine Mutter lässt sich auch nicht dazu überreden, Geschichten zu erzählen, wenn sie keine Lust dazu hat. Wenn man sie drängt, wird sie befangen und verstummt. Oder sie lacht und geht in die Küche, und kurz darauf hört man den Mixer surren. Ich habe es schon lange aufgegeben, sie dazu bringen zu wollen, auf Partys etwas zum Besten zu geben. In Gesellschaft von Leuten, die sie nicht kennt, hört sie nur mit leicht zur Seite geneigtem Kopf und einem glatten höflichen Lächeln aufmerksam zu. Das Geheimnis besteht darin, abzuwarten, was sie hinterher sagen wird.
Mit siebzehn ging meine Mutter auf die Normal School in Truro. Dieser Name – »Normal School« – hatte für mich früher immer etwas Geheimnisvolles. Ich dachte, man würde dort lernen, sich normal zu benehmen, was ja auch vielleicht der Fall war, denn eigentlich ging man dorthin, um Schullehrer zu werden. Danach unterrichtete meine Mutter nicht weit von zu Hause entfernt in einer Schule, die nur einen Raum hatte. Sie ritt jeden Tag mit ihrem Pferd in die Schule und sparte das Geld, das sie verdiente, um damit auf die Universität zu gehen. Mein Großvater wollte sie nicht hinschicken: Er sagte, sie wäre viel zu frivol. Für seinen Geschmack ging sie viel zu oft zum Schlittschuhlaufen und zum Tanzen.
Als sie die Normal School besuchte, wohnte meine Mutter bei einer Familie mit mehreren Söhnen, die mehr oder weniger im selben Alter waren wie die Untermieterinnen. Beim Essen saßen sie alle um einen großen Tisch (den ich mir aus dunklem Holz vorstelle, mit geschnitzten Beinen, aber immer mit einem weißen Leinentischtuch bedeckt), mit Mutter an dem einen und Vater an dem anderen Ende. Ich stellte sie mir beide groß und rosig und strahlend vor.
»Die Jungen waren richtige Lausejungen«, sagt meine Mutter. »Immer mussten sie was aushecken.« Das wurde von einem Jungen erwartet: ein richtiger Lausejunge zu sein, immer gerade dabei, etwas auszuhecken. Und meine Mutter fügt noch einen Schlüsselsatz hinzu: »Wir hatten viel Spaß.«
Spaß zu haben war etwas, das bei meiner Mutter immer ganz oben auf der Tagesordnung stand. Sie hat so viel Spaß wie nur möglich, aber was damit gemeint ist, lässt sich nur verstehen, wenn man eine Anpassung vornimmt, wenn man die große Kluft berücksichtigt, die dieser Satz überwinden muss, bevor er uns erreicht. Er kommt aus einer anderen Welt, die wie die Sterne, die ursprünglich das Licht aussandten, das wir oben am Himmel sehen, existieren mag oder auch längst verschwunden sein kann. Es ist möglich, die greifbaren Tatsachen dieser Welt zu rekonstruieren – die Möbel, die Kleidung, die Verzierungen am Kaminsims, die Krüge und Waschbecken und sogar die Nachttöpfe in den Schlafzimmern, aber nicht die Gefühle, zumindest nicht mit der gleichen Genauigkeit. So vieles von dem, was wir heute wissen und empfinden, ist mit jener anderen Welt nicht vereinbar.
Das war eine Welt, in der harmlose Flirts möglich waren, weil es viele Dinge gab, die brave Mädchen einfach nicht taten, und damals gab es weit mehr brave Mädchen als heutzutage. Nicht brav zu sein, bedeutete nicht nur den Verlust der Tugend: Sexualität hatte, jedenfalls bei Mädchen, finanzielle Folgen. Damals war das Leben fröhlicher und unschuldiger, aber gleichzeitig von Schuld und Schrecken durchdrungen, oder wenigstens fehlten, im ganz alltäglichen Geschehen, nicht die Gelegenheiten dazu. Es war wie das japanische Haiku: eine begrenzte Form mit festem Maß, in deren Innerem erstaunliche Freiheiten möglich waren.
Es gibt von meiner Mutter Fotos aus dieser Zeit, zusammen mit drei oder vier anderen Mädchen, mit untergehakten Armen oder wie sie sich ausgelassen gegenseitig die Arme um den Hals schlingen. Hinter ihnen, jenseits des Sees oder der Hügel oder was immer als Hintergrund dient, befindet sich eine Welt, die bereits in die Brüche geht und die sie nicht kennen: die Relativitätstheorie ist entdeckt, an den Wurzeln der Bäume bilden sich Säuren, die Ochsenfrösche sind dem Untergang geweiht. Aber sie lächeln auf eine Art, die man aus dieser Entfernung fast als Tapferkeit bezeichnen könnte, und ihr rechtes Bein ist wie in einer Parodie auf eine Tanzrevue nach vorn ausgestreckt.
Eines der höchsten Vergnügen für die Pensionärinnen und die Söhne der Familie war das Laientheater. In den Theaterstücken, die im Kirchenkeller aufgeführt wurden, traten oft junge Leute auf – man nannte sie »junge Leute«. Meine Mutter spielte regelmäßig mit. (Irgendwo im Haus habe ich einen ganzen Stapel mit den Stücken, vergilbte kleine Büchlein, in denen die Rollen meiner Mutter mit Bleistift angestrichen sind. Es sind alles Komödien, und alle sind unergründlich.) »Damals gab es noch kein Fernsehen«, sagt meine Mutter. »Da hat man sich selbst unterhalten.«
Für eines dieser Theaterstücke wurde eine Katze benötigt, und meine Mutter und einer der Söhne liehen sich die Familienkatze aus. Sie steckten sie in einen Leinenbeutel und fuhren zur Probe (inzwischen gab es Autos), und meine Mutter hatte die Katze auf dem Schoß. Die Katze, die sich gefürchtet haben muss, pinkelte ausgiebig, durch den Leinenbeutel hindurch und auf den Rock meiner Mutter. Außerdem breitete sich im Wagen ein erstaunlich übler Geruch aus.
»Ich wäre am liebsten im Boden versunken«, sagt meine Mutter. »Aber was konnte ich tun? Mir blieb nichts anderes übrig als still zu sitzen. Damals hat man solche Dinge« – sie meint Katzenpinkel oder jede Art Pinkel – »nicht erwähnt.« Sie meint, in gemischter Gesellschaft.
Ich stelle mir meine Mutter vor, wie sie durch die Nacht gefahren wird, mit tropfenden Röcken, voller Scham, während der junge Mann an ihrer Seite starr nach vorn blickt und so tut, als würde er nichts bemerken. Sie haben beide das Gefühl, dass dieser unaussprechliche Akt des Urinierens nicht der Katze zuzuschreiben ist, sondern meiner Mutter. Und so fahren sie weiter, immer geradeaus, über den Atlantik und die Erdkrümmung hinaus, und durch die Umlaufbahn des Mondes bis in die dunklen Weiten dahinter.
Jetzt, zurück auf der Erde, sagt meine Mutter: »Den Rock musste ich wegwerfen. Noch dazu ein guter Rock, aber der Geruch ging einfach nicht mehr raus.«
»Ich habe euren Vater nur ein Mal fluchen gehört«, sagt meine Mutter. Sie selbst flucht nie. Wenn sie an einer Geschichte zu einer Stelle kommt, an der Fluchen angebracht wäre, sagt sie »zum Kuckuck damit« oder »verflixt und zugenäht«.
»Das war, als er sich den Daumen gequetscht hat, beim Senken des Brunnens, für die Pumpe.« Ich weiß, dass sich diese Geschichte zugetragen hat, noch bevor ich auf die Welt kam, oben im Norden, wo unter den Bäumen und ihrem Laub nichts anderes ist als Sand und Felsgestein. Der Brunnen war für eine Handpumpe, die ihrerseits für die erste der vielen Hütten und Wohnungen dienen sollte, die meine Eltern gemeinsam bauten. Aber da ich bei späteren Brunnen zugesehen habe, die gesenkt wurden, und auch bei späteren Handpumpen, die eingebaut wurden, weiß ich, wie es gemacht wird. Man nimmt ein Rohr mit einer Spitze an dem einen Ende. Das schlägt man mit einem Hammer in den Boden, und während es immer tiefer eindringt, dreht man andere Rohrstücke oben drauf, bis man auf trinkbares Wasser stößt. Um das Gewinde am oberen Ende nicht zu beschädigen, hält man zwischen den Vorschlaghammer und das Rohr ein Stück Holz. Besser, man lässt es von jemandem halten. Auf diese Weise hat sich mein Vater nämlich den Daumen zerquetscht: Er hat beides selbst gemacht, gehalten und gehämmert.
»Er schwoll an wie ein Rettich«, sagt meine Mutter. »Er musste mit seinem Taschenmesser ein Loch in den Fingernagel machen, damit der Druck nachließ. Das Blut schoss heraus wie die Kerne aus einer Zitrone. Später wurde dann der ganze Nagel knallrot und schwarz und fiel ab. Zum Glück wuchs ein neuer nach. Es heißt, dass man nur zwei Mal eine Chance im Leben hat. Aber als er es tat, hat sich die Luft ringsherum meterweit blau gefärbt. Ich wusste gar nicht, dass er all diese Wörter kannte. Ich habe keine Ahnung, wo er sie herhatte.« Sie redet, als handle es sich bei diesen Wörtern um eine gefährliche ansteckende Krankheit, wie etwa die Windpocken.
Hier sieht mein Vater schüchtern auf seinen Teller. Für ihn gibt es zwei Welten: eine mit Damen, in der man bestimmte Ausdrücke nicht verwendet, und eine andere Welt, die aus Holzfällercamps und anderen Stätten seiner Kindheit und aus Zusammenkünften mit der richtigen Sorte Männer besteht, in der man es tut. Wenn man die Welt der Männer verbal in die der Damen hineinträgt, steht man als Flegel ohne Manieren da, wenn man aber die Damenwelt in die der Männer hineinträgt, ist man ein Snob oder vielleicht sogar ein Schwuler. So heißt das. Und jeder von ihnen weiß Bescheid.
Die Geschichte zeigt mehrere Dinge: erstens, dass mein Vater kein Schlappschwanz ist; und zweitens, dass sich meine Mutter richtig verhalten hat, indem sie sich auf angemessene Weise schockiert zeigte. Aber die Augen meiner Mutter glänzen vor Freude, wenn sie diese Geschichte erzählt. Insgeheim findet sie es komisch, meinen Vater ertappt zu haben, wenn auch nur dieses eine Mal. Der abgefallene Daumennagel selbst ist unbedeutend und längst vergessen.
Ein paar Geschichten gibt es, die meine Mutter nicht erzählt, wenn Männer dabei sind: niemals beim Essen, niemals auf Partys. Sie erzählt sie nur Frauen, gewöhnlich in der Küche, wenn wir oder sie ihr beim Abwaschen oder Erbsenpuhlen helfen, oder beim Abziehen von grünen Bohnen oder beim Hülsenschälen. Sie erzählt sie mit gesenkter Stimme, ohne mit den Händen in der Luft herumzufuchteln, und ohne Toneffekte. Es sind Geschichten von gebrochenen Liebesschwüren, ungewollten Schwangerschaften, allen möglichen schrecklichen Krankheiten, Ehebrüchen, Nervenzusammenbrüchen, tragischen Selbstmorden, unerfreulichen schleichenden Todesfällen. Sie sind nicht sehr reich an Einzelheiten oder ausgiebig mit Vorfällen und Episoden geschmückt: Es sind nackte Tatsachen. Die Frauen, deren Hände zwischen schmutzigem Geschirr oder Gemüseschalen stecken, nicken ernst.
Einige dieser Geschichten dürfen nicht an meinen Vater weitergegeben werden, weil sie ihn aufregen würden. Denn man weiß ja, dass Frauen mit diesen Dingen besser umgehen können als Männer. Männer sollten nichts erzählt bekommen, was sie als zu schmerzhaft empfinden könnten; die geheimen Tiefen der menschlichen Natur, die hässlichen materialistischen Dinge könnten sie übermannen und ihnen Schaden zufügen. So zum Beispiel fallen Männer oft beim Anblick ihres eigenen Bluts in Ohnmacht, weil sie nicht daran gewöhnt sind. Aus diesem Grund sollte man sich auch beim Blutspenden in der Rot-Kreuz-Klinik in der Schlange nie hinter einen Mann stellen. Aus irgendeinem geheimnisvollen Grund finden die Männer das Leben viel schwieriger als die Frauen. (Das glaubt meine Mutter trotz der gefangenen, kranken, verschwundenen oder verlassenen weiblichen Körper, die durch ihre Geschichten geistern.) Männern muss es erlaubt sein, in einem Sandkasten ihrer eigenen Wahl zu spielen, so glücklich wie sie nur können, ohne dabei gestört zu werden, weil sie sonst zu nörgeln anfangen und ihr Essen stehen lassen. Es gibt alle möglichen Dinge, die Männer einfach nicht verstehen können, weil sie nicht dafür geschaffen sind, warum es also von ihnen erwarten? Nicht alle teilen diese Meinung über Männer; trotzdem hat sie sich als nützlich erwiesen.
»Sie hat die Sträucher rings um das Haus ausgegraben«, sagt meine Mutter. Diese Geschichte handelt von einer zerbrochenen Ehe: eine ernste Angelegenheit. Die Augen meiner Mutter weiten sich. Die anderen Frauen beugen sich vor. »Das Einzige, was sie ihm ließ, waren die Duschvorhänge.« Es folgt ein gemeinsamer Seufzer, ein Ausstoßen von angehaltenem Atem. Mein Vater kommt in die Küche, wundert sich, wo der Tee bleibt, und die Frauen halten dicht, schenken ihm ihr falsches leeres Lächeln. Kurz darauf geht meine Mutter mit der Teekanne aus der Küche und stellt sie an ihren üblichen Platz auf dem Tisch.
»Ich erinnere mich noch daran, wie wir fast umgekommen wären«, sagt meine Mutter. So fangen viele ihrer Geschichten an. Wenn sie in einer ganz bestimmten Stimmung ist, sollen wir wissen, dass unser Leben nur durch eine Reihe erstaunlicher Zufälle und Glückssträhnen erhalten wurde; denn sonst wäre unsere gesamte Familie, jeder Einzelne oder alle zusammen, schon längst mausetot. Diese Geschichten erzeugen nicht nur Adrenalin, sondern bestärken uns auch in unserem Gefühl von Dankbarkeit. Das eine Mal, als wir im Nebel beinahe in einem Boot einen Wasserfall hinuntergestürzt wären; oder das andere Mal, als wir beinahe von einem Waldbrand eingeschlossen worden wären; oder als mein Vater direkt vor den Augen meiner Mutter beinahe von einem Dachbalken, den er an Ort und Stelle anbringen wollte, erschlagen worden wäre; oder als mein Bruder beinahe vom Blitz getroffen worden wäre, der so dicht an ihm vorbeischoss, dass er ihn zu Boden riss: »Man konnte ihn zischen hören«, sagt meine Mutter.
Und das ist die Geschichte von dem Heuwagen. »Euer Vater saß am Steuer«, sagt meine Mutter, »und fuhr genauso schnell wie sonst auch.« Zwischen den Zeilen lesen wir: zu schnell. »Ihr Kinder habt hinten gesessen.« Ich kann mich an diesen Tag erinnern, und so weiß ich auch, wie alt ich war und wie alt mein Bruder war. Wir waren alt genug, um Spaß daran zu haben, unseren Vater zu ärgern, indem wir populäre Lieder sangen, die er nicht mochte, wie etwa »Mockingbird Hill«; oder vielleicht imitierten wir auch Dudelsackmusik, indem wir uns die Nasen zuhielten und summten, während wir uns mit der Handkante gegen den Adamsapfel schlugen. Wenn wir ihm zu lästig wurden, sagte unser Vater immer: »Gebt endlich Ruhe.« Wir waren noch nicht alt genug, um zu wissen, dass er sich wirklich ärgern konnte: Wir glaubten, es sei auch nur ein Spiel.
»Wir fuhren gerade einen steilen Hügel hinunter«, fährt meine Mutter fort, »als unten ein Heuwagen einbog und quer über die Straße fuhr. Euer Vater trat auf die Bremse, aber es passierte nichts. Die Bremse fiel aus! Ich dachte, jetzt hätte unsere letzte Stunde geschlagen.« Zum Glück fuhr der Heuwagen weiter über die Straße, und wir schossen an ihm vorbei und verfehlten ihn nur um einen knappen halben Meter. »Mir blieb fast das Herz stehen«, sagt meine Mutter.
Ich erfuhr erst später, was geschehen war. Ich saß auf dem Rücksitz und spielte Dudelsackpfeife, ohne etwas zu bemerken. Das Bild war ganz genauso wie sonst auch immer bei unseren Autofahrten: Ich sah die Köpfe meiner Eltern, die über die Vordersitze ragten, von hinten. Mein Vater hatte seinen Hut auf, den er immer trug, damit ihm von den Bäumen nichts in die Haare fiel. Die Hand meiner Mutter ruhte leicht auf seinem Nacken.
»Ihr hattet einen so scharfen Geruchssinn, als ihr klein wart«, sagt meine Mutter.
Jetzt sind wir auf gefährlicherem Terrain: Die Kindheit meiner Mutter ist eine Sache, meine eigene etwas völlig anderes. Das ist der Moment, in dem ich anfange, mit dem Tafelsilber zu klappern, oder mir noch Tee einschenken lasse. »Ihr seid in Häuser marschiert, die euch fremd waren, und habt mit lauter Stimme gesagt: ›Was ist das für ein komischer Geruch?‹« Wenn Gäste da sind, rücken sie ein Stückchen von mir ab, werden sich ihrer eigenen Ausdünstungen bewusst, bemühen sich, nicht auf meine Nase zu sehen.
»Das war mir immer so peinlich«, sagt meine Mutter zerstreut. Dann wechselt sie das Thema. »Du warst so ein bequemes Kind. Du bist um sechs Uhr morgens aufgestanden und hast im Spielzimmer für dich allein gespielt, hast gesungen …« Es entsteht eine Pause. Eine ferne Stimme, meine, hoch und silbern, schwebt über den Raum hinweg, der uns trennt. »Du hast immer wie ein Buch geredet. Plapper, plapper, plapper, von morgens bis abends.« Meine Mutter seufzt unmerklich, als würde sie sich wundern, dass ich so still geworden bin, und steht auf, um im Feuer zu stochern.
In der Hoffnung, das Thema zu wechseln, frage ich, ob die Krokusse schon heraus sind oder nicht, aber sie lässt sich nicht ablenken. »Ich brauchte dich nie zu schlagen«, sagt sie. »Ein strenges Wort, und du warst wieder brav.« Sie sieht mich von der Seite an; sie ist sich nicht sicher, in was ich mich verwandelt habe, oder wie. »Es gab da nur ein oder zwei Ausnahmen. Einmal, als ich weg musste und dein Vater auf euch aufpassen sollte.« (Vielleicht ist das der eigentliche Punkt der Geschichte: die Unfähigkeit von Männern, kleine Kinder zu behüten.) »Ich kam die Straße entlang, und da wart ihr, du und dein Bruder, gerade dabei, oben aus dem Fenster im ersten Stock einen alten Mann mit Erdklumpen zu bewerfen.«
Wir wussten beide, wessen Idee das war. Für meine Mutter ist die richtige Auslegung dieses Vorfalls, dass mein Bruder immer Unfug im Kopf hatte und dass ich sein Schatten war, »leicht zu beeinflussen«, wie meine Mutter es auszudrücken beliebt. »Du warst Wachs in seinen Händen.«
»Natürlich musste ich euch beiden die gleiche Strafe geben«, sagt sie. Natürlich. Ich setze ein verzeihendes Lächeln auf. Aber in Wahrheit war ich viel gerissener als mein Bruder und ließ mich nur nicht so oft erwischen. Angriffe auf feindliche Maschinengewehrnester aus der vordersten Linie gab es bei mir nicht, wenn es sich vermeiden ließ. Meine einsamen hinterhältigen Taten spielten sich im Verborgenen ab, und nur in der gemeinsamen Attacke mit meinem Bruder warf ich jede Vorsicht über Bord.
»Er konnte dich um seinen kleinen Finger wickeln«, sagt meine Mutter. »Euer Vater hatte für jeden von euch eine Spielzeugkiste gemacht, und es galt die Regel –« (meine Mutter ist gut im Aufstellen von Regeln) »– die Regel, dass keiner das Spielzeug aus der Spielzeugkiste des anderen nehmen durfte, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Denn sonst hätte er dir dein ganzes Spielzeug weggenommen. Aber er hat es auch so bekommen, weißt du. Er hat dich immer überredet, mit ihm Mutter und Kind zu spielen, und dann hat er so getan, als wäre er das Baby. Und dann hat er so getan, als würde er weinen, und wenn du ihn gefragt hast, was er denn will, dann hat er immer etwas aus deiner Spielzeugkiste verlangt, womit er gerade spielen wollte. Und du hast es ihm immer gegeben.«
Daran kann ich mich nicht erinnern, auch wenn ich mich daran erinnere, wie wir auf dem Fußboden im Wohnzimmer den Zweiten Weltkrieg gespielt haben, mit Stoffbären und Stoffhasen als Armee; aber ganz sicher wurden damals einige grundsätzliche Muster festgelegt. Haben mich diese ersten Spielzeugkistenerfahrungen – und »Spielzeugkiste« selbst, als Konzept, ist voller Implikationen –, haben die mich gegenüber Männern, die bemuttert werden wollen, misstrauisch, aber gleichzeitig auch zugänglich gemacht? Hat man mich konditioniert, zu glauben, dass sie, wenn ich nicht um sie besorgt bin, wenn ich nicht für sie verfügbar bin, wenn ich nicht ein unerschöpfliches Füllhorn unterhaltsamer Freuden bin, ihre Sammlung mit Milchflaschenverschlüssen und ihre räudigen einohrigen Teddybären zusammenpacken und allein in die Wälder ziehen werden, um Scharfschütze zu spielen? Wahrscheinlich. Was meine Mutter nur für niedlich gehalten hat, könnte tödlich gewesen sein.
Aber das ist nicht ihre einzige Geschichte über meine Einfältigkeit und meine Leichtgläubigkeit. Sie wartet noch mit dem coup de grâce auf, der Geschichte von den Häschenplätzchen.
»Es war in Ottawa. Ich hatte eine Einladung zu einem Regierungstee«, sagt meine Mutter, und allein diese Tatsache sollte ein Element des Schreckens ankündigen: Meine Mutter hasste offizielle Veranstaltungen, zu denen sie aber gezwungenermaßen gehen musste, weil sie die Frau eines Beamten im öffentlichen Dienst war. »Ich musste euch Kinder mit dorthin schleppen; wir konnten uns damals nicht sehr oft einen Babysitter leisten.« Die Gastgeberin hatte einen ganzen Teller mit verzierten Plätzchen parat, falls Kinder kamen, und meine Mutter geht jetzt daran, sie zu beschreiben: wunderbare Plätzchen in der Form von Häschen, mit Gesichtern und Kleidern aus buntem Zuckerguss, kleine Röckchen für die kleinen Hasenmädchen, kleine Höschen für die kleinen Hasenjungen.
»Du hast dir eins ausgesucht«, sagt meine Mutter. »Du bist damit in die Ecke gegangen, ganz allein. Frau X sah dich und ging zu dir. ›Willst du dein Plätzchen denn nicht essen?‹, sagte sie. ›O nein‹, sagtest du. ›Ich will nur hier sitzen und mit ihm reden.‹ Und da saßest du, wunschlos glücklich. Aber jemand hatte den Fehler begangen, den Plätzchenteller dicht bei deinem Bruder stehen zu lassen. Als sie das nächste Mal hinsahen, war kein einziges Plätzchen mehr übrig. Er hatte alle aufgegessen. An dem Abend war ihm vielleicht schlecht, sage ich euch.«
Manche Geschichten meiner Mutter trotzen einer Analyse. Was zum Beispiel ist die Moral von dieser? Dass ich ein Einfaltspinsel war, ist klar genug, aber andererseits kriegte mein Bruder die Bauchschmerzen. Ist es besser, wenn man sein Essen auf eine direkte materialistische Art vertilgt, und so viel, wie es nur geht, oder wenn man sich in eine Ecke setzt und mit ihm redet? Das ist immer eine Lieblingsgeschichte meiner Mutter gewesen: als ich noch nicht verheiratet war und wenn ich einen »Liebhaber«, wie mein Vater sich ausdrückte, zum Essen mit nach Hause brachte. Spätestens zur Nachspeise kam die Geschichte von den Hasenplätzchen auf den Tisch, und ich drehte und wendete meinen Löffel, während meine Mutter munter draufloserzählte. Was sollten sich die Liebhaber eigentlich dabei denken? Wurde meine Freundlichkeit und reine Weiblichkeit vor ihnen ausgerollt, damit sie sie besichtigen konnten? Wurde ihnen auf umständliche Art mitgeteilt, dass ich harmlos war, dass sie erwarten konnten, von mir angesprochen, aber nicht vernichtet zu werden? Oder wollte sie sie irgendwie vor mir warnen? Weil ich mich vielleicht etwas verrückt benehme, ein bisschen wie jemand, von dem man erwartet, dass er plötzlich vom Esstisch aufspringt und schreit: »Esst es nicht! Es lebt!«
Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen Symbolhaftem und Anekdotischem. Wenn ich meiner Mutter zuhöre, muss ich manchmal daran denken.
»In meinem nächsten Leben«, hat meine Mutter einmal gesagt, »werde ich ein Archäologe sein und herumfahren und Dinge ausgraben.« Wir saßen auf dem Bett, das früher meinem Bruder, dann mir, dann meiner Schwester gehört hatte; wir sortierten die Sachen aus einer der Truhen und entschieden, was wir jetzt weggeben oder wegwerfen konnten. Meine Mutter glaubt, was man von seiner Vergangenheit bewahren möchte, sei hauptsächlich eine Frage der Wahl.
Zu diesem Zeitpunkt war in der Familie irgendetwas nicht in Ordnung, irgendjemand war nicht glücklich. Meine Mutter war zornig: ihr Frohsinn zahlte sich nicht aus.
Diese Erklärung von ihr erschreckte mich. Es war das erste Mal, dass ich meine Mutter sagen hörte, sie wäre vielleicht lieber etwas anderes gewesen als das, was sie war. Ich muss damals ungefähr fünfunddreißig gewesen sein, aber es kam mir noch immer schockierend und ein wenig anstößig vor, zu erfahren, dass meine Mutter mit der Rolle, die ihr das Schicksal zugedacht hatte, vielleicht nicht gänzlich zufrieden war: mit der Rolle, meine Mutter zu sein. Was für Daumenlutscher wir doch alle sind, wenn es um Mütter geht, dachte ich.
Kurz darauf wurde ich selber Mutter, und von diesem Augenblick an wurde alles anders.
Während meine Mutter meine fast unmöglichen Haare kämmte, sie über ihren langen Zeigefinger wickelte, mit einem Ruck die Böcke herausriss, las sie mir immer Geschichten vor. Die meisten sind noch irgendwo im Haus, aber eine ist verschwunden. Vielleicht war es ein Buch aus der Bücherei. Die Geschichte handelte von einem kleinen Mädchen, das war so arm, dass es für das Abendessen nur eine Kartoffel übrig hatte, und während es sie briet, stand die Kartoffel auf und lief weg. Es gab die übliche Verfolgungsjagd, aber an das Ende kann ich mich nicht erinnern: eine bedeutsame Lücke.
»Das war eine deiner Lieblingsgeschichten«, sagt meine Mutter. Wahrscheinlich hat sie noch immer den Eindruck, dass ich mich mit dem kleinen Mädchen identifizierte, mit seinem Hunger und dem Gefühl von Verlust; während ich mich in Wirklichkeit mit der Kartoffel identifizierte.
Frühe Einflüsse sind wichtig. Dieser brauchte eine Weile, bis er sich zu zeigen begann; vielleicht erst als ich auf die Universität ging und anfing, schwarze Strümpfe zu tragen und mein Haar nach hinten in einem Knoten zusammenzubinden und Ansprüche zu haben. Trübsinn machte sich breit. Unsere Nachbarin, die auf schöne Kleidung bedacht war, setzte meiner Mutter zu: »›Wenn sie doch nur etwas für sich tun würde‹«, zitiert meine Mutter, »›sie könnte so hübsch aussehen.‹«
»Du warst immer so beschäftigt«, sagt meine Mutter nachsichtig, wenn sie von dieser Zeit spricht. »Du hattest immer den Kopf voll. Das eine oder andere Projekt.«
Es gehört zu den Mythen meiner Mutter, dass ich genauso fröhlich und produktiv bin wie sie, obwohl sie zugibt, dass diese Eigenschaften gelegentlich und vorübergehend verborgen sein können. Viele Ängste waren mir nicht erlaubt im Haus. Ich musste mich ihnen im Keller hingeben, wo mich meine Mutter nicht beim Brüten aufstöbern und mir empfehlen würde, einen Spaziergang zu machen, etwas für meinen Kreislauf zu tun. Das war ihre Antwort auf jedes noch so kleine Anzeichen einer schleichenden Mutlosigkeit. Es gab nicht viel, was ein flotter Sprint durch tote Blätter, heulende Winde oder Hagelkörner nicht hätte heilen können.
Ich wusste, es war der Zeitgeist, der mir zu schaffen machte und gegen den diese einfachen Mittel machtlos waren. Wie Nebel schwebte ich durch ihre Tage und verbreitete Dumpfheit um mich herum. Ich las moderne Gedichte und Berichte von den Gräueltaten der Nazis und trank Kaffee. In weiter Ferne fuhr meine Mutter mit dem Staubsauger um meine Füße herum, während ich in Sesseln saß, studierte, in Autodecken gehüllt, weil mir plötzlich immer kalt war.
Meine Mutter hat wenig Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen. Ich erinnere mich nur an den seltsamen Blick, den ich manchmal in ihren Augen entdeckte. Und zum ersten Mal in meinem Leben fuhr es mir durch den Kopf, dass meine Mutter vielleicht Angst vor mir hatte. Ich konnte sie nicht einmal beruhigen, weil ich mir über die Art ihres Kummers nur verschwommen bewusst war, aber es muss etwas in mir vorgegangen sein, das für sie nicht fassbar war: In jedem Augenblick konnte ich den Mund aufmachen und etwas in einer Sprache von mir geben, die sie noch nie gehört hatte. Ich war zu einem Besucher aus dem Weltraum geworden, ein Zeitreisender, der aus der Zukunft zurückkehrt und die Nachricht von einem großen Unglück überbringt.
Hurrikan Hazel
In dem Sommer, als ich vierzehn war, lebten wir auf einem hundert Morgen großen, wieder freigegebenen verkümmerten Stück Ackerland in einer Hütte mit nur einem Raum. Die Hütte war von hohen alten Ahornbäumen umgeben, die dort stehen geblieben waren, als das Land gerodet wurde, und das Licht fiel in Strahlen ein, wie auf diesen Bildern, die ich lange davor in der Sonntagsschule gesehen hatte – Bilder von Rittern, die ohne Helm und mit nach oben gerollten Augen den Heiligen Gral suchten. Wahrscheinlich hatten meine Eltern das Land nur wegen dieser Bäume gekauft: Hätten sie es nicht getan, hätte es jemand anders gekauft und die Ahornbäume veräußert. Solche Dinge pflegten meine Eltern stets zu tun.
Die Hütte war aus Kanthölzern gebaut. Ursprünglich war sie nicht an dieser Stelle errichtet worden, sondern von den Leuten, zwei High-School-Lehrern, die sich für Antiquitäten interessierten und vor uns dort gewohnt hatten, von irgendwo anders dorthin gebracht worden. Die Holzbalken waren nummeriert, dann auseinander genommen und in ihrer ursprünglichen Anordnung wieder zusammengesetzt worden, und die Ritzen waren aufs Neue mit weißem Zement abgedichtet worden, der aber an manchen Stellen schon wieder herauszufallen begann, genauso wie der Kitt an den kleinen Fensterrahmen. Das weiß ich, weil es zu einem meiner ersten Jobs gehörte, sie abzuwaschen. Ich verrichtete diese Arbeit nur sehr widerwillig, ebenso wie die meisten anderen Jobs im Haus, die ich damals zu verrichten gezwungen war.
In dem einen Teil des Zimmers schliefen wir. Der Schlafbereich war durch Fallschirme abgetrennt, die mein Vater in dem Laden für Armeerestbestände erstanden hatte, wo er häufig einkaufte: khakifarbene Hosen mit Taschen an den Knien, Messer, Gabeln und Löffel, aneinander befestigt und ausklappbar, Bestecke, mit denen man unmöglich essen konnte, Regenumhänge in Tarnfarben, eine Dschungelhängematte mit Moskitonetzen an den Seiten, die wie Arbeitssocken von innen roch und von der man ein steifes Genick bekam, um die mein Bruder und ich uns aber dennoch stritten, um darin zu schlafen. Die Fallschirme waren auseinander geschnitten und hingen wie Vorhänge von dicken Drähten, die von einer Wand zur anderen gespannt waren. Die Fallschirme im Haus waren dunkelgrün, aber draußen war ein kleinerer, orangefarbener für meine dreijährige Schwester als Zelt zum Spielen aufgestellt.
Ich hatte die Zelle in der Südostecke. Dort schlief ich auf einem schmalen Bett mit Stahlfedern, die jedes Mal quietschten, wenn ich mich umdrehte. Auf der anderen Seite der Hütte, im Wohnteil, standen ein Tisch mit geplatztem Lack und mehrere schon öfters gestrichene Stühle, deren Farbe wie getrocknete Schmutzflecken aufgesprungen war, so dass die darunter liegenden Farben, die früher benutzt worden waren, zum Vorschein kamen. Es gab einen Geschirrschrank mit Tellern, der noch muffiger roch als alle anderen Sachen in der Hütte, und zwei Schaukelstühle, die auf dem unebenen Dielenboden nicht besonders gut schaukelten. All diese Möbelstücke waren in der Hütte, als wir sie kauften; wahrscheinlich entsprachen sie der Vorstellung, die die Lehrer von einem pionierhaften Dekor hatten.
Dann gab es noch eine Art Tresen, auf dem meine Mutter das Geschirr abwusch und den Primuskocher aufbewahrte, den sie bei Regen benutzte. Sonst kochte sie immer im Freien, auf einer Feuerstelle mit einem Eisenrost. Wenn wir draußen aßen, benutzten wir keine Stühle, sondern setzten uns auf Holzblöcke, weil der Boden feucht war. Die Hütte lag in einem Flusstal; bei Nacht herrschte starker Tau, und die morgendliche Wärme des Sonnenlichts erzeugte einen fast sichtbaren Dampf.
Mein Vater hatte uns am Anfang des Sommers in die Hütte gebracht. Dann war er zum Nordufer des St.-Lawrence-Stroms aufgebrochen, um dort in den Wäldern für eine Papierfabrik Untersuchungen durchzuführen. Diese ganze Zeit über gingen wir unserer täglichen Routine nach, die sich hauptsächlich um die Mahlzeiten drehte und was es dabei zu essen gab, während er in Buschflugzeugen in Täler flog, deren Wände so steil waren, dass der Pilot den Motor drosseln musste, um überhaupt bis an ihre Sohle zu gelangen, oder an großen Felsausläufern vorbei mühsam über Portagen kletterte oder von reißenden Stromschnellen beinahe mitgerissen wurde. Zwei Wochen lang war er von einem Waldbrand umzingelt, der ihn von allen Seiten umgab, und konnte sich nur mit Hilfe wildbachartiger Regenfälle retten, während denen er in seinem Zelt saß und seine Ersatzsocken wie zwei Wiener am Feuer röstete, damit sie trocken wurden. Das waren die Geschichten, die wir zu hören bekamen, wenn er wieder heil zurück war.
Bevor mein Vater loszog, stellte er sicher, dass genügend Holz gespalten und aufgestapelt war und wir genügend Vorräte und Dosennahrung im Haus hatten, um über die Runden zu kommen. Wenn wir andere Dinge wie Milch und Butter benötigten, wurde ich zu Fuß zum nächsten Laden geschickt, der anderthalb Meilen entfernt auf einem steilen Berg lag, aus dem später ein Skigebiet gemacht wurde. Damals gab es dort nur eine ungepflasterte Straße mitten im Nirgendwo, wie es mir vorkam, über der jedes Mal, wenn ein Auto darüber hinwegfuhr, Staubwolken aufwirbelten. Manchmal hupten die Autos, aber ich tat so, als würde ich es nicht bemerken.
Die Frau in dem Laden, die fett war und ständig von Schweiß triefte, interessierte sich für uns; sie versäumte niemals zu fragen, wie meine Mutter zurechtkäme. Ob es ihr denn gar nichts ausmachte – ganz allein in der heruntergekommenen Hütte zu leben, ohne einen richtigen Ofen und ohne einen Mann? Für sie war beides gleichbedeutend. Ich hasste es, ausgefragt zu werden, aber ich befand mich in einem Alter, wo für mich jede Meinung zählte, und ich begriff, dass ihr meine Mutter komisch vorkam.
Hätte meine Mutter etwas dagegen einzuwenden gehabt, mit einem dreijährigen Kind, ohne Telefon, ohne Auto, ohne Strom, allein mit mir, auf einer einsamen Farm zurückgelassen zu werden, so verlor sie jedenfalls kein Wort darüber. In dieser Situation hatte sie sich schon öfters befunden, und inzwischen musste sie sich wohl daran gewöhnt haben. Was immer geschah, behandelte sie als etwas Normales; in Krisensituationen, wenn etwa das Auto bis zur Achse im Schlamm feststeckte, stimmte sie ein Lied an und forderte uns auf, mitzusingen.
In jenem Sommer hat sie meinen Vater wahrscheinlich vermisst, obwohl sie es nie zugegeben hätte; in unserer Familie sprach man nicht über Gefühle. An den Abenden schrieb sie manchmal Briefe, obwohl sie behauptete, ihr fiele nie ein, was sie schreiben sollte. Tagsüber, wenn sie nicht gerade kochte oder das Geschirr abwusch, verrichtete sie kleinere Arbeiten, die sie jederzeit unterbrechen konnte. Sie schnitt das Gras, obwohl der unebene Fleck vor dem Haus mit Unkraut überwachsen war und keine Anstrengung der Welt ihn dazu bringen würde, wie ein Stück Rasen auszusehen; oder sie sammelte die Zweige unter den Ahornbäumen auf.
Vormittags passte ich immer ein paar Stunden auf meine kleine Schwester auf: Das gehörte zu meinen Aufgaben. Dann zog sich meine Mutter manchmal einen Schaukelstuhl auf die holprige Grasfläche und las Bücher, historische Romane oder Berichte über archäologische Expeditionen. Wenn ich mich ihr von hinten näherte und etwas zu ihr sagte, während sie las, schrie sie. Wenn die Sonne schien, trug sie Shorts, die sie niemals anzog, wenn Leute in der Nähe waren. Sie glaubte, dass ihre Knie zu knochig wären; das war das Einzige an ihrem Äußeren, dessen sie sich bewusst schien. Im Allgemeinen kümmerte sie sich nicht um ihre Kleidung. Sie sollte nur bedecken, was zu bedecken war, und nicht kaputtgehen, mehr erwartete sie nicht von ihr.
Wenn ich mich nicht gerade um meine Schwester kümmerte, ging ich allein irgendwohin. Ich kletterte auf einen Ahornbaum, der vom Haus aus nicht zu sehen war und ein paar bequem gegabelte Äste hatte, und las Die Sturmhöhe; oder ich ging den alten Holzweg entlang, auf dem jetzt junge Bäume nachwuchsen. Ich kannte mich zwischen dem Gestrüpp aus Unkraut und Dornen da draußen gut aus, und ich war auch schon durch den Fluss zu dem freien Feld auf der anderen Seite gegangen, auf dem unser Nachbar seine Kühe weiden durfte, um die Disteln und Kletten in Schach zu halten. Dort hatte ich auch das Pionierhaus gefunden, das echte, wie ich glaubte, obwohl es nicht viel mehr war als eine viereckige Vertiefung mit grasüberwucherten Rändern. Im ersten Jahr hatte dieser Mann einen Scheffel Erbsen gepflanzt und einen Scheffel voll geerntet. Das wussten wir von den Schullehrern, die es in überlieferten Aufzeichnungen nachgelesen hatten.
Hätte mein Bruder diese Entdeckung gemacht, würde er davon eine Karte gezeichnet haben. Er hätte eine Karte von dem ganzen Gebiet gezeichnet und alles säuberlich eingetragen. Ich unternahm nicht einmal den Versuch; stattdessen wanderte ich nur so herum, pflückte Himbeeren und Brombeeren oder sonnte mich in den hohen Kräutern, eingehüllt in den Geruch von Wolfsmilchgewächsen und Gänseblümchen und zertretenen Blättern, ganz schwindlig von der Sonne und dem Licht, das sich in den weißen Seiten meines Buchs spiegelte, während Heuschrecken auf mir landeten und Spuren ihres braunen Speichels hinterließen.
Meiner Mutter gegenüber war ich grob und widerspenstig, auch wenn ich, allein gelassen, faul und ziellos war. Es bedeutete schon eine große Anstrengung für mich, die Hände zu heben, um die Heuschrecken fortzuscheuchen. Ich schien mich immer im Halbschlaf zu befinden. Ich redete mir ein, etwas tun zu wollen; damit meinte ich etwas, mit dem man, irgendwo anders, Geld verdienen könnte. Ich wollte einen Sommerjob, aber ich war noch nicht alt genug dafür.
Mein Bruder hatte einen Job. Er war zwei Jahre älter als ich und war jetzt ein Junior Ranger, der irgendwo im Norden Ontarios neben den Highways das Gestrüpp schnitt und mit einem ganzen Trupp anderer sechzehnjähriger Jungen in Zelten hauste. Es war sein erster Sommer, den er fern von uns verbrachte. Ich litt unter seiner Abwesenheit und beneidete ihn, aber ich wartete jeden Tag auf seine Briefe. Die Post wurde von einer Frau gebracht, die auf einer nahe gelegenen Farm wohnte; sie fuhr sie in ihrem eigenen Auto aus. Wenn sie etwas für uns hatte, hupte sie, und ich ging nach draußen, zu dem staubigen verzinkten Briefkasten, der neben unserem Tor auf einem Pfosten angebracht war.
Mein Bruder schrieb an meine Mutter und auch an mich Briefe. Die an sie gerichteten waren informativ, anschaulich, genau. Er erzählte, was er tat, was sie aßen, wo sie ihre Wäsche wuschen. Er erzählte, dass die Stadt in der Nähe des Camps eine Hauptstraße hatte, die nur Telefondrähte vorzuweisen hatte. Meine Mutter war über diese Briefe sehr erfreut und las sie mir laut vor.
Ich las ihr die Briefe, die ich von meinem Bruder erhielt, nicht laut vor. Sie waren privat und enthielten die gleichen erheiternden und vulgären Kommentare, in denen wir oft schwelgten, wenn wir unter uns waren. Anderen Leuten erschienen wir ernst und aufmerksam, aber wenn wir allein waren, machten wir uns ohne Erbarmen über alles lustig, übertrafen uns gegenseitig mit allen möglichen empörenden Details. Die Briefe meines Bruders waren mit Zeichnungen seiner Zeltgefährten illustriert, auf deren Köpfen vielfüßige Käfer herumsprangen und die Flecken im Gesicht hatten und Wellenlinien um die Füße, die auf den Geruch hindeuteten, den ihre Füße verbreiteten, und mit Apfelkernen in dem Bart, den sich alle zuzulegen suchten. Er fügte unappetitliche Details über ihre persönlichen Gewohnheiten hinzu, zum Beispiel das Schnarchen. Ich nahm diese Briefe aus dem Postkasten und ging damit direkt zu dem Ahornbaum, wo ich sie mehrmals las. Dann schmuggelte ich sie unter meinem T-Shirt in die Hütte und versteckte sie unter meinem Bett.
Ich bekam auch noch andere Briefe, von meinem Freund, der Buddy hieß. Mein Bruder benutzte einen Füllfederhalter; Buddys Briefe waren mit einem blauen Kugelschreiber geschrieben, von der Art, die klecksen und schmutzige Fasern auf dem Papier hinterlassen, die an meinen Fingern kleben blieben. Die Briefe enthielten plumpe Komplimente, wie die von den Onkeln anderer Leute: Viele Wörter standen zwischen Anführungszeichen, andere waren unterstrichen. Bilder gab es keine.
Ich freute mich über diese Briefe von Buddy, aber sie waren mir auch peinlich. Das Schlimme war, dass ich wusste, was mein Bruder über Buddy sagen würde, zum Teil auch deshalb, weil er schon einiges davon gesagt hatte. Er redete, als wäre es sowohl für ihn als auch für mich selbstverständlich, dass ich mich Buddys bald entledigen würde, als wäre Buddy ein streunender Hund, den ich der Human Society übergeben musste, falls sein Besitzer nicht gefunden wurde. Sogar Buddys Name klang wie der eines Hundes, sagte mein Bruder. Er sagte, ich sollte Buddy »Pal« oder »Sport« rufen und ihm das Apportieren beibringen.
Ich fand die Art und Weise, wie sich mein Bruder über Buddy ausließ, komisch, aber auch grausam: komisch, weil er in gewisser Hinsicht Recht hatte, und grausam aus genau dem gleichen Grund. Es stimmte, dass Buddy Ähnlichkeit mit einem Hund besaß: die Freundlichkeit, die einfältige Treue seiner Augen, die Beflissenheit, mit der er dem Ritual der Verabredungen folgte. Er war ein Junge, der (obwohl ich es nie mit Sicherheit herausgefunden habe, weil ich es nie gesehen habe) seiner Mutter die Einkaufstüten abnahm, ohne dass sie ihn dazu auffordern musste, nicht weil ihm danach war, sondern einfach, weil es sich so gehörte. Er sagte Dinge wie: »Auf diese Weise wird ein Plätzchen zu Krümeln«, und als er es sagte, hatte ich das Gefühl, dass er es vierzig Jahre später auch noch sagen würde.