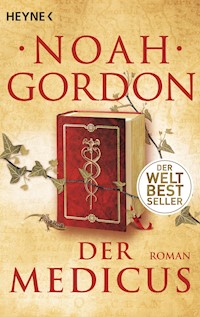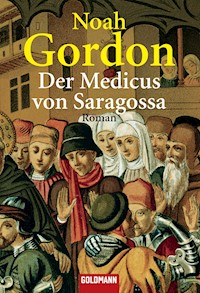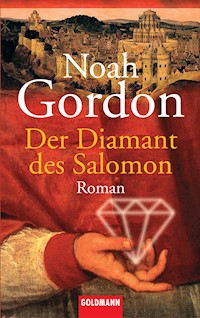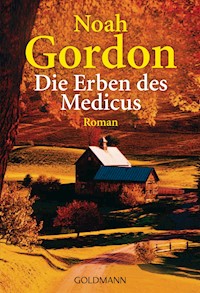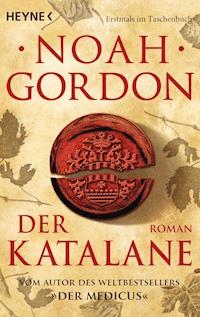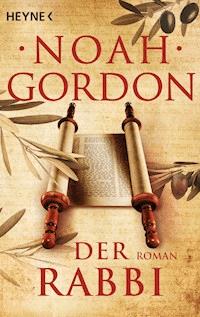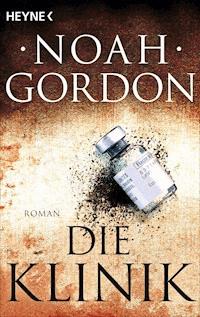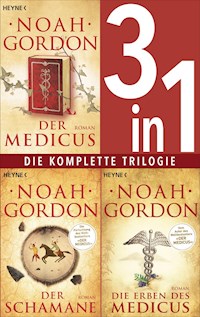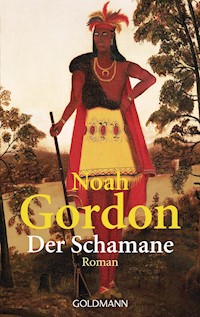
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blessing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Medicus-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Als Nachfahre des legendären Medicus will Rob J. Cole seine medizinische Laufbahn in der Neuen Welt beginnen. Nach ersten Erfahrungen als Armenarzt in Boston lässt er sich am Mississippi als Landarzt nieder. Eine indianische Schamanin weiht ihn dort in ihr Wissen über die heilenden Kräfte der Natur ein. Doch schon bald wird das ruhige Leben am Fluss vom beginnenden Bürgerkrieg erschüttert.
Bester historischer Roman des Jahres - der SPIEGEL-Bestseller jetzt exklusiv bei Goldmann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1045
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Buch
Rob J. Cole, ein Nachfahre des berühmten Medicus, muß seine Heimat Schottland verlassen und versucht, sich in der Neuen Welt eine Existenz aufzubauen. Um sich der Familientradition gemäß als Schafzüchter und Landarzt niederzulassen, erwirbt er im Tal des Mississippi mit jüdischen Freunden Land: Land, das früher den Indianern vom Stamm der Sauks gehörte. Die Sauks haben ihr Reservat verlassen und fristen ihr Dasein nur noch als widerwillig geduldete Minderheit. Für Cole aber wird die Begegnung mit den Indianern entscheidend: Er behandelt und pflegt die Kranken unter ihnen und wird so ihr »weißer Schamane«. Aber auch Cole lernt von den Indianern. Makwa-ikwa, die Priesterin und Medizinfrau der Sauks, vermittelt dem »weißen Schamanen« nicht nur wertvolles Wissen über die heilenden Kräfte der Natur, sie wird ihm auch eine unentbehrliche Helferin. Eines Tages begegnet Cole der Einsiedlerin Sarah, die fürchtet, bald sterben zu müssen. Cole rettet sie, und die beiden kommen sich rasch näher. Sie heiraten und bekommen einen Sohn, den Makwa »kleiner Schamane« nennt. Als er jedoch im Alter von fünf Jahren an Scharlach erkrankt, verliert Coles Sohn sein Gehör. Dennoch will der »kleine Schamane« in die Fußstapfen seines Vaters treten und Arzt werden. Doch dann wird Makwa brutal ermordet, und der beginnende Bürgerkrieg erschüttert das geordnete Leben der Arztfamilie und ihrer jüdischen Nachbarn …
Autor
Noah Gordon, 1926 in Worcester, Massachusetts, geboren, arbeitete lange Jahre als Journalist beim »Boston Herald«, bevor er mit seinem ersten Roman »Der Rabbi« den Durchbruch als Schriftsteller erlebte. Mit »Der Medicus« gelang ihm ein Weltbestseller, der auch in Deutschland viele Monate auf der Bestsellerliste stand. Noah Gordon hat drei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau in der Nähe von Boston.
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch ist in LiebeLorraine Gordon, Irving Cooper,Cis und Ed Plotkin, Charlie Ritzund in liebendem GedenkenIsa Ritz gewidmet.
Erster Teil
Die Heimkehr
22. April 1864
Jiggety-Jig
Die Spirit of Des Moines schickte ihr Signal voraus, als sie sich in der morgendlichen Kühle dem Bahnhof von Cincinnati näherte. Shaman spürte zuerst ein schwaches, kaum wahrnehmbares Vibrieren des hölzernen Bahnsteigs, dann ein deutliches Zittern und schließlich eine kräftige Erschütterung. Plötzlich war das Ungetüm da mit seinem Geruch nach heißem, öligem Metall und Dampf. Im fahlgrauen Zwielicht brauste es auf ihn zu, Messingarmaturen glänzten auf dem schwarzen Drachenkörper, mächtige Kolbenarme bewegten sich rhythmisch, und eine helle Rauchwolke stieg himmelwärts wie die Fontäne eines Wals und löste sich schließlich in zerfasernde Fetzen auf, als die Lokomotive langsam zum Stehen kam.
Im dritten Waggon waren nur noch wenige der harten, hölzernen Sitzplätze frei, und er nahm auf einem von ihnen Platz, während der Zug erzitterte und wieder anfuhr. Züge waren noch immer etwas Neues, aber sie bedeuteten auch, daß man mit zu vielen Leuten reisen mußte. Er zog es vor, allein und gedankenverloren auf einem Pferd zu reiten. Der lange Waggon war brechend voll mit Soldaten, Handlungsreisenden, Farmern und Frauen, von denen einige kleine Kinder dabeihatten. Das Kindergeschrei störte ihn überhaupt nicht, aber der Waggon roch nach einer Mischung aus säuerlich stinkenden Socken, dreckigen Windeln, schlechter Verdauung, verschwitzten, ungewaschenen Körpern und dem Mief von Zigaretten und Pfeifen. Das Fenster schien als Kraftprobe gedacht zu sein, aber Shaman war groß und stark, und es gelang ihm, es zu öffnen, was sich allerdings schnell als Fehler herausstellen sollte. Die mächtige Lokomotive drei Waggons weiter vorne stieß nicht nur Rauch, sondern auch ein Gemisch aus Ruß, glimmenden oder erloschenen Kohlestückchen und Asche aus, das der Fahrtwind nach hinten und zum Teil auch durch das offene Fenster in das Abteil wehte. Bald hatte ein glühender Funke in Shamans neues Jackett ein Loch gebrannt. Hustend und verärgert murmelnd stieß er das Fenster wieder zu und klopfte seine Jacke ab, bis der Funke erloschen war.
Eine Frau auf der anderen Seite des Mittelgangs sah ihm zu und lächelte. Sie war etwa zehn Jahre älter als er und modisch, aber für die Reise praktisch gekleidet. Ihr graues Wollkostüm hatte einen lose fallenden Rock ohne Reifen und war von Paspeln aus blauem Leinen eingefaßt, die das Blond ihrer Haare betonten. Die Augen der beiden trafen sich einen Augenblick lang, doch dann konzentrierte sich die Frau wieder auf das Handarbeitsschiffchen in ihrem Schoß. Shaman wandte sich ohne Bedauern von ihr ab; die Trauer war nicht die rechte Zeit für das Spiel zwischen Männern und Frauen.
Er hatte sich ein wichtiges Buch zum Lesen mitgenommen, doch sosehr er auch versuchte, sich darin zu vertiefen, seine Gedanken wanderten immer wieder zu Pa.
Der Schaffner hatte sich im Mittelgang bis zur Bank hinter Shaman vorgearbeitet; doch er bemerkte ihn erst, als der Mann ihm die Hand auf die Schulter legte. Er schreckte hoch und starrte in ein gerötetes Gesicht. Der Schnauzbart des Schaffners endete in zwei gewachsten Spitzen, und sein ergrauender rötlicher Kinn- und Backenbart gefiel Shaman, weil er den Mund frei ließ. »Sind wohl taub«, sagte der Mann gutmütig. »Ich hab’ Sie schon dreimal nach Ihrer Fahrkarte gefragt, Sir.«
Shaman lächelte ihn ohne Verlegenheit an, denn so etwas passierte ihm immer und immer wieder. »Ja, ich bin taub«, sagte er und gab dem Schaffner die Fahrkarte.
Shaman sah, wie sich vor dem Fenster die Prärie ausbreitete, doch der Anblick fesselte ihn nicht. Die Landschaft hatte etwas Monotones, und außerdem raste der Zug so schnell an ihr vorbei, daß einem die Einzelheiten kaum ins Bewußtsein dringen konnten. Am besten reiste man zu Fuß oder zu Pferd – wenn man dann an ein hübsches Fleckchen kam und hungrig war oder pinkeln mußte, konnte man einfach stehenbleiben und sein Bedürfnis befriedigen. Kam ein Zug an ein solches Fleckchen, rauschte es nur verschwommen an einem vorbei.
Das Buch, das er dabeihatte, hieß »Lazarett Skizzen« und stammte aus der Feder einer gewissen Louisa Alcott aus Massachusetts, die seit Beginn des Krieges Verwundete pflegte und deren Schilderungen des Leids und der entsetzlichen Zustände in den Lazaretten in Medizinerkreisen für große Aufregung gesorgt hatten. Als er jetzt darin blätterte, wurde er noch trauriger, denn er mußte dabei daran denken, welche Qualen sein Bruder Bigger durchleiden mochte, der als Kundschafter der Konföderierten vermißt war, wenn er nicht sogar schon zu den namenlosen Gefallenen gehörte. Diese Gedanken führten ihn auf dem Pfad tränenloser Trauer zurück zu seinem Vater, und er sah sich verzweifelt um.
Weiter vorne im Waggon fing ein magerer kleiner Junge an, sich zu übergeben, und seine Mutter, die bleich zwischen Gepäckstapeln und drei weiteren Kleinkindern saß, hielt hastig seinen Kopf, damit er nicht ihre Habseligkeiten bekleckerte. Als Shaman bei ihr war, hatte sie bereits begonnen, den Unrat aufzuwischen.
Er sprach sie an.
»Kann ich ihm vielleicht helfen? Ich bin Arzt.«
»Wir haben kein Geld, um zu bezahlen.«
Er tat den Einwand mit einer Handbewegung ab. Der Junge schwitzte nach dem krampfartigen Erbrechen, doch seine Haut fühlte sich kühl an. Seine Drüsen waren nicht geschwollen, und die Augen wirkten einigermaßen klar.
Sie sei Mrs. Jonathan Sperber, sagte die Frau auf seine Fragen, aus Lima in Ohio und auf dem Weg zu ihrem Gatten, der zusammen mit anderen Quäkern in Springdale, fünfzig Meilen westlich von Davenport, eine Siedlung errichte. Der kleine Patient hieß Lester und war acht Jahre alt. Er sah zwar noch blaß aus, doch die Farbe kehrte bereits in sein Gesicht zurück. Er schien also nicht ernstlich krank zu sein.
»Was hat er gegessen?«
Aus einem schmierigen Mehlsack zog sie widerstrebend eine hausgemachte Wurst. Sie war grün, und Shamans Nase bestätigte, was seine Augen ihm sagten. Mein Gott!
»Iih … Haben Sie die allen gegeben?«
Sie nickte, und Shaman sah die Kleinen angesichts ihrer Verdauung mit Bewunderung an.
»Die dürfen Sie ihnen nicht mehr geben! Die ist ja total verdorben.«
Ihr Mund wurde ein schmaler Strich. »So verdorben kann sie nun auch wieder nicht sein. Sie ist gut gepökelt, wir haben schon Schlimmeres gegessen. Wenn sie wirklich so schlecht ist, wie Sie behaupten, müßten die anderen ebenfalls krank sein und ich auch.«
Er kannte genug Siedler der verschiedensten Bekenntnisse, um zu wissen, was sie damit meinte: Die Wurst ist alles, was wir haben, entweder essen wir die verdorbene Wurst oder gar nichts. Er nickte und ging zu seinem Platz zurück. Sein Proviant steckte in einer aus Seiten des »Cincinnati Commercial« gedrehten Tüte: drei dicke Doppelscheiben dunkles Brot nach deutscher Art mit magerem Rindfleisch dazwischen, ein Erdbeertörtchen und zwei Äpfel, mit denen er kurz jonglierte, um die Kinder zum Lachen zu bringen. Als er Mrs. Sperber das Essen anbot, öffnete sie den Mund, als wolle sie protestieren, schloß ihn aber schnell wieder. Die Frau eines Siedlers braucht eine vernünftige Portion Realismus.
»Wir sind Ihnen sehr verbunden, mein Freund«, sagte sie.
Die blonde Frau auf der anderen Seite des Gangs sah wieder zu ihm herüber, doch Shaman versuchte sich erneut auf das Buch zu konzentrieren, da kam der Schaffner zurück. »Sagen Sie mal, ich kenn’ Sie doch, ist mir grade erst gekommen. Doc Coles Sohn aus Holden’s Crossing, oder?«
»Ja.« Shaman wußte, daß er aufgrund seiner Taubheit erkannt worden war.
»An mich erinnern Sie sich wohl nicht mehr? Frank Fletcher? Hab’ draußen an der Hooppole Road Mais angebaut. Ihr Daddy hat sich über sechs Jahre lang um uns sieben gekümmert, bis ich dann verkauft habe und zur Eisenbahn gegangen bin. Wir sind nach East Moline gezogen. Ich weiß noch, wie Sie als Knirps manchmal mitgekommen sind. Hinten auf dem Pferd haben Sie sich festgeklammert, als wär’s ums Leben gegangen.« Hausbesuche waren für seinen Vater die einzige Möglichkeit gewesen, mit seinen Söhnen zusammenzusein, und den Jungen hatte es sehr gefallen, ihn bei diesen Ausritten zu begleiten. »Jetzt erinnere ich mich an Sie«, sagte er zu Fletcher, »und an Ihre Farm. Ein weißgestrichenes Holzhaus, daneben der rote Stall mit Blechdach und die alte Torfhütte, die Sie als Lagerraum benutzt haben.«
»Ja, genauso war’s. Manchmal sind Sie mitgekommen, manchmal Ihr Bruder – wie heißt er gleich wieder?«
»Sie meinen Bigger, meinen Bruder Alex.«
»Ja. Wo steckt der jetzt?«
»Beim Militär.« Er sagte nicht, in welcher Armee.
»Natürlich. Und Sie werden wohl Pfarrer?« fragte der Schaffner mit einem Blick auf den schwarzen Anzug, der vierundzwanzig Stunden zuvor noch auf einem Verkaufsständer bei Seligman’s in Cincinnati gehangen hatte.
»Nein, ich bin auch Arzt.«
»Mein Gott. Sie sind doch noch gar nicht alt genug.«
Shaman spürte, daß seine Lippen sich verkrampften, denn mit seiner Jugend kam er schwerer zurecht als mit seiner Taubheit. »Ich bin alt genug. Hab’ in einem Krankenhaus in Ohio gearbeitet. Mr. Fletcher … mein Vater ist am Donnerstag gestorben.«
Fletchers Lächeln verschwand so langsam und vollständig, daß kein Zweifel an der Aufrichtigkeit seiner Trauer blieb. »Ach. Wir verlieren doch immer die Besten, nicht? Im Krieg?«
»Er war schon wieder zu Hause. Im Telegramm stand Typhus.« Der Schaffner schüttelte den Kopf. »Sagen Sie doch bitte Ihrer Mutter, daß sie eine ganze Menge Leute in ihre Gebete einschließen werden.«
Shaman dankte ihm und erwiderte, das werde sie sehr freuen. »Kommen eigentlich an einer der nächsten Haltestellen noch Imbißverkäufer in den Zug?« fragte er dann.
»Nein. Hier bringt jeder seine Verpflegung mit.« Der Eisenbahner sah ihn besorgt an. »Kaufen können Sie sich erst etwas, wenn Sie in Kankakee umsteigen. Mein Gott, hat man Ihnen das denn nicht gesagt, als Sie die Fahrkarte gekauft haben?«
»Doch, doch. Ich brauche ja nichts. Es hat mich nur interessiert.«
Der Schaffner tippte mit dem Finger an sein Mützenschild und ging. Fast im gleichen Augenblick stand die Frau auf der anderen Seite des Mittelganges auf, um sich nach einem umfänglichen Eichenspankorb auf der Gepäckablage zu strecken und dabei von der Brust bis zu den Schenkeln wohlgeformte Kurven zu präsentieren. Shaman ging hinüber und hob den Korb für sie herunter.
Sie lächelte ihn an. »Sie müssen von mir etwas nehmen«, sagte sie. »Wie Sie sehen, habe ich genug für eine ganze Armee.« Er wollte ablehnen, mußte aber zugeben, daß ihre Vorräte wirklich für eine Kompanie reichten. Bald darauf aß er Brathuhn, Gerstenmehlkuchen mit Kürbis und Kartoffelpie. Mr. Fletcher, der mit einem zerdrückten Schinkenbrot zurückkehrte, das er von einem Fahrgast für Shaman erbettelt hatte, grinste und erklärte, Dr. Cole sei im Proviantrequirieren besser als die Potomac-Army. Dann ging er schnell wieder, offensichtlich um das Brot selber zu essen.
Shaman aß mehr, als er redete, und der Appetit angesichts seiner Trauer wunderte und beschämte ihn. Sie redete mehr, als sie aß. Ihr Name war Martha McDonald. Ihr Gatte Lyman war in Rock Island Vertreter für die American Farm Implements Co. Sie drückte ihre Anteilnahme an Shamans Verlust aus. Während sie ihm das Essen reichte, berührten sich ihre Knie, eine angenehme Vertraulichkeit. Er hatte schon sehr früh festgestellt, daß viele Frauen von seiner Taubheit abgestoßen, viele aber auch von ihr erregt wurden. Vielleicht hing letzteres mit dem verlängerten Augenkontakt zusammen, denn während sie sprachen, schaute er ihnen ins Gesicht – eine reine Notwendigkeit, da er von ihren Lippen ablesen mußte, was sie sagten.
Er machte sich keine Illusionen über sein Aussehen. Auch wenn man ihn nicht gerade schön nennen konnte, war er doch groß, ohne tolpatschig zu wirken, er verströmte die Energie junger Männlichkeit und ausgezeichneter Gesundheit, und seine ebenmäßigen Gesichtszüge und die klaren blauen Augen, die er von seinem Vater geerbt hatte, ließen ihn zumindest anziehend erscheinen. Aber all das war im Zusammenhang mit Mrs. McDonald bedeutungslos. Er hatte es sich zur Regel gemacht, sich nie mit einer verheirateten Frau einzulassen, und diese Regel war so unumstößlich wie das Händewaschen vor und nach einer Operation. Deshalb dankte er Mrs. McDonald für das gute Essen und ging, sobald der Rückzug nicht mehr verletzend wirken konnte, zu seinem Platz zurück.
Den Großteil des Nachmittags verbrachte er über seinem Buch. Louisa Alcott berichtete von Operationen, die ohne schmerzbetäubende Mittel durchgeführt wurden, und von Männern, die an infizierten Wunden starben, weil die Lazarette nach Dreck und Verwesung stanken. Tod und Leid hatten ihn schon immer traurig gestimmt, überflüssiger Schmerz und unnötiges Sterben aber machten ihn wütend. Am Spätnachmittag kam Mr. Fletcher noch einmal vorbei und verkündete, der Zug bewege sich mit einer Geschwindigkeit von fünfundvierzig Meilen pro Stunde vorwärts, dreimal so schnell wie ein Pferd, und das ohne zu ermüden. Genauso hatte ein Telegramm Shaman, schon am Morgen nachdem es geschehen war, vom Tod des Vaters unterrichtet. Er überlegte sich verwundert, daß die Welt in eine Ära schneller Transportmittel und noch schnellerer Kommunikation trieb, in eine Ära neuer Krankenhäuser und Behandlungsmethoden, einer Chirurgie ohne Schmerzen entgegen. Doch da ihn solch erhabene Gedanken müde machten, zog er heimlich Martha McDonald mit den Augen aus, um, wenn auch feige, eine angenehme halbe Stunde damit zu verbringen, sich eine medizinische Untersuchung vorzustellen, die in einer Verführung endete – die ungefährlichste und harmloseste Verletzung des Hippokratischen Eids.
Die Ablenkung hielt nicht lange vor. Seine Gedanken landeten immer wieder bei Pa. Je näher er der Heimat kam, desto schwieriger fiel es ihm, sich der Realität zu stellen. Tränen kitzelten hinter seinen Lidern. Ein einundzwanzig Jahre alter Arzt durfte in der Öffentlichkeit nicht weinen. Pa … Die Nacht brach schwarz herein, schon Stunden bevor sie in Kankakee umstiegen. Schließlich und, wie ihm schien, viel zu früh – kaum elf Stunden nachdem sie Cincinnati verlassen hatten – verkündete Mr. Fletcher das Ziel der Reise: »Ro-o-ck I-i-i-sla-a and!«
Der Bahnhof war eine Oase des Lichts. Beim Aussteigen entdeckte Shaman sofort Alden, der unter einer Glaslampe auf ihn wartete. Der Knecht klopfte ihn auf den Arm, schenkte ihm ein trauriges Lächeln und begrüßte ihn mit der vertrauten Wendung: »Willkommen zu Hause, jiggety-jig!«
»Hallo, Alden!« Sie blieben einen Augenblick unter dem Licht stehen, damit sie sich unterhalten konnten. »Wie geht’s ihr?«
»Ach, du weißt schon, dreckig. Ist ihr noch gar nicht richtig zu Bewußtsein gekommen. Hatte ja noch kaum Gelegenheit, allein zu sein, bei all dem Kirchenvolk im Haus und diesem Reverend Blackmer, der ihr den ganzen Tag nicht mehr von der Seite geht.«
Shaman nickte. Der unbeugsame Glaube der Mutter war für sie alle eine Prüfung, aber wenn die First Baptist Church ihr in ihrem Kummer helfen konnte, wollte er dankbar dafür sein. Alden hatte richtig vermutet, daß Shaman nur mit einer Tasche reisen würde, und deshalb das einachsige Gig genommen, das im Gegensatz zum zweiachsigen Buckboard eine gute Federung hatte. Das Pferd war Boss, ein grauer Wallach, den sein Vater sehr gemocht hatte. Shaman streichelte ihm die Nase, bevor er auf den Sitz kletterte. Unterwegs war eine Unterhaltung unmöglich, denn in der Dunkelheit konnte er Aldens Gesicht nicht sehen. Der Knecht roch wie früher: nach Heu und Tabak, ungesponnener Wolle und Whiskey. Auf der Holzbrücke überquerten sie den Rocky River und folgten dann im Trab der Straße nach Nordosten. Das Land zu beiden Seiten konnte Shaman nicht sehen, doch er kannte jeden Baum und jeden Stein. Stellenweise war die Straße nur schwer zu befahren, weil sie das Schmelzwasser in einen Schlammpfad verwandelt hatte. Nach einer Stunde Fahrt hielt Alden an, wie er es immer tat, um das Pferd verschnaufen zu lassen. Er und Shaman stiegen aus, pinkelten auf Hans Buckmans feuchte untere Weide und vertraten sich ein paar Minuten lang die Beine. Bald darauf überquerten sie die schmale Brücke über den Fluß auf ihrem eigenen Anwesen, und als das Haus und der Stall in Sicht kamen, rutschte Shaman zum ersten Mal das Herz in die Hose. Bis dahin war alles wie immer gewesen, Alden hatte ihn abgeholt und nach Hause gefahren. Doch wenn sie jetzt ankamen, würde Pa nicht dasein. Nie mehr.
Shaman ging nicht sofort ins Haus. Er half Alden beim Ausspannen und folgte ihm in den Stall, wo er die Öllaterne anzündete, damit sie sich unterhalten konnten. Alden griff ins Heu und zog eine Flasche hervor, die noch etwa zu einem Drittel voll war, doch Shaman schüttelte den Kopf.
»Bist du da oben in Ohio vielleicht Abstinenzler geworden?«
»Nein.« Es war kompliziert. Er war nur ein schwacher Trinker wie alle Coles, entscheidender war jedoch, daß sein Vater ihm schon vor langer Zeit erklärt hatte, der Alkohol vertreibe jene geheimnisvolle Gabe. »Aber ich trinke nur selten.«
»Ja, du bist wie er. Aber heute abend würde es dir nicht schaden.«
»Ich will nicht, daß sie etwas riecht. Ich hab’ schon genug Schwierigkeiten mit ihr und möchte nicht auch noch darüber streiten müssen. Aber laß die Flasche bitte hier! Ich hol’ mir dann einen Schluck auf dem Weg zum Abort, wenn sie im Bett ist.«
Alden nickte. »Du mußt ein wenig Geduld mit ihr haben«, sagte er zögernd. »Ich weiß, daß sie schwierig sein kann, aber …« Er erstarrte vor Verblüffung, als Shaman auf ihn zukam und die Arme um ihn legte. Das gehörte nicht zu ihrer Beziehung; Männer umarmten einander nicht. Verlegen klopfte ihm der Knecht auf die Schulter. Einen Augenblick später wünschte Shaman ihm gute Nacht, blies die Laterne aus und ging über den dunklen Hof zur Küche, wo, nachdem alle anderen gegangen waren, seine Mutter auf ihn wartete.
Das Vermächtnis
Am nächsten Morgen hatte Shaman Kopfschmerzen, obwohl der Pegel der goldbraunen Flüssigkeit in Aldens Flasche nur um wenige Zentimeter gesunken war. Er hatte schlecht geschlafen; die alte Seilmatratze war seit Jahren nicht nachgespannt, geschweige denn neu geknüpft worden. Beim Rasieren schnitt er sich ins Kinn. Doch im Verlauf des Vormittags wurde das alles unwichtig. Sein Vater war schon beerdigt worden, da er an Typhus gestorben war, aber mit dem Gottesdienst hatte man bis zu Shamans Rückkehr gewartet. In der kleinen First Baptist Church drängten sich zwei Generationen von Patienten, die von seinem Vater entbunden oder behandelt worden waren, sei es wegen ihrer Krankheiten, einer Schrotkugel oder Stichwunde, Hautausschlägen, Knochenbrüchen und wer weiß welchen anderen Beschwerden. Reverend Sydney Blackmer hielt seinen Nachruf herzlich genug, um unter den Versammelten keine Verärgerung aufkommen zu lassen, aber doch nicht so herzlich, daß man auf den Gedanken kommen konnte, es sei in Ordnung, so zu sterben, wie Dr. Robert Judson Cole es getan hatte: ohne der alleinselig machenden Kirche beigetreten zu sein. Shamans Mutter hatte mehrmals dankbar erwähnt, daß Mr. Blackmer es aus Hochachtung für sie gestattet hatte, ihren Gatten in der geweihten Erde des Kirchhofs zu begraben.
Den ganzen Nachmittag war das Haus der Coles voller Leute, von denen die meisten Platten mit Braten, Farcen, Puddings und Pasteten mitbrachten, und zwar in solchen Mengen, daß aus dem traurigen Anlaß beinahe ein Fest wurde. Sogar Shaman ließ sich zu einigen Scheiben vom kalten, gebratenen Herz verführen, seinem Lieblingsfleisch. Makwa-ikwa hatte ihn auf den Geschmack gebracht; er hatte es damals für eine indianische Delikatesse gehalten wie gekochten Hund oder samt Innereien geschmortes Eichhörnchen und war froh gewesen, als er entdeckte, daß auch viele der weißen Nachbarn das Herz geschlachteter Kühe oder erlegten Wildes brieten. Er nahm sich gerade eine weitere Scheibe, als er Lillian Geiger entdeckte, die quer durchs Zimmer zielstrebig auf seine Mutter zuging. Sie sah inzwischen älter aus und etwas erschöpft, doch sie war noch immer attraktiv. Von ihr hatte Rachel das gute Aussehen geerbt. Lillian trug ihr bestes schwarzes Samtkleid, dazu einen schwarzen Leinenüberwurf und ein gefaltetes weißes Umhängetuch. Der kleine silberne Davidstern baumelte an einer Kette vor ihrem hübschen Busen. Shaman fiel auf, daß sie genau darauf achtete, wem sie zunickte, denn es gab Leute, die, wenn auch widerwillig, eine Jüdin höflich grüßten, jedoch nie eine Copperhead, eine Sympathisantin der Südstaaten. Lillian war die Cousine von Judah Benjamin, dem Bundesstaatssekretär der Konföderierten, und ihr Gatte Jay war zu Beginn des Krieges in seine Heimat South Carolina zurückgekehrt, um sich dort mit zweien seiner drei Brüder der Konföderiertenarmee anzuschließen.
Als Lillian schließlich vor Shaman stand, wirkte ihr Lächeln gezwungen. »Tante Lillian!« sagte er. Sie war gar nicht seine Tante, aber in seiner Kindheit waren die Geigers und die Coles wie enge Verwandte gewesen, und er hatte sie nie anders genannt.
Ihr Blick wurde sanfter. »Hallo, Rob J.!« sagte sie im vertrauten zärtlichen Ton. Niemand sonst nannte ihn so – es war eigentlich der Name seines Vaters –, aber Lillian hatte ihn fast nie Shaman genannt. Sie küßte ihn auf die Wange, verzichtete aber darauf, ihm ihr Beileid auszudrücken.
Nach dem, was sie gehört habe, sagte sie, und das sei wenig, da die Briefe die Fronten passieren müßten, befinde sich ihr Gatte wohlauf und außer Gefahr. Als Apotheker habe man ihn bei seinem Eintritt in die Armee zum Verwalter eines kleinen Armeelazaretts in Georgia gemacht, und inzwischen sei er Kommandant eines größeren Lazaretts am Ufer des James River in Virginia. Sein letzter Brief, erzählte sie weiter, habe die traurige Nachricht enthalten, daß sein Bruder, Joseph Reuben Geiger, ein Apotheker wie alle anderen männlichen Familienmitglieder, der sich zur Kavallerie gemeldet hatte, in der Schlacht gefallen sei.
Shaman nickte, und auch er vermied es, Beileid auszusprechen, wie es inzwischen als selbstverständlich galt.
Und wie ging es den Kindern?
»Könnt’ nicht besser sein. Die Jungen sind so gewachsen, daß Jay sie nicht wiedererkennen würde. Sie essen wie die Tiger.«
»Und Rachel?«
»Sie hat letzten Juni ihren Mann, Joe Regensberg, verloren. Er ist am Typhus gestorben – wie dein Vater.«
»Ach«, sagte er mit belegter Stimme. »Ich habe gehört, daß letzten Sommer in Chicago der Typhus grassiert hat. Geht es ihr gut?«
»O ja. Rachel geht es sehr gut – und ihren Kindern auch. Sie hat einen Sohn und eine Tochter.« Lillian zögerte. »Sie hat sich mit einem anderen Mann angefreundet, einem Cousin von Joe. Nach ihrem Trauerjahr wird die Verlobung offiziell bekanntgegeben.«
So? Verwunderlich, daß ihn das immer noch berührte, daß es ihn so tief traf. »Und wie fühlt man sich so als Großmutter?«
»Sehr gut«, erwiderte sie, verließ ihn dann und begann eine leise Unterhaltung mit Mrs. Pratt, deren Land an das der Geigers angrenzte.
Gegen Abend lud Shaman Essen auf einen Teller und brachte ihn zu Alden Kimballs stickiger kleiner Hütte, die immer nach Holzrauch roch. Der Knecht saß in der Unterwäsche auf seiner Koje und trank aus einem Krug. Seine Füße waren sauber, er hatte extra für den Trauergottesdienst gebadet. Die zweite Garnitur wollener Unterwäsche, die eher grau war als weiß, hing zum Trocknen auf einer quer durch die Hütte gespannten Leine. Shaman schüttelte den Kopf, als Alden ihm den Krug anbot. Er setzte sich auf den einzigen Holzstuhl und sah Alden beim Essen zu. »Wenn’s nach mir gegangen wär’, hätt’ ich Pa auf unserem Land am Flußufer beerdigt.«
Alden schüttelte den Kopf. »Das hätte sie nie zugelassen. Wär’ doch viel zu nah am Grab dieser Indianerin gewesen. Bevor die … getötet wurde«, sagte er vorsichtig, »haben die Leute über die beiden geredet. Deine Ma war furchtbar eifersüchtig.«
Shaman hätte gern Genaueres über Makwa, seine Mutter und seinen Vater erfahren, aber es erschien ihm nicht recht, mit Alden über seine Eltern zu reden. So winkte er nur zum Abschied und verließ die Hütte. Es dämmerte, als er zum Fluß hinunterging, zu den Ruinen von Makwa-ikwas hedonoso-te. Das eine Ende des Langhauses war noch intakt, doch das andere war eingestürzt, die Stämme und Zweige verrottet – ein Paradies für Schlangen und Nagetiere.
»Ich bin wieder da«, sagte er.
Er konnte Makwas Anwesenheit spüren. Sie war schon lange tot, und er fühlte noch immer ein Bedauern, das freilich angesichts der Trauer über seinen Vater verblaßte. Er suchte Trost, doch alles, was er spürte, war Makwas entsetzlicher Zorn, den er so deutlich wahrnahm, daß sich ihm die Nackenhaare sträubten. Nicht weit von der Ruine entfernt war ihr Grab, ohne Stein, doch sorgfältig gepflegt, das Gras geschnitten, der Rand bepflanzt mit wilden gelben Taglilien, die von einer nahe gelegenen Stelle am Flußufer stammten. Grüne Sprossen stachen bereits durch die nasse Erde. Er wußte, daß es nur sein Vater gewesen sein konnte, der sich um das Grab gekümmert hatte, und er kniete sich hin und riß das Unkraut zwischen den Taglilien heraus.
Inzwischen war es schon beinahe dunkel. Er meinte zu spüren, daß Makwa ihm etwas sagen wollte. Das war schon öfter passiert, und er glaubte beinahe, daß er ihren Zorn deshalb fühlte, weil sie ihm nicht sagen konnte, wer sie getötet hatte. Er wollte sie fragen, was er jetzt, da Pa nicht mehr lebte, tun solle. Der Wind kräuselte die Wasserfläche. Shaman entdeckte die ersten, hellen Sterne und fröstelte. Noch ist die Macht des Winters nicht gebrochen, dachte er, als er zum Haus zurückkehrte.
Am nächsten Tag war ihm zwar bewußt, daß er eigentlich im Haus bleiben sollte für den Fall, daß noch verspätete Trauergäste kamen, doch er brachte es nicht fertig. Er zog Arbeitskleidung an und verbrachte den Vormittag damit, zusammen mit Alden Schafe zu dippen. Es gab neugeborene Lämmer, und er kastrierte die männlichen Tiere, wobei Alden die prairie oysters, die Hoden, verlangte, die er mit Eiern zum Abendessen braten wollte.
Nachdem er gebadet und wieder seinen schwarzen Anzug angezogen hatte, saß er am Nachmittag mit seiner Mutter im Wohnzimmer. »Es wird das beste sein, du gehst die Sachen deines Vaters durch und entscheidest, wer was bekommen soll«, sagte sie.
Trotz der inzwischen schon stark angegrauten Haare war seine Mutter mit ihrer wundervollen langen Nase und dem sinnlichen Mund eine der apartesten Frauen, die er je gesehen hatte. Was die ganzen Jahre über zwischen ihnen gestanden hatte, war auch jetzt noch da, doch seinen Widerstand konnte sie spüren. »Früher oder später muß es getan werden, Robert«, sagte sie.
Sie machte sich fertig, um die leeren Teller und Platten zur Kirche zu bringen, wo sie die Besucher, die Essen mitgebracht hatten, abholen wollten, und er bot ihr an, das für sie zu erledigen. Aber sie erwiderte, sie wolle Reverend Blackmer besuchen. »Komm doch mit!« sagte sie, er jedoch schüttelte den Kopf, denn er wußte, daß er dann einen Sermon mit Argumenten über sich ergehen lassen mußte, warum man sich den Empfang des Heiligen Geistes nicht vorenthalten dürfe. Die Buchstabengläubigkeit seiner Mutter, was Himmel und Hölle betraf, erstaunte ihn immer wieder. Ihre Streitgespräche mit seinem Vater fielen ihm ein, und er wußte, daß sie jetzt eine ganz besondere Pein zu durchleiden hatte, denn es war schon immer eine qualvolle Vorstellung für sie gewesen, daß ihr Gatte, der die Taufe verweigert hatte, im Paradies nicht auf sie warten werde.
Sie hob die Hand und zeigte zum offenen Fenster. »Da kommt jemand geritten.« Sie lauschte eine Weile und sagte dann bitter lächelnd: »Eine Frau hat Alden gefragt, ob der Doktor daheim ist. Ihr Mann liegt verletzt zu Hause. Alden hat ihr gesagt, daß der Doktor gestorben ist. ›Der junge Doktor?‹ fragte sie. Und Alden sagte: ›Nein, der nicht, der ist da.‹«
Auch Shaman fand das lustig, und sie war bereits zur Tür gegangen, wo Rob J.s Arzttasche an ihrem gewohnten Platz stand. Die gab sie jetzt ihrem Sohn. »Nimm den Wagen, er ist bereits angespannt! Ich fahr’ dann später zur Kirche.«
Die Frau war Liddy Geacher. Sie und ihr Mann Henry hatten während Shamans Abwesenheit den Hof der Buchanans gekauft. Shaman kannte den Weg gut, es waren nur wenige Meilen. Geacher war vom Heuboden gefallen. Er lag noch genau dort, wo er aufgeschlagen war, sein Atem ging flach und mühsam. Er stöhnte, als sie versuchten, ihn auszuziehen, und Shaman schnitt deshalb die Kleidung auf, achtete aber darauf, nur die Nähte aufzutrennen, damit Mrs. Geacher sie später wieder zusammennähen konnte. Blut war keins zu sehen, nur schwere Quetschungen, und der linke Knöchel war geschwollen. Shaman nahm das Stethoskop aus der Tasche seines Vaters. »Kommen Sie bitte her! Ich will, daß Sie mir sagen, was Sie hören«, sagte er zu der Frau und steckte ihr die Elfenbeinknöpfe ins Ohr. Sie riß die Augen auf, als er die Membran auf die Brust ihres Mannes drückte. Er ließ sie lange horchen, wobei er die Membranglocke mit der Linken hielt und mit den Fingerspitzen der Rechten dem Mann den Puls fühlte.
»Bumm-bumm-bumm-bumm-bumm!« flüsterte sie.
Shaman lächelte. Henry Geachers Puls ging schnell, doch das war auch nicht verwunderlich. »Was hören Sie sonst noch? Lassen Sie sich Zeit!«
Sie horchte lange.
»Kein leises Knistern, als würde jemand trockenes Stroh zerdrücken?«
Sie schüttelte den Kopf. »Bumm-bumm-bumm.«
Gut. Dann hatte keine gebrochene Rippe einen Lungenflügel durchstoßen. Er nahm der Frau das Stethoskop wieder ab und tastete Geachers Körper Zoll für Zoll mit den Händen ab. Da er nichts hörte, mußte er seine anderen Sinne sorgfältiger und aufmerksamer benutzen als andere Ärzte. Als er die Hände des Mannes hielt, nickte er zufrieden über das, was die Colesche Gabe ihm sagte. Geacher hatte Glück gehabt, ein Heuhaufen hatte seinen Sturz gedämpft. Er hatte sich die Rippen geprellt, aber Anzeichen für einen Bruch waren nirgends zu entdecken. Shaman vermutete, daß die fünfte und die achte Rippe angeknackst waren – und vielleicht auch die neunte. Als er Geacher den Brustkorb bandagierte, konnte der Farmer leichter atmen. Shaman schiente den Knöchel und holte dann eine Flasche mit dem Schmerzmittel seines Vaters aus der Tasche, vorwiegend Alkohol mit etwas Morphium und einigen Kräutern.
Einen Dollar für den Hausbesuch, fünfzig Cent für die Verbände, fünfzig Cent für das Medikament. Aber die Arbeit war noch nicht beendet. Die nächsten Nachbarn der Geachers waren die Reismans, ihr Hof lag zehn Reitminuten entfernt. Shaman fuhr hin und redete mit Tod Reisman und seinem Sohn Dave, die versprachen, auszuhelfen und dafür zu sorgen, daß auf der Geacher-Farm eine Woche lang alles weiterlief.
Shaman ließ sich auf dem Nachhauseweg Zeit und genoß den Frühling. Die schwarze Erde war zum Pflügen noch zu naß. Morgens hatte er gesehen, daß auf den Weiden bereits die ersten Blumen blühten, Veilchen und orange leuchtende Gelbwurz und rosafarbener Präriephlox, in wenigen Wochen würden größere Blüten die Ebenen mit ihrer Farbenpracht überziehen. Vergnügt atmete er den schweren, süßen Duft gedüngter Felder ein.
Als er heimkam, war das Haus leer, und der Eierkorb hing nicht an seinem Haken, was bedeutete, daß seine Mutter im Hühnerstall war. Er ging ihr nicht nach. Bevor er die Arzttasche an ihren Platz neben der Tür zurückstellte, untersuchte er sie, als sähe er sie zum erstenmal. Das Leder war abgenutzt, doch es war solides Rindsleder, das ewig halten würde. Die Instrumente, Verbände und Arzneien lagen darin, wie sein Vater sie eigenhändig eingeordnet hatte, sauber, übersichtlich und so, daß er stets für alles gerüstet war.
Shaman ging ins Arbeitszimmer und fing an, die Habseligkeiten seines Vaters methodisch zu inspizieren. Er wühlte in den Schreibtischschubladen, öffnete die lederne Truhe und teilte alles in drei Gruppen: für seine Mutter all die Kleinigkeiten, die für sie persönlichen Wert haben mochten, für Bigger das halbe Dutzend Pullover, die Sarah Cole aus hauseigener Wolle gestrickt hatte, damit sie den Doktor bei kalten Nachtfahrten warm hielten, dazu die Angel- und Jagdausrüstung des Vaters und einen Schatz, der so neu war, daß Shaman ihn zum erstenmal sah: einen 44er Colt Texas Navy Revolver mit gezogenem Neun-Zoll-Lauf und dunklen Nußbaumgriffschalen. Die Waffe war eine Überraschung und ein Schock. Zwar hatte sein pazifistischer Vater sich am Ende dazu durchgerungen, die Truppen der Union zu behandeln, doch nur unter der deutlich ausgesprochenen Bedingung, daß er als Nichtkämpfer keine Waffe tragen würde. Warum hatte er sich dann diesen offensichtlich teuren Revolver gekauft?
Die medizinischen Bücher, das Mikroskop, die Arzttasche und der Vorrat an Kräutern und Medikamenten standen Shaman zu. In der Truhe fand er unter dem Mikroskopkasten eine Sammlung Bücher, broschierte Bände aus gutem Schreibpapier. Als er sie durchsah, erkannte Shaman, daß es sich um das lebenslange Tagebuch seines Vaters handelte.
Der Band, den er willkürlich zur Hand nahm, war 1842 geschrieben. Beim Durchblättern entdeckte Shaman eine reichhaltige, aber wahllose Aneinanderreihung von medizinischen und pharmazeutischen Notizen und intimen Gedanken. Das Buch war übersät mit Skizzen: Gesichter, anatomische Zeichnungen, der Ganzkörper-Akt einer Frau, seiner Mutter, wie er erkannte. Er betrachtete das noch junge Gesicht und starrte fasziniert das nackte Fleisch an, wohl wissend, daß in dem unübersehbar schwangeren Bauch ein Fötus heranwuchs, der er selbst werden sollte. Er schlug einen früheren Band auf, aus der Zeit, als Robert Judson Cole noch ein junger Mann war, der eben erst mit dem Schiff aus Schottland gekommen war. Auch der enthielt einen weiblichen Akt, diesmal mit einem Gesicht, das Shaman nicht kannte. Die Züge waren nur undeutlich, die Vulva jedoch mit klinischer Detailtreue gezeichnet, und Shaman sah sich plötzlich vertieft in den Bericht über eine Affäre, die sein Vater mit einer Frau in seiner Pension gehabt hatte.
Während er las, wurde er immer jünger. Die Jahre fielen von ihm ab, sein Körper entwickelte sich zurück, die Erde drehte sich in Gegenrichtung, und die zerbrechlichen Geheimnisse und Leiden der Jugend erstanden neu. Er war wieder ein Junge, der verbotene Bücher las und nach Worten und Bildern suchte, die ihm alles über die geheimen, niederen und vielleicht unermeßlich wunderbaren Dinge verrieten, die Männer mit Frauen anstellten.
Zitternd stand er da und gab acht, ob nicht vielleicht sein Vater zur Tür hereinkäme und ihn hier überraschte.
Erst als er merkte, daß seine Mutter mit den Eiern ins Haus kam, zwang er sich, das Buch zu schließen und in die Truhe zurückzulegen.
Beim Abendessen sagte er, er habe angefangen, die Habseligkeiten seines Vaters durchzusehen, und er werde eine leere Kiste vom Dachboden holen, um die Sachen darin zu verstauen, die sein Bruder bekommen solle.
Unausgesprochen stand zwischen ihnen die Frage, ob Alex überhaupt noch lebte, ob er zurückkehren und die Sachen benutzen werde. Doch dann entschloß Sarah sich zu einem Nicken. »Gut«, sagte sie, offensichtlich erleichtert, daß ihr Jüngerer sich an die Arbeit gemacht hatte.
In dieser Nacht lag Shaman wach und sagte sich, daß ihn die Lektüre dieser Tagebücher zu einem Voyeur mache, zu einem Eindringling in das Leben seiner Eltern, vielleicht sogar in ihr Schlafzimmer, und daß er die Bücher deshalb verbrennen müsse. Doch sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, daß sein Vater sie geschrieben hatte, um das Wesentliche aus seinem Leben aufzuzeichnen, und während er grübelnd in dem durchhängenden Bett lag, fragte er sich, wie wohl die Wahrheit über das Leben und den Tod von Makwa-ikwa aussah, und er befürchtete, daß diese Wahrheit ernste Gefahren in sich bergen könne.
Schließlich stand er auf, zündete die Lampe an und schlich sich mit ihr hinunter – leise, um seine Mutter nicht aufzuwecken. Er stutzte den qualmenden Docht und drehte die Flamme so hoch wie möglich. Das Licht reichte noch immer kaum zum Lesen, und das Arbeitszimmer war zu dieser Nachtzeit ungemütlich kalt. Doch Shaman nahm den ersten Band und fing an zu lesen, und im gleichen Augenblick vergaß er die schlechte Beleuchtung und die unangenehme Temperatur, denn nun erfuhr er über seinen Vater und sich selbst mehr, als er je hatte wissen wollen.
Zweiter Teil
Frische Leinwand, neues Gemälde
11. März 1839
Der Einwanderer
Zum erstenmal sah Rob J. Cole die Neue Welt, als an einem nebligen Frühlingstag das Postschiff Cormorant – ein schwerfälliges Schiff mit drei kurzen Masten und einem Besansegel, und dennoch der Stolz der Black Ball Line – von der Flut in einen geräumigen Hafen geschoben wurde und dort seinen Anker in die kabbelige Dünung warf. East Boston war nichts Besonderes und bestand nur aus ein paar Reihen schlecht gebauter Holzhäuser, aber von einem der Piers aus nahm Rob J. für drei Pence eine kleine Dampfschiffähre, die ihn auf verschlungenem Kurs durch eine beeindruckende Ansammlung von Schiffen und Kähnen auf die andere Seite, zum eigentlichen Hafenviertel, brachte, einer wild wuchernden Siedlung aus Wohnbauten und Geschäftshäusern, die beruhigend nach verfaulendem Fisch, Bilgenwasser und geteertem Seil roch wie jeder schottische Hafen auch.
Er war hochgewachsen und breit, größer als die meisten. Das Gehen fiel ihm schwer, als er sich auf der krummen Kopfsteinpflasterstraße, die vom Wasser wegführte, in Bewegung setzte, denn die Seereise steckte ihm noch in den Knochen. Auf der linken Schulter trug er einen schweren Schiffskoffer, und unter seinem rechten Arm klemmte, als habe er eine Frau um die Taille gefaßt, ein großes Saiteninstrument. Er sog Amerika mit jeder Pore ein. Schmale Straßen, kaum breit genug für Karren und Kutschen, die meisten Gebäude aus Holz oder aus sehr roten Ziegeln, die Geschäfte voller Waren, über den Türen farbenfrohe Schilder mit vergoldeten Buchstaben. Er bemühte sich, die Frauen, die aus den Geschäften kamen, nicht anzustarren, obwohl er wie betrunken war vor Sehnsucht nach dem Geruch einer Frau.
Er spähte kurz in ein Hotel, das American House, doch die Lüster und die Perserteppiche schüchterten ihn ein, und er wußte, daß die Preise zu hoch für ihn waren. In einem billigen Lokal aß er eine Tasse Fischsuppe und fragte zwei Kellner, ob sie ihm eine billige, aber saubere Pension empfehlen könnten.
»Da mußt du dich schon entscheiden, Junge, entweder das eine oder das andere«, sagte der eine. Doch der andere schüttelte den Kopf und schickte ihn zu Mrs. Burton in der Spring Lane.
Das einzig freie Quartier war eine ehemalige Dienstbotenkammer auf dem Dachboden neben den Zimmern des Knechts und des Dienstmädchens. Es war nicht nur winzig, sondern man mußte auch drei Stockwerke hochsteigen, und da es direkt unter den Dachsparren lag, war es im Sommer mit Sicherheit heiß und im Winter kalt. Es gab lediglich ein schmales Bett, einen kleinen Tisch mit einer angeschlagenen Waschschüssel und einen weißen Nachttopf. Mit Frühstück – Porridge, Kekse und ein Hühnerei – koste das Zimmer einen Dollar fünfzig Cent die Woche, erklärte ihm Louise Burton. Sie war eine farblose Witwe Mitte der Sechzig mit unverblümt neugierigem Blick. »Was haben Sie da unterm Arm?«
»Man nennt es eine Gambe.«
»Verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt als Musiker?«
»Ich spiel’ nur zum Vergnügen. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich als Arzt.«
Sie nickte skeptisch. Dann verlangte sie eine Vorauszahlung und nannte ihm ein Wirtshaus in der Nähe der Beacon Street, wo er für einen weiteren Dollar pro Woche sein Abendessen bekommen könne.
Sobald sie gegangen war, fiel er ins Bett. Den ganzen Nachmittag und den Abend schlief er traumlos, nur das Stampfen und Rollen des Schiffs glaubte er gelegentlich noch zu spüren, und am nächsten Morgen erwachte er wieder frisch und jung. Beim Frühstück saß er neben einem anderen Pensionsgast, Stanley Finch, der bei einem Hutmacher in der Summer Street arbeitete. Von Finch erfuhr er zwei äußerst wichtige Dinge: Für vierundzwanzig Cent konnte man sich von Lem Raskin, dem Hausdiener, Wasser erhitzen und in eine winzige Wanne gießen lassen; und in Boston gab es drei Krankenhäuser: das Massachusetts General, das Lying-In und das Eye and Ear Infirmary, die Augen- und Ohrenklinik. Nach dem Frühstück lag er selig in der Wanne und fing erst an, sich abzuschrubben, als das Wasser kalt wurde. Anschließend gab er sich alle Mühe, seine Kleidung so präsentabel wie möglich zu machen. Beim Hinuntergehen sah er das Dienstmädchen, das auf den Knien die Treppe wischte. Ihre nackten Arme waren sommersprossig, und ihr rundlicher Hintern wackelte im Takt der heftigen Schrubbewegungen. Ein mürrisches, altjüngferliches Gesicht sah zu ihm hoch, als er vorbeiging, und er bemerkte, daß die roten Haare, die unter ihrer Haube hervorlugten, die Tönung hatten, die ihm am wenigsten gefiel, nämlich die nasser Karotten.
Im Massachusetts General wartete er den halben Vormittag, bis er von einem Dr. Walter Channing empfangen wurde, der ihm ohne Umschweife sagte, daß die Klinik keine zusätzlichen Ärzte brauche. In den beiden anderen Krankenhäusern machte er sehr schnell die gleiche Erfahrung. Im Lying-In schüttelte ein junger Arzt namens David Humphreys Storer mitfühlend den Kopf. »Die Harvard Medical School entläßt jedes Jahr junge Ärzte, die um eine Anstellung Schlange stehen, Dr. Cole. Ehrlich gesagt, ein Fremder hat da wenig Aussicht.«
Rob J. wußte, was Dr. Storer nicht gesagt hatte: Einige der ansässigen Jungmediziner profitierten vom Ruf ihrer Familie und von deren Beziehungen, so wie es für ihn in Edinburgh von Vorteil gewesen war, zur bekannten Medizinerdynastie der Coles zu gehören.
»Ich würde es in einer anderen Stadt versuchen, vielleicht in Providence oder New Haven«, sagte Dr. Storer, und Rob J. murmelte seinen Dank und verließ ihn. Doch einen Augenblick später kam ihm Dr. Storer nachgelaufen. »Es gibt da noch eine entfernte Möglichkeit«, sagte er. »Sie müssen mit Dr. Walter Aldrich sprechen.«
Der Arzt hatte seine Praxis zu Hause, in einem gepflegten weißgestrichenen Holzhaus an der Südseite einer großen Grünfläche, die The Common hieß. Es war gerade Sprechstunde, und Rob J. mußte lange warten. Dr. Aldrich erwies sich als stattlicher Mann mit einem grauen Vollbart, der freilich den wie eine Schnittwunde wirkenden Mund nicht verbergen konnte. Er hörte zu, während Rob J. erzählte, und unterbrach ihn hin und wieder mit einer Frage. »Am Universitätskrankenhaus von Edinburgh? Unter dem Chirurgen William Fergusson? Warum haben Sie denn eine solche Assistentenstelle aufgegeben?«
»Man hätte mich nach Australien deportiert, wenn ich nicht geflohen wäre.« Rob J. wußte, daß seine einzige Hoffnung in der Wahrheit lag. »Ich habe ein Pamphlet verfaßt, das zu einem Arbeiteraufstand gegen die englische Krone führte, die Schottland seit Jahren ausbluten läßt. Es kam zu Straßenschlachten, Menschen wurden getötet.«
»Eine offene Antwort«, sagte Dr. Aldrich und nickte. »Ein Mann muß für das Wohlergehen seines Landes kämpfen. Mein Vater und mein Großvater haben gegen die Engländer gekämpft.« Er betrachtete Rob J. mit abwägendem Blick. »Es gibt da eine Möglichkeit. Bei einer wohltätigen Einrichtung, die Ärzte zu den Bedürftigen der Stadt schickt.«
Es klang nach schmutziger Arbeit ohne Zukunftsaussichten. Dr. Aldrich sagte, die meisten Gemeindeärzte erhielten fünfzig Dollar pro Jahr und seien froh um die Erfahrung, doch Rob fragte sich, was ein Arzt aus Edinburgh in einem provinziellen Elendsviertel Neues über Medizin lernen könne.
»Wenn Sie Mitglied der Boston Dispensary werden, kann ich Ihnen eine Assistentenstelle für die Abendvorlesungen im anatomischen Institut der Tremont Medical School beschaffen. Das bringt Ihnen zusätzlich zweihundertfünfzig Dollar pro Jahr.«
»Ich glaube nicht, daß ich mit dreihundert Dollar existieren kann, Sir. Ich habe praktisch keine eigenen Mittel.«
»Etwas anderes habe ich nicht anzubieten. Genaugenommen beläuft sich das Jahreseinkommen auf dreihundertfünfzig Dollar. Die freie Stelle ist im achten Distrikt, und für den hat der Beirat des Dispensary vor kurzem eine Erhöhung des Gemeindearztgehalts auf hundert Dollar beschlossen.«
»Warum bekommt man im achten Distrikt doppelt soviel wie in den anderen?«
Nun war es an Dr. Aldrich, offen und ehrlich zu antworten. »Dort leben die Iren«, sagte er in einem Ton, der so dünn und blutleer war wie seine Lippen.
Am nächsten Morgen stieg Robert J. im Haus Washington Street Nr. 109 knarzende Treppen hinauf und betrat die überfüllte Apotheke, die den einzigen Geschäftsraum der Boston Dispensary, einer Art städtischen Gesundheitsbehörde, darstellte. Hier drängten sich bereits die Ärzte, die auf ihre Patientenzuweisungen für diesen Tag warteten. Charles K. Wilson, der Direktor, war geschäftsmäßig kurz angebunden, als Rob J. an die Reihe kam: »Soso. Neuer Arzt für den achten Distrikt, was? Na ja, das Viertel war eine Zeitlang ohne Betreuung. Die da warten auf Sie«, sagte er und gab ihm einen Stapel Zettel, jeder mit einem Namen und einer Adresse.
Wilson erklärte ihm die Vorschriften und beschrieb ihm den achten Distrikt. Die Broad Street trennte den Hafen und die Docks von den hochaufragenden Häuserzeilen Fort Hills. Als die Stadt noch jung war, prägten Großhändler dieses Viertel, die sich hier prächtige Residenzen bauten, um in der Nähe ihrer Lagerhäuser und Geschäfte zu sein. Im Lauf der Zeit übersiedelten sie in andere, bessere Gegenden, und Yankees aus der Arbeiterschicht übernahmen die Häuser, die dann in kleinere Wohneinheiten unterteilt und von noch ärmeren Einheimischen bezogen wurden, bis schließlich die irischen Einwanderer kamen, die aus den Bäuchen der Schiffe quollen. Zu dieser Zeit waren die riesigen Häuser bereits verkommen und vernachlässigt, die Wohnungen wurden immer weiter unterteilt und zu ungerechtfertigt hohen Preisen wochenweise untervermietet. Lagerhäuser wurden zu Bienenstöcken aus winzigen Zimmern ohne eine einzige Licht- oder Frischluftquelle, und der Wohnraum war so knapp, daß neben und hinter jedem Gebäude häßliche, windschiefe Hütten entstanden. Das Ergebnis war ein abscheuliches Elendsviertel, in dem bis zu zwölf Personen ein Zimmer bewohnten: Eheleute, Brüder, Schwestern und Kinder, die manchmal alle in ein und demselben Bett schliefen. Wilsons Angaben folgend, fand Rob J. den achten Distrikt. Der Gestank der Broad Street, das Miasma, das zu wenige und von zu vielen Menschen benutzte Toiletten ausströmten, war der Geruch der Armut, der in jeder Stadt der Welt der gleiche war. Doch ein Teil Rob J.s, der genug davon hatte, ein Fremder zu sein, freute sich über die irischen Gesichter. Denn diese Menschen waren keltischer Abstammung wie er. Sein erster Patientenschein lautete auf den Namen Patrick Geoghegan am Half Moon Place. Die Adresse hätte ebensogut auf einem anderen Planeten sein können, denn in dem Labyrinth von Gassen und namenlosen Privatwegen, die von der Broad Street abgingen, verirrte er sich sofort. Schließlich gab er einem Jungen mit schmutzigem Gesicht einen Penny, um sich zu einem winzigen, überfüllten Platz führen zu lassen. Weitere Nachforschungen brachten ihn in den obersten Stock eines Hauses, wo er sich durch Zimmer, die von zwei anderen Familien bewohnt wurden, einen Weg zu der winzigen Unterkunft der Geoghegans bahnte. Eine Frau saß in dem Zimmer und suchte bei Kerzenlicht den Kopf eines Kindes nach Läusen ab.
»Patrick Geoghegan?« Rob J. mußte den Namen wiederholen, bevor er mit einem heiseren Flüstern belohnt wurde: »Mein Dad … Vor fünf Tagen isser gestorben, am Hirnfieber.«
So nannten auch die Leute in Schottland jedes hohe Fieber mit Todesfolge. »Das tut mir sehr leid, Madam«, sagte er. Doch sie sah nicht einmal auf.
Unten im Hof blieb er stehen und sah sich um. Er wußte, daß es in jedem Land solche Straßen gab, Straßen, in denen eine so erdrückende Ungerechtigkeit herrschte, daß sie ihre eigenen Bilder, Geräusche und Gerüche hervorbrachten: Ein käsig-bleiches Kind saß auf einer Schwelle und nagte an einer Speckrinde wie ein Hund an einem Knochen; drei nicht zueinander passende Schuhe, so abgetragen, daß sie nicht mehr zu reparieren waren, schmückten die mit Abfall übersäte, staubige Gasse; ein Betrunkener sang ein weinerliches Lied über die grünen Hügel eines entfernten Landes wie eine Hymne; und über allem waberte der Geruch von gekochtem Kohl und der feuchte Gestank von verstopften Abflüssen und unzähligen Arten von Dreck. Er kannte die Armenviertel von Edinburgh und Paisley und die steinernen Häuserschluchten unzähliger Städte, wo Erwachsene und Kinder vor Tagesanbruch aufbrachen, um sich zu den Baumwollfabriken und Wollspinnereien zu schleppen und erst lange nach Anbruch der Nacht zurückzukehren, Menschen, die ausschließlich in der Dunkelheit unterwegs waren. Ihm kam plötzlich die Ironie seiner Lage zu Bewußtsein: Aus Schottland war er geflohen, weil er die Kräfte bekämpft hatte, die solche Elendsviertel entstehen ließen, und jetzt, in diesem neuen Land, wurde er wieder mit der Nase hineingestoßen.
Sein zweiter Schein führte ihn zu Martin O’Hara am Humphrey Place, einer Hüttensiedlung am Rande von Fort Hill. Er mußte über eine knapp zwanzig Meter hohe Holztreppe, die so steil war, daß man sie beinahe wie eine Leiter hochklettern mußte. Neben der Treppe verlief eine offene Rinne, in der die ungeklärten Abwässer des Humphrey Place nach unten stürzten und die Probleme des Half Moon Place noch verschlimmerten.
Trotz des Elends seiner Umgebung bemühte sich Rob J., schnell zu arbeiten, und machte sich dabei vertraut mit seinem Betätigungsfeld. Es war eine anstrengende Tätigkeit, und doch erwarteten ihn am Ende des Nachmittags nur eine karge, von Sorgen umdüsterte Mahlzeit und der Abend mit seiner zweiten Beschäftigung. Die beiden Stellen würden ihm erst nach einem Monat den ersten Lohn einbringen, und für das Geld, das er noch hatte, konnte er sich nicht mehr oft ein Abendessen kaufen.
Das anatomische Institut der Tremont Medical School bestand aus einem großen Raum über Thomas Metcalfes Apotheke am Tremont Place Nr. 35, der gleichzeitig als Hörsaal diente. Geleitet wurde es von einer Gruppe Professoren mit Harvard-Examen, die aus Unzufriedenheit mit der chaotischen Medizinerausbildung an ihrer Alma Mater ein streng reglementiertes und kontrolliertes Dreijahresprogramm entwickelt hatten, das ihrer Ansicht nach bessere Ärzte hervorbrachte.
Der Pathologieprofessor, unter dem er als Sezierassistent arbeiten sollte, erwies sich als kurzer, säbelbeiniger Mann, der nur zehn Jahre älter war als er. »Ich heiße Holmes. Sind Sie ein erfahrener Dozent, Dr. Cole?«
»Nein. Ich habe noch nie unterrichtet. Aber ich habe Erfahrung in der Chirurgie und beim Sezieren.«
Na, wir werden sehen, schien Dr. Holmes’ kühles Nicken zu bedeuten. Er erklärte ihm kurz die Handgriffe, die zur Vorbereitung der Vorlesung nötig waren. Es handelte sich bis auf wenige Ausnahmen um Routinearbeiten, mit denen Rob J. vertraut war. Er und Fergusson hatten in Edinburgh jeden Morgen vor der Visite Autopsien vorgenommen, zu Forschungszwecken, aber auch zur Übung, damit sie beim Operieren ihrer Patienten immer schneller und sicherer wurden. Jetzt zog Rob J. das Laken von dem dürren Leichnam eines Jungen, band sich eine lange, graue Arbeitsschürze um und legte die Instrumente zurecht, während bereits die ersten Studenten eintrafen.
Es waren insgesamt nur sieben Medizinstudenten. Dr. Holmes stand an einem Pult neben dem Seziertisch. »Als ich in Paris Anatomie studierte«, begann er, »konnte sich jeder Student für fünfzig Sou eine komplette Leiche besorgen. Es gab da eine Stelle, an der sie jeden Tag pünktlich um zwölf Uhr mittags verkauft wurden. Aber heutzutage ist das Angebot an Leichen zu Studienzwecken sehr rar. Diese da – ein sechzehnjähriger Junge, der heute morgen an einer Kongestion der Lunge gestorben ist – hat uns die staatliche Wohlfahrtsbehörde überlassen. Doch heute abend werden Sie noch nicht sezieren. In einer späteren Vorlesung werden wir die Leiche unter Ihnen aufteilen, zwei von Ihnen werden je einen Arm zur Untersuchung bekommen, zwei je ein Bein und die restlichen den Rumpf.«
Während Dr. Holmes erklärte, was sein Assistent tat, öffnete Rob J. den Brustkorb des Jungen und begann, die Organe zu entfernen und zu wiegen, wobei er jedesmal das Gewicht mit lauter Stimme verkündete, damit der Professor es aufschreiben konnte. Danach mußte er auf verschiedene Körperpartien deuten, um zu illustrieren, was der Professor sagte. Holmes sprach stockend und mit hoher Stimme, doch Rob J. merkte sehr schnell, daß die Studenten seine Vorlesung als Leckerbissen betrachteten. Er scheute vor derben Ausdrücken nicht zurück, und um zu demonstrieren, wie der Arm sich bewegt, markierte er einen kräftigen Aufwärtshaken; zur Erläuterung des Bewegungsablaufs des Beins schwang er seines hoch in die Luft, und um zu zeigen, wie die Hüfte funktioniert, vollführte er einen Bauchtanz. Die Studenten hingen an seinen Lippen und verfolgten jede seiner Bewegungen, und am Ende der Vorlesung bedrängten sie ihn mit Fragen. Der Professor beantwortete sie und ließ dabei seinen neuen Assistenten nicht aus den Augen, der in der Zwischenzeit die Leiche und die anatomischen Präparate in den Konservierungstank legte, den Tisch schrubbte und dann die Instrumente reinigte, abtrocknete und aufräumte. Rob J. wusch sich gerade gründlich die Hände, als der letzte Student ging.
»Sie waren nicht schlecht.«
Warum auch nicht, wollte Rob J. sagen, es ist schließlich eine Arbeit, die auch jeder intelligente Student verrichten kann. Statt dessen ertappte er sich bei der Frage, ob er einen Vorschuß erhalten könne.
»Ich habe gehört, Sie arbeiten für die Dispensary. Ich habe selbst einmal für diesen Verein gearbeitet. Verdammt harte Arbeit, bei der man bestimmt nicht reich wird. Aber sehr lehrreich.« Holmes nahm zwei Fünf-Dollar-Scheine aus seiner Brieftasche. »Genügt ein halber Monatslohn?«
Rob J. versuchte, sich die Erleichterung nicht allzusehr anmerken zu lassen, als er Dr. Holmes versicherte, daß dies genüge. Sie löschten die Lampen, verabschiedeten sich am Fuß der Treppe und gingen ihrer Wege. Als Rob J. an einer Bäckerei vorbeikam, nahm ein Mann eben Tabletts mit Gebäck aus dem Fenster, weil er den Laden schließen wollte, und Rob J. ging hinein und kaufte sich zur Feier des Tages zwei Brombeertörtchen.
Er hatte vor, sie auf seinem Zimmer zu verspeisen, doch im Haus an der Spring Lane war das Dienstmädchen noch auf und wusch das Geschirr. Er ging in die Küche und zeigte ihr die Törtchen. »Eins gehört dir, wenn du mir hilfst, ein bißchen Milch zu klauen.«
Sie lächelte. »Brauchst nicht zu flüstern! Sie schläft schon.« Sie deutete nach oben, wo Mrs. Burtons Zimmer lag. »Wenn die mal schnarcht, weckt sie nichts mehr auf.« Sie trocknete sich die Hände ab und holte Milch, dazu zwei saubere Tassen. Sie heiße Margaret Holland, sagte sie, aber jeder nenne sie Meg. Nach dem Festmahl klebte ihr ein Milchbart an der Oberlippe, und er beugte sich über den Tisch und wischte ihn mit ruhigen Chirurgenfingern weg.
Die Anatomiestunde
Sehr schnell entdeckte Rob J. den schrecklichen Makel, welcher der Arbeitsweise der Dispensary anhaftete. Die Namen auf den Scheinen, die er jeden Morgen erhielt, waren nicht die der am schwersten Erkrankten im Fort Hill Viertel. Die medizinische Versorgung erwies sich als ungerecht und undemokratisch. Die Patientenscheine wurden an die reichen Spender der Organisation verteilt, und die füllten sie aus, um sie an jene weiterzugeben, die sie mochten, meistens an ihre eigene Dienerschaft als Belohnung. Häufig wurde er zu Leuten gerufen, die nur geringfügige Beschwerden hatten, während ein paar Türen weiter ein Mittelloser ohne ärztliche Betreuung starb. Der Eid, den er geleistet hatte, verbot ihm, Schwerstkranke unbehandelt zu lassen, doch wenn er seine Stelle behalten wollte, mußte er eine große Anzahl von Scheinen abliefern und nachweisen, daß er die Patienten behandelt hatte, deren Namen auf diesen standen.
Eines Abends sprach er nach der Vorlesung mit Dr. Holmes über dieses Problem. »Als ich für die Dispensary gearbeitet habe«, sagte der Professor, »habe ich bei den Freunden meiner Familie, die gespendet haben, unausgefüllte Behandlungsscheine gesammelt. Ich werde das wieder tun und sie Ihnen geben.« Rob J. war dankbar dafür, doch seine Stimmung wurde nicht besser. Er würde nie genug Blankoscheine zusammenbringen, um alle bedürftigen Patienten in seinem Distrikt behandeln zu können. Dazu hätte man eine ganze Armee von Ärzten gebraucht.
Oft war es der einzige Lichtblick seines Tages, sich spätabends, wenn er in die Spring Lane zurückkehrte, ein paar Minuten zu Meg Holland in die Küche zu setzen und mit ihr heimlich beiseite geschaffte Überbleibsel zu essen. Er gewöhnte es sich an, ihr kleine Geschenke mitzubringen, eine Tüte heiße Maronen, ein Stück Ahornzucker oder ein paar gelbe Pippinäpfel. Das irische Mädchen erzählte ihm den Hausklatsch: daß Mr. Stanley Finch – dieser Aufschneider! – ein Mädchen geschwängert habe und ausgerissen sei, daß Mrs. Burton einmal sehr nett und dann wieder unausstehlich sein könne oder daß der Hausdiener Lem Raskin, der im Zimmer neben Rob J. wohnte, einen mächtigen Durst habe.
Nach etwa einer Woche ließ sie sehr beiläufig die Bemerkung fallen, daß Lem, wenn man ihm ein Viertel Brandy spendiere, alles auf einmal austrinke und dann nicht mehr wach zu kriegen sei.
Am folgenden Abend bezahlte Rob J. Lemuel sein Quantum Brandy.
Die Wartezeit wurde ihm lang, und mehr als einmal sagte er sich, daß das Mädchen ihn an der Nase herumgeführt habe. In dem alten Haus gab es eine Unzahl von nächtlichen Geräuschen, knarrende Dielen, Lems kehliges Schnarchen und immer wieder geheimnisvolles Knacken in den hölzernen Zwischenwänden. Schließlich hörte er ein sehr leises Geräusch an der Tür, nur die Andeutung eines Klopfens, und als er öffnete, schlüpfte Margaret Holland, schwach nach Frau und Geschirrwasser riechend, herein, flüsterte, daß es eine kalte Nacht werde, und streckte ihm zur Rechtfertigung ihres Kommens eine fadenscheinige zusätzliche Decke entgegen.
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel »Shaman« bei E. P. Dutton, New York.
9. Auflage Taschenbuchausgabe 4/2003 Copyright © der Originalausgabe 1992 by Noah Gordon Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2002 by Karl Blessing Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Deutsche Übersetzung aus dem Amerikanischen von Klaus Berr Copyright © 1992 Droemer Knaur Verlag, München Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagmotiv: corbis Satz:Uhl+Massopust, Aalen BH · Herstellung: Str.
eISBN 978-3-641-13278-1
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de