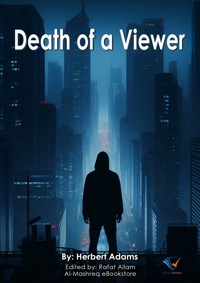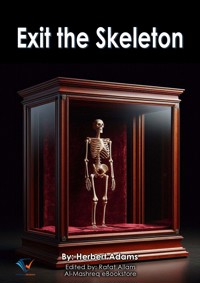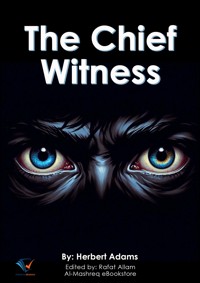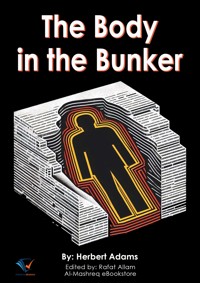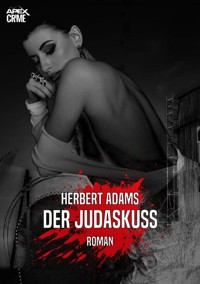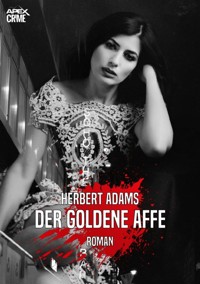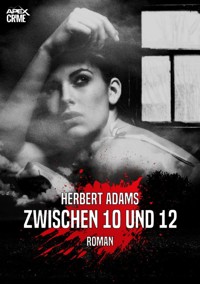6,99 €
Mehr erfahren.
Während der kurzen Fahrt hatten sich die jungen Mädchen flüsternd geeinigt, den Vater zum Kauf dieses Hauses zu überreden, wenn es nur halbwegs ihren Wünschen entspräche. Sie waren der Jagd nach einem Heim schon gründlich müde. Sie sehnten sich nach einem Haus, in dem jedes der Kinder ein eigenes großes Schlaf- und womöglich auch ein Wohnzimmer haben konnte. Als aber Roberts, der Chauffeur, das Tor geöffnet hatte und sie in einen gähnenden, schwarzen Schlund hineinblickten, sanken ihre Hoffnungen.
Vier große, runde Steinsäulen in der Halle trugen eine schwerfällige Steingalerie, auf der wieder vier Steinsäulen standen, die abermals eine zum nächsthöheren Stockwerk gehörige Steingalerie trugen. Das Erdgeschoss lag etwas vertieft, die Fenster waren fast lichtdicht verschlossen. Es schien nichts außer Acht gelassen zu sein, das Haus so finster und ungewöhnlich wie nur möglich zu machen...
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Der Schatz von Queens Gate erschien erstmals im Jahr 1927; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1955.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HERBERT ADAMS
Der Schatz
von Queens Gate
Roman
Apex Crime, Band 164
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DER SCHATZ VON QUEENS GATE
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
Das Buch
Während der kurzen Fahrt hatten sich die jungen Mädchen flüsternd geeinigt, den Vater zum Kauf dieses Hauses zu überreden, wenn es nur halbwegs ihren Wünschen entspräche. Sie waren der Jagd nach einem Heim schon gründlich müde. Sie sehnten sich nach einem Haus, in dem jedes der Kinder ein eigenes großes Schlaf- und womöglich auch ein Wohnzimmer haben konnte. Als aber Roberts, der Chauffeur, das Tor geöffnet hatte und sie in einen gähnenden, schwarzen Schlund hineinblickten, sanken ihre Hoffnungen.
Vier große, runde Steinsäulen in der Halle trugen eine schwerfällige Steingalerie, auf der wieder vier Steinsäulen standen, die abermals eine zum nächsthöheren Stockwerk gehörige Steingalerie trugen. Das Erdgeschoss lag etwas vertieft, die Fenster waren fast lichtdicht verschlossen. Es schien nichts außer Acht gelassen zu sein, das Haus so finster und ungewöhnlich wie nur möglich zu machen.
Herbert Adams (* 1874 in Dorset, South West England; † 1958) war ein englischer Schriftsteller. Adams veröffentlichte beinahe sechzig Kriminalromane; viele unter seinem eigenen Namen, einige unter dem Pseudonym Jonathan Gray. Seine Leser – wie auch die Literaturkritik – verglichen Adams oft mit seiner Kollegin Agatha Christie.
Der Roman Der Schatz von Queens Gate erschien erstmals im Jahr 1927; eine deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1955.
Der Apex-Verlag veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers der Kriminal-Literatur in seiner Reihe APEX CRIME.
DER SCHATZ VON QUEENS GATE
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Mr. Theodor Schildkrot war gründlich verärgert. Er stampfte auf den kostbaren Perserteppich, fluchte und versetzte dem Papierkorb einen Fußtritt, dass er bis zur Feuerstelle des Kamins rollte. Lady Rowan hatte Glenton-Cottage gekauft. Dieselbe Lady Rowan, die ihm versichert hatte, sie werde es ihm überlassen, ein geeignetes Heim für sie ausfindig zu machen, hatte Glenton-Cottage, diesen reizenden und wertvollen Landsitz, erworben – und zwar durch Vermittlung eines aufstrebenden Konkurrenten, während er doch gedacht hatte, mit dem Verkauf sei einzig und allein er betraut. Als er ihr vorgeschlagen hatte, das Gut zu besichtigen, hatte sie mit der Begründung abgelehnt, es sei für sie zu groß, sie brauche nur ein einfaches Landhaus und werde keinesfalls in einen verkleideten Stall ziehen. Und jetzt hatte sie Glenton-Cottage doch gekauft, und ein anderer steckte die fette Provision ein.
Mr. Theodor Schildkrot war ein beleibter Herr und schon über die besten Jahre hinaus. Seine Augen hatten einen müden Ausdruck: die Enttäuschungen durch doppelzüngige Damen, die einen Wohnsitz suchten und ihn dann durch einen anderen Makler erwarben, waren nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er führte nämlich eine Maklerfirma und war gleichzeitig vereidigter Texator für Häuser und Grundstücke. Nach einer merkwürdigen Gewohnheit seines Berufs nannte sich seine Firma Schildkrot & Schildkrot, obwohl Theodor beide Schildkröten in einer Person verkörperte. Er hatte ein ziemlich gutgehend geführtes Geschäft, wenn auch die draufgängerische Art jüngerer Leute ihm schon manchen Abbruch getan hatte. Leute, die sich wegen eines Häuserkaufs oder anderen Verkaufs an ihn wandten, liebte er seine Klienten zu nennen, und er war wirklich immer bestrebt, ihre Interessen möglichst gut wahrzunehmen. Begreiflicherweise war er daher schwer gekränkt, wenn ihm jemand, für den er sich bemüht hatte, kaltblütig erklärte, er habe schon, dank fremder Vermittlung, das Richtige gefunden. Wenn es sich aber noch, wie in dem Fall der Lady Rowan, um ein Haus handelte, das er selbst angepriesen hatte, dann konnte er nichts als fluchen und seinen Papierkorb misshandeln.
In diesem Augenblick trat ein hübsches Tippfräulein ins Zimmer: »Sir Josiah Kellock möchte Sie sprechen, Sir.« Dann stellte sie den Papierkorb an seinen alten Platz und suchte die auf dem Teppich zerstreuten Briefumschläge zusammen.
Mr. Schildkrots Miene heiterte sich auf. Sir Josiah Kellock! Das war ein Klient, der ihn sicher nicht sitzenließ.
»Ich lasse bitten«, sagte er, und sein Gesicht drückte Hochachtung, aber auch Leutseligkeit aus – ein Ausdruck, mit dem er einen Mann von großem Reichtum aber niedriger Herkunft zu empfangen pflegte. Mr. Schildkrot bemühte sich stets, für jeden Besucher die richtige Miene aufzusetzen, und obwohl sich seine Kundschaft aus allen Gesellschaftsschichten zusammensetzte – vom bescheidenen Wohnungssuchenden bis zum Herzog mit Ansprüchen auf ein einsames Schloss –, traf er fast immer den für den jeweiligen Fall passenden Ton.
»Na, hören Sie mal, Schildkrot, ich verstehe nicht, dass Sie nichts Geeignetes für mich finden können. Was Sie mir bis jetzt vorgeschlagen haben, kommt ja gar nicht in Betracht.«
Mit diesen Worten betrat Sir Josiah das Büro. Ihm folgten seine zwei Töchter, von denen noch keine zwanzig Jahre alt war. Sir Josiah Kellock war der stolze Vater von sechs Kindern. Nur das letzte war ein Junge, ein Beweis dafür, dass man mit Ausdauer immer noch das Ziel erreicht.
Sir Josiah traf keinerlei Anstalten, Mr. Schildkrot durch Handschütteln zu begrüßen, der dies übrigens auch gar nicht erwartete. Ein Herzog von blauestem Geblüt würde es vielleicht getan haben, ein solcher Emporkömmling nie!
»Ich bedaure unendlich, das zu hören, Sir Josiah. Aber wollen Sie nicht, bitte, Platz nehmen? Welche Häuser haben Sie denn angesehen?«
»Alle. Wie sich Menschen in solchen Schweineställen wohl fühlen können, ist mir unverständlich. Die Aufenthaltsräume gingen ja noch an, aber die Schlafzimmer – großer Gott! Wenn in einem der Häuser zwei anständige Schlafräume zu finden waren, so war es schon viel. Die anderen waren nicht größer als Wandschränke. Keine Katze hätte man darin am Schwanz herum wirbeln können.« Die richtige Antwort wäre vielleicht gewesen, dass leider viele alte, schöne Bräuche immer mehren Vergessenheit geraten und man heute in Schlafzimmern nur noch selten Katzen am Schwänze herumzuwirbeln pflegt, aber Mr. Schildkrot beherrschte sich und sagte: »Ganz richtig, ganz richtig. Aber haben Sie auch wirklich schon Nr. 90 am Belgrave Square besichtigt?«
»Oh ja. Ein ebensolcher Stall. Hören Sie mich jetzt an. Ich brauche ein Haus mit fünfzehn anständigen Schlafzimmern. Es ist mir gleichgültig, in welchem Zustand es sich befindet. Ich kann es leicht in Ordnung bringen lassen. Auch der Preis ist mir gleich. Aber ich muss große Zimmer haben. Sie müssen bedenken, dass ich nur mit Leuten verkehre, die schöne Landhäuser oder Schlösser besitzen. Was sollen die anfangen, wenn sie in die Stadt kommen? Ich muss sieben große Schlafzimmer haben. Verstehen Sie mich?«
»Die Übrigen können kleiner sein. Können Sie mir etwas Geeignetes vorschlagen?«
»Tja... Da wäre vielleicht Nr. 317 in Knightsbridge? Das ist ein ungemein geräumiges Gebäude, das einst der Herzog von Sporran bewohnte. Es ist...«
»Nichts wert, nicht zu gebrauchen. Ich habe es angesehen. Ein anderer Makler hat mir’s nämlich auch schon empfohlen.«
Das bohrte sich wie ein Dolchstoß in das Herz des armen Schildkrot. Sollte sich am Ende Sir Josiah auch als ein abtrünniger Kunde entpuppen, wie diese falsche Lady Rowan? Aber der wackere Schildkrot verbarg seine Gefühle.
»Ganz richtig, ganz richtig. Ich habe mir auch gedacht, dass es nicht das Rechte für Sie sei. Es liegt an einer lärmerfüllten Hauptverkehrsader. Kein Haus für einen Edelmann.« Natürlich konnte es kein Haus für einen Edelmann sein, wenn jemand anders es angepriesen hatte! »Es ist eben schwer, Sie zufriedenzustellen, Sir Josiah? Würde Ihnen vielleicht etwas am Portland Place oder am Grosvenor Square zusagen?«
»Mir ist’s ganz gleichgültig, wo ich wohne. Aber ich muss Luft zum Atmen haben und Raum genug, dass meine Kinder ihre Freunde einladen können.«
»Ganz richtig. Ich werde mich bemühen, etwas Ihren Bedürfnissen Entsprechendes zu finden. Überläsen Sie das nur mir, Sir Josiah, ich kann Ihnen so ziemlich jedes Haus in London verschaffen. Aber da fällt mir gerade etwas ein... Wie war’s mit einem etwas altertümlichen, aber sehr geräumigen Haus in Queens Gate?« Herr Schildkrot brachte es etwas zögernd hervor. Es war ihm gerade ein leerstehendes, großes Stadthaus in den Sinn gekommen, aber er wusste nicht recht, ob er es empfehlen solle.
»Warum nicht in Queens Gate? Um welches handelt es sich?«
»Um Nr. 142. Die Raumeinteilung würde Ihren Wünschen vollkommen entsprechen. Es hat schöne Empfangsräume, darunter einen Salon, der fast schon ein Saal zu nennen ist, und siebzehn, meist sehr geräumige, Schlafzimmer.«
»Und was hat es für einen Haken damit?« Sir Josiah hatte der verlegenen Art des Maklers entnommen, dass beträchtliche Schattenseiten vorhanden sein dürften.
»Es ist, wie schon gesagt, sehr altmodisch.«
»Das würde nichts machen. Leicht in Ordnung zu bringen. Wie viele Badezimmer?«
»Bedauerlicherweise gar keine. Und elektrische Beleuchtung ist auch noch nicht gelegt. Das Haus steht schon seit Jahren leer.«
»Hört sich eher an, als wäre es seit Jahrhunderten unbewohnt«, meinte Maisie Kellock, die jüngere der beiden Töchter. »Geistert es vielleicht darin?«
»Aber nein, gnädiges Fräulein«, beeilte sich Schildkrot im Brustton der Überzeugung zu widersprechen. »Es ist nur lange Jahre hindurch von einer alten Klientin von mir, einer hochschätzbaren Dame, bewohnt worden, die keine Veränderungen zulassen wollte. Sie hasste alles Neuzeitliche. Als die Dame dann starb, war es natürlich nicht gut möglich, das Haus zu verkaufen; man hätte eine Menge Umbauten vornehmen müssen, um es modernen Anforderungen entsprechend zu gestalten. Auch erfordert es wegen seiner Größe eine zahlreiche Dienerschaft, was in unseren Zeiten schwer ins Gewicht fällt. Aber es besitzt viele und große Räume, und kann, wenn man es sich etwas kosten lassen will, sehr gut modernisiert werden.«
»Das ist für mich die Hauptsache«, erklärte der neugebackene Edelmann. »Und Dienerschaft findet man immer, wenn man nur zahlen kann.«
»Ganz richtig, ganz richtig«, stimmte Mr. Schildkrot bei, der mit einem Millionär zu sprechen pflegte, als wäre er auch einer. »Dieser Palast – man kann ruhig Palast sagen – ist in hervorragender Weise geeignet, sich in eine Stätte gepflegter Wohnkultur zu verwandeln, wenn er in den Besitz eines großzügigen Mannes gelangt, Sir Josiah.«
»Was ist der Preis und wie lange läuft die Grundpacht?«
»Der Pachtvertrag läuft allerdings nur noch fünfundzwanzig Jahre, aber der Preis ist sehr niedrig. Da der Grundzins nur fünf Pfund jährlich beträgt, wäre der Schätzungswert mit mindestens fünftausend zu berechnen. Ich würde Ihnen aber angesichts der bestehenden Schwierigkeiten das Haus zu dem halben Preis, also für zweitausendfünfhundert Pfund, anbieten.«
»Scheint mir auch reichlich genug, wenn man mindestens das Doppelte hineinstecken muss, um es überhaupt bewohnbar zu machen. Und nur für fünfundzwanzig Jahre? Na, für mich alten Herrn wird das gerade noch reichen, und die Jungen sollen sich dann selbst ein neues Nest suchen. Kommt, Mädels, wir wollen uns den Kasten ansehen.«
»Hm, hm... Es ist kein Aufseher im Haus, Sir Josiah. Ich habe den Schlüssel hier. Vielleicht würden Sie mir gestatten, es Ihnen selbst zu zeigen?«
Der Besucher verstand die Ehrung nicht zu würdigen, die in diesem Angebot lag: für gewöhnlich nämlich überließ Mr. Schildkrot seinen Angestellten die Führung durch die Häuser.
»Bemühen Sie sich nicht«, sagte der Baron. »Mein Chauffeur kann uns ganz gut das Haus aufschließen und Ihnen dann den Schlüssel zurückbringen. Ihr Angestellter spricht immer viel zu viel, wenn er einem ein Haus zeigt, und will einen beschwatzen. Ich ziehe es vor, alles in Ruhe zu besichtigen und mir meine eigene Meinung zu bilden. Ein wenig Staub und Spinnweben werden uns nicht umbringen – was, Mädels?«
»Ich denke, was wir bisher sahen, hat uns schon einigermaßen abgehärtet«, meinte Dorothea, die ältere Tochter. »Oder kommt es noch schlimmer?« Sie lächelte dabei gutmütig, und Hoffnung zog in Schildkrots Brust ein.
»Nicht so arg, gnädiges Fräulein. Staubig wird es wohl sein. Ich fürchte, dass schon seit Wochen oder gar Monaten kein Mensch das Haus betreten hat. Aber es bietet wunderbare Ausgestaltungsmöglichkeiten, das müssen Sie im Auge behalten. Sie müssen es sich vorstellen, wie es nach einer gründlichen Reparatur und den nötigen Veränderungen aussehen wird: frisch angestrichen und tapeziert, mit neuen Badezimmern, kurz, vollkommen modernisiert. Die Lage ist ebenfalls ganz vorzüglich.«
»Sie meinen wohl wegen der Nähe des Naturhistorischen Museums, nicht? Oder noch aus anderen Gründen? Da muss ich Ihnen nämlich erklären, dass weder meine Schwestern noch ich sehr viel für ausgestopfte Viecher übrighaben.«
»Komm doch, Dorothea«, fiel ihr der Vater ins Wort. »Wir dürfen Mr. Schildkrot nicht länger aufhalten.« Und er schob seine Töchter zur Tür hinaus.
Der blitzende Rolls Royce sauste am Museum vorbei, über das sich Fräulein Dorothea ebenso geringschätzig geäußert hatte, und fuhr bald an einem großen, düsteren Gebäude vor.
Während der kurzen Fahrt hatten sich die jungen Mädchen flüsternd geeinigt, den Vater zum Kauf dieses Hauses zu überreden, wenn es nur halbwegs ihren Wünschen entspräche. Sie waren der Jagd nach einem Heim schon gründlich müde. Sie sehnten sich nach einem Haus, in dem jedes der Kinder ein eigenes großes Schlaf- und womöglich auch ein Wohnzimmer haben konnte. Als aber Roberts, der Chauffeur, das Tor geöffnet hatte und sie in einen gähnenden, schwarzen Schlund hineinblickten, sanken ihre Hoffnungen.
Vier große, runde Steinsäulen in der Halle trugen eine schwerfällige Steingalerie, auf der wieder vier Steinsäulen standen, die abermals eine zum nächsthöheren Stockwerk gehörige Steingalerie trugen. Das Erdgeschoss lag etwas vertieft, die Fenster waren fast lichtdicht verschlossen. Es schien nichts außer Acht gelassen zu sein, das Haus so finster und ungewöhnlich wie nur möglich zu machen.
»Gehen Sie hinein und öffnen Sie die Fensterläden«, befahl Sir Josiah.
Roberts gehorchte.
Der Baron und seine Töchter warteten am Eingang. Allmählich gewöhnten sich ihre Augen an das Dunkel, das sich lichtete, als die Fenster in den unteren Zimmern und die Türen geöffnet wurden. Dann erst betraten sie das Haus.
Die Tapeten in der Halle waren von der Art, wie sie der frühviktorianischen Epoche so sehr zusagte. Die Zeit hatte sie dunkelgelb gefärbt, doch waren sie noch in gutem Zustand; wahrscheinlich waren sie seit fünfzig Jahren nicht berührt worden.
Zu ebener Erde lag nach vorn ein riesiger Speisesaal mit dunkler, bis zur Decke reichender Eichentäfelung. Daran schloss sich ein kleinerer Raum, dessen einziges Fenster auf einen düsteren Lichtschacht mit abbröckelndem Kalkbewurf ging. Auch das Fenster eines dritten Zimmers mündete in diesen Lichtschacht. Dann kam ein finsteres Stiegenhaus mit einer Steintreppe für die Dienstboten, und schließlich ein Hinterzimmer, das verhältnismäßig hell zu nennen war, weil sein Fenster auf einen Hof mit niederen Gebäuden – offenbar Stallungen oder eine Garage – hinausging.
»Der Architekt, der den Plan zu diesem Haus entworfen hat, verdiente erschossen zu werden«, entrüstete sich Sir Josiah.
»Vielleicht ist er auch erschossen worden«, stimmte Maisie bei, »aber dann jedenfalls mit Pfeilen im Mittelalter.«
»Mein Baumeister könnte aber immerhin etwas daraus machen«, fuhr ihr Vater fort. »Wir könnten die Dienstbotentreppe wegfallen lassen und dafür einen Aufzug einbauen. Ich möchte nur wissen, ob die Garage mit dazugehört?«
Sie stiegen die Haupttreppe hinauf, die sich ganz gut ausnahm.
Ihr Geländer war mit einst bronzefarbenem Samt überzogen, der die Hand beschmutzte, wenn man sich darauf stützte. Am Treppenabsatz war eine Nische in die Wand eingebaut, groß genug für ein mittleres Zimmer. Die Salons befanden sich im ersten Stock.
Es war auf den ersten Blick zu erkennen, dass diese, wenn sie erst einmal mit einem neuen Parkettboden versehen und hübsch eingerichtet waren, sich vorzüglich für Tanzfeste eigneten. Die Laune der Besucher besserte sich zusehends; das Haus erschien ihnen immer weniger gruftähnlich, je höher sie kamen. Die beiden jungen Mädchen eilten voraus, um zu sehen, welche Räume für sie in Frage kommen würden. Sir Josiah folgte etwas langsamer.
»Vierzig Stufen zu zeigen, bis man die Schlafzimmer erreicht!«, keuchte er. Ein Aufzug musste her, das stand bei ihm fest. Da wurde er durch einen Schrei aus seinen Gedanken aufgeschreckt. Er blieb stehen und rief hinauf: »Was ist denn los?«
Ein zweiter Schrei, noch durchdringender als der erste, war die einzige Antwort.
»Was gibt’s? Was ist los?«, rief er nochmals und eilte die Treppe hinauf.,
»Papa! Papa! Rasch!« Es war Dorotheas Stimme; sie klang ganz schrill vor Schreck.
» Ja... Ich komme schon... Was gibt’s denn?«
»Ein Mann... Ein toter Mann...«
»Wie? Was?«, schrie er. Sein Herz pochte heftig gegen die Rippen, als er mit ungewohnter Hast hinter seinen Töchtern herrannte.
»Da drinnen!«, flüsterten die Mädchen mit kreidebleichen Gesichtern, als er sie am Treppenabsatz erreichte. Sie wiesen dabei auf eine kleine, nach rückwärts gelegene dunkle Kammer.
Er betrat den Raum, die Mädchen folgten ihm. Wahrhaftig! Ein in einen grauen Tweedanzug gekleideter Körper lag regungslos auf dem staubigen Fußboden. Sir Josiah bückte sich schweratmend über ihn.
Es war ein anscheinend dreißig bis fünfunddreißig Jahre alter Mann. Allerdings war es schwer, das zu bestimmen. Das Gesicht war durch Wunden entstellt und stark angeschwollen. Geronnenes Blut klebte am Boden. Eine besonders schwere Verletzung war an der Stirn knapp unterhalb der braunen Stirnlocke zu sehen. Nicht weit von dem Leichnam entfernt lag ein steifer Hut. Eine Waffe war nicht zu erblicken.
Sir Josiah hob eine Hand des Toten auf. Sie fühlte sich eisig an und fiel leblos herab, als er sie losließ. Der Leichnam war bereits erkaltet, aber es sah doch nicht so aus, als ob der Tod schon vor längerer Zeit eingetreten wäre.
»Mord!«, keuchte der Baron, »Wo ist Roberts? Die Sache muss gleich der Polizei angezeigt werden. Wer kann es sein?«
»Wir... Wir haben ihn so gefunden«, flüsterte Dorothea mit angstbebender Stimme. »Dürfen wir heimgehen, Vater? Von dem Haus wollen nichts mehr wissen.«
»Dieser verdammte Kerl von einem Makler!«, brummte der Vater. »Er hat doch gesagt, dass seit Monaten niemand das Haus betreten habe. Grenzenlose Schlamperei! Wie kann man auch ein Haus vollkommen unbedacht lassen. Roberts! Roberts!«
Wenn irgendetwas mit einem Haus nicht stimmt, so wird auf den Makler geschimpft. Dazu ist er da. Sir Josiah gehorchte in seiner Empörung nur der alten Regel.
Zweites Kapitel
Jimmie Haswell betrat fröhlich pfeifend seine Kanzlei. Er war ein lustiger Rechtsanwalt – gewiss eine Seltenheit. Hat die Schinderei bei den Examina noch etwas übriggelassen, so löscht die Praxis des trockenen Rechtsanwalt-Betriebs alle Fröhlichkeit restlos aus. Das war aber bei Jimmie durchaus nicht der Fall. Er war frohgemut und hatte allen Grund, es zu sein. Seine Praxis war wohl noch nicht sehr ausgedehnt, aber in stetigem Wachstum begriffen. Er war von Natur aus glücklich veranlagt. Sein gewinnendes, etwas burschikoses Wesen pflegte ihm bei Gericht die Herzen der Geschworenen zu erobern, wenn es ihm auch manchmal eine kleine Rüge seitens des Vorsitzenden eintrug. Aber seine Fröhlichkeit hatte auch noch einen anderen Grund: er war seit kaum sechs Monaten mit dem Mädchen verheiratet, das ihm als das berückendste der Welt erschienen war, und seine Meinung darüber hatte sich noch nicht geändert.
Wer sich an den aufregenden Mord im Zug erinnert, der den, Zeitungen so viel Stoff lieferte, wird vielleicht auch wissen, dass die Geschichte mit der Heirat Jimmie Haswells und Nonna Warrens endete und dass Nonna die Erbin eines großen Vermögens wurde. Jimmie gab deshalb seine Rechtsanwaltspraxis nicht auf, aber er war jetzt in der glücklichen Lage, sich nur mit Fällen zu befassen, die ihn interessierten, und. nicht für jeden kleinen Prozess dankbar sein zu müssen. Wie sollte ein gesunder, junger Mann, den seine schöne, junge, reiche Frau geradezu vergöttert und dessen Geschäft im Aufblühen begriffen ist, nicht fröhlich sein? Jimmie Haswell war jedenfalls keiner von denen, die ihr Glück verkennen.
Das verliebte junge Paar pflegte den Honigmond dadurch zu verlängern, dass es jedes Wochenende auf dem Land verbrachte. Das war auch diesmal der Fall gewesen. Jimmie hatte seine junge Frau nach Haus gebracht und war dann in seine Kanzlei geeilt, um sich mit frischen Kräften auf die Arbeit zu stürzen.
Er fand auf seinem Schreibtisch nicht sehr viel Post vor, aber darunter ein Schreiben, das ihn sehr zu überraschen schien. Er las es zweimal durch. Es war vom Freitag datiert, stammte aus dem Neuen Militärclub in Piccadilly und lautete:
Mein lieber Haswell!
Ich bitte Dich um eine Auskunft über die Rechtsverhältnisse in dem nachstehenden Fall, der jeder tatsächlichen Grundlage entbehrt. Es handelt sich nur um eine Wette.
Eine alte Dame lebte in einem großen, düsteren Haus. Da sie etwas geizig veranlagt war, versteckte sie darin gewisse Wertgegenstände, gleichgültig ob Schmuck oder Geld. Sie starb, und das von ihr bewohnte Haus stand jahrelang leer. Dann findet jemand – nennen wir ihn X – den verborgenen Schatz.
Nun möchte ich Dein Gutachten über folgende Punkte erbitten:
1. Wem gehört der Schatz?
2. Kann X, weil er ihn gefunden hat, irgendwelche Rechtsansprüche darauf erheben?
3. Wird er gesetzlich sein Eigentum, wenn er das Haus kauft?
4. Oder gilt er als gefundenes Gut?
Ich hoffe, Du nimmst es mir nicht übel, dass ich Dich mit solchen Fragen belästige, alter Junge. Die Frage wurde kürzlich im Rauchzimmer des Clubs aufgeworfen, und wir haben mehrere Wetten abgeschlossen. Dein Urteil soll entscheiden, wer gewinnen wird.
Ich habe Dich nun schon seit Deiner Hochzeit nicht mehr gesehen. Gelegentlich werde ich Dich bitten, mich Deiner verehrten jungen Frau vorzustellen.
Stets Dein ergebener
Gregory Brüden
Nachdem Jimmie den Brief das zweite Mal durchgelesen hatte, klingelte er seinem Schreiber und ließ sich die Morgenblätter bringen. Der junge Mann brachte ihm die Times und The Daily Picture. Jimmie nahm das zweite zur Hand und schlug die Tagesneuigkeiten auf. An der Spitze stand ein Artikel mit einer Überschrift in fettgedruckten Lettern:
Das Geheimnis von Queens Gate
Ein Unbekannter in einem verlassenen Haus tot aufgefunden.
Wer ist es?
Was hat er dort gesucht?
Handelt es sich um einen Mord?
Es wurde dann berichtet, wie Sir Josiah Kellock und seine zwei Töchter am Sonnabendmorgen das Haus Nr. 142 in Queens Gate besichtigt und zu ihrem großen Entsetzen in einem der höher gelegenen Zimmer die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt hätten. Die Polizei sei sofort verständigt worden und habe nach eingehender Durchforschung des Gebäudes den Leichnam in die Leichenhalle überführt. Der Tote sei anscheinend durch Schläge mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf umgebracht worden. Der herbeigerufene Arzt habe festgestellt, dass der Tod erst innerhalb der letzten vierundzwanzig Stunden eingetreten sein könne.
Die Leser wurden ferner auf die dazugehörigen Bilder aufmerksam gemacht. Es befand sich darunter eine in der Leichenhalle hergestellte Aufnahme des Getöteten, die ein durch Verletzungen arg entstelltes und daher schwer erkennbares Gesicht zeigte. Außerdem gab es Abbildungen von dem als sehr weitläufig, düster und vollkommen verlassen geschilderten Haus in Queens Gate und ein Portrait jenes Mr. Theodor Schildkrot von der Firma Schildkrot & Schildkrot, den der Sonderberichterstatter des Blattes The Daily Picture interviewt hatte.
Mr. Schildkrot äußerte sich bei dieser Gelegenheit dahin, dass es ihm ganz unmöglich sei, eine Erklärung für das Rätsel zu finden. Schon seit Monaten habe sich außer Sir Josiah Kellock niemand für das Haus interessiert; den Schlüssel habe er nie aus seinen Händen gegeben.
»Wie war das Haus gesichert?«, lautete eine der ersten Fragen, die der Reporter Mr. Schildkrot gestellt hatte.
»Im ganzen Haus waren Türen und Fenster verriegelt, alle Fensterläden geschlossen, das Haustor war mit einem einfachen Sicherheitsschloss versperrt, da es ja zeitweise für Interessenten geöffnet werden musste.«
»Kann das Tor nicht erbrochen worden sein?«
»Kaum ohne Spuren zu hinterlassen, und solche waren nicht vorhanden.«
»Glauben Sie, Mr. Schildkrot, dass der Mord im Gebäude verübt wurde, wenn es sich überhaupt um einen Mord handelt, oder meinen Sie eher, dass das Verbrechen anderswo begangen und nur der Leichnam in dem leerstehenden Haus verborgen wurde?«
»Die zweite Annahme allein scheint mir das Vorhandensein der Leiche im Haus zu erklären. Ich wüsste nicht, was sonst jemand in dem leerstehenden Gebäude gesucht haben sollte. Freilich ist es mir ein Rätsel, wie die Täter hineingelangt sind.«
»Können Sie mir sagen, Mr. Schildkrot, wer der letzte Besitzer und Bewohner des Hauses gewesen ist?«
»Das Haus gehörte einer Miss Octavia Cowley, einer etwas exzentrischen alten Dame, die vor sieben Jahren starb. Seit jener Zeit steht es leer, da es völlig unmodern ist.«
Es waren in der Zeitung noch zahlreiche Einzelheiten angeführt, doch keine war geeignet, das Geheimnis zu erhellen. Weiter unten jedoch entdeckte Jimmie noch eine kurze Mitteilung:
Nach Redaktionsschluss eingegangen:
Das Geheimnis von Queens Gate
Laut polizeilicher Mitteilung ist der Tote als ein gewisser Charles Viney erkannt worden, der in Kennington, Melksham Street Nr. 83, wohnte.
Jimmie blätterte um und sah sich nochmals die Fotographie des fürchterlich entstellten Gesichtes des Ermordeten an.
»Die Schatzinsel in South Kensington!«, brummte er vor sich hin. »Die Gespenster von Robert Louis Stevenson, dem Dichter, und seinem John Silver! Ist es nur ein seltsames Zusammentreffen, oder hat die alte Dame wirklich die düsteren Gewölbe ihrer Behausung mit Goldbarren vollgestopft? Und ist der Schatz noch vorhanden, oder hat ihn bereits jemand an sich gebracht?«
Er nahm aus einer Lade des Schreibtisches eine Lupe und besah sich das Bild genauer. Es wurde unter der Linse wohl größer, aber nicht viel deutlicher.
»Zum Teufel, wer bist du nun wirklich?«, fragte er das stumme Bild. »Man sagt, du seist Charles Viney, aber du könntest ebenso gut auch Gregory Brüden nach einer kleinen besoffenen Rauferei darstellen. Und wenn du Gregory Brüden wärst und es in dem Haus den verborgenen Schatz eines Geizhalses gegeben hätte, so hätte deine Frage nach dem Besitzrecht des Finders einen Sinn gehabt. Natürlich hättest du mir in diesem Fall vorgemacht, es handle sich um eine Wette, damit ich ja nicht einen Anteil an der Beute verlange! Was aber hast du in Ali Babas Zauberhöhle gesucht, wenn du wirklich nur Charles Viney warst, und wer sollte dich getötet haben? Brüden hat sich schon manche kleine Ungehörigkeit geleistet, aber vor einem Mord wäre er doch gewiss zurückgeschreckt. Wenn du aber Brüden bist – und ich bin halb überzeugt, dass du es bist«, fuhr er fort, auf das Bild einzureden, »frage ich, wer dich wohl ermordet haben kann? Woher hast du von dem Schatz erfahren, und warum nennt man dich Charles Viney? Wenn du aber nicht Brüden bist – was ich aufrichtig hoffe –, dann ist Brüden am Leben und ich rede Unsinn.«
Er legte bei diesen Worten das Blatt beiseite, griff nach dem Telefon und ließ sich mit dem Neuen Militärclub verbinden.
»Hier Haswell. Können Sie mir sagen, ob Hauptmann Brüden im Club ist?«
»Ich glaube nicht, Sir. Er ist sogar bestimmt nicht hier, denn seine Post ist noch da.«
»Kommt er alle Tage?«
»Gewöhnlich schon, um seine Briefe abzuholen. Aber ich glaube, dass er seit Freitag nicht mehr hier war.«
»Ich habe am Freitag ein Schreiben von ihm erhalten. Bitte, wollen Sie ihm sagen, er möge mich anrufen.«
»Gewiss, Sir, gern.«
So stand also die Sache. Es war damit noch nicht viel bewiesen, aber immerhin war es auffällig, dass Brüden seit dem Tag des Mordes nicht mehr im Club aufgetaucht war. Wo er wohnte, wusste Jimmie nicht. Er beschloss, am nächsten Tag noch einmal im Club anzurufen. Die Beantwortung der Frage wegen der Wette war ja nicht gar so dringend! Vielleicht hatten bis dahin die Abendblätter schon neue Enthüllungen gebracht.
Jimmie hatte dann den ganzen Tag über mit seinen eigenen Berufsangelegenheiten vollauf zu tun und war recht froh, als er endlich Schluss machen und nach Haus eilen konnte. Er hatte mit Nonna abgemacht, dass sie nach dem fröhlichen Wochenende einen ruhigen Abend daheim verbringen wollten.
Es ist eine oft erörterte und nie entscheidend beantwortete Frage, inwieweit ein Mann seine Berufssachen mit seiner Frau besprechen soll. Priester, Ärzte und Rechtsanwälte sind zweifellos oft die Bewahrer von Geheimnissen, die sie niemals ihrem Ehepartner mitteilen dürften, auch wenn sie ihrer Verschwiegenheit vollkommen sicher wären. Anderseits ist schon mancher Mann leichter zu einer wichtigen Entscheidung gelangt, wenn er berufliche Fragen mit seiner Frau besprochen hat. Sie versteht ja vielleicht die technischen Seiten nicht, aber sie betrachtet alles vom rein menschlichen Standpunkt aus, und das ist oft sehr gut.
Im vorliegenden Fall zögerte Jimmie nicht, ihr die Tatsachen zu erzählen. Sie hatten mit seiner Anwaltspraxis nichts zu tun. Er wies auf das merkwürdige Zusammentreffen hin, dass das Haus, das Brüden in seinem Brief erwähnt hatte, und das in den Zeitungen beschriebene Gebäude eine gewisse Ähnlichkeit zeigten, sowie in beiden Fällen eine alte, exzentrische Dame als einstige Eigentümerin eine Rolle spielte.
»War dieser Hauptmann Brüden ein guter Freund von dir?«, fragte Nonna.
»Nicht gerade ein Busenfreund«, antwortete Jimmie lachend. »Er behauptet, dass ich ihm im Krieg das Leben gerettet hätte – wir retteten uns ja damals fortwährend das Leben, bis wir es verloren. Das war nichts Besonderes. Aber er scheint geglaubt zu haben, dass ich ihm auch jetzt noch aus jeder Verlegenheit heraushelfen müsste, wie ich ihn damals unter einem zusammenbrechenden Unterstand hervorgezogen habe. Und er hat das Zeug, in Verlegenheiten zu geraten. Manchmal brauchte er Geld, um vor dem Eingesperrtwerden bewahrt zu bleiben, dann wieder, um eine Erfindung zu kaufen. Noch öfter bedurfte er meiner Bürgschaft, um einer Polizeistrafe zu entgehen. Einmal lieh ich ihm Geld, damit er nach Amerika fahren könne, er verlor es aber beim Rennen. Er war ein gutmütiger Kerl – ihn hatte der Krieg entwurzelt, und er fand sich nachher nicht mehr zurecht.«
»Was ist gefundenes Gut, Jimmie?«, fragte Nonna, nachdem sie Brüdens Brief noch einmal gelesen hatte.
»Du bist ein gefundener Schatz, Liebling«, gab er zur Antwort und legte seinen Arm um sie. »Etwas sehr, sehr Kostbares. Die Regierung könnte dich für sich in Anspruch nehmen, wenn ich nicht beweisen könnte, dass du mir gehörst.«
»Hab’ gar kein Verlangen nach der Regierung«, flüsterte sie, während sie ihren Kopf an seine Schulter legte und ihm verliebt in die Augen sah. Er benahm sich den Umständen entsprechend. Die Unterhaltung wurde daher abgebrochen.
Da sie bisher kein eigenes Haus gefunden hatten, bewohnten sie eine möblierte Wohnung in einem der entzückendsten Häuser Londons. Wer hätte gedacht, dass keine hundert Meter von einem so lärmenden Platz wie dem des South-Kensington-Bahnhofs zwei Reihen netter Villen standen, jede mit einem großen Garten, eine sogar mit Tennisplatz, wildem Wein, Brombeeren und Geißblatt? Und doch war es so. Von der staubigen Straße, die vom Bahnhof ihren Ausgang nimmt, zweigt ein Pfad ab, von dem aus der Neugierige die Häuschen erspähen kann, denen eine hohe Mauerumfriedung eine noch heimlichere Note verleiht.
Haswells Haus hatte nur zwei Stockwerke. In der Mitte lag die kleine Halle, zur einen Seite das Speisezimmer und die Küche, zur anderen eine Bibliothek und ein großer Salon, die miteinander verbunden waren. Die Küche hatte einen eigenen Eingang. Nach dem Garten war eine über zehn Meter lange Veranda vorgebaut, auf der Jimmie und Nonna an diesem angenehmen Sommerabend saßen.
»Aber wenn es in dem dunklen, alten Haus einen Schatz gibt«, sagte Nonna, zu ihrem Gesprächsthema zurückkehrend, »wem gehört der dann wirklich?«
»Nicht der Person, die ihn findet, auch dann nicht, wenn sie das Haus kauft«, antwortete Jimmie. »Natürlich könnte der Finder den Schatz verhehlen, und niemand würde etwas wissen. Der Schatz gehört den gesetzlichen Erben der Person, die ihn versteckt hat.«
»Hauptmann Brüden wäre also nicht der Besitzer geworden?«
»Rechtmäßig nicht. Aber das Ganze ist ja ein wüster Traum? Wer hat denn je von dem Schatz eines Geizhalses in Queens Gate gehört? Armer, alter Brüden! Das sähe ihm übrigens ganz ähnlich, irgendeinem Hirngespinst nachzujagen. Ich hoffe, dass er nicht verunglückt ist.«
»Was hast du vor, Jimmie?«