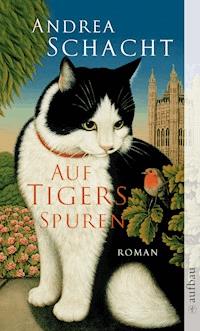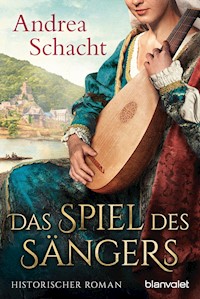7,99 €
7,99 €
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2009
Anita, eine junge Kölnerin, muss miterleben, wie die Maschine, mit der sie fliegen sollte, beim Start explodiert. In den Sekunden, bevor sie das Bewusstsein verliert, sieht sie drei ähnliche Feuerszenen vor sich... Annik, eine keltische Barbarin, zieht es im Jahr 98 nach Colonia. Von ihrem Geliebten erhält sie einen Siegelring - den sie eines Nachts bei einem keltischen Ritual in den Wäldern opfert. Kurz darauf wird ihr Geliebter tot aufgefunden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe November 2003 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © 2003 by
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlagmotiv: akg-images Lektorat: Silvia Kuttny Redaktion: Petra Zimmermann Herstellung: Heidrun Nawrot
ISBN : 978-3-641-03068-1V002
www.blanvalet.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Buch
Autorin
A Lieferbare Titel:
Lob
Dramatis Personae
Vorwort
1. Kapitel – Wiederkehr
2. Kapitel – Explosion
3. Kapitel – Die Seherin
4. Kapitel – Aufwachen
5. Kapitel – Das Testament
6. Kapitel – Rose
7. Kapitel – Der Siegelring
Ad perpetuam memoriam – Zum immerwährenden Gedenken
8. Kapitel – In den Wäldern
9. Kapitel – Die Colonia
10. Kapitel – Der Fotograf
11. Kapitel – Die Herrin des Hauses
12. Kapitel – Der Barde
13. Kapitel – Titus Valerius Corvus
14. Kapitel – Ausstellung
15. Kapitel – Leben auf dem Gut
16. Kapitel – Katzentatzen
17. Kapitel – Ein Bad und ein Fest
18. Kapitel – Der Auftrag
19. Kapitel – Amokfahrt
20. Kapitel – In den Wäldern
21. Kapitel – Hinterhalt
22. Kapitel – Besuch des Matronentempels
23. Kapitel – Überfall
24. Kapitel – Valerius’ Besuch
25. Kapitel – In den Wäldern
26. Kapitel – Das Stilett
27. Kapitel – Gewährte Bitte
28. Kapitel – In den Wäldern
29. Kapitel – Der Tod des Ofensetzers
30. Kapitel – In der Küche
31. Kapitel – Das Opfer
32. Kapitel – Falcos Besuch
Gegenwart
33. Kapitel – Ein Erlebnis
34. Kapitel – Anderwelt
Copyright
Buch
Die junge Kölnerin Anita Kaiser erfährt auf dem Weg zu einem Ferienort, dass ihr Vater tödlich verunglückt ist. Sofort bricht sie die Reise ab und bucht den Rückflug – und muss miterleben, wie die Maschine, mit der sie eigentlich hätte fliegen sollen, beim Start explodiert. Von Trümmerteilen getroffen, sieht sie in den letzten Sekunden, bevor sie das Bewusstsein verliert, blitzartig drei ähnliche Feuerszenen wie einen Film vor sich ablaufen. Szenen, die ihren Tod bedeuteten… Doch eine innere Stimme sagt ihr: Diesmal nicht!
Anita überlebt das Unglück und erfährt, dass ihr verstorbener Vater noch eine weitere, uneheliche Tochter hat: ihre Halbschwester Rosewita. Bald schon stellen die beiden fest, dass ihr Vater ihnen von Kindheit an ganz ähnliche Geschichten erzählt hat. Geschichten, in denen drei besondere Ringe eine schicksalhafte Rolle spielen. Diese Ringe gehörten einer keltischen Töpferin im Köln der Römerzeit, einer Stiftsdame im mittelalterlichen Köln und einem französischen Flüchtlingsmädchen im Köln des beginnenden 19. Jahrhunderts…
Autorin
Andrea Schacht, Jahrgang 1956, war lange Jahre als Wirtschaftsingenieurin in der Industrie und als Unternehmensberaterin tätig, hat dann jedoch den seit Jugendtagen gehegten Traum verwirklicht, Schriftstellerin zu werden. Sie lebt heute mit ihrem Mann bei Bad Godesberg und wird von zwei Katzen betreut, die gern auf dem Schreibtisch sitzen und mit spitzer Kralle den Gedankenfluss in Schwung bringen.
A Lieferbare Titel:
Die Ring-Trilogie: Der Siegelring (35990), Der Bernsteinring (36033), Der Lilienring (36034)
Die Beginen-Romane:Der dunkle Spiegel (36280), Das Werk der Teufelin (36466), Die Sündeaber gebiert den Tod (36628), Die elfte Jungfrau (36780)
Die Lauscherin im Beichtstuhl. Eine Klosterkatze ermittelt (36263),Kreuzblume (geb. Ausgabe, 0220), Rheines Gold (36262)
»Gemäß eurer Vorstellung, Gallier, erreichen die Schatten nicht die stillen Plätze der Unterwelt. Der Geist des Toten belebt vielmehr einen anderen Körper in einer anderen Welt. Wenn das, was ihr singt, der Wahrheit entspricht, so ist der Tod nur die Mitte eines langen Lebens.«
Lukan, De bello civili (1.Jh.)
Dramatis Personae
In römischer Zeit
Annik, die Barbarin – unternehmungslustige Töpferin, die sich mit ihrem Freund Rayan auf den Weg von Nordgallien an den Rhein macht und dort ihrem Schicksal begegnet.
Rayan, später Martius genannt - junger Gallier, der sich auf Pferde versteht und eine Vorliebe für die römische Kultur entwickelt, insbesondere, wenn sie von der Weiblichkeit präsentiert wird.
Titus Valerius Corvus - Patrizier, einst Quaestor in der Legion, jetzt als Gutsbesitzer und Stadtrat in der Colonia, verkrüppelt durch den Schwerthieb eines Bataver, ansonsten aber ungebrochen.
Ulpia Rosina – seine Frau, versucht ihre Vergangenheit und gelegentlich auch die Gegenwart zu vergessen, indem sie sich der Glasschleiferei widmet. Daneben fasst sie eine bedauerliche Leidenschaft zu einem barbarischen Krieger.
Valeria Gratia – Tochter des Valerius aus erster Ehe, ein fröhliches, wissbegieriges Mädchen auf der Schwelle zur Frau.
Lucilius Aurelius Falco – römischer Offizier auf Europa-Tour, um Pferde und Legionäre einzukaufen. Dazu bekommt er ein paar gallische Draufgaben.
Cullen, der Barde – ein junger Narr, der sich in Annik verliebt hat und sie damit in Schwierigkeiten bringt. Sich selbst bringt er mit seinen Satiren in Schwierigkeiten.
Ursa – die germanische Hausverwalterin und Vertraute des Hausherren, bestechend durch ihre Körpergröße und bärenhafte Statur.
Auf dem Gut: Erwan, der alte Ofensetzer, und Ilan, der Stalljunge, Mechthild, Rosinas Dienerin, Charal, der germanische Verwalter, Berold, der Pächter, Humilius, Gratias Lehrer.
In der Colonia: der gallische Arzt Viatronix, Cosimo, Valerius’ Leibdiener, Gerardus, Hausverwalter in Colonia, Helgard, seine Gattin, Frikka, seine Tochter, und Senator Publius Pontanus, dem ein Ungemach geschieht.
Am Ende der Welt: Deneza, Anniks Mutter, Briag, ihr Vater, Jord, der Druide, Anniks Mann und Mutter Tekla, die gallische Seherin.
In der Gegenwart
Anahita Kaiser, genannt Anita – hat gerade ihr Studium beendet und bummelt in Ferienclubs herum, bis sie einem explodierenden Flugzeug in die Quere kommt. Das ändert einiges in ihrem Leben.
Caesar King, bürgerlich Julian Kaiser - Anitas Vater, ein berühmter Schlagersänger, der den Zenit überschritten hat. Er erzählt mit Leidenschaft Geschichten und weiß verschiedentlich Geheimnisse nur allzu gut zu wahren.
Uschi Kaiser – Anitas Mutter, von labiler Gemütslage, starkem Anlehnungsbedürfnis und milde hysterischem Charakter.
Rosewita van Cleve, genannt Rose – Glasdesignerin, eine etwas schüchterne, aber inspirierte Künstlerin und Restaurateurin antiker Gläser, uneheliche Tochter von Caesar King.
Gracilla Valerie van Cleve, genannt Cilly – Schwester von Rose, ein fröhliches und sensibles Mädchen, das eine mögliche Vergangenheit für bare Münze nimmt.
Marc Britten – Sensations-Fotograf mit dem Hang zum Abenteuer und schönen Frauen, doch von betrüblich unbeständigem Charakter.
Valerius – ein Erlebnis
Vorwort
Die Katzenpfote war es, die mich zu diesem Roman inspirierte. Der Abdruck eines kleinen Katzenpfötchens auf einem alten römischen Ziegel. Dieser Dachziegel wurde im ersten nachchristlichen Jahrhundert im Rheinland geformt und zum Trocknen auf den Boden gelegt. Er sollte das Dach eines ländlichen Gutshauses, einer Villa Rustica, in der Nähe von Ahrweiler decken, und als er noch feucht in der Sonne lag, trippelte die Hofkatze darüber.
Geschichte – das sind nicht nur heroische Schlachten, weltbewegende Katastrophen, kaiserliche Edikte oder päpstliche Bullen. Geschichte haben vor allem die Kleinen und Unbedeutenden gemacht. Die Hofkatze des Römers beispielsweise. Oder dieTöpferin.
Colonia Claudia Ara Agrippinensium, kurz CCAA genannt, oder heute schlicht Köln, war der zentrale Ort des Rheinlands. Die Römer legten die Stadt nach bewährtem Muster an, wie sie auch ihre Legionslager zu bauen pflegten – mit gradlinigen Straßen, den notwendigen öffentlichen Gebäuden wie dem Kapitol, dem Praetorium, dem Forum, den Thermen, einer Rennbahn und dem Hafen. Sie umgaben sie mit einer Stadtmauer samt Toren und Türmen, organisierten die städtische Müllabfuhr und die Entsorgung der Abwässer, vor allem aber legten sie sich eine exklusive, 100 Kilometer lange Frischwasserleitung, die die Stadt mit quellfrischem Eifelwasser versorgte. Und wie auch heute Städter es gelegentlich vorziehen, haben sich die Vornehmen ihr Landhaus im Umland gegönnt.
Gelebt haben in Köln und seinem Umland hauptsächlich die Altgedienten aus den Legionen, aber natürlich ebenso die einheimischen Germanen und einige Gallier, die vor Julius Caesars Eroberungszügen das Rheinland bevölkerten. Man schien sich weitgehend vertragen zu haben. Weitgehend, nicht immer. Aufstände gab es dann und wann, die letzten eben in jener Zeit, über die ich berichten will.
Denn die Colonia war dazu ein Zentrum der Macht, Caesaren und künftige Caesaren wurden hier ernannt, etwa Vitellus und Traian.
Köln war schon zur Römerzeit eine blühende, weltoffene Stadt an einem gewaltigen Strom, der Handelswaren, Menschen und vor allem Nachrichten aus aller Herren Länder transportierte. Der Rhein formte den Charakter der Stadt und seiner Bewohner. Und der hat sich bis heute in gewisser Weise erhalten und macht den Charme des Rheinlands aus.
Sollte die Vorstellung stimmen, die die Gallier vom Leben und vom Tod haben, dann ist es nicht undenkbar, dass jene, die einmal am Rhein gelebt haben, in ihrem nächsten Leben an seine Gestade zurückkehren.
1. Kapitel
Wiederkehr
Sie starb. Es wurde dunkel um sie, doch das Gesicht ihres Geliebten war das Letzte, was sie mit ihren schwindenden Sinnen wahrnehmen konnte. Dann begann ihre Wanderung durch die Sphären des Alls. Sie nahm ihren Weg ohne Angst auf, wissend, dass sie sie finden würde – Unendlichkeit, hinter der sich ein ordnender Wille verbarg. Doch um ihm nahe zu kommen, musste sie die Welten der Materie hinter sich lassen. Sie wanderte lange, und es lösten sich Wehmut, Schmerzen und Trauer auf. Doch das tiefste Gefühl, das sie je empfunden hatte, blieb bei ihr, und die Liebe wuchs zu einer gewaltigen, drängenden Kraft an: der Sehnsucht.
Und als sie mächtig genug war, wurde sie wieder angezogen von jenem leuchtenden Stern, um den die Planeten tanzten. Und die Ströme der Zeit ordneten sich so, dass die Gegebenheiten günstig waren. Daher wurde im Jahre 1972 einem Star des Schlagerhimmels, Caesar King, zu Köln eine Tochter geboren.
2. Kapitel
Explosion
Es herrschte das übliche Durcheinander vor den Schaltern der Chartergesellschaften. Braun gebrannte Touristen warteten auf ihren Abflug, weißhäutige Ankömmlinge in mehr oder minder heiterer Urlaubsstimmung sammelten sich um Reiseleiter, mehr oder minder freundliches Bodenpersonal nahm Gepäck und Beschwerden entgegen. Koffer, Rucksäcke, Surfbretter und quäkende Kleinkinder vervollständigten das Bild des milden Chaos, das um mich herum tobte.
Wir warteten auf unseren Abflug von Gran Canaria nach Rom, von wo wir zur nächsten Ferienanlage weiterfliegen sollten. Wir, das war eine Gruppe junger, überwiegend gut aussehender und durchtrainierter Männer und Frauen, die zu einem Team gehörten, das die Gäste betreuen und das Unterhaltungsprogramm organisieren sollte. Ein unterhaltsamer Job, der mir nach einer etwas anstrengenden Zeit zu Hause genau in den Kram passte.
In all dem Lärmen von Lautsprecher-Durchsagen, heftigen Diskussionen und lautstarken Verabschiedungen hätte ich beinahe das melodische Trillern meines Mobiltelefons überhört. Mit einer Hand hielt ich mir das linke Ohr zu, an das andere Ohr drückte ich das Gerät. Trotzdem war es mir nicht sofort möglich zu verstehen, was mir die Anruferin mitteilen wollte.
»Uschi? Ich verstehe dich nicht!«, sagte ich, schob Grace zur Seite und suchte mir eine etwas ruhigere Ecke hinter einem Pfeiler. »Was willst du damit sagen, er ist nicht nach Hause gekommen?«
Marek warf mir seinen Rucksack auf die Füße und bat: »Pass einen Moment darauf auf, ja!«
Ich nickte kurz und lauschte weiter dem zusammenhanglosen Gestammel, das mir aus dem Telefon entgegenklang.
»Uschi, willst du damit sagen, dass Julian dich wegen einer anderen Frau verlassen hat?«
Zwei herumtollende Kinder rempelten mich an, ich knurrte ungehalten. Dann endlich hatte ich verstanden, was meine Mutter mir sagen wollte.
»O mein Gott! Er ist tot? Ja, ich komme nach Hause, sobald ich meinen Flug umgebucht habe!«
»Du bist so blass, Anita. Was ist passiert?« Ulla war wie üblich die Erste, die die Veränderung an mir bemerkte. Mitfühlend legte sie ihre Hand auf meinen Arm. Ich lehnte meinen Kopf an den Pfeiler und fühlte den kühlen Beton an meiner Stirn. Mir war ein wenig schwindelig.
»Anita? Schlimme Nachrichten?«
Ich nickte. Dann raffte ich mich auf, um es auszusprechen.
»Ich habe gerade erfahren, dass mein Vater heute Nacht bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist.«
Es war gesagt, und damit war es Wirklichkeit. Ulla legte den Arm um mich und drückte mich kurz an sich. Aber für Tränen war noch keine Zeit. Es gab etliche Dinge zu erledigen.
»Tut mir Leid«, sagte ich zu ihr und machte mich frei. »Ich kann nicht mit euch kommen. Ich muss einen Flug nach Deutschland finden.«
»Das kriegen wir schon hin. Setz dich erst mal, du bist weiß wie die Wand.«
Sie führte mich zu einem freien Platz und nahm mir den schweren Rucksack ab.
»Es ist so unglaublich, Ulla«, seufzte ich, während ich mich hinsetzte.
»Das ist es wohl immer, nicht wahr? Hast du ihm nahe gestanden?«
»Ja, irgendwie – ja. Doch.«
»Ach Liebchen, du bist völlig durch den Wind. Komm, gib mir dein Ticket. Ich kümmere mich um die Umbuchung. Wohin willst du fliegen?«
»Köln-Bonn, wenn es geht. Danke, Ulla.«
Ich sah der molligen Frau nach, mit Anfang vierzig die Älteste in unserem Team. Sie kümmerte sich meistens um die Kinderbetreuung und brachte den sportlichen Aktionen nur geringes Interesse entgegen. Ich mochte sie sehr. Dann aber wanderten meine Gedanken zu meinem Vater, Julian Kaiser, der Welt besser bekannt als Caesar King, einer der bekanntesten Schlagersänger der Siebziger- und frühen Achtzigerjahre. In der letzten Zeit allerdings hatte er kaum noch Erfolg, wenn auch manche Fans in nostalgischem Eifer seine seltenen Konzerte besuchten. Angeblich wollte er gestern Abend seinen Agenten aufsuchen, um ein neues Engagement zu besprechen, war aber zu seinem Termin nicht erschienen. Was meine Mutter Uschi zu der wirren Annahme verleitet hatte, dass er stattdessen seine heimliche Geliebte aufgesucht haben müsse. Auf dem Rückweg von ihr sei er dann verunglückt. Es erschien mir ziemlich unglaubwürdig, aber bevor ich nicht mehr als nur die krausen Informationsfetzen kannte, die meine Mutter mir eben mitgeteilt hatte, wollte ich mir darüber keine Gedanken machen. Dass er tot war, war schlimm genug.
»Hier, ich hab’ einen Flug für morgen früh um sechs. Vorher geht keine Maschine. Aber du kannst im Flughafenhotel übernachten, das ist mit drin.«
Ulla reichte mir die Papiere, und ich schenkte ihr ein dankbares und ein bisschen trauriges Lächeln. Der Flug nach Rom wurde aufgerufen, und mit einer Umarmung verabschiedete ich mich von meiner Freundin.
»Ich erkläre es den anderen, keine Sorge. Wir sehen uns bestimmt wieder, Anita. Wir bleiben im Kontakt, ja?«
»Ja, Ulla. Mach es gut. Und noch mal danke. Ich kann jetzt mit den anderen nicht darüber sprechen.«
»Schon gut, Liebchen.«
Ich sah der kleinen Gruppe nach, die sich jetzt zum Ausgang wendete. Roxane sah sich noch einmal nach mir um, um mir einen erstaunten und – wie üblich – leicht giftigen Blick zu spendieren. Ich nahm meinen Rucksack und suchte auf den Hinweisschildern nach dem Weg zum Hotel. Es war nicht schwer zu finden, und kurz darauf stand ich vor dem Eingang. Eine ruhige Nacht würde es wohl nicht werden, die Start- und Landebahnen lagen in unmittelbarer Nähe. Aber ich erwartete auch keine ruhige Nacht, zu viel ging mir im Kopf herum.
Die Maschine nach Rom donnerte heran und hob ab. Es gab einen ungeheuren Knall, und sie löste sich in einem Feuerball auf. Ich wurde gegen die Mauer geschleudert, merkte fassungslos, wie ich zusammensank. Wie in unendlicher Verzögerung sah ich aus den grellen Flammen ein glühendes Stück Metall auf mich zufliegen. Doch bevor es mich an der Schläfe traf, vermeinte ich eine Stimme zu hören, die zu mir sagte: »Diesmal nicht!«
Die Schwärze senkte sich über mich, aber noch vor dem endgültigen Auslöschen meines Bewusstseins zogen in schneller Folge drei ebenso erschreckende Szenen vor meinem inneren Auge vorbei – ein Dorf in Flammen, ein loderndes Lagerhaus und das Auseinanderbersten eines festgemauerten Militärgebäudes.
Das allerletzte Bild aber war ein unendlich vertrautes Gesicht, das sich über mich beugte.
Ich lag irgendwo, halb wachend, halb schlafend und träumte vor mich hin, anscheinend frei von allen irdischen Bindungen. Es war nicht unangenehm. Manchmal fühlte ich mich schwerelos, wie im Wasser liegend, das mich sanft wiegte. Um mich herum schien alles verschwommen und unscharf, wie in Nebel gehüllt. Hin und wieder waren da Stimmen, aber meistens schien es nur ein fernes Rauschen zu geben. Einmal wurde es durchbrochen von einem pulsierenden Trommeln, das sich näherte, lauter wurde. Für einen kurzen Moment zerriss der Nebel, und da lag ein Strand vor mir, ein langer, weißer, sandiger Halbmond, hinter dem sich eine grüne Düne erhob. Ein Reiter kam näher. Ich wusste, es war mein Geliebter.
Dann wachte ich richtig auf. Aber kaum dass ich meinen Blick zentrieren konnte, setzte schon die Verwirrung ein. Etwas stimmte nicht. Es stimmte ganz und gar nicht! Wo war die vertraute graue Steinwand mit dem kleinen, rechteckigen Fenster, durch dessen Holzladen die Morgensonne ihre schmalen Streifen warf? Wo waren die dunklen Balken über mir, auf denen das Strohdach ruhte? Wo war die vertraute Decke aus Wolle mit ihrem dunkel- und hellbraun gewebten Karomuster? Wo war das Holzgestell meines Bettes, der Kittel, den ich am Abend über den Pfosten gehängt hatte? Und wo war Rayan? Wo war mein blonder Geliebter, der am vergangenen Abend endlich wieder einmal den Weg in meine Hütte gefunden hatte?
Befremdet betastete ich die weiche, weiße Decke, die über mir ausgebreitet war. Irgendetwas Weißes war auch um meine Arme gewickelt. Das Licht in dem Zimmer mit den schrecklich weißen Wänden war grell, es strömte, völlig unwirklich, von der Decke herab und nicht vom Fenster her. Und das Bett – ihr Götter! -, das Bett war zwar wunderbar weich, aber das Gestell war, wie ich durch kurzes Befühlen feststellte, aus kaltem Metall. Ich schloss die Augen wieder. Es war zu hell, zu unbekannt, zu fremd. War das die andere Welt? War ich unversehens durch den Nebel in die Welt der Götter und Geister geraten? War ich in der Anderwelt angekommen, in die die Menschen nach dem Tod eingingen? Man wanderte dort, hieß es, und vergaß, was geschehen war, bis man wieder den Weg zurück in die diesseitige Welt fand und neu geboren wurde. War ich denn gestorben? Oder hatte mich eine der Korriganen entführt?
Hatte ich schon alles vergessen? Verzweifelt versuchte ich mich zu erinnern, was geschehen war. Doch ich konnte mich nur entsinnen, dass ich mich, als die Sonne untergegangen war, an Rayans Seite geschmiegt hatte. Seine muskulösen Schultern, seine breite Brust und sein straffer Bauch waren warm und verlockend gewesen, und bevor wir eingeschlafen waren, hatten wir uns eingehend mit den Freuden beschäftigt, die uns unsere Körper schenkten. Das führte zwar gelegentlich an die Grenzen zu einer anderen Welt, aber ich hatte noch nie gehört, dass jemand sie dadurch überschritten hätte. Überhaupt, soweit ich wusste, war es nur den ganz wenigen Weisen und Wissenden möglich, lebend durch die Tore der Anderwelt zu gehen und wieder zurückzukehren. Gewöhnliche Sterbliche fanden die Eingänge nicht. Oder sie kehrten nicht zurück.
Da war jetzt eine Stimme. Jemand sprach mich an. Ohne Zweifel. Auch wenn ich die Worte nicht verstand, so war doch der Tonfall eindringlich. Jemand rief mich und wollte, dass ich wach würde. Mühsam hob ich noch einmal die Lider und blinzelte in das allzu helle Licht. Der weiß gekleidete Mann erkannte meine Pein und verdunkelte mit einer schnellen Handbewegung den Raum. So war es besser. Er musste ein sehr kundiger Druide sein, der so über das Licht gebieten konnte. Aber sosehr ich mir auch Mühe gab, ich konnte einfach nicht verstehen, was er sagte. Es war nicht meine Sprache, und es war auch nicht das Latein, das die Römer mir beigebracht hatten.
Frustriert schüttelte ich den Kopf und bemerkte dabei, dass auch er zum Teil mit irgendetwas bedeckt war. Ja, wenn ich es richtig betrachtete, schmerzte mein Gesicht ganz ungeheuerlich. Mein linker Arm und die rechte Brust brannten ebenfalls wie Feuer. Ein Stöhnen entrang sich mir, und der Druide oder wer immer der Mann war gab ein paar beruhigende Worte von sich. Etwas glitzerte in seiner Hand auf, ich spürte ein leichtes Stechen und sank gnädig in meine Traumwelt zurück.
3. Kapitel
Die Seherin
Als Annik das nächste Mal aufwachte, war, den Göttern sei Dank, alles wieder in Ordnung. Die Sonnenstrahlen bildeten lange Streifen durch den Holzladen vor der Fensteröffnung, und von draußen her drang das Meeresrauschen. Die Morgenflut kam herein, und die Dünung brach sich an den rund gewaschenen Felsen vor dem Haus. Annik streckte sich und stand auf. Nackt, wie sie war, öffnete sie die Tür und ließ den frischen Wind über ihren schlafwarmen Körper streifen, bis sich eine Gänsehaut bildete. Salzige Gischt und der Geruch von feuchtem Tang, der sich an der Flutlinie abgelagert hatte, traf ihre Nase, aber auch der süße Duft des gelb blühenden Ginsters neben dem Haus und der Rauch der Holzfeuer aus den Hütten auf der anderen Seite der Bucht. Möwenkreischen mischte sich in das Gackern der aufgeregten Hühner, die nach verstreuten Körnern pickten, und zwei Elstern zankten sich mit rauen, unwirschen Stimmen um etwas, was sie am Strand gefunden hatten.
Rayan war schon früh aufgebrochen, sein Pferd hatte unten in der sandigen Bucht eine Hufspur hinterlassen, die jetzt langsam von der steigenden Flut ausgelöscht wurde. Annik drehte sich um, nahm die kurze Tunika vom Bettpfosten und warf sie sich über. Mit sicheren Bewegungen, die auf lange Übung schließen ließen, kletterte sie die Felsen hinunter zum Strand, spürte den noch kühlen Sand unter den bloßen Füßen und sah über das blaue Meer hinaus.
Der Sommermorgen war makellos klar, und am Horizont teilte sich deutlich die dunkelblaue Wasserfläche vom hellblauen Himmel. Kleine weiße Schaumkronen spielten auf dem Wasser, und auf den aus den Fluten herausragenden Felsen hatten sich unzählige der weißen Reiher und Möwen niedergelassen. Hin und wieder erhob sich eine Schar, drehte eine gemeinsame Runde und landete nahe der Küste auf Wasser. Kleine, emsig pickende Strandvögel eilten an der Wasserlinie geschäftig auf und ab und drehten und wendeten sich stets gleichzeitig, als gäbe ein unsichtbarer Führer ihnen das Kommando. Annik lächelte wie immer bei diesem Anblick. Er erinnerte sie an die römischen Legionäre, die sich ordentlich in Formation bewegten, gedrillt und alle gleich ausgerichtet.
Aber dann verblasste ihr Lächeln, denn ihr fiel wieder ein, dass sie nun endgültig ihre Entscheidung treffen musste. Bevor die Sommersonne ihren höchsten Stand erreicht hatte, wollten Rayan und Falco aufbrechen. Noch in der Nacht hatte Rayan sie gebeten mitzukommen. Und das hieß Abschied nehmen vom Meer, von den salzigen Gestaden, dem weiten Blick bis hin zur Unendlichkeit, dem Ende der Welt. Abschied von ihrer eigenen kleinen Insel.
Annik liebte das Meer. Trotz allem. Sie liebte es nicht nur an den hellen, sonnigen Tagen wie diesem, sondern ebenso die bleigrauen Wogen unter sturmdunklem Himmel, die wabernden, weißen Nebel und die dunstigen, feuchtkalten Tage. Sie liebte es, selbst wenn es tobte, sich auftürmte und brüllte und dumpf gegen die Felsen donnerte. Sie respektierte es, wenn es versuchte, einen Teil der Küste zu verschlingen, wie es ihm einst, vor sechs Jahren, gelungen war. Als es das kleine Stück Land, auf dem sie jetzt ihre Hütte hatte, vom Festland trennte. Sie nahm es dem Meer nicht übel, dass es seine Fluten so gewaltig hatte ansteigen lassen. Dennoch trauerte sie noch heute um ihre Eltern und die vielen anderen ihres Clans, darunter auch Rayans Angehörige, die damals umgekommen waren.
Das Meer, ihre Heimat, sollte sie verlassen! Dorthin ziehen, wo, wie Falco sagte, die Wälder dicht und dunkel waren, sich über Hügel und Berge ausbreiteten und nur der breite Fluss mit seinem gemächlichen Strömen daran gemahnte, dass alles Wasser zum Meer floss. Andererseits – was hielt sie noch hier? Ihre Familie war tot, und wenngleich sie vom Nachbardorf, das von den schlimmsten Auswirkungen der großen Flut verschont geblieben war, selbstverständlich aufgenommen worden war, so war sie doch irgendwie fremd geblieben. Sicher, der Töpfer hatte sie gerne bei sich untergebracht, denn sie war schon als Kind geschickt mit Ton und Drehscheibe umgegangen. Sie hatte viel von ihm gelernt, und jetzt waren sogar die anspruchsvollen Römer bereit, ihre Schalen und Krüge zu kaufen. Als Töpferin könnte sie im Rheinland genauso ihren Lebensunterhalt verdienen und nicht nur abhängig von Rayan sein.
Sie verstand ja, was ihn reizte. Rayan war wild und voller Energie. Falco dagegen war ein überzeugender Redner, wenn er etwas wollte. Und er wollte Rayan.
Rayan, der Sohn eines Pferdezüchters, der ein geradezu magisches Geschick bei diesen Tieren hatte, war zwei Jahre jünger als Annik. Sie waren Haus an Haus aufgewachsen, nicht gerade in liebevoller Freundschaft, sondern raufend, streitend, miteinander schmollend und in seltenen Fällen auch mal in trauter Einigkeit gegen den Rest der Welt. Dann kam die Flut, als Annik neunzehn und Rayan siebzehn Jahre alt waren. Annik hatte nicht nur ihre Verwandten, sondern auch ihren Liebsten verloren, und als sie durch die Trümmer des verwüsteten Dorfes strich, fand sie lediglich den großen Jungen weinend an den Resten der Herdstätte seiner Familie sitzen. Das gemeinsame Elend, die Trauer und die Einsamkeit führten sie zusammen. Annik fand Unterschlupf für sie beide bei den Überlebenden und half dem verstörten Rayan, wieder Mut zu fassen.
Sie lächelte bei dem Gedanken, wie gut Rayan es geschafft hatte, sich bei den Ausländern trotz seiner jungen Jahre ein beträchtliches Ansehen zu verschaffen. Die Römer hatten sich schon Jahre vor ihrer Geburt in der Flussmündung niedergelassen und einen Hafen angelegt. Es hatte nie besondere Zwistigkeiten zwischen ihnen und den einheimischen Kelten gegeben. Sie hatten den Handel gefördert, Straßen und Wege gebaut und den Handwerkern Arbeit gegeben. Manche Bequemlichkeiten ihrer Zivilisation wollte man heute sicher nicht mehr missen, dachte Annik. Und Gnaeus Iulius Celerinus, der ein großes Gut im Landesinneren bewirtschaftete, hatte von Rayans Vater oft genug Pferde erworben. Er war nur zu glücklich, dem fähigen jungen Mann Arbeit und Unterkunft zu geben.
Im Laufe der Jahre hatte Rayan zunehmend mehr Verantwortung für die Pferdezucht des Römers übernommen, und so blieb es nicht aus, dass er Lucilius Aurelius Falco auffiel, der seit dem Winter als Gast bei Celerinus weilte. Wie Rayan mit glühenden Augen Annik bei Jahresbeginn berichtete, war dieser Römer der Praefect einer Ala, also einer Reitereinheit, der Legio I Minerva. Er war nach Nordgallien gekommen, um sowohl Hilfstruppen anzuwerben als auch Pferde zu kaufen. Stolz berichtete Rayan, wie beeindruckt der Römer von seiner Kraft, seinem Kampfesmut und Geschick mit den Tieren war. So allmählich und wann immer Rayan bei ihr vorbeischaute, bemerkte Annik, dass er sich mehr und mehr mit dem Gedanken anfreundete, sich der Legion anzuschließen. Den größten Reiz übte, wie sie vermutete, die Zusage aus, dass ein Angehöriger der Auxiliartruppen nach der Entlassung aus der Legion die römische Staatsbürgerschaft erhielt. Genauso zog Rayan allerdings das Leben in fremden Ländern an. Sie selbst hatte Falco dann ebenfalls kennen gelernt, einen großen, sehnigen Mann Anfang der dreißig, mit einem schmalen, scharf geschnittenen Gesicht, das unbedingte Willensstärke ausstrahlte. Seine dunklen Haare hatte er nach Römerart kurz geschnitten, und er war bartlos, doch er trug nicht die militärische Tracht des Praefecten, sondern die Kleidung der einheimischen Gallier. Dennoch bestand kein Zweifel daran, dass er ein Befehlshaber war. Annik verstand, dass Rayan ihn verehrte. Auch sie empfand widerwillig Achtung vor Aurelius Falco, der zu diesem Namen offensichtlich nicht unverdient gekommen war – er hatte wahrlich etwas von einem scharfsichtigen Falken.
Vor einem Monat hatte Rayan ihr schließlich mitgeteilt, dass er im Sommer mit der Truppe ziehen würde, die Praefect Falco angeworben hatte, um sich als Zureiter um die Pferde zu kümmern. Außerdem wolle er zukünftig mit dem Namen Martius gerufen werden. Seine Begeisterung war so groß, dass er nicht merkte, wie wortkarg Annik auf diese Ankündigung reagierte und in sich gekehrt blieb. Aber in dieser letzten Nacht nun hatte er sie gebeten, ihn als seine Gefährtin zu begleiten.
Nun musste sie ihre Entscheidung treffen.
Annik machte einen Schritt auf das Wasser zu und ließ die Wellen an ihren nackten Zehen lecken. Es war kühl, aber nicht kalt, und entschlossen legte sie das Hemd ab und lief ins Meer. Das Wasser lag flach, blaugrün schimmernd und glasklar vor ihr. Erst nach etlichen Schritten verlor sie den Boden unter den Füßen. Das Schwimmen machte ihr Freude, wusch die Zweifel und ungelösten Fragen für eine Weile fort. Sie erreichte den Felsen vor der Küste, drehte sich auf den Rücken und ließ sich von den Wellen schaukeln, während sie zu ihrer kleinen Insel schaute. Einst hatte dort das Dorf gestanden, in dem sie aufgewachsen war. Nun gab es nur noch ein paar von Ranken überzogene Mauerstümpfe und verfallene Herdstätten. Ihre Hütte war das einzige vollständige Bauwerk. Niemand hatte es ihr damals streitig gemacht, als sie darauf bestand, auf dem durch die Flut abgetrennten Stückchen Land zu wohnen. Ja, man hatte ihr sogar geholfen, aus den verbliebenen Bruchsteinen und Balken eine recht solide Behausung zu bauen. Hier war ihr Refugium, zu dem sie des Abends zurückkehrte. Weit war es nicht vom Dorf entfernt, den Fußmarsch morgens und abends nahm sie gerne auf sich. Der einzige Nachteil der Insel war, dass zwei Mal am Tag, wenn die Flut hoch stand, der Weg zum Festland überflutet war. Nicht sehr hoch, aber mit einigen Untiefen und einer nicht ungefährlichen Strömung, die es angeraten sein ließ, zu warten, bis der Ebbstrom den festen, feuchten Sand wieder freigelegt hatte.
Annik sah zum Himmel hoch. Einige kleine Wolkenbäuschchen wanderten gen Osten, die Sonne war inzwischen um einige Handbreit weiter gestiegen, und wenn sie noch trockenen Fußes in die Töpferei gelangen wollte, dann sollte sie sich jetzt sputen. Mit kräftigen Schwimmzügen wandte sie sich in Richtung Strand. Dort nahm sie ihr Hemd auf und kletterte den Felsen empor. Aus dem Regenwassertrog vor dem Haus schöpfte sie einen Eimer Wasser, löste die beiden Zöpfe, die sie im Nacken zusammengebunden hatte, und goss sich das Süßwasser über den Kopf. Ihre Haare reichten ihr bis über die Hüften, und im Licht der strahlenden Sonne glänzten sie wie Gold. Doch da viele Angehörige ihres Volkes blond waren, empfand sie diese Farbe nicht als etwas Besonderes. Wie ein nasser Hund schüttelte sie sich, dass die Tropfen flogen und beeilte sich dann, sich abzutrocknen, anzukleiden und auf den Weg zu machen.
Es waren die Wölkchen, die über den Himmel zogen, die ihr die Idee eingaben, später am Tag die Seherin aufzusuchen.
Mutter Tekla war eine von allen hochgeachtete Frau, die ihre Hütte hinter dichten Eibenhecken am Rande des Dorfes hatte. Sie war schon alt, manche behaupteten, sie habe schon weit über sechzig Sommer gesehen, aber sie selbst sagte dazu regelmäßig, die Winter seien interessanter gewesen. Sie spann und webte die Wolle, die man zu ihr brachte, und dafür erhielt sie ihren Anteil an Korn und Eiern, Fleisch und Milch. Ihre zwei Töchter und ihre zahllosen Enkel waren oft bei ihr, aber an manchen Tagen scheuchte sie sie alle wie eine Schar Hühner von ihrem Hof, um alleine zu sein. Das war schon immer so gewesen, und niemand nahm es ihr übel, wenn sie in Ruhe gelassen werden wollte. Denn auf der anderen Seite war sie überaus hilfsbereit, wenn man sie um Rat fragte, ganz gleich, zu welchen Angelegenheiten. Und ihren Rat hatten bisher fast alle als gut und segensreich empfunden.
Annik hoffte, dass die Alte Zeit für sie finden würde, als sie am späten Nachmittag den staubigen Weg durch das Dorf ging und an der hohen Eibenhecke den Einschlupf zu ihrem Haus suchte. Sie hatte Glück, zwischen den Gemüsebeeten kniete Mutter Tekla und hackte die Erde auf. Als sie Annik kommen sah, schenkte sie ihr ein Willkommenslächeln, und mit einem Schwung, der ihr Alter Lügen strafte, erhob sie sich vom Boden. Bewundernd betrachtete sie die elegant geformte Keramikschale, die ihre Besucherin in den Händen hielt.
»Noch so eine Erdarbeiterin wie ich. Was führt dich zu mir, Anna, Tochter der Deneza?«
»Na, was meinst du, Mutter Tekla?«
»Du brauchst ein feines Wollhemd für die lange Reise?«
Annik wusste natürlich, dass Mutter Tekla die Gabe der Vorhersehung besaß, aber jetzt zeichnete sich doch Verblüffung in ihrem Gesicht ab. Die Alte kicherte.
»Nein, nicht die Vögel haben es mir verraten, Annik. Menschliche Schwätzer erzählen, dass dein schöner Junge mit den Römern gehen will. Wirst du mit ihm ziehen?«
»Ich weiß es nicht. Das ist genau der Grund, warum ich hier bin.«
»Ach ja? Und, soll ich dir die Entscheidung abnehmen?«
»Nein – oder besser, vielleicht kannst du mir helfen, eine Entscheidung zu treffen?«
»Vielleicht.«
Mutter Tekla wusch sich die erdverschmierten Hände am Brunnen und warf sich ein Wolltuch über die Schulter. Annik stellte die Schale vorsichtig auf die Holzbank an der Hauswand. Die Seherin nickte.
»Komm mit.«
Annik folgte der Alten, die den Weg zur Küste einschlug. Dort, an der Düne, inmitten der Wiesen, ragte eine rund geschliffene Steinformation auf, die ihr Ziel war. Das hohe, saftig grüne Gras streifte den Saum ihrer langen Röcke, und ein schwarzer Vogel erhob sich krächzend von dem Felsen, um sich einer Beute auf dem Boden zu widmen.
»Raben!«, stellte Mutter Tekla fest. »Magst du sie, Annik?«
»Sie sind mir unheimlich. Vielleicht, weil sie so hässliche Stimmen haben.«
»Sie erzählen dir viel, wenn du sie verstehen kannst.«
»Ihre Sprache verstehe ich nicht, dazu bedarf es grö ßerer Weisheit als der meinen, denke ich.«
»Es ist die Sprache der Götter. Die Raben sind ihre Boten. Nun, wir werden sehen.«
Mutter Tekla erklomm die Steine, die an manchen Stellen ausgehöhlt waren, so dass sich in den runden Mulden das Regenwasser sammelte. Doch nicht in diese spiegelnden Flächen warf sie ihren Blick, sondern betrachtete sinnend den Himmel. Die Wolkenbäusche des Morgens waren dicker geworden, und über ihnen, in gro ßer Höhe, hatten sich fedrige, lange Schwaden gebildet. Zwischen Meer und Wolken aber zogen Vögel ihre Bahnen, und deren Flug galt die Aufmerksamkeit der Seherin. Annik verhielt sich ruhig, lehnte sich an den sonnenwarmen, grauen Stein und lauschte einer zirpenden Grille. Es schien eine lange Weile vergangen zu sein, bis Mutter Tekla endlich wieder das Wort an sie richtete.
»Die Götter haben dir einen mutigen Geist mitgegeben, Annik«, sagte die Seherin. »Das ist Tugend und Last zugleich. Nun ja…« Sie seufzte. »Du willst Rat. Du willst wissen, ob du gehen oder bleiben sollst. Die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Ich glaube, wenn du noch fest verbunden mit deinem Leben hier wärst, würdest du mit dieser Entscheidung nicht ringen müssen. Dann würdest du bleiben. Aber Anna, Tochter der Deneza, du hast deinen Anspruch aufgegeben. Warum, weißt du wohl selbst am besten. Du hättest auch nach dem Tod von Briag dem Schwarzen und Deneza, seiner Frau, noch immer Fürstin und Führerin unseres Volkes sein können. Nun bist du Töpferin geworden und gräbst in der Erde nach deinen Wurzeln. Nur wenig von dir haftet jedoch noch in diesem Boden. Und er ist, vor allem dort auf deiner Insel, zu locker, zu sandig, um dich zu halten. Mag sein, dass dich der schwere Boden im Inneren des Landes fester zu halten vermag. Doch dazu musst du dich ganz mit ihm verbinden. Ich glaube allerdings nicht, dass dein schöner Rayan dir dabei helfen wird. Er wird seinen eigenen Weg gehen, das solltest du wissen.«
»Ja, mag sein. Er geht ihn jetzt schon oft. Aber für eine Weile …«
»... braucht er dich noch.«
»Er braucht mich nicht, er ist ein Mann. Ich brauche ihn. Er ist, wie du ganz richtig festgestellt hast, das bisschen Wurzel, der Halt, den ich noch habe.«
Zweifelnd sah die Seherin die junge Frau an.
»Wenn du meinst. Nun, dann gehe auf jeden Fall mit ihm. Die Omen für deine Reise sind glücklich, falls dich das beruhigt. Du wirst dein Ziel unbeschadet erreichen. Aber die fernere Zukunft...«
Mutter Tekla verstummte und sah mit wachsendem Erstaunen den dahingleitenden Möwen zu.
»Was bringt mir die Zukunft? Sag es mir, auch wenn es eine Warnung ist.«
»Es ist keine Warnung, eher ein Versprechen. Aber – Annik, eines, das vermutlich nicht in diesem Leben eingelöst wird, wie mir scheint. Du wirst einst zurückkehren zu dieser Insel, aber zuvor wirst du eine lange Wanderung hinter dich bringen müssen.«
»Du sprichst in Rätseln.«
Mutter Tekla kicherte. »Das ist die Art der Seher!« Sie schwieg einen Moment, anscheinend um die rechten Worte zu finden. Aber auch das, was sie dann sagte, war nicht gerade eindeutig.
»Annik, ich mag einen Blick in die Zukunft tun können und dir die Möglichkeiten beschreiben, die unser diesseitiges Leben betreffen, so dass du es verstehst. Aber der Blick in die Anderwelt bedeutet, dass man nur noch in Bildern sprechen kann. Höre, wir sind Weber und Muster zugleich, der Lauf des Lebensfadens ist verknüpft mit anderen Fäden. Wie es das Muster bestimmt, so kreuzen sich die Fäden – erst wenn du erkennst, welches Muster sich entwickelt, kannst du es nach eigenem Belieben verändern. Wenn nicht, bestimmen die Götter dein Schicksal.« Sie lächelte Annik verständnisvoll an. »Die Aussage hilft dir jetzt wenig, später vielleicht mehr.«
»Hoffentlich.«
Annik löste sich von dem Felsen in der Annahme, dass die Alte nun alles gesagt hatte, was sie sehen konnte, doch Mutter Tekla hatte ihre Augen fest auf eine der mit Wasser gefüllten Höhlungen gerichtet und betrachtete die spiegelnde Oberfläche.
Annik verharrte gebannt.
Leise murmelte die Seherin: »Du wirst dein Spiegelbild finden, und dann ist es an dir, die wahrhaft richtige Entscheidung zu fällen. Lass dich nicht durch den Augenschein blenden.«
Genau zu diesem Zeitpunkt flatterte der Rabe aus dem Gras auf und zog mit einem Krächzen dicht über ihren Köpfen hin. Eine schwarze Feder taumelte nieder und landete auf der Wasseroberfläche.
»Der Rabe ist dir wohlgesinnt! Fürchte dich nicht vor ihm. Er wird dein Führer sein durch alle Welten. Er wird dich hierher zurückbringen. Einst.«
Annik nahm die Feder vorsichtig in die Hand. Sie wirkte versonnen, auch sie hatte in ihrem Inneren Bilder gesehen. Andere als die Alte, aber nicht minder wunderliche.
»Ich werde deinen Rat beherzigen. Danke, Mutter Tekla. Ich glaube, du hast mir geholfen. Noch bevor der Sommer vorbei ist, werde ich wohl in den dunklen Wäldern Germaniens meine neue Heimat suchen.«
»Geh deinen Weg, Kind, und finde Frieden. Und nun leb wohl!«
So verabschiedet kletterte Annik den Fels hinunter und ließ die Seherin allein, die unverwandt zum Horizont blickte. Dort tauchte im Westen eine glutrote Sonne ins Wasser, und der Himmel begann, sich in ein flammendes Feuermeer zu verwandeln, vor dem sich die schwarzen Silhouetten der Vögel wie Schriftzeichen abbildeten.
Entsetzen packte die alte Seherin, und sie rief Annik hinterher: »Geh nicht!«
Aber Annik hörte sie nicht mehr.
4. Kapitel
Aufwachen
Ich wachte im Krankenhaus auf, als die Krankenschwester sich an dem Tropf zu schaffen machte. Mühsam löste ich mich von den Fesseln meines Traumes, der so ungeheuer lebendig war, dass ich meinte, den kühlen, salzigen Wind in meinen Haaren zu spüren. Aber wenn ich es recht betrachtete, war da kein Wind in meinen Haaren. Ich lag in einem weiß bezogenen Krankenhausbett, den linken Arm verbunden, Infusionsnadeln in meiner Haut – und mit Schmerzen.
Langsam, ganz langsam kam die Erinnerung an das Grauen. Der Feuerball, die glühenden Metallteile, das Flugzeug, in dem meine Freunde saßen …
Die Schwester sprach auf mich ein, aber in meinem umwölkten und vermutlich auch von Medikamenten gelähmten Gehirn wollte sich kein Verstehen bilden. Sie sprach ohne Zweifel eine Sprache, die ich ansatzweise beherrschte. Spanisch war es, richtig. Aber es war mir zu mühsam, die Worte zu übersetzen. Sprechen war ebenfalls mühsam, denn da war irgendetwas mit meinem Gesicht geschehen.
Es kam ein Arzt, gnädigerweise sprach er deutsch mit mir, aber was er mir mitzuteilen hatte, war alles andere als beglückend. Ich hatte Brandwunden dritten Grades am linken Arm, größere zweiten Grades an der Schulter und quer über die Brust. Dazu einen tiefen Schnitt von der Braue bis zum Kinn. Wie durch ein Wunder war mein rechtes Auge dabei unversehrt geblieben. Er tröstete mich mit den Möglichkeiten der plastischen Chirurgie, aber ich konnte ihm nicht aufmerksam genug zuhören, und er ließ mich mit meinen Gedanken alleine. So ganz allmählich kehrten die Bruchstücke zurück. Der Anruf meiner Mutter – ja, das war der Grund, warum ich nicht mit den anderen zusammen in der Unglücksmaschine gesessen hatte, sondern zum Hotel gegangen war, um dort auf meinen Rückflug nach Deutschland zu warten. Wie ein schwerer Klumpen legte sich die Trauer auf mein Herz. Ulla, die wohl am ehesten die Bezeichnung »beste Freundin« verdient hatte, war vermutlich in den Trümmern gestorben. Aber auch um Roxane, die ständig irgendeine Stichelei, irgendeine hinterlistige Anspielung auf Lager hatte und mich aus unerklärlichem Grund ständig anfeindete, tat es mir Leid. Immerhin war sie in ihrer verletzenden Scharfzüngigkeit witzig gewesen. Grace hatte ebenfalls einiges von ihr zu erleiden gehabt, aber bei ihr war recht viel Wahres an den ätzenden Kommentaren über ihren Lebens- und Liebeswandel gewesen. Grace war milde medikamentenabhängig und knapp davor, als Nymphomanin durchzugehen. Bedauern fühlte ich auch Mareks wegen, dem sanften Jungen, der sich geduldig jedes Leid und jeden Jammer anhörte und seine eigene Befriedigung daraus zog, dass es ihm noch schlechter ging als dem anderen. Möglicherweise tat es mir um ihn sogar mehr Leid als um den egomanischen Dänen Titus, zwar ein perfekter Techniker, der sogar im dampfenden Dschungel noch eine komplett ausgeleuchtete Bühnenshow organisieren konnte, aber jeden so gut ausnutzte, wie er es nur irgend schaffte. Besonders Hawkins, den trotteligen Briten, der aus unerfindlichen Gründen lediglich beim Bogenschießen keine zwei linken Hände hatte. Wir waren ein Team, das seit einigen Jahren in unterschiedlicher Besetzung immer wieder zusammenkam. Wir waren dann gerade lange genug beieinander, um uns nicht wirklich auf den Geist zu gehen. Wenn einer nach zwei, drei Monaten wieder bei demselben Veranstalter aufkreuzte, wurde er mit lautstarker Herzlichkeit aufgenommen. Es war eine gute Zeit gewesen, das Herumtingeln in den Tourismushochburgen der Welt. Sommer im Winter, Frühling im Sommer, ununterbrochen blaues Meer, Strand, Palmen. Sicher, manches wurde schal mit der Zeit. Das Einheitsessen, die ewig gleichen Touris mit ihren ewig gleichen Ansprüchen, die Affairen und Affairchen, die plumpe Anmacherei. Zum Ausgleich gab es den Sport. Ich hatte mit Marek gemeinsam oft Surfkurse gegeben, mir mit Grace die Strandaerobic geteilt und Fahrrad-Touren organisiert. Schätzungsweise war es jetzt von Vorteil, dass ich so durchtrainiert und gesund war. Es mochte bei der Heilung helfen. Aber eine neue Haut brachte es mir nicht.
Ein kalter Schauder durchfuhr mich, als ich die Verbände betastete. Bikinis würde ich für mich bestimmt vergessen können.
Ich war wieder ein wenig eingedämmert, fuhr aber nach kurzer Zeit erneut hoch.
Dass ich meine Freunde verloren hatte, war ja nur die eine Seite. Der Verlust, der zuvor eingetreten war, der Grund, warum ich nicht mit ihnen gestorben war, das war die wirkliche Ursache meiner Trauer. Vater! Julian. Er hatte schon früh darauf bestanden, dass ich ihn mit seinem Namen anredete. Er fand den Titel Vater so altmodisch. Und ich kam mir außerordentlich wichtig und erwachsen vor als Kind. Meine Mutter hatte es dagegen missbilligt und erst in den letzten Jahren akzeptiert, dass ich sie Uschi nannte. Von Julian sprach sie allerdings unverdrossen als »dein Vater«.
Es war unfassbar.
Julian war achtundfünfzig, ein vitaler Mann mit vielen Plänen. Seine wirklich große Zeit als Star am Schlagerhimmel war vorbei, aber das bedauerte er nicht. Er hatte es auch nicht nötig, sich über seinen Zenit hin zu verkaufen. Er nahm keine Engagements um jeden Preis an, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen es tun mussten. Er hatte klug gewirtschaftet, wenn auch deswegen gelegentlich bespöttelt und als Mister Saubermann verhöhnt, weil er sich vom Glamourleben weitgehend ferngehalten hatte. Auch als Ehemann war er, soweit ich es beurteilen konnte, beständig und solide gewesen. Vor achtundzwanzig Jahren hatte er geheiratet, als Uschi, damals Bühnen-Tänzerin, ein Kind von ihm erwartete. Auf mich, seine Tochter, war er stolz. Er taufte mich Anahita, was aber in allerkürzester Zeit zu Anita wurde.
In den vergangenen zwei, drei Jahren hatte er sich überhaupt nicht mehr um populäre Schlager gekümmert, sondern eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Er war künstlerisch eigenwilliger geworden, hatte experimentiert, und wer weiß, womöglich hätte er noch einmal einen anderen Zenit erklommen. An Fähigkeiten fehlte es ihm wahrhaftig nicht.
Ich schloss die Augen, um zu vermeiden, dass mir die Tränen kamen. Er würde mir fehlen. Er fehlte mir jetzt schon. Lebte er noch, könnte ich sicher sein, dass er jetzt hier an meinem Bett säße und mir eine seiner fantastischen Geschichten erzählte. So wie er es immer getan hatte, wenn ich als Kind einmal krank war. Er hatte eine blühende, überaus bildhafte Fantasie, die einen restlos in Bann schlagen konnte, die einen vergessen ließ, wo man war und wer man war. Als ich älter geworden war, hatte ich ihn oft gebeten, diese Geschichten aufzuschreiben, und ich glaubte nach wie vor, dass sie das wert waren. Doch er hatte nur gelacht und gesagt, das mache ihm zu viel Arbeit. Er erfand sie und vergaß sie wieder. Sein Dämon hieß Musik, nicht Dichtkunst.
Der seltsame Traum fiel mir ein. Ja, wenn ich es recht betrachtete, dann war er so wie die Geschichten, die Julian zu erfinden pflegte. Eventuell war es sogar die Erinnerung an eine solche Erzählung. Er hatte stets großen Wert darauf gelegt, ganz genau zu beschreiben, wie seine Personen gelebt hatten. Nie waren sie in einer unglaubwürdigen Fantasie-Welt angesiedelt, sondern in einer nachvollziehbaren, historisch belegten Zeit. Die Vergangenheit hatte ihn fasziniert, in seiner Freizeit hatte er viele Bücher und Artikel darüber gelesen. Mich hatte er schließlich damit angesteckt. So sehr, dass ich es zu meinem Beruf hatte machen wollen. Beachvolley und Strandaerobic betrieb ich nämlich nur in den Semesterferien. Meine Zeit an der Universität war allerdings seit einem halben Jahr endgültig vorbei. Nach der Abschlussprüfung hatte ich nur noch einmal ein paar Monate ausspannen wollen, um im Herbst mein Brot in einem renommierten Auktionshaus zu verdienen. Eine Planung, die fürs Erste zunichte gemacht worden war.
Julian hatte sich darüber gefreut, dass ich Kunstgeschichte studiert hatte. Ich musste trotz meiner Trauer lächeln. Wie sehr es ihn wohl erstaunt hätte, dass selbst nach seinem Tod sein Einfluss auf mich noch so groß war, dass ich eine seiner Geschichten im Traum erlebte. Oder mochte es ein letzter Gruß von ihm gewesen sein? Einer aus jener anderen Welt, in der er jetzt hoffentlich glücklich wandelte? So würde er es wahrscheinlich deuten, denn das war etwas, was ihn in der letzten Zeit stark bewegt hatte. Er hatte sich, für mich und auch für einige seiner Freunde etwas unerklärlich, sehr intensiv mit esoterischen Themen auseinander gesetzt. Hier konnte und wollte ich ihm allerdings nicht folgen, manche Theorien, die da aufgestellt wurden, schienen mir denn doch ein wenig an den Haaren herbeigezogen zu sein.
Ich schickte nichtsdestotrotz ein paar liebevolle Gedanken in seine Richtung und schlief, ein wenig getrösteter, wieder ein.
Ein Geräusch weckte mich. Diesmal kam ich etwas schneller zu mir und war mir völlig im Klaren darüber, wo ich mich befand und was mir geschehen war. Darum wusste ich genau, dass dieser Mann da an der Tür nichts in meinem Zimmer zu suchen hatte. Auch wenn es ein ungemein gut aussehender Mann war. Er trug verwaschene, enge Jeans, und ein ärmelloses T-Shirt spannte sich über einem muskulösen Brustkorb. Erstaunlich schöne blonde Locken umgaben sein braun gebranntes, kantiges Gesicht. Ich war bisher attraktiven Männern gegenüber nicht grundlegend abgeneigt, trotzdem empfand ich sein unaufgefordertes Eindringen in mein Krankenzimmer als unangenehm.
»Suchen Sie jemanden?«, fragte ich kühl.
»Ja, dich, Schätzchen!«
Schätzchen ist ein Titel, den ich partout nicht schätze, und darum tastete ich nach dem Rufknopf für das Pflegepersonal und schnauzte ihn an: »Das ist ja wohl die Höhe! Machen Sie, dass Sie aus dem Zimmer verschwinden.«
»Nicht so hastig, Süße. Ich bin eigentlich hier, um dir zu helfen.«
»Dazu ist derzeit das medizinische Personal bestens in der Lage. Raus!«
»Und ich dachte, in einer solch bescheidenen Situation wäre die Hilfe von einem Landsmann mit blendenden Spanischkenntnissen vielleicht doch recht nützlich. Ich entschuldige mich für das Schätzchen und die Süße. Ich heiße Marc. Darf ich es mit Anita versuchen?«
Die Unverfrorenheit beeindruckte mich wider Willen. Ich zog die Hand vom Rufknopf zurück.
»Woher wissen Sie meinen Namen?«
»War nicht schwer, ihn herauszufinden. Es mag dir entgangen sein, dass du zu einer internationalen Berühmtheit geworden bist. Leidest du unter einer Amnesie, oder kannst du dich an den Unfall erinnern?«
»Das Flugzeug. Doch, ich erinnere mich nur zu gut.«
Marc kam näher und zog sich einen Stuhl heran. Ich las so etwas wie Mitgefühl in seinem Gesicht. Und darum stellte ich die Frage, deren traurige Antwort ich beinahe zu wissen glaubte.
»Es hat wohl keine Überlebenden gegeben?«
»Nein. Nur dich. Alle glaubten an ein Wunder, bis man herausfand, dass du im letzten Moment umgebucht hattest.«
Also stimmte es, was ich mir gedacht hatte. Aber es traf mich doch noch einmal heftig.
»Es ist fünf Tage her, falls du einen Bezugsrahmen für die Zeit brauchst, die du schon hier bist. Wie kommt es, dass deine Familie sich nicht tröstend um dein Bett versammelt hat?«
»Meine Familie hat momentan andere Sorgen.«
»Scheint ein herzloses Volk zu sein. Aber das geht mich wohl nichts an.«
»Richtig, das geht dich nichts an.«
Wenn er mich so permanent duzte, konnte ich das auch.
»Aber wenn du etwas brauchst, kannst du es jetzt ja mir sagen. Ich bin die Hilfsbereitschaft in Person.«
»Warum eigentlich? Bist du so was wie der heilige Michael?«
Es mussten die blonden Locken sein, die mir diesen Vergleich auf die Zunge legten, und eitel wie der Kerl war, deutete er das prompt richtig und fuhr sich herausfordernd mit dem Finger durch die schimmernde Pracht.
»Ach ja, man vergleicht mich gerne mit dem Drachentöter. Aber das ist nicht so direkt mein Gebiet.«
»Sondern?«
»Ich bin Fotograf.«
»Und machst besonders schöne Landschaftsaufnahmen von den Kanarischen Inseln im Sonnenuntergang. Ob ich das glaube?«
»Halte es, wie du willst. Landschaften sind jedenfalls häufig auf meinen Bildern mit drauf. Aber ich hab auch ein ausgemachtes Gespür fürs Dramatische, und wie der Zufall es wollte, kam ich gerade zurecht, als das Flugzeug explodierte.«
»Presse?«
Er zuckte mit den Schultern, und mir entfuhr ein innig gemeintes: »Scheiße!«
Er grinste nur.
»Ich kann mit der Verachtung leben. Es ist ein gut bezahlter Job.«
»Für welches Blatt arbeitest du?«
»Für das, was am besten zahlt. Ich bin ungebunden.«
Wenn ich nicht selbst einige Jahre diese Form der Ungebundenheit genossen hätte, wäre er jetzt vermutlich völlig bei mir unten durch gewesen. Aber irgendwie gefiel mir der Bursche, auch wenn ich ihm keine Sekunde über den Weg traute. Außerdem hatte er mir ein Problem bewusst gemacht, über das ich bisher noch nicht hatte nachdenken können. Ich wollte nach Hause! Mal sehen, wie weit die angebotene Hilfsbereitschaft reichte.
»Marc, du kannst mir wahrhaftig einen Gefallen tun.«
»Ah, dacht ich es mir doch. Madame brauchen nur zu befehlen.«
»Gut, dann schaff mich umgehend nach Deutschland zurück.«
»Mh, ja, das kann ich verstehen. Ist ein bisschen schwierig, so was vom Bett aus zu organisieren, was?«
»Du sagst es. Kannst du die deutsche Vertretung hier benachrichtigen? Ich weiß nicht mal, an wen man sich wenden muss oder ob die gar von selbst darauf kommen. Ich bin dummerweise in den letzten Tagen etwas geistesabwesend gewesen.«
»Mach dir keine Gedanken. Ich kenne jemanden, der darin ziemlich fit ist.«
»Menschliches Strandgut aufzuklauben?«
»Fühlst du dich so?«
»Ich fühle mich grässlich, wenn du schon fragst. Und schaff ein paar Spezialisten herbei, mit denen ich mich in meiner Sprache über die Konsequenzen und Behandlungsmöglichkeiten unterhalten kann. Ein paar plastische Chirurgen hätte ich ganz gerne um meine Bettstatt versammelt.«
»Viel sieht man nicht von dir, das stimmt schon. Aber sie haben dir nicht die Haare abgeschnitten. Das solltest du als mitfühlenden Akt werten.«
»Damit ich sie mir, wenn der Verband ab ist, verhüllend über das Gesicht drapieren kann. Ha, ich weiß nicht. Wahrscheinlich werde ich eh gezwungen sein, den Schleier zu nehmen.«
Dieser Marc setzte irgendeine Quelle der Schnodderigkeit in mir frei, von der ich überhaupt nicht geahnt hatte, dass sie angesichts meiner absolut bescheidenen Lage in mir noch vorhanden war.
»Das wird sich gewiss regeln lassen. Aber so weit, dass ich mir deinetwegen die Haut über die Ohren ziehen lasse, geht die Hilfsbereitschaft dann doch nicht. Da wirst du dich an andere Spender halten müssen.«
»Erst nach Hause, dann weitersehen.«
»Okay, ich eile!«
»Und noch was!«
»Ah, gibt man erst den kleinen Finger...«
»Halt mir die Reporter vom Hals!«
»Du weißt nicht, was du verlangst, Anita Kaiser alias King!«
Scheiße, er wusste wirklich, wer ich war.
5. Kapitel
Das Testament
Was immer mein Zufallsbekannter für offizielle oder inoffizielle Fäden gezogen hatte – sie wirkten. Er ließ sich zwar nicht mehr blicken, aber drei Tage später war ich zu Hause. Und zwar in meinem Elternhaus, da ich im vergangenen Jahr nur sporadische Heimatbesuche gemacht und deshalb meine eigene Wohnung aufgegeben hatte. So saß ich also an diesem Sommernachmittag wieder in meinem alten Zimmer und studierte die Untersuchungsergebnisse und die Vorschläge für die weitere Behandlung meiner Verletzungen. Es waren keine rosigen Aussichten. Der Blick in den Spiegel, den ich endlich gewagt hatte, war ebenfalls nicht dazu angetan, meine Stimmung zu heben. Obwohl mir die Ärzte versichert hatten, dass die Narbe später kaum sichtbar sein würde und den spanischen Kollegen zu seiner Kunststickerei beglückwünschten. Noch durchzog eine hässliche rote Linie mein verquollenes Gesicht von der Stirn bis zum Kinn. Schlimmer aber waren die Brandwunden. Der Termin für die erste Hauttransplantation stand in wenigen Tagen an. Ein Teil der Schulter war so weit abgeheilt, dass es möglich war. Doch das Gewebe am rechten Arm, der am stärksten betroffen war, würde noch Wochen brauchen, um sich zu regenerieren.
Dazu kam, dass ich in den Einflussbereich meiner Mutter geraten war, die sich, nachdem ich sie vom Krankenhaus aus angerufen hatte, mit einem Schwall von Vorwürfen überschüttete. Ich hatte keine Ahnung, warum. Bis mir zu Hause die Zeitungen und Zeitschriften der letzten Tage in die Hände fielen.
Marc war wirklich zur richtigen Zeit am Flughafen gewesen. Die Bilder von dem Feuerball trafen mich wie ein Schlag. Stärker traf mich allerdings der Anblick der blut überströmten Anita, die dort wie eine zerschlagene Puppe an der Hotelmauer lag.
»Doppelte Tragödie!«, nannte die schreiende Überschrift den Artikel, und das Foto eines total zerstörten Fahrzeugs befand sich neben dem meinen. Natürlich, das war ein Fressen für die Sensationsberichterstatter. Berühmter Schlagersänger tödlich verunglückt – und am Tag darauf seine Tochter die einzige Überlebende eines Flugzeugunglücks, schwer verletzt und mit dem Tode ringend. Die Fotos stammten von einem Marc Britten. Toll!
Was ich diesem verfluchten Marc aber besonders übel nahm, war die Aufnahme, die die besagte Überlebende in wenig dekorative Verbände gewickelt in einem Krankenhausbett zeigte. Dieser Mistkerl hatte mich fotografiert, bevor er mir sein hilfreiches Angebot unterbreitete. Ich wünschte, ich könnte ihn erwürgen. Etwas anderes kam nicht in Frage. Die Bilder waren erschienen, rückgängig gemacht werden konnte das sowieso nicht mehr.
Zudem war es schwer, Uschi davon zu überzeugen, dass ich mich nicht mit Absicht in dieser angeschlagenen Form der Presse präsentiert hatte. Sie war absolut verstört und aufgebracht durch die schrecklichen Ereignisse. Ich vermutete außerdem stark, dass ihr Arzt ihr irgendwelche dämpfenden Medikamente verschrieben hatte, denn sie wirkte stellenweise richtiggehend verwirrt. Sie tat mir Leid, natürlich. Sie war in ihrem ganzen Leben kein sehr starker Mensch gewesen und hatte sich, solange ich denken konnte, an meinen Vater gelehnt. Nun war diese Stütze fort, und sie musste mit den Schwierigkeiten alleine zurechtkommen, denn auch ich fiel derzeit aus. Es war natürlich furchtbar, dass sie von der Paparazzia belagert wurde, dass ihr und Julians Leben durch die bunten Blätter gezerrt wurde. Jedes alte Tränenkrüglein wurde geschüttelt, jedes Skandälchen noch mal aufgewärmt und jeder Tratsch und Klatsch genüsslich breit getreten. Zusätzlich untersuchte natürlich die Polizei den Todesfall, und es war durchgesickert, dass sich Julian offensichtlich vor dem Unfall mit Psychopharmaka voll gepumpt hatte. Wirre Gerüchte von Selbstmord waren aufgetaucht, Mutmaßungen, dass er mit dem Ende seiner Karriere nicht klargekommen sei, wurden geäußert. Familiäre Probleme, eine anspruchsvolle Geliebte, sogar Drogensucht wurden vorgeschoben – alles ein hanebüchener Unsinn und ein Rufmord ohnegleichen, der meiner Mutter verständlicherweise die Nerven raubte. Ich nahm an, dass sie irgendwo in ihrem Herzen ein bisschen Bedauern für mein Schicksal empfand, aber sie war nicht in der Lage, es mir zu zeigen. Sie lud ihre Wut und ihre Verzweiflung bei mir ab und machte mich zum Sündenbock, ohne dafür einen stichhaltigen Grund zu haben. Ich tat mein Möglichstes, um Geduld zu wahren. Aber es war schwer.
Ich packte die Zeitschriften und Berichte zusammen, raffte mich auf, um Uschi von meinen nächsten Terminen zu berichten und ging ins Wohnzimmer hinunter.
Meine Mutter war ihr Leben lang sehr schlank gewesen, und als Tänzerin hatten vor allem ihre langen Beine bestochen. Jetzt trug sie tiefstes Schwarz und schien in den vergangenen Tagen mehrere Kilo an Gewicht verloren zu haben. Sie wirkte mager, knochig und verhärmt. Sie saß einfach so auf dem Sofa und starrte aus dem Fenster in den blühenden Garten. Ich setzte mich neben sie und legte ihr den gesunden Arm um die Schulter. Erschrocken fuhr sie zusammen und schüttelte den Arm ab. In ihrem Gesicht standen Ekel und Entsetzen.
»Mein Gott, wie siehst du denn aus!«, fuhr sie mich an. »Hättest du die Verbände nicht drüber lassen können?«
»Entschuldige«, sagte ich und setzte mich so, dass sie nur meine unversehrte linke Seite im Sichtfeld hatte. Uschi war außerordentlich empfindlich geworden. »Sie sagen, dass es in ein paar Tagen schon besser sein wird. Außerdem bin ich ab dem Zwanzigsten erneut eine Woche lang in der Klinik. Die Schulter, weißt du!«
»Und wenn du wieder hier bist, willst du von vorne bis hinten bedient werden. Als hätte ich keine anderen Sorgen.«
»Uschi, ein wenig ungerecht bist du schon. Du brauchst mich nicht zu bedienen. Ich komme selbst zurecht. Und sowie ich mich einigermaßen erholt habe, werde ich mir so schnell wie möglich eine eigene Wohnung organisieren, keine Angst!«
»Ach ja, verlass du mich ruhig auch noch. Erst dein Vater, jetzt du. Keinem von euch beiden habe ich je nur einen Hauch bedeutet.«
»Du hast Julian immer sehr viel bedeutet, das weißt du genau. Warum steigerst du dich nur so in deine Vorurteile rein?«
Es war wirklich sehr mühsam, die Ruhe zu bewahren.
»Dann verrate mir mal, warum er sich ständig mit anderen Frauen herumgetrieben hat!«
»Hat er das wirklich? Ich weiß es nicht, Uschi. Bildest du dir das vielleicht nur ein? Er hatte natürlich viele Termine, auch mit Frauen, und ein paar alte Bewunderinnen waren ihm wohl auch hin und wieder auf den Fersen, aber ich glaube nicht, dass er ihnen je mehr als ein Autogramm in ihr Poesiealbum gekritzelt hat.«
»Unfug! Er hatte eine Freundin, zu der er an diesem Abend gefahren ist. Er ist um vier Uhr nachmittags vom Studio aufgebrochen und ist um halb sechs in der Früh verunglückt. Auf der Autobahn von Koblenz nach Bonn. Ich bitte dich, was hatte er da wohl zu suchen?«
»Er wollte zu seinem Agenten, das stand zumindest in seinem Kalender, und wie du weißt, hat Wegener das bestätigt.«
»Er war nicht bei ihm!«
Nein, er war nicht bei seinem Agenten gewesen, mit dem er um zwanzig Uhr in Koblenz zum Essen verabredet war, und es war natürlich ein Rätsel, wo er die beinahe vierzehn Stunden verbracht hatte. Auch ich hatte mir inzwischen Gedanken darüber gemacht. Ich wusste, dass Julian sich in den letzten Jahren für ein paar ausgefallene Ideen interessiert hatte, von denen er zwar mir, nicht aber Uschi erzählt hatte. Womöglich war er einer spontanen Eingebung gefolgt. Er hatte so seine Theorien von Orten, die irgendwelche Ausstrahlungen hatten. Eventuell hatte er sich also einfach irgendwo im Wald aufgehalten, den »Vibrations« gelauscht und darüber die Zeit vergessen. Aber das war eine Erklärung, die Uschi sowieso nicht gelten ließ.
»Ich könnte mir denken, dass eine mögliche Geliebte, wenn es denn eine gab, vermutlich ebenso tief getroffen von seinem Tod ist wie wir, meinst du nicht?«
»Blödsinn, ein Weib, das nur auf sein Geld aus war!«
»Ehrlich, Uschi, du spinnst!«
»Ich spinne nicht. Ihr wollt mich alle nur einwickeln. Ich bin kein kleines Kind, das man belügen und betrügen kann. Ich kenne die Welt!«
Sie fing hysterisch an zu schluchzen und kramte nach ihrem Taschentuch. Ich wollte ihr, ohne nachzudenken, den Arm um die Schultern legen, aber wieder stieß sie mich fort. Ihr schauderte sichtlich vor meiner Berührung.