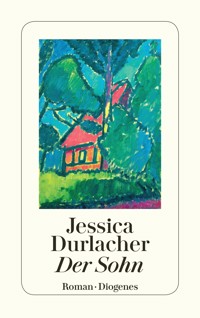
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schlagartig ist es vorbei, das sorglose Leben der Familie Silverstein. Da ist einer, der ihr Leben bedroht, denn er ist gefangen in einer Geschichte, die der Vergangenheit angehört und doch auf fatale Weise bis in die Gegenwart reicht. Eine Geschichte, die Großvater Silverstein immer verschwiegen hat. Und die sein Enkel Mitch zu Ende führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Jessica Durlacher
Der Sohn
Roman
Aus dem Niederländischen von
Hanni Ehlers
Titel der 2010 im Verlag
De Bezige Bij, Amsterdam,
erschienenen Originalausgabe: ›De held‹
Copyright © 2010 by Jessica Durlacher
Die deutsche Erstausgabe erschien
2012 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Alexej von Jawlensky, ›Landschaft‹,
ca. 1910
Foto: Copyright © dacs/Bridgeman Berlin
Für meine Familie
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 24244 7 (1. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60139 8
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] (…)
Aber,
aber er bäumt sich, der Baum. Er,
auch er
steht gegen
die Pest.
Paul Celan
[7] Wenn ich an meine Familie denke, sehe ich auch heute noch immer diesen einen Abend vor mir. Wir waren alle zusammenkommen, weil Mitchs Abreise nach Berkeley bevorstand. Nicht, dass wir so viele gewesen wären. Zu siebt waren wir vollzählig – Tote und nie Geborene nicht mitgerechnet. Unser Sohn ging für ein Jahr nach Amerika, um Filmwissenschaft zu studieren und Fußball zu spielen. Und mein Vater machte Kohlrouladen mit Kümmel.
Das ist kein Gericht, über das man die Nase rümpfen sollte. Mein Vater bereitete Kohlrouladen mit Kümmel nur bei ganz besonderen Anlässen zu.
Im Haus meiner Eltern riecht es nach einer Zeit lange vor unserer Geburt, einem früheren Leben, denke ich, als wir hereinkommen. Wenn mein Vater das Essen zubereitet, wird das Kochen zu einer höchst bedeutsamen Angelegenheit. Dann ist niemand willkommen im Operationssaal, der normalerweise Küche heißt. Nicht einmal Jacob, mein Mann, der große Film- und Fernsehproduzent, an dessen starken Geschichten mein Vater sonst so viel Freude hat. Vielleicht gerade Jacob nicht. Mein Vater wetteifert zwar gern mit ihm und versucht, seine Berichte aus der Welt zu überbieten, aber jetzt würde ihn das nur ablenken. Mein Vater nimmt keine Aufgabe im Leben auf die leichte Schulter, die [8] Zubereitung von Kohlrouladen schon gar nicht. Kohlrouladen sind heilig. Er bereitet sie nach dem Rezept seiner Mutter zu, die sie wiederum nach dem Rezept ihrer Mutter machte, und die hatte sich ganz nach den Anweisungen ihrer Mutter gerichtet. Das sind keine unverbindlichen Empfehlungen, das sind Gebete, Psalmen, Fleisch gewordene Worte – beziehungsweise in Kohl gewickelte.
Meiner Mutter, Iezebel, geht der ganze Aufstand immer etwas auf die Nerven. Dass die Küchentür geschlossen bleibt, damit der Schöpfer da drinnen nicht in seiner Inspiration gestört wird, ist für eine, die nicht immer aus freien Stücken so viel Zeit ebendort zubringt, kaum zu ertragen. Nicht, dass sie sich beklagen wolle, aber ohne sie in der Küche würden wir alle verhungern, murrt sie. Anfälle von Kohlrouladenfieber sind selten, und die Rollenverteilung in unserer Familie ist einigermaßen traditionell. Wir wissen alle, wer das wüst zugerichtete, verschmierte Atelier des Teilzeitkünstlers hinterher wieder in einen nutzbaren Raum zurückverwandeln wird.
Meine Mutter war früher Französischlehrerin. Sie hat ein spitzes Gesicht und lange, jetzt graue, früher braune Haare, die sie seit dreißig Jahren zum immergleichen Knoten windet. Meine Mutter ist eine hochgewachsene Frau, auch heute noch, und früher galt sie als streng. Als strenge Lehrerin. Nur meine Schwester Tara und ich wussten, dass das gar nicht stimmte. Ihre Schüler sollten sie ruhig für streng halten, bei uns war sie immer locker und nachgiebig, und nicht selten verschworen wir drei uns gegen den Einzigen in der Familie, der wirklich streng war, vor lauter besessener Sorge um uns: meinen Vater.
[9] Mein Vater ist nicht so groß, aber breitschultrig, hat ein feingeschnittenes, markantes Gesicht mit dunkelbraunen Augen und schmaler Nase, dichtes weißes Haar und eine Stimme, mit der er laut brüllen kann, meistens aber sanft und leise Geschichten erzählt.
Meine Schwester Tara ist auch da. Tara ist drei Jahre älter als ich. Sie hat dunkles Haar und eine sehr helle Haut – schön, auf eine etwas biestige Art. Tara ist noch auf der Suche nach dem richtigen Mann, denn wenn sie mal einen gefunden hat, der ihren hohen Ansprüchen genügt, serviert sie ihn meist schon nach wenigen Monaten wieder ab. Dass mal einer länger bleibt, ist die Ausnahme. Sie beneide mich um Jacob, hat sie schon mal gesagt, dann aber gleich hinzugefügt, dass sie niemals mit jemandem zusammenbleiben könnte, den sie schon von klein auf kenne. Dafür habe sie schon zu viele Entwicklungsphasen durchlaufen.
Tara ist in der Küche genauso unwillkommen wie ich.
Wir sitzen alle im Wintergarten meiner Eltern, einem noch relativ neuen, modernen Anbau. Meine Mutter hat uns noch eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank sichern können, bevor mein Vater die Küche in Beschlag nahm, aber die haben wir in Erwartung der Dinge, die da kommen mögen, inzwischen ausgetrunken.
Mitch, der drei Wochen lang sein bestandenes Abitur gefeiert hat, sieht blass aus. Er ist noch nicht lange wach und gar nicht richtig anwesend. Ich weiß, dass er sich auf das bevorstehende Abenteuer Berkeley freut, das ihm durch ein Soccer Scholarship ermöglicht wird.
Mich schreckt die Vorstellung, Mitch ein ganzes Jahr lang nicht zu sehen und nicht auf ihn achtgeben zu können. Er [10] ist noch so jung. Er isst alles, was man ihm vorsetzt, aber setzt man ihm nichts vor, ernährt er sich notfalls von M&Ms. Ich habe ihm mehrfach gezeigt, wie man Spaghetti kocht und eine Soße dazu macht. Aber er war mit seinen Gedanken meistens woanders. Er ist mit seinen Gedanken immer woanders. Ich verkneife mir einen Kommentar dazu.
Als Tara Mitch gerade erzählt, dass es in den Wäldern um Berkeley eine Art Panther gebe, hören wir aus der Küche einen Knall. Er muss von einer Schüssel oder einem Teller herrühren, dem Klang nach zu urteilen, gefüllt. Jetzt erhebt sich ein Gebrüll, das nur aus der Kehle meines Vaters kommen kann. Wir sehen einander ratlos an. Jacob blickt zu mir, aufrichtig beunruhigt, Tara und ich sehen uns gegenseitig an, auch wir besorgt und schon darauf gefasst, dass wir uns mit einem verdorbenen Abend abfinden müssen, meine Mutter schaut panisch, mit vor Schreck geweiteten Augen in die Runde.
Meine Tochter Tess hört Musik auf ihrem iPod und hat gar nichts mitbekommen. Mitch legt, ohne eine Miene zu verziehen, seine Zeitung hin, steht auf und geht zur Küche. Noch bevor wir anderen uns übertrieben laut fragen können, ob wohl alles in Ordnung ist und nicht so schlimm, wie es sich anhörte, hat er die Küchentür schon wieder hinter sich geschlossen.
Jetzt wird alles gut. Denn Mitch ist der Einzige, der dort jetzt geduldet wird – das wissen wir alle. Nie werden wir erfahren, was runtergefallen ist. Jetzt, da Mitch zur Stelle ist, werden wir nicht vermissen, was dort jetzt aufgekehrt wird. Es wird ihr Geheimnis bleiben.
Mitch ist mit seinen achtzehn Jahren das jugendliche [11] Ebenbild meines Vaters. Und so gleichgültig und schnoddrig er normalerweise sein kann, so erwachsen, interessiert und vernünftig ist er im Beisein seines Großvaters.
Als meine Mutter, Tara und ich, inzwischen kichernd vor Erleichterung, das Ohr an die Küchentür drücken, hören wir zuerst Gebrumm und das Zusammenfegen von Scherben, dann wird das Radio angemacht, und zu guter Letzt ertönt sogar Gelächter.
Wir kommen uns ein kleines bisschen ausgebootet vor, aber in diesem Fall ist das kein so schlechtes Gefühl, weil Mitch es ist, der uns den Abend rettet.
Wir huschen in den Wintergarten zurück, wo Jacob und Tess unterdessen den Fernseher eingeschaltet haben. Meine Mutter findet Fernsehen ungemütlich. Wir sollten ein Gläschen trinken, findet sie, und stellt Knabbergebäck auf den Tisch. Den Wein müsst ihr euch dazudenken, sagt sie. Aus Solidarität mit meinem Vater und seinen Kohlrouladen lehne ich ab.
Als mein Vater eine halbe Stunde später auf einer gigantischen Platte seine dampfenden Kreationen hereinträgt, mit rot glänzendem Gesicht und besessenem Blick, ist alles vergeben und vergessen. Aus Liebe muckt keiner von uns auf, als er uns ganz ohne Humor anblafft, augenblicklich am Tisch Platz zu nehmen, da sonst alles kalt werde. Mitch trägt eine Schüssel mit Soße. Tess, die sonst nie zur Mithilfe zu bewegen ist, hat einen Soßenlöffel in der Hand und trällert aus unerfindlichem Grund lauthals das alberne Kinderlied, das Jacob ihr immer vorgesungen hat, als sie noch ganz klein war: »Drei Gäns im Haberstroh, saßen da und waren froh…«
[12] Mein Vater tut uns auf, setzt sich, seufzt, puh! Unser erster Bissen wird zum feierlichen Moment. Die Rouladen sind köstlich, auch wenn wir das bei jedem Bissen beteuern müssen.
Es sollte das letzte Mal sein, dass wir sie von meinem Vater zubereitet aßen.
[13] 1
Nach allem, was passiert ist, weiß ich jetzt zumindest eines ganz sicher: dass die Besorgnis meines Vaters um uns nicht umsonst war. Wer so magisch denkt wie ich, könnte sogar behaupten, dass er uns mit dieser gigantischen Besorgnis beschützt hat. Unter seinem wachsamen Blick und seiner erbitterten Lenkung blieben uns Katastrophen, Unglücksfälle und Kriege erspart – und nach seinem Tod ging auffällig viel schief. Oder anders ausgedrückt: Bis zu seinem Tod war alles gutgegangen, aber dann war es damit vorbei. Vielleicht war das Schicksal ihm etwas schuldig gewesen, nach all dem, was es ihm angetan hatte, und als er nicht mehr war, gab es dann kein Halten mehr.
Oder ist Schicksal ein zu freundliches Wort für die Gewalt, der wir ausgesetzt wurden?
Ohne das »Gib acht!«, »Vorsicht!«, »Tu das lieber nicht!« meines Vaters kann ich jetzt nur hoffen (und beten und flehen), dass ich in Zukunft genauso wie er in der Lage sein werde, die, die mir nahestehen, zu beschützen. Kraft meiner Liebe.
So magisch möchte ich denken.
Die Besorgnis meines Vaters erstreckte sich auf uns alle. Meine Schwester, mich mitsamt Mann und Kindern, meine [14] Mutter natürlich, seine Frau Iezebel – wenn auch auf sie etwas weniger, weil sie dazu da war, stark zu sein und meinen Vater in allem, was er tat, zu unterstützen. Dass eben deshalb gerade Iezebel seine größte Besorgnis hätte gelten müssen – denn was wäre er ohne sie? –, diese logische Schlussfolgerung zog Herman Silverstein nie. Daran, dass er sich für eine Frau wie meine Mutter entschieden hatte, konnte man erkennen, dass er ein Überlebender war, ein Pragmatiker, der seinem Instinkt folgte, keinem Urinstinkt, sondern einem Instinkt, der ihm hart in die DNA eingebrannt worden war. Er hatte sich aus Liebe für sie entschieden, aber auch, und vielleicht lief das in seinem Fall auf dasselbe hinaus, weil sie ihm gewachsen war, stark war. Und wenn sie ihm gewachsen war, war sie allem gewachsen. Punkt. Um sie besorgt zu sein, würde alles nur noch schlimmer machen.
Das galt nicht für die »zarten Pflänzchen« – seine Bezeichnung für Tara und mich –, die er mit Iezebel in die Welt gesetzt hatte. (Und später die gleichermaßen zarten Pflänzchen, die ich in die Welt setzte.)
Uns zarte Pflänzchen hatte er gezeugt, nachdem die schlechte, böse, kalte Welt, in der schon seine Eltern ermordet worden waren, auch ihm für immer Tageslicht und Gras und Himmel und Sachertorte mit Sahne hatte nehmen wollen. Unsere Geburt forderte die Probleme doch geradezu heraus. Daher hätte Herman uns, wenn es nach ihm gegangen wäre, am liebsten gleich bei unserer Ankunft angekettet in seinem Schreibtisch aufbewahrt, ganz behutsam natürlich, in Lavendelkissen gebettet. Dann hätte er uns von Zeit zu Zeit hervorgeholt, uns etwas Gutes zu essen [15] gegeben und uns dann wieder weggeborgen, wobei unsere Ketten fest in der Wand hinter dem Schreibtisch verankert gewesen wären.
Herman erblickte in allem, was Tara und ich machten, ob wir nun etwas außer Haus unternahmen oder einfach nur die Treppe hinauf- oder hinuntergingen, sofort die Gefahren, das drohende Unheil, und nur dank seiner Beschwörungen (und der Magie jenes Wortes »Vorsicht!« aus seinem besorgten Mund) blieben wir von allem verschont, was er schon bildhaft vor sich sah.
So jedenfalls habe ich es verinnerlicht, und dieser Glaube ist mir auch jetzt, Jahre später, da ich diese Geschichte erzähle, immer noch hoch und heilig.
Wer hat es an Besorgnis fehlen lassen, als Herman starb? Keine von uns jedenfalls, weder seine Töchter noch seine Frau. Tara und ich, die, von der Aufgeregtheit unseres Vaters um unser Wohlergehen behütet, eine ziemlich sorglose Kindheit hatten, kannten eigentlich nur eine wirkliche Sorge, und das war Hermans Gesundheit. Er tat zwar immer, als ob er über alles Menschliche und Irdische erhaben wäre, aber er hing wahnsinnig am Leben und hatte eine Heidenangst vor Krankheit und Tod.
Ob sich daran in seinen letzten Wochen etwas änderte, kann ich nicht sagen. Mir jedenfalls wurde in jenen Wochen erstmals bewusst, dass es Seiten im Leben meines Vaters gab, ja womöglich sogar in seiner Persönlichkeit, die mir völlig unbekannt waren. Hatte er uns wie immer vor diesen unbekannten Seiten behüten wollen? Oder spielten seine »zarten Pflänzchen« in diesem Zusammenhang einfach keine so große Rolle? Das Einzige, was ich wusste, war, dass die [16] Antwort etwas mit seiner Mutter Zewa, meiner unbekannten Oma, zu tun hatte. Und natürlich mit Wagner. Schon damals fasste ich den festen Vorsatz, ein Buch über Zewa zu schreiben, doch es bedurfte einiger Nackenschläge, bevor die Zeit dafür reif war. »Manifestationen des Bösen« könnte man sie auch nennen.
Was heute ist, verdanken wir nur dem Vorausgegangenen. Was daraus folgt, ist simpel: Wir leben weiter, wir sind noch da… Die Narben sind in unserem Kopf, und nur Worte können dem Ganzen im Nachhinein einen gewissen Sinn geben. Zusammenhang gleich Sinn gleich eine Form der Akzeptanz.
Dass die Angst nicht weg ist und wahrscheinlich nie weggehen wird, ist Fakt. Auch daran werden wir uns gewöhnen, auch das Schlimmste wird irgendwann normal.
Dies ist eine Geschichte mit verzweigten Wurzeln. Wie verzweigt und wie tief sie sind, davon erzählt dieses Buch.
2
Mein Vater hatte sich bei einem Unfall im Garten die Hüfte gebrochen und zwei Rippen angeknackst. Er habe einen kaputten Nistkasten vom Baum holen wollen, sagte er.
Mein Vater war recht rüstig, und so machten wir uns zunächst gar keine großen Sorgen, obwohl er ziemlich mitgenommen aussah, als er da auf dem Rasen lag. Meine Mutter hatte sich ja auch schon mal die Hüfte gebrochen. Mit einem Metallstift fixiert, würde das bald wieder verheilt sein. Schlimmer waren eigentlich die angeknacksten Rippen. Da [17] konnte man nämlich nichts machen, die mussten von selbst heilen. Aber in einer Woche würde er bestimmt wieder aufstehen können, versicherte man uns.
Wer hätte vorhersehen können, dass er nach wenigen Tagen im Krankenhaus bösartigen, gefräßigen Bazillen zum Opfer fallen würde? Warum passierte so etwas? Ich wollte dieses Krankenhaus belangen, fertigmachen, die Schließung erwirken. Aber was hatte mein Vater noch davon? Mein Vater, der nun doch noch umgebracht worden war, von einer blöden Bazille. Ein schwaches Herz, sagte der Arzt. Er trug eine Brille, deren Gläser seine Augen irrsinnig vergrößerten. Das müssen Sie doch gewusst haben, dass er ein schwaches Herz hatte. Vom Krieg her wahrscheinlich. Vom Hunger. Es ist wirklich ein Wunder, dass er so alt geworden ist. Das ist natürlich kein Trost, aber daran sollten Sie denken. Achtzig, so ein Alter grenzt unter diesen Umständen an ein Wunder.
Mörder, dachte ich nur.
Wenn jemand jung denkt, ist achtzig jung. Mein Vater war mein Vater und kein Greis, kein Achtzigjähriger. Aber was kümmerte das einen Mörder wie den? Erbarmungslos wurde Herman Silverstein und mit ihm die Liebe und die Angst sowie die wertvolle Sammlung von Erinnerungen, Interessen, Gedanken und Witzen, die ihn ausmachten, den Launen einer hungrigen Bazille ausgesetzt, die gar nicht in seine Nähe hätte gelangen dürfen. Vom Erdboden weggefressen wurde er, als hätte es ihn und all das, was er war, was er gesagt, gesungen, gelacht und gehofft hatte, nie gegeben. Mein lieber, schnurriger Vater wurde im Kampf gegen das Fieber, mit dem sein alter Körper die Entzündung seiner [18] Lunge zu bekämpfen versuchte, immer magerer und kleiner und ausgehöhlter, bis am Ende scheinbar nichts mehr von ihm übrig war als ein fahlgelbes, hageres Gesicht und eine ganz leise Flüsterstimme. Dabei war mein Vater immer breitschultrig und robust gewesen.
Wie Mitch, sein Enkel, mein Sohn.
3
Aber weniger sein rapider Verfall war es, was mich nicht mehr loslassen sollte, sondern mir ging – und geht auch jetzt, da ich weiß, woher es kam und wohin es schließlich führen würde – Hermans ängstliches, weinerliches Gemurmel in jenen letzten Tagen nicht mehr aus dem Ohr. An der Schwelle zum Tod flüsterte Herman Dinge, die ich auch mit größter Mühe kaum verstand, zumal er eine Sprache benutzte, die er in unserem Beisein nur selten gesprochen hatte, ein sanft und freundlich klingendes, leicht veraltetes Deutsch. Es hatte etwas Befremdliches, allzu Intimes, ihn so sprechen zu hören, und bestürzt musste ich mit ansehen, wie mein Vater die Rolle ablegte, die er immer für uns alle gespielt hatte. Verschwunden war der sarkastische alte Witzeerzähler, der liebe, beruhigende Papa, das hysterisch besorgte Familienoberhaupt, der traumatisierte, fanatische Buchhalter der Vertriebenen seiner Stadt. Und da lag nun ein kleiner Junge, der gerade erst am Beginn des Alptraums stand, der sein Leben werden sollte, unschuldig, aber bang, sterbensbang. Ich hatte mich immer mit dem begnügen müssen, der den Panzer trug, dem Mann mit den [19] Erinnerungen. Erst jetzt, da es zu spät war, erhielt ich einen kleinen Einblick in die Person, die sich unter dem Ballast verbarg.
»Mutti.«
Ich wusste so wenig.
Diese Mutti, die Mutter meines Vaters, hieß Zewa – Zewa Teubl, bis sie Izak Silverstein heiratete. Niemand weiß, wie sie starb, wer der Letzte war, mit dem sie sprach, was sie dachte, was sie sagte. Ihr Sohn schon gar nicht, und wenn es einen gab, der es gerne gewusst hätte, war er es. Seiner Erzählung nach hatte er sie an seinem fünfzehnten Geburtstag zum letzten Mal gesehen. Dem furchtbarsten Geburtstag seines Lebens. Wahrscheinlich erinnerte ihn von da an jeder Geburtstag und alles, was irgendwie gefeiert wurde, an diese Trennung, denn fröhlich war er bei solchen Anlässen nie. Ungefähr eine Stunde lang schaffte er es, ein Geburtstagsgesicht aufzusetzen und dabeizubleiben, wenn die Kerzen ausgepustet und die Geschenke ausgepackt wurden, oder beim Weihnachtsfest zu ertragen, dass Kerzen angezündet wurden und der Truthahn zerteilt wurde. Aber dann wollte er gern »in sein Zimmer«. Was er dort vorhatte, weiß ich nicht. Ich hörte ihn die Treppe hinaufpoltern und seine Zimmertür aufschließen. Sie war mit drei Schlössern versehen – einem Zylinderschloss oben, einem normalen Einsteckschloss in der Mitte und einem trickreichen sternförmigen Schloss unten, das mit einem kleinen Schlüsselchen geöffnet wurde – und immer verriegelt, wenn er nicht gerade drinnen war. Dann folgte das kurze Quietschen der Tür, die er anschließend resolut hinter sich zudrückte. Das hatte etwas Bedrohliches – als betrete er eine geheime Stadt, [20] eine Welt, die ihn mit offenen Armen empfing und nicht so bald wieder gehen lassen würde. Eine für uns verbotene Welt, selbst für Iezebel, wenn auch weniger strikt.
In seinem Zimmer war alles Mögliche, was ihn völlig in Anspruch nahm, denn ich hörte immer sofort die Rollen von seinem Schreibtischstuhl, mit dem er rasante Fahrten durch seine Zimmerstadt machte. Er schien mit seinem Rennstuhl vom einen Ende zum anderen zu düsen, vom Tisch zum Bücherregal und wieder zurück, während er wie wild Informationen sammelte, Entdeckungen machte und mit wer weiß wem telefonierte. Gleich nach dem Rollendonner der ersten Kurve im Drehstuhlrennen folgte immer das laute, hohe Aufschnappen der Metallfeder, wenn er die Verriegelung von seinem Schreibtisch löste und damit die Schubladen voller Geheimnisse freigab. Offenbar musste er jedes Mal, wenn er in sein Zimmer kam, kurz kontrollieren, ob sie noch alle dort lagen, wo sie hingehörten.
Ich litt indes sehr wohl darunter, dass mein Vater an meinem Geburtstag nicht unten war, bei mir, denn es sollte schließlich schön sein und ein besonderer Tag. Es war nicht zum Aushalten, wie meine Mutter allein hilflose Versuche unternahm, etwas Festlich-Fröhliches aus dem Ganzen zu machen – wobei sie mir nicht nur leidtat, sondern mich mindestens genauso sehr ärgerte.
Mein Vater hatte auch seinen Vater an seinem fünfzehnten Geburtstag zum letzten Mal gesehen. Wie sich das genau abgespielt hatte, wusste ich nicht. Die Eltern meines Vaters wurden an Orte gebracht, wo sie nichts Gutes erwartete, und er musste bleiben, wo er war – eine Logik, die nur durch das Wort Krieg zu erklären ist, Umstände, unter [21] denen menschliche Beziehungen für die, die die Fäden in der Hand halten, keinerlei Bedeutung haben.
Gebannt von den Geschehnissen, die er überlebt hatte, hat mein Vater als Hochschullehrer für neuere und neueste Geschichte lange an der Universität unterrichtet, aber er hat sich nie dazu veranlasst gesehen, sein Leben in einem Buch aufzuzeichnen.
Von seiner Mutter Zewa hatte er sehr wenig erzählt. Ich sah nur ein Foto vor mir, wenn ich an sie dachte. Ihr Charakter, ihre Angewohnheiten, wie und was sie redete, das alles kam in keiner Erzählung vor. Danach zu fragen war tabu. Die wenigen Male, da er überhaupt auf sie zu sprechen kam, verzog mein Vater das Gesicht zu einer starren Maske, die mir Angst machte. Ich vermutete, dass er sie gar nicht so gut gekannt hatte. Denn obwohl er mit erst fünfzehn schon sehr widrige Umstände zu meistern hatte, hatte er seine Mutter vielleicht doch noch zu sehr wie ein Kind geliebt, um sie von außen betrachten zu können. Dass ich so wenig wusste, bedauerte ich unendlich, als er krank wurde und immer wieder nach ihr rief.
Sehr schwer krank wurde er. Durch das Fieber und das Morphium, das man ihm gab, halluzinierte er und rief nach seiner Mutter, die seit mehr als fünfundsechzig Jahren tot war. Er hatte offensichtlich Angst in seinem Fieberwahn, große Angst. Ich verstand immer ungefähr dieselben Worte.
»Wagner«, verstand ich, »Vorsicht!« Und: »Meine Mutter«, »beschützen« (möglicherweise »soll euch beschützen«, ich konnte das nicht richtig verstehen). Dann: »Nicht vergessen!« Und: »…komme gerade!« Auch den Namen Federmann meinte ich zu hören.
[22] Wovon redete er? Dieses plötzliche Deutsch war unheimlich. Auch, wie er es sprach, dieses altmodische Deutsch, mit gerolltem R und in einer Art Singsang. Dabei schien es ihm egal zu sein, ob ich zuhörte oder nicht. Das war seltsam. Als sei er in eine Zeit zurückgekehrt, in der ich nicht vorkam.
Seine Kriegserinnerungen kannte ich ein wenig. Davon hatte er erzählt, und dadurch hatte er sie in den Griff bekommen, eine Geschichte daraus gemacht. Es war eine furchtbar bittere, kaum zu ertragende Geschichte, aber dennoch: eine Geschichte. In eine Geschichte aufgenommene Erinnerungen bekommen eine feste Hülle und gerinnen allmählich, so dass sie bei jeder weiteren Berührung etwas weniger schmerzlich sind. Aber hier handelte es sich offenbar um Material, das er nicht mit eingebunden hatte. Weil er es nicht gekonnt hatte. Die Angst des Jungen, irgendetwas mit seiner Mutter und Wagner. Bruchstücke eines unverdauten Stoffs ganz anderer Art. Etwas Unbekanntes, mit dem er offenbar nicht länger leben konnte, oder vielleicht besser gesagt: mit dem er nicht sterben konnte.
Zufällig war ich immer mit ihm allein, wenn er so redete – was mir ein Gefühl großer Verantwortung vermittelte. Und es ließ auch den Gedanken bei mir aufkommen, dass er vielleicht Iezebel meinte, wenn er »Mutti« sagte, dass er wollte, ich solle meine Mutter beschützen.
Wagner hatten sie bei ihm zu Hause viel gehört. Das wusste ich. Die Tür wurde geschlossen, alle mussten den Mund halten und stillsitzen. Wagner im Radio. Lohengrin, Die Meistersinger von Nürnberg, Der fliegende Holländer. [23] Weihevolle Stille. Mein Vater mochte Wagner nicht, hatte ihn nie gemocht. Warum redete er jetzt von Wagner?
4
Nach dem Tod meines Vaters beschäftigte ich mich oft lange mit den wenigen Fotos, die es von Zewa gab. Wie bekannt sie doch irgendwie aussah, mit ihren dunklen Augen und Brauen, ihrem kleinen, feinen Mund, ihren hohen, breiten Wangenknochen und ihrem verletzlichen Blick. Als mein Vater noch lebte, hatte ich oft gedacht, dass es schön wäre, wenn ich sie beruhigen könnte. Ihr sagen könnte, dass wir für ihren Sohn sorgten, dass er bei uns ein gutes Leben habe. Jetzt, da er gestorben war, wünschte ich, Zewa möge wissen, dass er zu ihr unterwegs war, damit er nicht noch einmal nach ihr suchen musste. Wo bist du, Zewa, er kommt zu dir!
Wenn ich sie mir vorzustellen versuchte, ihre Stimme, wie sie gesprochen hatte, kam mir immer das Bild von einem schüchternen, zurückhaltenden, verhuschten Menschen. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich, weil ich so wenig von ihr wusste, automatisch das Bild von meiner anderen Oma auf sie übertrug, die ich als scheu und zurückhaltend gekannt hatte. Oder vielleicht daran, dass ich selbst ziemlich schüchtern sein konnte.
[24] 5
Was mit seinen Eltern geschehen war, hat mein Vater erst Jahre nach dem Krieg erfahren. Sein Vater ist verhungert, in Bergen-Belsen. Zewa, die schöne, schüchterne, dunkle Zewa ist in Stutthof ermordet worden. Ob vergast oder erschossen oder gehängt, ist nicht bekannt. Ihr Verbrechen? Dass es sie gab. Natürlich weiß auch niemand, wo ihre sterblichen Überreste geblieben sind. Was aus Federmann geworden war, sollte mein Vater nie erfahren.
Dass mein Vater von Natur aus optimistisch war, schallend lachen konnte und gerne Witze erzählte, war für mich, je älter ich wurde und je mehr Bücher ich über die Zeit las, in der er aufgewachsen war, ein immer größeres Wunder. Desto mehr tat es mir aber auch weh, wenn er fröhlich war, Späße machte oder mit großem Genuss Musik hörte. Dann liebte ich ihn zu sehr und hasste seine furchtbare Kindheit, dann wollte ich ihn rückwirkend beschützen und vor dem längst erlittenen Leid bewahren. Wie machtlos ich mir vorkam, dass ich nichts hatte verhindern können, und jetzt, im Nachhinein, auch nichts wiedergutmachen konnte! Überdies fürchtete ich immer, er könnte doch noch an irgendetwas erkranken und sterben, wogegen er nicht wie andere gefeit war.
6
Nicht lange nach dem Tod meines Vaters erhielten wir, als seine Familie, einen Brief von der Stadt Baden-Baden, [25] seinem Geburtsort, aus dem er 1937 mit seinen Eltern hatte fliehen müssen.
Die Familie meines Vaters hatte dort gewohnt und gearbeitet, bis Mitbürger und Braunhemden sie wie alle anderen jüdischen Familien terrorisierten und vertrieben. Man beschmierte die Fassade ihres Ladens, warf die Schaufensterscheiben ein, und zum Schluss konfiszierten die Nazis das gesamte Möbelimperium der Familie. Erst Anfang der achtziger Jahre war Herman zum ersten Mal wieder dort gewesen.
Von einem Artikel Hermans in der Süddeutschen Zeitung tief ergriffen, hatte der inzwischen amtierende idealistische, junge Bürgermeister von Baden-Baden ihn eingeladen, von der Vertreibung und seinen eigenen bitteren Erfahrungen als kleiner Junge in dieser Stadt zu erzählen. Der Vortrag wurde zum Auftakt für Hermans großes Werk: das Gedenkbuch von Baden-Baden, die Geschichte seiner jüdischen Familien. Nach Erscheinen dieses Buches, viele Jahre später, wurde er zum Ehrenbürger ernannt.
»Jetzt stehe ich auf einer Liste mit Adolf Hitler!«, höhnte mein Vater damals. Das traf zu. Nur war Adolfs Name auf der Liste der Ehrenbürger durchgestrichen – gelöscht werden durfte er nicht.
Die Ehrenbürgerwürde war nicht schlecht für einen, der als jüdischer Junge sogar von den Lehrern seines Gymnasiums schikaniert und ausgegrenzt worden war. In dieser neuen Eigenschaft hielt Herman danach noch eine Reihe von Vorträgen, bei denen des Öfteren alte Schulkameraden auf ihn zukamen, die sich ganz groß fühlten, wenn sie unter den Augen des (inzwischen nicht mehr ganz so jungen) [26] Bürgermeisters, der Honoratioren und Reichen der Stadt ein Gespräch mit dem bedeutenden Redner anknüpften. Nicht ausgeschlossen, dass diese Männer in den fraglichen Jahren selbst zum Kreis der Jungen gehört hatten, die ihm nach der Schule mit Knüppeln und Lederriemen auflauerten und ihm das giftige Heil Hitler zubellten, bevor sie ihn alle zusammen schlimm zurichteten.
Wie vom Licht angezogene Motten konnten diese einstigen Schulkameraden nicht anders, als sich dem strahlenden Mittelpunkt zu nähern – auf die Gefahr hin, sich an seinem Sarkasmus zu verbrennen –, mit dem sie sich durch so etwas wie eine gemeinsame Vergangenheit – wie war das damals noch gleich? – verbunden fühlten.
»Was für eine interessante Geschichte! Und welche Ehre, Ihnen die Hand schütteln zu dürfen. Erinnern Sie sich an mich? Ich glaube, wir sind zusammen in dieselbe Klasse gegangen.« Damit führte sich so ein alter Herr im Jackett meist ein, Bauch leicht vorgeschoben, Beine scheinbar leger auseinander, eine Hand in der Hosentasche und ein Ich-bin-ein-Weltbürger-Lächeln auf dem Gesicht, mit dem sich jede Unsicherheit und jede Wissenslücke überspielen ließen. Dazu dann die Haltung des »Wir haben diese alte Geschichte zum Glück alle längst hinter uns gelassen«.
O wie angeregt man war, während man im Innersten danach fieberte – welche Chance! –, mit so einem warmen, vertraulichen Gespräch zugleich den Schmutz von der Geschichte zu waschen, als handelte es sich um einen kleinen Fleck. Als räumte man ein kleines Versehen aus. Der Inhalt von Hermans Vortrag ging an solchen Leuten offenbar gänzlich vorbei.
[27] Mein Vater wusste nach kurzem Ausloten immer exakt, welchem Lager der Jeweilige früher angehört hatte.
»Ach, wirklich?«, erwiderte er dann. »Das ist ja ein hübscher Zufall! Sie waren also damals auf dem Gymnasium…« So ein Gespräch endete nie elegant.
Dennoch wuchs Herman in seiner Ehrenbürgerrolle. Die Deutschen hätten es ganz gern, wenn man sie ein bisschen mit ihrer Vergangenheit quäle, sagte er oft. Für sie sei es schön, dort, wo es zwicke und wehtue, gereizt und provoziert und beleidigt zu werden, erklärte er uns. Das helfe bei der Vergangenheitsbewältigung.
»Ach komm, Herman, was soll denn der Unsinn!«, widersprach Iezebel dann. »Die Leute haben doch bis auf wenige Ausnahmen den Krieg gar nicht erlebt! Und der Bürgermeister ist durch und durch koscher, arechter mentsch.« Obwohl meine Mutter keine Jüdin ist, liebt sie jiddische Ausdrücke.
Nur Iezebel zuliebe hatte mein Vater die Ehrenbürgerwürde überhaupt angenommen. Aber diese Ehre tat ihm auch ein bisschen gut. Das war nicht zu verhehlen. Das sah sogar ich.
Und jetzt, da er tot war, erwiesen sie sich in Baden-Baden wiederum als durch und durch koscher und luden zu einer schönen Gedenkfeier für Herman Silverstein ins Rathaus. Ich überredete meine Mutter, gemeinsam hinzufahren.
Ich war entzückt, dass ich auf diese Weise die Gelegenheit erhielt, die Geburtsstadt meines Vaters kennenzulernen. Zu sehen, wo er als kleiner Junge gelebt hatte. Und insgeheim hoffte ich auch, dort Informationen über meine [28] Großmutter Zewa zu finden. Nach dem ängstlichen Gemurmel meines Vaters träumte ich dauernd von ihr. Mir war schon fast, als würde ich sie dort treffen. Als wohnte sie noch dort.
7
Je weiter sich unser Hochgeschwindigkeitszug BadenBaden näherte, desto näher rückten die üppig begrünten Hänge des Schwarzwalds. Das ließ mich von Ferien träumen, die ich nie erlebt hatte, und einer Zeit, in der ich noch nicht auf der Welt gewesen war. Aus Erzählungen wusste ich, wie sehr sich mein Vater früher während der Bahnreisen nach Deutschland an weiß gedeckten Tischen deftige deutsche Gerichte hatte schmecken lassen. Ihm lief das Wasser im Munde zusammen, wenn er mit glänzenden Augen deren Namen auflistete.
Ich malte mir lebhaft aus, wie er, eine Serviette um den Hals, geschlemmt hatte wie ein gieriges großes Kind, das unbeaufsichtigt seinem Heißhunger nachgeben konnte. Das Aroma von Knoblauch und Sahne passte auch in so eine fahrende Rakete. Die Erzählungen meines Vaters kamen aus längst vergangener Zeit, aber sie waren stark. Weiß gedeckte Tische und livrierte Kellner machten sich immer gut. Ich konnte mir unschwer das Gefühl der Genugtuung und die unterschwellige Wut vergegenwärtigen, die diese Mahlzeiten bei meinem Vater auslösten, wie er selbst gesagt hatte.
Ich hätte Iezebel gerne gefragt, ob sie mehr über Zewa [29] wusste, aber ich tat es lieber nicht, solange Tara dabei war. Zwischen Tara und mir schwelte nämlich ein latenter Streit in Bezug auf alles, was mit der Vergangenheit zu tun hatte – Überbleibsel eines kindischen alten Zwists.
Wir quartierten uns in einem Hotel ein, das von außen viel hermachte, im Innern aber nichts von dem für Baden-Baden typischen hochherrschaftlichen Stil besaß. Iezebel hatte Zimmer sechzehn, ich teilte mir mit Tara die Nummer vierzehn.
Wortlos schloss ich die Zimmertür auf. Während ich meinen Koffer auf dem Bett ablegte, in dem ich zu schlafen gedachte, gab Tara einen Stoßseufzer von sich.
»Großer Gott, ich weiß nicht, ob ich das alles verkrafte«, sagte sie.
Sie bot ein Bild des Jammers. Offensichtlich zermarterte sie sich das Hirn. Ich konnte förmlich den Geigerzähler knattern hören, mit dem sie ihre Empfindungen maß. Sie bereute, dass sie mitgefahren war, das war mir inzwischen nur allzu klar. Es hatte schon im Zug angefangen. Als der Zugkellner sich erkundigte, ob wir Tee, Kaffee oder ein Erfrischungsgetränk wollten. Er trug einen tadellosen schwarzen Anzug. Die Tische waren mit weißen Tischtüchern gedeckt.
»Widerlich«, knurrte Tara, als er weg war. »Dieses Deutsch ist einfach zum Kotzen.«
»Herrje, Tara, woher willst du denn schlechte Erinnerungen an die deutsche Sprache haben?«, wandte ich ein. »Der Einzige, den du ab und zu deutsch hast sprechen hören, war Papa. Und der hat nun wirklich nicht dauernd ›Heil Hitler‹ gebrüllt!«
[30] Ich hatte Spätzle bestellt, nicht, weil ich sie so gern mag, sondern als Ehrerweisung an meinen Vater. Meine Mutter nahm Weißwurst. Tara wollte nur einen Salat mit Ei.
»Ach nee, das hast du dir ja hübsch zurechtgelegt«, pflaumte Tara mich an. »Aber vielleicht darf ich auch noch eine Meinung haben? Für mich ist Deutsch eine ekelhafte Sprache. Ekelhafte Leute, ekelhaftes Land. Das ist eben meine Meinung. Diese Sprache ist hart, dazu geschaffen, laut geschrien zu werden, um in Stadien jubelnde Idioten aufzuhetzen. Die haben meine Familie umgebracht. Ist doch so, oder? Soll ich das einfach mal eben vergessen, nur weil wir gerade so gemütlich in diesem Zug zusammensitzen? Verdammt scheinheilig ist das. Und insgeheim denkt ihr genauso, aber ihr habt zu viel Schiss, um das auch laut zu sagen. Stimmt’s, oder hab ich recht?«
»Muss das jetzt wirklich sein, Tara?«, fragte ich daraufhin nur.
Wir waren doch Hermans Frauen, Hermans Witwen. Meine Mutter und ich sahen uns ganz kurz an, beinahe verschreckt.
Dann machte ich noch einen Versuch: »Aber Papa war doch auch ein Deutscher, Tara! Fast mehr Deutscher als Jude. Er liebte die Berge, die Wälder, die Seen in Deutschland. Er fand sogar die Sprache schön. Sein Deutsch war auch schön, schön und weich. Er mochte das Essen hier unheimlich gern, Tara, die knusprigen Brötchen, dick mit Quark und Marmelade bestrichen, den Aufschnitt, Spätzle und Nudeln mit Rahmsoße. Und er liebte die Konditoreien. Wer sind wir, dass wir uns anmaßen könnten, das zu hassen, was er liebte – allem zum Trotz, was ihm daran [31] hätte zuwider sein können? Er hatte doch unendlich viel mehr Gründe, Deutschland zu hassen, als wir!«
Verwirrt starrte sie mich an.
»Was hat denn das mit mir zu tun?«, sagte sie dann störrisch und offenkundig tief davon überzeugt, dass sie mit der Stimme der Vernunft sprach und nicht ich. »Ich habe doch wohl genauso viel Recht, Deutschland zu hassen oder zu lieben wie Papa, oder etwa nicht? Jeder hat ja wohl das Recht auf seine eigenen Gefühle. Und ich fühle eben so! Deutschland hat meine Kindheit verpestet und mich traumatisiert! Ich darf Deutschland hassen. Und das tue ich auch. Ich hasse diesen Zug, und ich hasse das verdammte Baden-Baden. Ich werde nicht schleimen oder mich womöglich bedanken, das können die sich abschminken. Diese verdammten Moffen!«
Sie machte uns Vorwürfe. »Ihr wollt tatsächlich einen auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, was? Wir haben nie richtig über Papa geredet. Wie er war, wie er sich aufführte… Damit sollten wir uns vielleicht auch mal beschäftigen – ich lebe schließlich noch, wisst ihr, ich bin hier. Ich bin noch nicht tot.«
Die letzten Worte kamen stoßweise heraus, sie weinte.
Ich versuchte, ruhig weiterzuatmen.
»Mein Gott, Tara, es hat doch auch keiner behauptet, dass du tot bist.«
»Haha!«, schrie sie. »Sehr witzig!«
Brüsk stand sie auf und stieß dabei mit dem Knie gegen den Tisch, so dass eine Flasche Wasser ins Wanken geriet. Fluchtartig rannte sie aus dem Wagen.
Wir hatten uns halb erhoben, setzten uns aber wieder.
[32] Iezebel sah ganz fertig aus. Sie umklammerte mit beiden Händen ihre Tasche und zitterte leicht.
»Ach nein, das musste doch jetzt nicht sein«, sagte sie.
»Glaub mir, Mam, das geht schon wieder vorbei«, hatte ich daraufhin gemurmelt.
Aber das war zu optimistisch gewesen.
Tara setzte sich aufs Bett und schloss die Augen. Ich zog meine Laufschuhe aus der Tasche. Bitte keine Probleme! Tochter zu sein, war manchmal leichter, als Schwester zu sein. Streitereien mit Tara machten mich kleinlich und armselig. Meine ganze Weisheit und die jahrelange Erfahrung, die ich dem Leben abgerungen hatte, schienen sich in der Konfrontation mit meiner Schwester manchmal zu verflüchtigen, so dass man meinen konnte, dass das, was aus mir geworden war, nur in meiner Einbildung bestand und ich in Wirklichkeit immer noch ein unselbständiges Kind war. Von meinem Vater dagegen hatte ich mich immer gewürdigt gefühlt, so schwierig und uneinsichtig er auch sein konnte. Nie war es ihm darum gegangen herauszukehren, was an Verlogenem in mir steckte, wie Tara es in unserem endlosen Geschwisterstreit tat. Und meine Mutter war nie sehr überzeugend in der Rolle des Königs Salomon. Wessen Stimme gab den Ausschlag: meine oder Taras? Wo sollte Herman beigesetzt werden, in Westerveld oder Muiderberg? Wenn meine Stimme gewann, schmollte Tara. Wenn Taras Stimme gewann, konnte ich vor Wut nächtelang nicht schlafen. Die Entscheidung war übrigens auf Westerveld gefallen, und ich triumphierte – was mich selbst anwiderte. Tara machte mich schlechter, niedriger.
[33] Wenn Iezebel Tara recht gab, beging sie in meinen Augen Verrat an dem, was ich die Vernunft nannte. Und das empfand ich als Verrat an Herman, dem Muster an Vernunft. Doch ich musste jetzt ohne Hermans Vernunft auskommen und fühlte mich verwaist. Früher hatte ich mich immer in seiner Hut wähnen können, wenn ich mit meiner Schwester und meiner Mutter sprach, da hatte ich gewissermaßen in seinem Namen gesprochen – und dementsprechend wurde meine Stimme auch in Familienangelegenheiten akzeptiert. Jetzt, da mein Vater tot war, waren wir drei einzelne Frauen, und das Gleichgewicht war zerstört. Ich – immerhin Mutter eines neunzehnjährigen Sohnes und einer dreizehnjährigen Tochter – vermisste meinen Vater wie ein Kind, das plötzlich ohne Anleitung zurechtkommen muss. Und wir drei, meine Mutter, Tara und ich, hatten niemanden mehr, dessen allzu rigiden Standpunkt wir attackieren und an dessen strengen moralischen Grundsätzen wir rütteln konnten. Mit dem Wegfall dieser Widerstände gerieten wir in den freien Fall. Logisch, dass wir jetzt gegeneinander opponierten. Unser Mittelpunkt, unsere Richtschnur war weg.
8
Ich ging joggen. Es regnete leicht. Hauchfeine Tröpfchen, die mit bloßem Auge nicht zu sehen waren, aber die Lichtentaler Allee umso grüner machten und das Gesicht mit einem Wasserfilm benetzten. Zumal wenn man schnell lief. Und ich lief schnell, obwohl ich ganz gegen meine Gewohnheit schon längere Zeit nicht mehr gejoggt war.
[34] Nach fünfhundert Metern glänzte ich vor Nässe und war völlig außer Atem. Meine Lunge schrie. Wie früher, wenn ich den ganzen Abend neurotisch geraucht hatte und dann rennen musste, um die letzte Straßenbahn zu kriegen.
Irre, dass mein Vater sich früher auch durch diese Allee bewegt hatte. Vor der großen Katastrophe, die über ihn und seine Familie hereinbrach, damals, als die Welt noch die Chance hatte, dieses Geschehen zu verhindern. Jetzt, fast fünfundsiebzig Jahre später, konnte man meinen, diese Katastrophe hätte nie stattgefunden. Wen kümmerte noch der Krieg der früheren Generationen?
Ich stellte mir vor, wie er durch diesen Park gegangen war, mit seiner Mutter und seinem Hund, ein Spaziergang, der bestimmt in eine Konditorei geführt hatte und zu einem festlichen Stück Torte. Diese Stadt hatte so großen Einfluss auf das Leben meines Vaters gehabt. Wie schön wäre es, wenn ich die Zeit aus ihr herausschöpfen, das ganze Elend herausbaggern und irgendwo abladen könnte, wo es keinen Schaden anrichtete! Und wenn seine Eltern, meine Großeltern, gerade erst auf die Welt kämen! Dass die Landschaft hier so lieblich war, erboste mich geradezu. Die grün gesäumten Wege, die sich am Fluss entlangschlängelten, Baden-Baden selbst mit seinen auf und ab führenden Gassen, den wunderschönen, imposanten Gebäuden, dem Casino, der Trinkhalle und den klassizistischen Hotels: All das kam mir irgendwie vertraut vor, obwohl ich nur ein einziges Mal hier gewesen war, und das als Vierjährige. Von hier aus wirkte die Geburtsstadt meines Vaters stolz und schön. Aber sie hatte meinen Vater und seine Familie nicht vor den aggressiven Kräften beschützt, die in ihr erwacht waren. Ich [35] wusste, dass die Täter tot waren und die Strafen verhängt, dass die, die an der Macht waren, gewechselt hatten und dass tiefe Reue und Scham vorhanden waren, aber die prunkvollen Gebäude, die reizenden Gassen waren noch genauso schön und unzerstört wie damals.
Man kann eine Stadt nicht für schuldig erklären, schon gar nicht, wenn ihre Bewohner nicht mehr die von damals sind, doch ich fand trotzdem, dass auch die Stadt eine Persönlichkeit hat, über die man nicht einfach hinwegsehen kann.
9
Nachdem mein Vater gestürzt war, hatte ich wochenlang nicht joggen wollen. Und als er dann starb, schon gar nicht. Sport, laute Musik, Gewalt im Fernsehen, all das war nicht erlaubt. Bewegung, die mit Schweiß, Ächzen, Keuchen, Schnaufen und anschließender Ermüdung verbunden war, galt als unerhört animalisch, kaum anders als Blutdurst und Willkür. Sport zu treiben, war eine Beleidigung der Sanftheit meines Vaters, widersprach allem, was er war – so etwas musste es gewesen sein. Als Kind war Sport für mich nie in Frage gekommen, Sport erinnerte zu sehr an Faschismus, Nazideutschland, Riefenstahl-Stadien, blonde Herrenmenschen.
Und später hatte ich immer, wenn ich joggte oder mich in einem Fitnessstudio anstrengte, ja sogar beim Schwimmen, innerlich meinen Vater missbilligend mit der Zunge schnalzen hören und vor mir gesehen, wie er seine jiddische [36] Handbewegung zum »oj oj woss far a gojisch nachess!« machte, aus dem tiefste Ablehnung und Entgeisterung sprachen.
Erst sein großer Enkelsohn Mitch, dessen Physis und Ego durch viel Fußball und Hockey sichtlich gestärkt wurden, hatte meinen Vater ein bisschen von seinen alten Denkschablonen kuriert.
In jenen Wochen, da mein Vater im Krankenhaus lag, saß ich jeden Tag an seinem Bett. Das Joggen verbot ich mir. Zunächst aus Solidarität (und Aberglauben, denn ich hoffte, dass er dann schneller genesen würde), und als er starb, stellvertretend für das Schiwa-Sitzen, die siebentägige traditionelle jüdische Trauerzeit, für die sich anscheinend keiner aus meiner heidnischen Familie erwärmen konnte.
Doch er ließ mich zurück, in diesem versifften Krankenhaus, in diesem sogenannt effizienten anonymen Chaos. Oder besser gesagt: Er zwang mich, ihn gehen zu lassen. Sein Röcheln, zuvor noch durch die Sauerstoffapparate verstärkt, verstummte plötzlich – als wäre dieses Geräusch nie da gewesen. Es ist vorbei, flüsterte die dämliche Krankenschwester auch noch, während sie mit professioneller Zärtlichkeit die Hand meines Vaters streichelte.
Finger weg von der Hand meines Vaters, du blöde Tucke!
Aber ich sagte nichts. Tat nichts. Sah nur zu, wie dieses Weib ihn von den Maschinen abkoppelte. Dann nahm ich meine Mutter fest in die Arme. Die starrte noch auf meinen Vater, ohne zu begreifen. Als ich sagte, dass es geschehen sei, dass ihr Herman tot sei, weinte sie untröstlich. Als hätte sie auf ein Codewort gewartet – die Freigabe der Tränen. Unermessliche Trauer um alles, was jetzt verloren war. Die [37] Ordnung. Das Fest des Lebens. Tara blickte nur vor sich hin.
Als die Krankenschwester weg war, legten wir alle drei die Hand auf seine Hand. Als könnten wir ihn schnell zurückholen, wenn niemand guckte.
Diese ungeheure Stille, diese blöde, banale, leblose Scheißstille – bis auf unser Schluchzen. Früher war es immer gleich gemütlich gewesen, wenn mein Vater im Raum war. Jetzt hörten wir nur das leichte Summen der Kaffeemaschine draußen auf dem Flur und wie jemand im Vorbeigehen etwas über IKEA sagte.
10
Warum war er überhaupt gestürzt? Er war doch immer so vorsichtig gewesen, peinlichst vorsichtig.
»Mutti!«
Nach ihr hatte er gerufen. Nach seiner längst verstorbenen Mutter – das konnte fast nicht anders sein. Mein alter Vater, der wieder zum Sohn geworden war, wo war er jetzt?
Komm zurück, mach die Augen auf, komm zurück. Hilf mir mit deiner Stimme. Deiner Vaterstimme. Dann bin ich wieder deine Tochter. Wenn du redest, ist alles wieder gut. Sag mir, dass ich Talent habe, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich noch jung bin, dass mich noch so viel erwartet. Sag mir, woher ich komme, wem ich ähnele. Sag mir, dass ich deiner Mutter ähnele, dass ich ihre Augen habe, ihre Stirn, sag mir mehr, sag mir, dass ich dich an dich selbst erinnere, sag mir zur Not, was du von mir hältst. Aber sag etwas.
[38] 11
Der Nieselregen hatte aufgehört. Je weiter ich mich von der Stadt entfernte, desto trockener wurde es und desto kälter die Luft. Wind kam auf. Ich erschrak, als ein Pferd an mir vorbeitrabte. Ein doofes großes Pferd – das lebte und im Licht vor sich hintrabte. Wie ich. So war die übriggebliebene Welt: doofe trabende Pferde, ein Park, in den mein Vater nie mehr zurückkehren würde, eine Landschaft wie von Caspar David Friedrich.
Es war kaum ein halbes Jahr her, dass er Tess von Doktor Faustus erzählt hatte. Vermeintlich locker, scherzhaft. Er hatte das Buch seit mindestens vierzig, wenn nicht sogar fünfzig Jahren nicht mehr gelesen.
»Aber du gibst immer gut auf dich acht, meine liebe Tess, ja? Bewahrst deine liebe Seele in einer guten, stabilen Tasche auf, so einer, die schön nach Leder riecht und die du mit einem Messingschloss verschließen kannst, ja? Tess, hörst du? Nie dich selbst verleugnen, ja! Nicht Model werden wollen oder etwas anderes Dummes, Innenarchitektin oder dergleichen, ja, Tess?«
»Mensch, Opa, neee…« Tess war gerade dreizehn geworden.
Als ich sechs wurde und in die Grundschule kam, hatte er ein Ledermäppchen für mich gekauft. Ich habe es heute noch. Ein Mäppchen aus rotem Leder, das man mit einem kleinen Messingschloss verriegelt. Er hatte die ganze Stadt danach abgeklappert, wie mir meine Mutter damals erzählte. Es sollte nämlich genauso ein Mäppchen sein wie das, das er selbst früher gehabt hatte. Und die Stifte, der [39] Radiergummi und der Füller darin waren von der allerbesten Qualität.
12
Mitch war nur für eine Woche aus Berkeley gekommen, als es meinem Vater so schlechtging. Länger war nicht möglich gewesen, weil er Prüfungen hatte. Er fehlte mir schrecklich. Neunzehn war er inzwischen und genau mein Vater, wie ich von den wenigen Jugendfotos wusste, die Iezebel noch von ihm hatte. Dichtes dunkles Haar – bei meinem Vater inzwischen weiß geworden – mit natürlich fallendem Seitenscheitel, breites Gesicht, buschige Brauen, fast schwarze Augen. Beide meistens gut aufgelegt, aber zu unerwarteten Wutausbrüchen neigend. Guter Dinge, wo andere erwartet hätten, dass sie fluchen würden (wenn sie früh aus dem Bett mussten, wenn ein Schaden zu reparieren war, wenn eine Packung Tomatensoße runterklatschte). Dann feixten sie, ließen sich die Laune nicht verderben, taten, was zu tun war.
Wie mein Vater konnte Mitch in aller Seelenruhe einen ganzen Kuchen oder ein ganzes Hähnchen verspeisen. Konnte sich völlig abkapseln und den ganzen Tag stumm und missmutig vor Fernseher oder Computer hocken, um dann abends plötzlich wieder munter irgendeine komische Geschichte zu erzählen. Mitch war genauso hypersensibel und genauso sentimental wie mein Vater, weil er die gleiche Angst hatte, dass einem von uns etwas passieren könnte.
Aber mein Vater war intellektueller. Während Mitch für [40] sein Leben gern Spiele spielte, war mein Vater ein Büchernarr und durchforstete das Internet, um sich Wissen anzueignen. Mitch war auf Sensationen aus (ich kam irgendwann nicht mehr mit, welche das gerade waren) und hatte Zukunftsträume, die für mein Empfinden wenig Konsistenz hatten. Er wollte eigentlich eine Weltreise machen, ging aber nach Berkeley, um Fußball zu spielen und zu lernen, wie man Drehbücher schreibt. Manchmal redete er plötzlich von der »großen Fahrt« oder dem Militär, dann wieder träumte er davon, auf eine Business School zu gehen (was immer er sich darunter vorstellte) und »stinkreich« zu werden, und es gab auch Momente, da er am liebsten Schauspieler oder Regisseur werden wollte.
Aber angesichts der Tatsache, dass er in jüngeren Jahren lange eine Karriere als Gangster angestrebt hatte, stellten seine diversen neueren Pläne keinerlei Problem für mich dar.
»Mitch? Mitch wird schon etwas finden. Solange er kein Krimineller wird, ist mir alles recht.«
Mein Vater hatte nie viel zu Mitchs Plänen gesagt, als hätte er gespürt, dass sie ohnehin nicht das Richtige für ihn waren. Er hatte sich nach Mitchs Geburt irrsinnig schwergetan, sich an die Existenz dieses Enkelsohns zu gewöhnen, der mein erstes Kind war und sein erster Konkurrent um meine Zuwendung, die zuvor ungeteilt ihm gegolten hatte. Erst als Mitch ein halbes Jahr alt war, hatte er großmütig das Handtuch geworfen und Mitch von nun an genauso geliebt wie wir.
Bei Tess war es anders. Zwischen ihr und meinem Vater war gleich alles gut. Tess war ein Kind, das nichts verlangte, nichts brauchte. Tess schuf sich ihr eigenes Universum und [41] war unbeirrbar. Sie ähnele seiner Mutter, sagte mein Vater einmal. Ich könnte mich ohrfeigen, dass ich an der Stelle nicht nachgehakt habe, sondern noch halb eifersüchtig auf Tess war und beleidigt fragte: »Mehr als ich?«
13
Die Landschaft wurde noch anmutiger, offener, freier. Ich war jetzt wirklich draußen, hier standen auch keine Häuser mehr.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn ich hier Dienstmädchen mit weißen Schürzen begegnet wäre, jung und fröhlich, die Arme voll mit Pilzen, die sie für ihre Herrschaften gesammelt hatten und ins Städtchen zurücktrugen. Pilze in Rahmsoße…
Als Tara und ich junge Mädchen gewesen waren, hatte mein Vater uns mit seiner als Zorn getarnten Besorgnis zur Weißglut getrieben. Ich hatte es trotzdem immer hingenommen. Diese Besorgnis war ja nichts anderes als Liebe. Beides gehörte fest zusammen: Liebe plus Angst gleich wahre Liebe. (Das heißt, sehr große Angst – und damit auch sehr große Liebe, wie ich hoffte.) Tara aber litt darunter. Der Jähzorn meines Vaters, Begleiterscheinung seines Optimismus (abgesehen von seiner unausstehlichen Einmischerei), machte sie verrückt. Tara war oft böse auf ihn, und auf mich gleich mit. Sie wollte meinen Vater nicht verstehen und ärgerte sich schwarz, wenn ich ihn verteidigte. Vielleicht war ich auch feiger als sie. Ich traute mich ja nicht mal, böse auf meinen Vater zu sein. Meine Schwester [42] beschimpfte ihn manchmal glattweg, schrie »Arschloch!« und haute ihm um die Ohren, wie sehr er ihr mit seiner Vergangenheit das Leben vermiese. Weil sie abends nicht wegdürfe, weil er gar kein Interesse an ihrem Leben habe. Weil gegen seinen Krieg alles andere unwichtig sei. »Du immer mit deinem Krieg! Ich hasse deinen Scheißkrieg!«, kreischte sie dann.
So etwas konnte ich nicht sagen, konnte ich nicht einmal denken. Es verschlug mir die Sprache und die Laune, wenn Tara es tat – ich wünschte, er würde ihr einfach eine Ohrfeige geben, damit sie mal einen Dämpfer bekam und in Zukunft den Mund hielt. Aber er schritt meistens nicht groß ein. »Aber, aber, Taartje!«, murmelte er höchstens schwach, und das war schon eine Menge.
Herman sollte seine Töchter nicht verlieren. Wir verloren ihn.
Und genaugenommen verloren wir ihn an seine Mutter. Denn zu ihr ging er letztlich zurück. Daran zu glauben, war ein schöner Gedanke.
14
Es war schon dunkel, als ich das Hotel wieder betrat. Schwere Essensgerüche empfingen mich. So roch es hier abends bestimmt seit Jahrzehnten, im endlosen Trott der obligatorischen althergebrachten Gerichte.
Tara war auf ihrem Bett eingenickt. Im Schlaf sah sie lieb aus. Sie schnarchte leicht.
Ich duschte so leise ich konnte, um Tara nicht zu stören. [43] Zog saubere Sachen an. Bestimmt war mein Hunger Auslöser dafür, aber ich hatte plötzlich Lust darauf, in das Dunkel einer mondänen Stadt hinauszuziehen, Lust auf Restaurants, gut gekleidete Menschen, Lust darauf, das andere Wasser hier zu kosten, Deutsches zu kosten. Nur weg hier, aus diesem kleinen Hotelzimmer.
»Tara, aufwachen«, flüsterte ich. »Kommst du mit?«
Tara brummte etwas: »Was?«
»Bist du jetzt etwas besser drauf, Taar? Wollen wir essen gehen? Mama wartet bestimmt schon unten… Ich bin eine Runde gejoggt.«
Tara sagte nichts.
Tara wollte nicht mit.
Sie fuhr am nächsten Morgen nach Hause zurück. Das war die Quintessenz ihrer Bedenken.
»Aber du wolltest doch so gerne mitkommen! Jetzt bist du umsonst so weit gefahren!«, rief ich bestürzt aus.
In dem Moment tat sie mir zum ersten Mal richtig leid. Um jemanden zu trauern, mit dem man sich ständig gestritten hatte, war bestimmt sehr kompliziert. Die Vergangenheit war Taras Gegner.
15
Kerzen brannten, und es wurde Mendelssohn gespielt. Im Sitzungssaal des Rathauses von Baden-Baden hatte man ein Porträtfoto von Herman aufgestellt, das ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, und dazu ein Foto von dem Haus, in dem er mit seinen Eltern gewohnt hatte. [44] Versöhnung findet man in der Erinnerung, hatte man darunter geschrieben.
Für Iezebel und mich wurde rührend gesorgt. Man hatte sogar an Petit Fours gedacht, und ich sah meinen Vater in Gedanken eine ganze Platte davon konfiszieren. Auch Käsekuchen und Linzertorte gab es – wie seine Mutter sie früher gebacken haben musste, ich erinnerte mich nur zu gut an seine Beschreibungen.
Es ging mir doch zu Herzen, dass Kuchen serviert wurde, den er immer so gern gegessen hatte. Von Mitch hörte ich später, dass Herman bei seinen vielen Besuchen in dieser Stadt (warum, warum nur war ich nie mitgefahren, wenn er hier einen Vortrag hielt?) mit dem Bürgermeister leidenschaftlich über Essen diskutiert hatte.
Des Lebens von Herman Silverstein wurde in einem kleinen Saal gedacht, in dem sich circa fünfzig Interessierte versammelt hatten, darunter einige Historiker, mit denen mein Vater zusammengearbeitet hatte, und ein Grüppchen älterer, offenbar sehr wohlhabender Damen, die auch Iezebel unbekannt waren.
Der geringe Zulauf enttäuschte mich, und ich überlegte unwillkürlich, was wohl Tara dazu gesagt hätte. Ich hatte mich zwar damit abgefunden, dass sie nicht dabei war, aber nun plagten mich die Gedanken, die sie für gewöhnlich in aggressivem Ton äußerte. Und die ich dann zu widerlegen versuchte.
So entfachte denn all die im Grunde so wohltuende Anerkennung des Schlimmen, das geschehen war, in meinem primitiven Herzen auch gleichermaßen Wut. Ich hasste die Schurken und Verräter, auch die toten, und weidete mich [45] insgeheim an meinem Hass. Er war so etwas wie ein persönliches Kleinod, das ich bei mir trug.
Der Bürgermeister hielt eine reizende Ansprache auf meinen Vater. Ich kämpfte mit aller Macht gegen die Tränen an. Iezebel gab das praktisch sofort auf, und das Schniefen und Schluchzen neben mir gab mir die Kraft standzuhalten. All das, was über Herman gesagt wurde, ließ meinen Zorn schon ein bisschen verrauchen, doch auch nach der Rede vom Leiter des Stadtarchivs, dem Nachfolger desjenigen, mit dem Herman das Gedenkbuch geschrieben hatte, fand ich nicht, dass ich dankbar sein müsste. Das wäre unverhältnismäßig gewesen. Wiedergutmachung gönnte ich niemandem.
Ich bedankte mich trotzdem beim Redner. Sein Name war Dieter von Felsenrath. Er war seinerzeit ein ganz junger Angestellter gewesen, der meinem Vater bei der Aktensuche im Archiv geholfen hatte. Ein hünenhafter Mann, dieser Dieter von Felsenrath, schon fast ein bisschen unheimlich. Er hatte ein breites Gesicht mit einem merkwürdigen, etwas schiefen Mund. Ich bat ihn um seine Karte und sagte leise, um meine Mutter nicht mit einzubeziehen, dass ich dabei sei, Recherchen über meine Großmutter anzustellen.
»Ich bin so erschöpft«, flüsterte Iezebel mir kurz danach zu. »Lass uns bloß gehen!«
Wir machten noch einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Es kam selten vor, dass wir beide zusammen so weit von zu Hause weg waren. Für mich hatte das Ungewohnte der Situation etwas Beklemmendes, wie ein merkwürdiger Traum, in dem ich gefangen war. Iezebel meinte, [46] unterhaltsam sein zu müssen, und das nervte mich. Als hätte ich plötzlich Hermans Seele dazubekommen, mit dem Auftrag, seine Witwe vor allzu weibischem Getue zu behüten. Und so pflaumte ich Iezebel an, obwohl ich nichts lieber wollte, als nett zu ihr zu sein. Nein, mir ist nicht kalt! Herrgott, jetzt sei doch nicht so nervös wegen dem Essen heute Abend!
Ich hätte gern über Tara geredet, aber dafür war jetzt wohl nicht der geeignete Moment.
16
Hier war auch Zewa gegangen. Hier hatte sie für Herman, ihren kleinen, dicken Vielfraß, Kuchen gekauft. Sie hatte in schimmernden Kleidern das Theater besucht, war bestimmt mehr als einmal im Auto durch diese imposante Straße gefahren. In dieser Stadt hatte sie später, von Braunhemden ausgebuht, auf die beschmierten Scheiben ihres Ladens gestarrt. Herman war in einer Seitengasse dieser verkehrsreichen, kalten Straße von Hitlerjungen verprügelt worden. Und was hatten sie gedacht, als sie in ihrem Adler die Stadt verließen, Zewa, ihr Mann Izak und Herman, und noch einmal zu ihrem Haus zurückschauten – hatten sie gedacht, dass sie es je wiedersehen würden? Hatten sie alle Höhepunkte ihres Lebens in dieser Stadt ein letztes Mal an sich vorüberziehen lassen, oder wollten sie da lieber nicht zu viel denken – damit der Abschied weniger endgültig war?
Vielleicht hatten sie auch für nichts von alledem Zeit gehabt.
[47] 17
Beim Abendessen hatte ich Dieter von Felsenrath zu meiner Rechten, den Bürgermeister schräg gegenüber, und meine Mutter saß ein gutes Stück entfernt neben einem soignierten Herrn im Smoking. Links von mir saß eine Buchhändlerin, die sich in lebhaftem Dialekt mit der Frau mir gegenüber unterhielt. Mir fiel der Geruch auf, den Felsenrath ausdünstete, süßlich und ziemlich penetrant. Alkohol, wie mir erst nach einigen Minuten aufging. Ich rückte unwillkürlich etwas von ihm ab.
Von Felsenrath hörte ich zum ersten Mal etwas über Zewas Briefe.





























